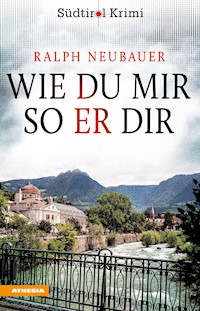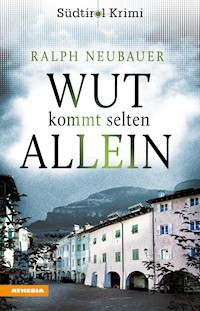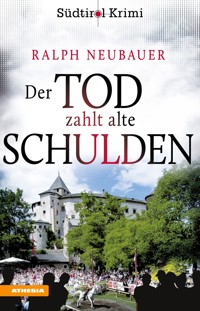Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Athesia Tappeiner Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Todesfälle, die zunächst kein Verbrechen vermuten lassen, mysteriöse Begegnungen, ein schweigsamer Künstler, ein rätselhafter Verkehrsunfall, ein glasklarer Mord. Alles steht miteinander in Verbindung. Diese Zusammenhänge sind für die Ermittler schwer zu durchschauen, zumal auch ein Mord nahe der Königsallee in Düsseldorf damit zu tun hat. Es geht um den internationalen Kunsthandel und seine Auswüchse. Fälschungen, Betrug, schmutziges Geld, das in den legalen Wirtschaftskreislauf eingebracht wird. Fabio Fameo, Tommaso Caruso und Francesca Giardi sind im Pustertal unterwegs. Eine interessante Schlossherrin aus diesem Tal hilft. Dieser Krimi führt die Leser in die Städte Bruneck, Brixen und Meran.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 441
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Für Louisa und Simon
Inhaltsverzeichnis
Widmung
(Meran im Herbst – eine alte Villa in Obermais)
(Im Februar des darauffolgenden Jahres in einem Schloss im Pustertal)
Null
Eins: (Tag 1 – Montag – Nachmittag)
Zwei: (Tag 1 – Montag – früher Abend)
Drei: (Tag 1 – Montag – abends im Pustertal)
Vier: (Tag 1 – Montag – Abend / Nacht)
Fünf: (Tag 2 – Dienstag – Morgen)
Sechs: (Tag 2 – Dienstag – Abend)
Sieben: (Tag 2 – Dienstag – Abend)
Acht: (Tag 3 – Mittwoch)
Neun: (Tag drei – Mittwoch – Abend)
Zehn: (Vierter Tag – Donnerstag – Morgen)
Elf: (Tag 5 – Freitag – Morgen)
Zwölf: (Tag 5 – Freitag – Vormittag)
Dreizehn: (Tag 5 – Freitag – Abend)
Vierzehn: (Tag 5 – Freitag – Abend)
Fünfzehn: (Tag 6 – Samstag – Vormittag)
Sechszehn: (Tag 7 – Sonntag)
Siebzehn: (Tag 8 – Montag)
Achtzehn: (Tag 9 – Dienstag)
Neunzehn: (Tag 10 – Mittwoch)
Zwanzig: (Tag 11 – Donnerstag)
Einundzwanzig: (Tag 15 – Montag)
Zweiundzwanzig: (Tag 18 – Donnerstag)
Dreiundzwanzig: (Tag 19 – Freitag)
Vierundzwanzig: (Tag 22 – Montag)
Fünfundzwanzig: (September) Südtirol – Büro des Vicequestore
Sechsundzwanzig: (Mitte September an einem Freitag)
Siebenundzwanzig: (Mittwoch – Büro von Hagen Bös)
Achtundzwanzig: (Ende September – Düsseldorf – Solingen )
Erläuterungen
Danksagungen
Impressum
(Meran im Herbst – eine alte Villa in Obermais)
Der alte Mann hatte ein schwaches Herz. Vielleicht blieb es stehen, weil er sich zu sehr aufgeregt hatte. Vielleicht war es auch die Angst. Möglicherweise war er aber auch an dem Knebel erstickt, den sie ihm in den Mund geschoben hatten.
Als sie gefunden hatten, wonach sie suchten, stellten sie fest, dass sich der alte Mann nicht mehr bewegte.
»Der ist tot«, sagte der Anführer. Er zeigte dabei keine Gefühlsregung. Sein Kumpan zuckte nur mit der Schulter. Sie hatten so viele Tote in ihrem Leben gesehen, dass ein solcher Anblick sie nicht mehr zu berühren vermochte.
»Mach die Fesseln los und nimm ihm den Knebel raus. Lass es so aussehen, als ob er im Sessel eingeschlafen wäre.«
Sie hatten dem alten Mann die Hände und die Beine gefesselt und ihn in diesen Sessel gesetzt. Als er laut lamentierte, hatten sie ihm einen Knebel in den Mund gedrückt. Irgendein altes Handtuch, das herumlag. Dabei waren sie nicht zimperlich vorgegangen. Dann hatten sie begonnen, die Wohnung zu durchsuchen.
Als der Mann eine Woche später gefunden wurde, weil sich die Nachbarin darüber gewundert hatte, dass der Briefkasten tagelang nicht geleert wurde, konnte niemand mehr die Abschürfungen an den Händen erkennen. Das Handtuch lag auf dem Boden. Achtlos dort hingeworfen. Es wurde daher nicht weiter beachtet. Die Wohnung wirkte auch nicht unordentlich. Die Eindringlinge waren behutsam vorgegangen. Jede Schublade, jede Schranktür nur sanft geöffnet, alles sorgsam durchsucht, nichts durchwühlt.
Der alte Mann hatte keine Verwandten. Seine wenigen Freunde waren selbst alt und nicht alle schafften den Weg zur Beerdigung. Die kleine Trauergemeinde ging davon aus, dass der Verstorbene einfach eingeschlafen war. Das Alter hatte er gehabt. Nur einer unter den Trauergästen sah das anders. Der Alte hatte Paul Lorenz als seinen Erben eingesetzt. Und Paul Lorenz wusste, dass etwas da gewesen sein musste, was jetzt fehlte. Aber sicher war er sich dessen nicht. Denn er hatte es nie gesehen. Der Alte hatte ihm nur davon erzählt.
Der Alte war ein Experte für die Malerei des 18. und 19. Jahrhunderts gewesen. Und er hatte seit drei Jahren an einem Werk gearbeitet, das sich mit der Geschichte der alpenländischen Malerei des ausgehenden 19. Jahrhunderts befasste. Er hatte es unbedingt noch fertigstellen wollen. Für die Nachwelt. Sein gesammeltes Wissen um eine besondere Epoche, mit ganz besonderen Entdeckungen, die er gemacht hatte. Ein Werk, das die Kunstwelt bereichern sollte. Ein Werk, das die Fachwelt dringend brauchen konnte. Aber in der alten Villa, die Paul Lorenz gründlich durchsucht hatte, war davon nichts zu finden. Dass der Alte die Arbeit an diesem Werk nur vorgetäuscht haben sollte, wollte dem Erben nicht in den Sinn.
Als der Pfarrer den Sarg einsegnete, fing es an zu regnen. Es war kühl.
(Im Februar des darauffolgenden Jahres in einem Schloss im Pustertal)
Die ersten intensiven Sonnenstrahlen des Jahres wärmten zwar noch nicht, gaben dem »Fürstenzimmer« mit seinen alten Wandfresken und der dunklen Deckenverkleidung aus Zirbelholz aber genau den Effekt, den Victoria so schätzte. Der Februar war auf Schloss Kehl immer ein Erlebnis. Die Bauherren des Schlosses hatten bei der Architektur der Gebäude sehr darauf geachtet, dass die Fenster immer genügend Sonne hineinließen. Victoria freute sich jedes Mal aufs Neue, wenn nach dem Ende der dunklen Jahreszeit Schloss Kehl mit Sonnenenergie fast magisch aufgeladen wurde. So hatte sie es schon als Kind empfunden, als sie im Innenhof herumgetollt war, in den vielen Räumen des Schlosses mit ihren Freunden Fangen gespielt hatte, in den Kellern und Speichern auf Entdeckungsreise gegangen war. Schloss Kehl hatte ihrer Familie von Anbeginn an gehört. Das Geschlecht derer von Emeri hatte einen verzweigten Stammbaum, der weit zurück in die österreichisch-ungarische Zeit reichte. Victorias Familie hatte Wurzeln in fast allen Völkern, die das k.u.k. Reich eingeschlossen hatte. Da gab es den ungarischen Zweig der Familie, den slowakischen, den kroatischen. Es gab Siebenbürger Sachsen, die heute zu Rumänien gehörten, es gab einige jüdische Zweige der Familie aus dem alten Galizien und dem Königreich Böhmen. Fast alle von ihnen fanden sich auf den Wandfresken von Schloss Kehl wieder. Der ganze Stammbaum war dargestellt, soweit er erforscht und belegt werden konnte. Mehrere vorangegangene Generationen hatten daran gearbeitet, doch mit ihr würde er enden, denn sie war die Letzte ihres Geschlechts. Ihre Eltern hatten nur ein Kind bekommen. Und da sie nicht vorhatte, das Geschlecht nur deshalb weiterzuführen, damit es nicht ausstarb, würde das Fresko an der Stelle gleich neben der prächtigen Tür zum »Fürstenzimmer« enden. Daran musste sie immer denken, wenn sie es betrat.
Heute, als sich die ersten Sonnenstrahlen des noch jungen Februars – durch die bunten Glasscherben des Hauptfensters gebrochen – ihren Weg durch das Zimmer bahnten und genau den Flecken des Wandfreskos ausleuchteten, wo einst sie eingearbeitet werden würde, spürte sie einen kleinen Schmerz. Zum Glück war sie nicht allein. Sie hatte Besuch von ihrem alten Freund, Paul Lorenz.
»Victoria, schau dir bitte diese Tagebucheintragung an.« Er deutete auf eine bestimmte Stelle. Victoria las. Sie schaute den ihr gut vertrauten Freund nachdenklich an.
»Und eine Woche später wird er tot aufgefunden. Und es gibt keine Unterlagen mehr. Nichts, gar nichts. Ich habe die ganze Villa durchsucht. Da ist nichts. Wenn er nicht noch irgendwo ein geheimes Versteck hatte, dann sind alle seine Arbeiten verschwunden.«
Victoria nickte: »Oder in fremden Händen.«
»Ja! Oder in fremden Händen.«
Victoria schaute ihren Freund Paul sorgenvoll an: »Und was hast du vor?«
»Ich werde diesen Mann suchen, von dem die Tagebucheintragung berichtet.«
Victoria hatte ein schlechtes Gefühl. Die Sache war merkwürdig. Der alte Kunstexperte, den sie natürlich auch gekannt hatte, hatte in dieser Tagebucheintragung von einem seltsamen Besuch berichtet. Ihm seien zwei Bilder zur Begutachtung vorgelegt worden – Bilder von Franz Egener, die, wenn sie echt waren, ein Vermögen darstellten.
Franz Egener hatte in den Jahren 1844 bis 1914 gelebt und galt als einer der wichtigsten Alpenmaler. Kaum einem vor oder nach ihm war es gelungen, das Licht der Alpen so brillant einzufangen. Er war zudem bekannt für die einfühlsame Darstellung des bäuerlichen Lebens seiner Zeit. Gesichert war die Existenz von rund 400 Bildern. Aber da gab es auch Unsicherheiten. Egener war nicht sehr genau mit seinem Werkverzeichnis gewesen. Man sagte ihm außerdem eine Neigung zum Leben auf großem Fuß nach: Um diesen aufwändigen Lebensstil zu finanzieren, hatte er es nicht so genau genommen, wenn es darum ging, ein Werk, das in seinem Besitz war, aber von einem anderen Maler stammte, leicht zu überarbeiten, um es als eigenes Original zu verkaufen. Darüber hinaus wusste man von ihm, dass er sich öfter am Bergwerk am Rettenbach und in der Erzhütte im Ahrntal aufgehalten hatte. Der Legende nach angelockt durch eine Liebschaft. Es gab sogar eine ungesicherte Überlieferung, dass er dort gemalt haben sollte, wenn auch Bilder zum Thema Bergbau eigentlich nicht zu seiner Bilderwelt gehörten. In seinen Landschaftsbildern, für die er berühmt war, spielte das Licht eine große Rolle. Und im Bergbau gab es kein Licht. Jedenfalls kein natürliches. Es wäre also eine Sensation, fände man solche Bilder aus der Welt des Bergbaus von Egener. Damit ließe sich ein Vermögen verdienen. Denn Egeners Bilder wurden mittlerweile in einer Preisregion gehandelt, die fast jede Vorstellung sprengte.
Der Tagebucheintragung zufolge waren dem alten Kunstexperten zwei Bilder Egeners mit Motiven aus dem Bergbau zur Begutachtung vorgelegt worden. Der Eintrag gab jedoch keine Auskunft über das Ergebnis seiner Überprüfung. Lediglich der Anbieter wurde beschrieben. Ein Mann osteuropäischer Herkunft, der sich Oleg nannte.
Victoria fasste ihren Freund an den Schultern, justierte ihn damit so, dass er ihrem Blick nicht ausweichen konnte: »Pass auf dich auf. Der Markt ist in Bewegung. Das weißt du. Und viel Geld ist unterwegs, um es in Kunst zu bunkern. Deshalb explodieren die Preise auch. Und wenn dieser Oleg zu der Sorte Mensch gehört, die derzeit gehäuft unterwegs ist, dann ist das für dich gefährlich. Es kann natürlich Zufall sein, dass unser alter Freund genau eine Woche, nachdem dieser Oleg bei ihm war, verstorben ist. Vielleicht aber auch nicht.«
Paul Lorenz nickte und machte ein besorgtes Gesicht: »Er ist allerdings nicht eine Woche danach gestorben, da ist er lediglich tot aufgefunden worden. Gestorben ist er schon früher.«
Victoria wurde sich des Umstands bewusst, dass der Todeszeitpunkt damit in noch größere Nähe zum Zusammentreffen mit Oleg rückte: »Dann musst du erst recht auf dich aufpassen. Ist es nicht besser, wenn wir die Polizei einschalten?«
»Nein. Keine Polizei. Zuerst gehe ich der Sache nach. Ich bin schließlich als Erbe eingesetzt und ich fühle mich persönlich für sein Vermächtnis verantwortlich. Das bin ich ihm schuldig.«
Null
(Pustertal, 2. Juniwoche: Tag 1 – Montag – Vormittag)
»Hören Sie mich?« Der Rettungssanitäter klopfte dem Verletzten leicht auf die Wangen. Der öffnete die Augen, dämmerte aber sofort wieder weg. »Sie müssen jetzt wach bleiben!« Der Sanitäter sprach laut und deutlich zu dem Mann, während der Notarzt dem Verletzten eine Infusion legte. Der Mann hatte viel Blut verloren. Sein Blutdruck war niedrig: 80 zu 50. Der Puls war hoch: 120. Hände, Arme und Beine waren kalt. Seine Atmung war flach. Er wirkte abwesend. Er reagierte verlangsamt auf die Ansprache des Rettungssanitäters. Das ließ auf einen hohen Blutverlust schließen. Wie viel Blut er verloren hatte, konnten die Männer nur schwer einschätzen. Der Holzboden hatte möglicherweise einiges davon aufgesogen. Bei solchen Verletzungen drohten Ohnmacht und Kreislaufkollaps. Die Trage wurde hereingebracht. Sie hatten das Bein des Verwundeten in einer speziellen Schiene gelagert, sodass es auf Spannung gehalten wurde. Die Helfer des Weißen Kreuzes kannten sich damit aus. Knochenbrüche bei Skifahrern waren eine ihrer Spezialitäten. Aber dieser Mann hier war kein Skifahrer. Seine Verletzungen waren allerdings mindestens so schwer wie nach einem dramatischen Sturz bei der Abfahrt. Nur, dass er sich in seinem Haus verletzt hatte. Im Juni!
Als der Kreislauf des Verletzten wieder einigermaßen stabil war, hoben die Männer den Verletzten mit gekonnten Griffen in die enge Schale der Trage und zurrten ihn fest. Er stöhnte. Hatte Schmerzen. Der Hubschrauberpilot ließ den Motor an. Die Rotorblätter begannen sich langsam zu drehen, als die Trage hinten in den Rumpf eingeschoben wurde. Pelikan 1 hob ab und flog Richtung Krankenhaus Bozen. In der engen Kabine war es ohrenbetäubend laut. Der Notarzt meldete über Funk ins Krankenhaus: »Schwere und offene Frakturen am rechten Bein. Hoher Blutverlust. Möglicherweise Schädeltrauma. Ankunft in zehn Minuten.«
Eins
(Tag 1 – Montag – Nachmittag)
Lena war noch nicht lange in der Bozner Chirurgie. Sie hatte sich gefreut, als sie erfahren hatte, dass ihr nach dem bestandenen Examen als »Operationstechnische Assistentin« ein weiteres Auslandsjahr genehmigt worden war. Sie war während ihrer Ausbildung bereits in Mexiko gewesen und hatte dort an vielen Operationen teilgenommen. Als »Instrumentierende«, so nannte man diese Spezialisten, war sie nahe am Operationsgeschehen. Sie war dafür verantwortlich, dass im Operationssaal alle notwendigen Geräte vorhanden waren. Sie begleitete die Operation aktiv; ihre Tätigkeit erinnerte an jene der Techniker in der Boxengasse bei einem Formel-1-Rennen. Wenn der Operateur etwas brauchte, musste sie es zur Hand haben, bevor er explizit danach verlangte. Sie kannte sich daher mit Verletzungsmustern und den notwendigen Operationen gut aus. Aber das, was sie heute gesehen hatte, war auch für sie neu.
*
Lena reinigte die Zangen, die Sägen und all die anderen Geräte, die sie verwendet hatten. Der Chirurg zog seinen mit Blutspritzern verunreinigten Kasack aus und warf ihn in den Wäschekorb. Lena beobachtete, wie er sein Gesicht im Spiegel betrachtete. Auch wenn Operateure, Instrumentierende, Narkoseärzte und Assistenten eines OP-Teams viel ertragen konnten, sah Lena, dass sich bestimmte Eindrücke und Erlebnisse am OP-Tisch deutlich in die Gesichter der Beteiligten eingruben.
Seit zehn Jahren arbeitete der Chirurg, zu dessen Schicht sie eingeteilt worden war, an diesem Krankenhaus. Zehn Jahre Notfallchirurgie. Das waren zehn Jahre gebrochene Knochen, zerfetztes Gewebe, Schockzustände, Wiederbelebungsversuche, Blut, Schmerz und die damit verbundenen Gerüche.
Der Operateur war gerne Chirurg. Das wusste Lena. Sie hatten darüber gesprochen. Selbst in der Notfallchirurgie, wenn nicht alles nach Plan lief, konnte er Chaos und auch Schmerzensschreie ausblenden, sich ganz auf das Notwendige konzentrieren.
Er stand am Tisch, Lena als die Instrumentierende neben ihm. Seine Kommandos kamen ruhig und leise. Lena reichte, was verlangt wurde, räumte gebrauchte Instrumente sofort weg. Ihre Kollegin, die OP-Schwester, arbeitete routiniert, der Anästhesist überwachte den Kreislauf, gab leise Informationen nach vorne. Der erfahrene Chirurg schnitt, sägte, klemmte, nähte.
Und wenn sie dann in der Umkleide waren, fiel die Anstrengung von ihnen ab. Auch von Lena. Normalerweise dachte keiner nach der Schicht an die Menschen, die sie wieder zusammengeflickt hatten.
Heute war es anders. Die Knochen, die der Doktor soeben mit viel Mühe wieder sortiert und mit einer langen Metallplatte verschraubt hatte, waren in einer Art gebrochen, wie sie es noch nicht gesehen hatte. Skiunfälle waren anders. Verletzungen bei Autounfällen waren schon vergleichbar. Aber der Verletzte war in seinem Atelier gefunden worden. Auch wenn jemand ganz böse stürzte, konnte er sich solche Verletzungen nicht zuziehen. »Dem Mann hat jemand das Bein gebrochen.« Da waren sie sich sicher.
Zwei
(Tag 1 – Montag – früher Abend)
Elisabeth wollte mit Fabio heute Abend ins Theater. Sie hatten Karten für »Der Tiger, das Kreuz und der Antichrist«, ein modernes Stück, das schon vor seiner Premiere für Aufregung gesorgt hatte. Im vorwiegend katholischen Südtirol waren Anspielungen auf christliche Riten und Gebräuche heikel.
Elisabeth hatte die Karten bestellt, bevor die Entrüstungswelle durch den Blätterwald gerauscht war. Jetzt war sie neugierig darauf, worüber sich die Südtiroler so aufregten. Das fand sie noch spannender, als das Stück selbst. Von dem hatte sie nur gelesen, dass es in Deutschland auf vielen Bühnen aufgeführt worden war – ohne dass es Proteste gegeben hatte.
Elisabeth und Fabio waren seit zwei Wochen von ihrer Hochzeitsreise zurück. Drei Wochen waren sie unterwegs gewesen. Länger hatte Elisabeth ihren Mitarbeiterinnen den Betrieb ihrer Apotheke nicht zumuten wollen. Es war eine herrliche Zeit gewesen. Ihre Hochzeitsreise hatten Elisabeth und Fabio ihren Freunden Anna und Tommaso nachgemacht. Die waren vor mehr als 25 Jahren mit einem kleinen Koffer in den Bus zum Gardasee gestiegen und hatten dort in einer einfachen Pension ihre Flitterwochen verbracht. Kurz entschlossen hatten Elisabeth und Fabio im Frühjahr zwei kleine Koffer in Fabios neu erworbenes, aber an Jahren altes Auto gepackt und waren mit der flotten, innen aber sehr engen Lancia Fulvia aufs Geratewohl losgefahren. Zunächst Richtung Gardasee.
Fabio hatte die Reise auch sehr gut gefallen. Aber nachdem sie zurück im Alltag waren, hatte es nicht lange gedauert und er war unruhig geworden. »Die Questura Bozen ist schon ziemlich klein«, hatte er zum Beispiel gesagt, als sie beim Abendbrot zusammensaßen. Elisabeth ahnte, was in Fabio vorging. Er hing in Gedanken immer noch den vermeintlich spannenderen Fällen nach, die er in Rom bearbeiten konnte, bevor man ihn nach Bozen versetzt hatte.
»Du kannst aber nicht sagen, dass du hier langweilige Fälle hattest«, hielt Elisabeth ihm entgegen. Fabio hatte seit dem Sommer des vergangenen Jahres drei dicke Mordfälle aufklären müssen. Schwierige Fälle, verzwickte Verstrickungen. Einmal war er dabei sogar in Lebensgefahr geraten.
»Und mir gefällt es, dass es hier übersichtlicher zugeht, als in den Großstädten dieser Welt.« Sie hatte ihn genau beobachtet, während sie sprach. Ihre Ehe war schnell, sehr schnell geschlossen worden. Im Frühsommer des vergangenen Jahres hatten sie sich kennen gelernt, im Herbst schon geheiratet. Sie zweifelte nicht daran, dass er der Richtige war. Aber würde er sich hier auf Dauer zu Hause fühlen?
Fabio wechselte das Thema. Und Elisabeth erkannte langsam, was es bedeuten konnte, mit einem Polizisten verheiratet zu sein, der seinen Beruf als Berufung verstand.
Elisabeth hatte daher beschlossen, ihm das Leben in Südtirol näher zu bringen. Das Kulturleben, die sehr gute Küche, die ihr Fabio erst in Ansätzen kennen gelernt hatte. Kurz: Sie wollte ihm die schönen Seiten des Lebens zeigen. Und deshalb hatte sie auch die Premierekarten bestellt.
Das Stück war eher langweilig, fand Elisabeth. Der Stückeschreiber war Ire und hatte in diesem Stück alles Mögliche aufgearbeitet. Vordergründig ging es um das irische Schicksal, die wechselvolle Geschichte voller Unterdrückung, Gewalt, aber auch erlebter Armut. Hintergründig hatte der Autor seine eigenen Probleme mit der väterlichen Autorität und seine ganz persönliche Auseinandersetzung mit dem Katholizismus aufgearbeitet. Man konnte auch meinen, er wollte den Zuschauern seines Stückes zumuten, alles zu durchleben, was in seiner von Alkoholexzessen beeinflussten Gefühlswelt passiert war. Elisabeth fand, dass es dazu nicht nötig gewesen wäre, einen Hundekadaver an ein Kreuz zu binden und die Schauspieler dabei agieren zu lassen wie römische Legionäre bei der Kreuzigung Jesu. Allein schon die dargestellten Parallelen der Gefühlslage des irischen Volkes zu der Gefühlslage der Südtiroler mit Blick auf Fremdbestimmung und Unterdrückung hätten die Auswahl des Stückes für das Meraner Theater sinnhaft erscheinen lassen können – ganz ohne unnötige Überspitzung. Aber die teils hart an den Rand der Geschmacklosigkeit reichenden Szenen führten dazu, dass manche Theatergäste unter lautem Protest ihre Sitzplätze in den ersten Reihen schon während der laufenden Aufführung verließen. Das war das eigentlich Interessante an diesem Stück. Die Inszenierung des Publikums. Es reagierte. Es spendete nicht Applaus. Es protestierte.
Schon vor Beginn der Aufführung, als das Premierenpublikum gerade eintraf, hatte sich ein bekannter Stadtpolitiker vor dem Theater postiert. Er saß hinter einem kleinen Klapptisch und hielt »Bürgersprechstunden« ab. Auf einer großen Schiefertafel stand mit Kreide geschrieben, dass er aus Protest gegen die Aufführung dieses Stückes auf normale Kleidung verzichte. Stattdessen werde er in Lumpen gehüllt arbeiten, als augenfälliges Zeichen seines Widerstandes gegen diesen Affront.
Jedenfalls sollte diese Aktion und auch die anschließende tägliche Berichterstattung über das »Skandalstück« dafür sorgen, dass das Theater immer ausverkauft war. Sei es, dass die Menschen sich aufregen wollten, sei es, dass die Menschen sich amüsieren wollten. Und irgendwie lief das wohl auf dasselbe hinaus.
In der Pause hatten Fabio und Elisabeth ihren Spaß daran, sich die aufgeregt diskutierenden Theatergäste anzuschauen. Fabio hatte an der voll belagerten Bar erfolgreich zwei Gläser mit Sekt erstanden. Sie hatten gerade den ersten Schluck genossen, als Fabio eine ihm bekannte Stimme vernahm.
»Ah, so trifft man sich wieder!«
Fabio drehte sich um und blickte in das Gesicht seines Chefs. Silvano Pallua war von untersetzter Statur. Seit neuestem trug er sein spärliches Haupthaar kurz, was ihn etwas flotter wirken ließ. Als Fabio ihn vor gut einem Jahr kennen gelernt hatte, hatte er das wenige Haar noch von rechts nach links quer über den breiten Mittelscheitel gekämmt. Es war, als bemühe er sich seit neuestem um ein flotteres Aussehen. Er strahlte jedoch von jeher Dynamik und Durchsetzungsfreude aus. Wenn er redete, wirkte er mit seinen Gesten und seiner Mimik nicht wie ein Mann über 60, sondern wesentlich jünger.
Silvano Pallua wandte sich jetzt Elisabeth zu. »Oh, ich nehme an, dass Sie die Frau Gemahlin sind?« Er reichte Elisabeth die Hand. »Es ist mir eine Freude, Sie endlich einmal kennenzulernen. Ihr Gatte hat mir zwar von der Hochzeit berichtet«, er ließ Elisabeths Hand wieder los und wandte sich Fabio zu, »aber er hat mir bisher verschwiegen, was für eine wunderschöne Frau er geheiratet hat.« Dabei lächelte er.
Fabios Verhältnis zum Vicequestore war über die Zeit zwar fast kollegial geworden, aber er konnte seinen Chef immer noch nicht richtig einschätzen. Der Vice hatte Fabio wiederholt gezeigt, dass er »den Laden im Griff« hatte, wie er sich gerne ausdrückte. Und er hatte ihm immer wieder angeboten, ihn in das Netzwerk einzuführen, dessen er sich bediente. Etwas Konkretes war daraus aber nicht geworden. Nachdem mächtige Kreise aus Rom versucht hatten, den Vice etwas unsanft von seinem Sessel zu stoßen, im Ergebnis damit aber gescheitert waren, hatte sich ihr Verhältnis etwas gebessert. Es schien Fabio, als ahne der Vice eine bestimmte Entwicklung voraus, die ihm, Fabio, später noch einiges an Ungemach bereiten könnte. Aber er drückte sich nicht klar aus. Er beobachtete. Manchmal war es Fabio, als nehme der Chef ihn wochenlang kaum wahr. Und dann tauchte er plötzlich in seinem Büro auf und ließ durchblicken, dass er über alles im Bilde war, ließ sich unterrichten, gab den einen oder anderen Hinweis und verschwand wieder. Dieser Chef war und blieb geheimnisvoll.
Jetzt traf man sich zufällig im Meraner Theater, beim Besuch des derzeitigen »Skandalstücks«.
»Amüsant, finden Sie nicht auch?« Die Frage vom Vice war an Elisabeth und Fabio gerichtet.
»Sie meinen das Stück?« Fabio wollte irgendetwas Belangloses zum Stück sagen und suchte nach einem passenden Einstieg. Small Talk war nicht seine Stärke. Er überlegte immer zu lange, bis ihm etwas einfiel. Und das war dann selten passend.
»Ach was!«, meinte der Vice, »Das Stück ist doch total langweilig, in sich vollkommen verquast, aus Frust geboren, wobei der Alkohol Geburtshelfer war. Nein! Ich meine die Leute! Das ist doch amüsant. All diese aufgeregten Leute. Wie sie alle diskutieren! Und dann unser Moralapostel vom Dienst in seiner Kutte vor dem Theater. Der nutzt die Gunst der Stunde. Wegen seiner dilettantischen Politik kommt der kaum noch in die Zeitung. Aber mit der Kutte und der lauthals vorgetragenen moralinsauren Geschichte steht der jetzt täglich in den Zeitungen.«
Der Vice machte dabei ein neutrales Gesicht, aber seine Augen blinkten amüsiert. Sie weiteten sich, als sein Blick auf eine Dame fiel, die auf die kleine Gruppe zusteuerte, zwei Sektgläser in den Händen. Sie blickte Fabio und Elisabeth neugierig an. Der Vice nahm ihr ein Glas aus der Hand.
»Ich möchte Ihnen Gräfin Victoria von Emeri vorstellen.« Und zu ihr gewandt: »Das sind mein bester Commissario, Fabio Fameo, und seine Gattin. Wir unterhalten uns gerade über die Aufregung, die dieses Stück in unser sonst so ruhiges Land bringt.«
Die Gräfin begrüßte Fabio und Elisabeth mit einem Lächeln. Sie war klein und zierlich. Fabio schätzte ihr Alter auf Mitte Vierzig. Sie strahlte Eleganz und Lebensfreude aus. Der Duft, den sie verströmte, ließ auf ein teures Parfüm schließen. Auch ihre Garderobe ließ den Schluss zu, dass sie bestimmt nicht auf Schnäppchenjagd gehen musste. Ein seidig schimmerndes Sakko mit dreiviertellangen Ärmeln, das nur mit einem Taillenknopf genau über der schlanken Mitte geschlossen war, dominierte. Hose und Top waren schwarz und wirkten auf teure Weise schlicht. Auch die aus feinem schwarzem Leder gefertigten niedrigen Slipper, die für sich genommen so manche Schuhliebhaberin entzückt hätten, vermochten es nicht, dem aufwändig gearbeiteten Sakko die Präsenz zu nehmen. Ihr Kopf war von dunkelblondem Haar umrahmt, das ihr fast bis auf die Schultern fiel. Die Haare waren modisch frisiert. Sie hatte ein fein gezeichnetes Gesicht mit hohen Wangenknochen, aus dem ihre graublauen Augen munter, interessiert und wissend die Umwelt musterten. Ihre Hände waren sehr gepflegt. Die Nägel waren dezent manikürt. Es fiel auf, dass sie keinen Schmuck trug. Nicht einen Ring. Nicht einen Armreif. Keine Kette. Sie wirkte einfach, natürlich und doch sehr interessant.
Der Vice jedenfalls schien es zu genießen, dass er sich in der Begleitung einer solchen Aufsehen erregenden Frau befand. Fabio hatte von der Sekretärin des Vices hier und da Andeutungen vernommen, dass der Vice in Sachen Frauen kein Kostverächter war. Sie hatte ihm aber weder etwas Konkretes verraten, noch hatte er selbst irgendetwas in dieser Richtung wahrgenommen. Eigentlich war es ihm auch völlig egal. Aber jetzt erwachte Fabios Neugier. War des Vices Begleiterin seine Freundin? Oder nur eine Bekannte? Jedenfalls war sie eine beeindruckende Erscheinung. »Hätte ich dem Mann jetzt nicht zugetraut«, dachte er.
Der Vice musterte ihn. Amüsiert.
»Kann er meine Gedanken lesen?«
Der Vice räusperte sich: »Lassen Sie uns einen Schluck nehmen. Die Pause ist gleich vorbei. Dann müssen wir wieder rein, in den Kunsttempel, um uns den Rest des Stücks einzuverleiben.« Er hob leicht sein Glas und alle tranken. Dann kam auch schon das Signal, das die Theatergäste wieder auf ihre Sitze befahl. Der Vice und seine Gräfin verschwanden Richtung Logenplätze, freundlich grüßend. Zunächst Fabio und Elisabeth, dann, auf ihrem Weg zur Loge, viele weitere Theatergäste.
»Die beiden scheinen viele Leute zu kennen«. Fabio nickte zustimmend: »Scheint so zu sein. Der Vice ist ja auch schon lange hier. Und er hat mir immer erzählt, dass er gut verdrahtet ist. Aber seine Begleiterin ist ja vielleicht ein Kaliber. Das hätte ich ihm gar nicht zugetraut. Ob sie etwas miteinander haben?«
Elisabeth schaute ihren Fabio verwundert an: »Na klar. Hast du das denn nicht gesehen?«
Das zweite Signal nötigte sie, schleunigst zu ihren Plätzen zu gehen.
Drei
(Tag 1 – Montag – abends im Pustertal)
Matthias Althuber, genannt Hiasl, saß zusammen mit Hubert, seinem Sohn, über der Abendsuppe:
»Ich kann es nicht fassen!«, stieß Hiasl hervor.
Hubert nickte: »Das ist alles sehr sonderbar. So, wie du sagst, dass er zugerichtet war, kann er nicht einfach gestürzt sein.«
»Niemals ist der gestürzt. Der ist doch fit. Und du hättest das Blut sehen sollen! Alles war voll damit. »Jemand hat ihn übel zugerichtet.«
Hubert nickte erneut und fragte:»Aber wer? Und warum?«
Die beiden schwiegen.
Hiasls Sohn dachte laut nach: »Da oben ist es einsam. Zeugen wird es kaum geben. Warum macht einer so was? Raub? Ist etwas gestohlen worden?«, fragte er.
Hiasl schüttelte den Kopf: »Ich weiß nicht. Sah nicht danach aus. Ich meine – es war nichts durchwühlt. Er hat nur da gelegen, mitten in seinem eigenen Blut, und hat schrecklich ausgesehen, mit dem Bein.«
»Wenn es kein Raub war, dann muss es einen anderen Grund geben, warum er so zugerichtet worden ist. Vielleicht sollten wir es der Polizei melden?«, setzte Hubert seine Überlegungen fort.
Hiasl nickte langsam: »Aber als ich ihn fand, hat er mich angesehen und gesagt: ›Keine Polizei. Keine Polizei!‹. Dann ist er ohnmächtig geworden.«
»Meinst du, er hat Angst vor der Polizei?«
Hiasl nickte langsam: »Hörte sich so an.«
»Und was machst du jetzt?«
Hiasl schaute zu seinem Sohn: »Weißt du noch, wie dich die Carabinieri damals am Wickel hatten?«
Hubert musste lachen: »Klar weiß ich das noch. Und wenn Tommaso damals nicht gewesen wäre, hätte das böse für mich enden können.«
»Ich werde Tommaso davon erzählen. Der wird wissen, was hier zu tun ist«, beendete der Vater das Gespräch.
Vier
(Tag 1 – Montag – Abend / Nacht)
Das Stück war aus und die Schauspieler bekamen ihren Applaus. Sie hatten ihn verdient. Das Stück eher nicht. Einige Pfiffe hatte es auch gegeben.
Im Foyer trafen Elisabeth und Fabio erneut auf den Vice und seine aparte Begleitung.
»Mein lieber Fabio, sollen wir den Abend bei einem guten Glas Wein ausklingen lassen? Was meinen Sie?« Dabei hatte er sich Elisabeth zugewandt. »Ich hätte Lust auf einen Blauburgunder. Wie sieht es mit Ihnen aus?«
Er wartete nicht auf eine Antwort. Es war, als habe er bereits beschlossen, dass sie den Abend gemeinsam zum Abschluss bringen sollten. »Ich dachte da an den Ansitz Kränzel. Der liegt ohnehin auf Ihrem Weg. Ich rufe rasch an, dass man uns nicht vor der Nase zumacht.« Mit diesen Worten ließ er seine Gräfin mit Elisabeth und Fabio stehen, um – von ihnen abgewandt – den eben angekündigten Anruf zu tätigen. Sie hörten, wie er lautstark und in kumpelhaftem Ton sprach. »Ja, wir kommen noch. Das Stück? Es war langweilig. Hast du noch einen Tisch für vier frei? Danke. Bis gleich.«
Mit einem Lächeln kam er zurück: »Man erwartet uns! Auf geht’s!«
Ein sichtbar gut gelaunter Vice ging voran, an seiner Seite die Gräfin, schmunzelnd, dahinter ein etwas verdutzter Fabio und an seiner Seite, neugierig, Elisabeth.
Das Restaurant Miil1, in das sie der Vice lotste, lag direkt am Ansitz Kränzel. Das Gebäude hatte früher als Mühle gedient. Fabio nahm zunächst die schwarz geräucherte Kuppeldecke im Eingangsbereich wahr. »Hier war früher die Küche«, erklärte der Vice und zeigte anschließend nach links: »Und jetzt ist hier eine famose Bar eingebaut.« Die Beleuchtung unter der steinernen Tischplatte des Tresens erhellte den Fußraum und das gläserne Regal voller Weingläser strahlte durch das Glas hindurch sanftes Licht in den Raum, ohne dass die Lichtquellen dafür auszumachen waren. Der Vice führte sie in den Hauptraum, der sich sowohl nach oben auf eine Galerie als auch nach unten, gefühlt in die Kellerlage, erstreckte. Getrennt wurden die beiden Ebenen durch ein Geländer aus schweren Glasplatten, die an ihren schmalen Schnittstellen aus sich heraus leuchteten. Dasselbe Prinzip wie im Weingläserregal: Licht im Raum ohne direkt erkennbare Quellen. Der Vice lächelte einen Herrn an, der ihm munter entgegenkam. Sie grüßten einander herzlich. Der Wirt, wie sich herausstellte.
»Schön, dich mal wieder hier zu sehen«, begrüßt der Wirt den Vice. »Du warst schon lange nicht mehr hier.« Der Wirt musterte die Begleitung des Vicequestore.
»Darf ich dir Gräfin Victoria von Emeri vorstellen?« Mit diesen Worten gab er den Blick auf seine Begleiterin frei.
Der Inhaber der Miil lächelte. »Wir kennen uns. Was macht die Kunst?«
Victoria von Emeri nickte ihm zu. Sie wirkte dabei leicht amüsiert, wie es Fabio schien. »Die Kunst? Nun, sie entwickelt sich fort, so wie sie es seit tausenden von Jahren tut und immerzu tun wird«, antwortete sie. »Aber die Geschäfte laufen gut, wenn Sie das meinen..«
Der Vice fuhr fort, die anderen vorzustellen. »Das sind Fabio Fameo, mein leitender Commissario, und seine Frau.«
Elisabeth reichte dem Wirt die Hand, »Elisabeth Trafoier 2, ich führe die Apotheke in Tisens.« Sie ließ dabei ihren ganzen Charme spielen, wie Fabio etwas verwundert feststellte. Dem Wirt schien das zu gefallen.
»Ja, ich habe von Ihnen gehört. Sie kommen aus dem Ultental?«, stellte er fest und kleidete das höflich in eine Frage.
Elisabeth nickte nur.
Fabio wurde daraufhin ebenfalls herzlich begrüßt und der Wirt führte sie an den Tisch, von dem er sich erhoben hatte, um ihnen entgegenzugehen. Silvano Pallua lachte auf.
»Ja, wen haben wir denn da?«
Er begrüßte den Mann, der offensichtlich vor ihrem Eintreffen mit dem Wirt an diesem Tisch gesessen haben musste. »Luis, das ist eine Überraschung!«, rief er aus und umarmte den Mann.
Elisabeth wisperte Fabio fast unmerklich ins Ohr: »Das ist Luis Durnwalder, unser Landeshauptmann 3.«
Fabio hatte ihn noch nie vorher erlebt. Er kannte ihn nur aus den Zeitungen. Und jetzt saß er mit ihnen am selben Tisch.
»So spät noch unterwegs?«, konnte Fabio verstehen. Der Vice und Luis Durnwalder mochten sich. Das konnte selbst Fabio erkennen, denn Mimik, Gestik und Klangfarbe der Stimmen waren eindeutig. Der Ober brachte gute Weine aus dem Keller und es wurde schnell lustig.
»Der hat was? In einer Kutte? Der Gottfried, der alte Lokalchampion!« Der Landeshauptmann wollte kaum glauben, was ihm der Vice erzählte. Er schüttelte amüsiert den Kopf. »Und wie war das Stück? Die Zeitungen haben es ja schon vor der Premiere zerrissen.«
Der Vice lächelte leicht in die Runde: »Dieses Stück fand ich – gewöhnungsbedürftig.«
Der Wirt nickte: »Dann entspann dich jetzt! Unser Essen ist nicht gewöhnungsbedürftig. Der Koch der Miil ist ein Künstler. Ich bin froh, dass ich ihn bekommen habe. Der zaubert aus guten Zutaten kleine Kunstwerke auf die Teller. Und die Genießer dieser Kochkunst entscheiden sich schnell und sicher, ob sie gefällt. Aber bei bildender Kunst oder bei Gartenkunst scheiden sich nun einmal die Geister.«
»Dazu kannst du ja bestimmt viel erzählen.« Das war der Vice. Dabei schaute er Fabio an. »Kennen Sie den Labyrinthgarten? Gleich nebenan?«
Fabio verneinte.
»Den müssen sie sich einmal ansehen. Bei Tageslicht, oder auch im Sommer, wenn dort abends Aufführungen stattfinden. Gartenarchitektur, verwoben mit Skulpturen, Irrgärten, Zengärten, ein Gesamtkunstwerk der besonderen Art.«
Der Wirt schaute belustigt: »Mein lieber Silvano, du hast ja Sinn für das Schöne! Das freut mich.«
Ein leises Lächeln huschte über das Gesicht des Vicequestore: »Ja, da staunst du! Ich habe durchaus Sinn für schöne Dinge. Und dass du im Miil auch unsere Gaumen verwöhnen lässt, entschädigt mich ein wenig für den seltsamen Kunstgenuss, den ich im Meraner Theater erlebt habe. Einen Hund zu kreuzigen. Also wirklich!«
Der Landeshauptmann nickte: »Ich habe das Stück ja nicht gesehen, aber mir gefällt die Vorstellung auch nicht besonders, den Leichnam eines Hundes in ein Theaterstück einzubauen.« Er wiegte seinen Kopf hin und her. »Hunde sind wichtig für uns Menschen. Sie werden von den Schäfern und Jägern gebraucht. Und als Jäger brauche ich sogar einen gut ausgebildeten Hund, der weiß, welche Aufgaben er zu erledigen hat. Dann ist er auch ein Kamerad, ein treuer Freund. Und da graut es mir, wenn ich mir vorstelle, dass so ein Stückeschreiber meint, er müsse den Kadaver einer solchen Kreatur missbrauchen.«
Der Wirt nickte. »Und, hast du überhaupt noch Zeit für die Jagd?«, fragte er den Landeshauptmann.
»Wenig. Kannst du dir ja denken. Die Tage sind ausgefüllt. Aber im Urlaub und wenn sich zwischendurch die Gelegenheit ergibt, dann bin ich im Wald.«
Er hob sein Glas und alle machten es ihm nach.
Es wurde spät. Sehr spät. Sie waren irgendwann die einzigen verbliebenen Gäste und der ältere Mann, der für den Service verantwortlich war, setzte sich zu ihnen. Er flocht sich ungezwungen in das Gespräch ein und plauderte in lockerer Mundart. Fabio verstand nicht einmal die Hälfte. Die anderen antworteten ihm im gleichen Dialekt, wechselten hie und da aber ins Hochdeutsche. Der Wirt schickte den Mann ab und an in den Keller, um eine besondere Flasche zu holen. Es war klar, dass er hier der Chef war. Aber sie benahmen sich ansonsten wie Freunde. Allerdings trank der Mann nicht mit.
*
Als sie auf dem Heimweg waren, dachte Fabio darüber nach, wie locker der Vice den Abend inszeniert hatte. Inszeniert, fand Fabio, war das richtige Wort. Der Landeshauptmann am Kopf des Tisches platziert, die Gräfin, die er jetzt einfach Victoria nennen durfte, daneben, und der Vice selbst so, dass er die Gespräche steuern konnte. Wie ein Moderator. Nur, dass alles so unaufdringlich, so eingespielt, so selbstverständlich wirkte. Fast unbemerkt hatte der Vice mit dem Ober die Bestellung abgesprochen. Es wurden gute Weine herbeigeschafft, aus der Küche kamen bemerkenswert schmackhafte kleine Speisen, die gut zum Wein passten. Alles lief ab wie bei einer Theateraufführung. Und zum Schluss gab es Applaus in Form einer herzlichen Verabschiedung. Bis zur Morgendämmerung waren es nur noch wenige Stunden, als man sich trennte. Als Fabio nach der Rechnung fragen wollte, bedeutet ihm der Vice, dass er die Rechnung übernehmen würde. Es sei alles geregelt.
Auch die Heimfahrt wurde geregelt. Der ältere Mann, der sie die ganze Zeit über betreut hatte, bot an, sie nach Hause zu fahren. Er war auch Taxifahrer. Auf der Fahrt erzählte er in lockerem Plauderton, dass er Rentner sei und sich auf diese Weise noch ein wenig dazuverdiene. Als Kellner und als Taxifahrer. Außerdem habe er noch einen Hof, der auch noch etwas abwerfe.
Als er Fabio und Elisabeth in Tisens abgesetzt hatte, gingen sie ins Haus und Fabio legte sich sofort ins Bett. Die späte Stunde, der viele Wein. Er wunderte sich, wo Elisabeth blieb. Sie war in ihrem Arbeitszimmer verschwunden. Als sie ins Schlafzimmer kam, hatte sie ein Buch in der Hand.
»Ich wusste doch, dass ich es irgendwo hatte. Der Landeshauptmann hat mich auf eine Idee gebracht.« Sie gähnte jetzt herzhaft. Die späte Stunde und der viele Wein entfalteten auch auf sie ihre Wirkung.
Halb im Schlaf fragte Fabio: »Auf welche Idee?«
Sie kuschelte sich an ihn und die Augen fielen ihr zu: »Erzähl ich dir ein anderes Mal.«
1 Lokaler Ausdruck für »Mühle«
2 Zum Verständnis: In Südtirol behalten viele Frauen ihren Geburtsnamen auch nach der Eheschließung.
3 Für die Leser aus Deutschland: Der Landeshauptmann ist das höchste politische Amt in Südtirol. Die Funktion entspricht jener eines Ministerpräsidenten in Deutschland. Luis Durnwalder bekleidete das Amt von 1989 bis 2014.
Fünf
(Tag 2 – Dienstag – Morgen)
Tommaso Caruso, Fabios Freund und Kollege, wartete an diesem Morgen etwas länger auf Fabio. Tommaso war Maresciallo der Carabinieri und arbeitete wie Fabio in Bozen. Sie hatten sich kennen gelernt, kurz nachdem Fabio aus Rom nach Südtirol versetzt worden war. Eigentlich arbeiteten Carabinieri und die Polizia di Stato, der Fabio angehörte, nicht eng zusammen. Aber ihre Freundschaft verschaffte den beiden auch in ihrer Arbeit hie und da Vorteile. Praktisch war es, dass sie im selben Dorf wohnten. Tisens lag auf rund 600 Metern Höhe, was besonders im Sommer von Vorteil war. Bozen war dann ein Heizkessel und sie genossen es jeden Tag, nach der Arbeit wieder in die kühlere Höhe hinaufzufahren. Tommaso genoss es seit kurzem umso mehr: Fabio hatte sich im vergangenen Herbst nämlich eine Lancia Fulvia gekauft. Von einem Freund Tommasos. Seither holte Fabio Tommaso zur Arbeit ab. Früher war das umgekehrt, denn Fabio war ein rechter Automuffel gewesen. Mit der Fulvia hatte sich das geändert. Nur manchmal dachte sich Tommaso, dass er ihm zu einem anderen Wagen hätte raten sollen. Denn Tommaso war ein Baum von einem Mann. Er hatte jedes Mal Mühe, sich in die enge Fulvia hineinzuzwängen.
Tommaso wunderte sich darüber, dass Fabio zu Fuß kam.
»Kannst du heute fahren? Ich habe meinen Wagen im Ansitz Kränzel stehen. Ist gestern sehr spät geworden.«
Auf der MEBO Richtung Bozen in Tommasos Wagen erzählte Fabio von seinen Erlebnissen des vorangegangenen Abends. »Und heute Abend bring ich dich zum Ansitz Kränzel, damit du deinen Wagen abholen kannst«, sagte Tommaso.
*
»Und er hat doch tatsächlich eine Freundin. Und was für eine!« Fabio war richtig stolz, dass er seiner Assistentin Francesca Giardi eine echte Neuigkeit berichten konnte. Diese schmunzelte – mit einer wissenden Miene. Das erkannte er sofort. Francescas Mimik war ihm mittlerweile nur zu vertraut. Sie arbeiteten seit einem Jahr zusammen und hatten in dieser Zeit schon viel gemeinsam erlebt. Sie vertraute Fabio. Er wusste, dass Elisabeth keinen Grund zur Eifersucht hatte, soweit es Francesca betraf.
Das Studium ihrer Mimik war wahrscheinlich sein Privileg. Andere Männer, die nicht ahnten, dass sie niemals eine Chance bei ihr haben würden, waren durch ihr attraktives Äußeres zu sehr abgelenkt, als dass sie sich auf das ausdrucksstarke Mienenspiel hätten konzentrieren können. Francesca hatte dunkle Augen, meist dunkelbraun, manchmal erschienen sie ihm auch fast schwarz. Sie war auffallend gekleidet. Figurbetont. Aufreizend. Gerne in bunten Farben – zumindest von Frühling bis Spätherbst. Sie wirkte wie aus einem Modekatalog. Und immer auf hohen Hacken unterwegs.
Hinter der Fassade des Modepüppchens verbarg sich aber eine gute Polizistin mit klarem Verstand, die ihr Handwerk gelernt hatte. Darüber hinaus hatte sie aber Fähigkeiten, die ihr niemand in Fabios Umgebung zugetraut hätte. Sie hatte ihm erzählt, dass sie ein Jahr lang bei den Spezialeinheiten gewesen war, sich dann aber dagegen entschieden hatte.
Wenn Francesca sich über etwas amüsierte, dann schmunzelte sie. Dann zog sie ihre Lippen ganz leicht zusammen. Eine Augenbraue stark nach oben gezogen bedeutete: Achtung!
»Warum schmunzelst du?« Fabio wusste es bereits, als er die Frage stellte.
»Du wusstest es schon. Und du wusstest es schon lange vor mir, richtig?«
Sie schaute ihn amüsiert an: »Ja, ich wusste es schon vor dir. War aber top secret. Bis heute jedenfalls, wie es scheint. Wenn er sich jetzt mit seiner Gräfin in der Öffentlichkeit gezeigt hat, dann ist das von nun an wohl offiziell.«
»Ich habe nichts von einer Gräfin gesagt.«
Francesca ging an ihren Schreibtisch, zog eine der Schubladen heraus, kramte darin herum und förderte eine alte Zeitungsseite hervor: »Hier, das ist sie. Gräfin Victoria von Emeri, wohnt auf Schloss Kehl im Pustertal. In der Nähe von Gais. Kunstsammlerin, Kunstexpertin. Der Bericht ist vom Sommer letzten Jahres. Sie hat damals im Brunecker Stadtmuseum eine Ausstellung eröffnet und die Festansprache gehalten. Das Feuilleton bejubelt ihre Brillanz.«
Sie reichte Fabio den Zeitungsausschnitt:
Retrospektive des Alpenmalers Franz Egener (1844–1914) in Bruneck. Gräfin Victoria von Emeri hielt Festvortrag
Zur Eröffnung des Brunecker Kultursommers ließ Gräfin Victoria von Emeri (50) in einer schwungvollen Rede Bilder aus einer vergangenen Zeit vor dem inneren Auge des Zuhörers entstehen. Fast 200 Gäste waren zur Eröffnung der Ausstellung von Werken des berühmten »Alpenmalers« Franz Egener erschienen, die mit »Sorgfalt, Kenntnisreichtum und Liebe« – so die Gräfin in ihrer Rede – von dem international anerkannten Experten für die Malerei des ausgehenden 19. Jahrhunderts im alpenländischen Raum, Paul Innerhofer (76), zusammengestellt wurden. Innerhofer habe geschafft, was viele für unmöglich gehalten hatten. Das Werk Egeners sei – so die Gräfin – schwer zu kuratieren. Der aus Meran stammende Innerhofer habe es aber vollbracht, den Besuchern dieser Ausstellung einen guten Überblick über Egeners Schaffen zu geben. Als Kurator habe er sich bleibende Verdienste erworben. Niemand sonst hätte die Fähigkeit gehabt, diese ausdrucksstarke Zusammenstellung in Bruneck auf die Beine zu stellen. Bruneck sei deshalb ein gut gewählter Ort, weil Egener viele seine Bilder im Pustertal gemalt habe. Er sei zwar ein Wanderer gewesen, aber die Höhen des Pustertals und seine einsamen Seitentäler hätten es ihm angetan. Auch wenn sein Leben und sein Werk noch nicht vollständig erforscht seien, könne man doch sagen, dass Egeners Schaffensschwerpunkt im heutigen Südtirol gelegen haben muss.
Franz Egener war einer der bedeutendsten Maler des alpinen Raumes. Sein Werk zeichnet sich dadurch aus, dass es den Lebensraum und den Alltag der alpinen Bevölkerung unprätentiös und konkret beschreibt. Dabei löst er beim Betrachter durch die realistische Darstellung des Lichts in der Landschaft eine fast metaphysische Überhöhung des Naturempfindens aus.
Die Ausstellung der Werke Egeners im Brunecker Stadtmuseum kann bis zum 19. September täglich von 9 bis 19 Uhr besucht werden.
Fabio las den Artikel quer. Das Foto zeigte in der Tat die Freundin des Vice – Victoria, wie er sie seit gestern nennen durfte. Neben ihr stand ein alter Mann. Wahrscheinlich der erwähnte Kurator. Dabei fiel sein Blick noch einmal auf die ersten Zeilen des Berichts.
»Victoria ist ja schon 50! Hier steht das Alter! Sie hat sich aber gut gehalten!«
Francescas Augenbraue ging leicht nach oben: »Wieso?«
»Ich hätte die Gräfin auf höchstens Mitte 40 geschätzt. Die sah toll aus.«
Dann starrte er seine Assistentin an: »Aber wieso weißt du das alles? Und woher hast du den Artikel?« Fabio fragte nur der Form halber. Die Antwort kannte er schon: »Frauennetzwerk!«
»Mein lieber Chef. Einer guten Assistentin entgeht nichts. Und einer guten Sekretärin entgeht auch nichts. Und wenn sich die gute Sekretärin …«
Fabio fiel ihr lachend ins Wort: »... mit der guten Assistentin gut versteht, dann haben die beiden fix raus, was gerade beim Chef läuft. Richtig?«
Francescas Gesicht lachte ihn jetzt auch an: »Richtig. Carlotta hat es herausgefunden. Sie beobachtet einfach gut. Der Vice war plötzlich immer super gut gelaunt. Und er war noch öfter weg als sonst schon. Eigentlich dauernd. Und dann hat die Gräfin halt einmal in seinem Büro angerufen. Und Carlotta hat es an seiner Stimme gehört, als sie das Gespräch in sein Büro gestellt hat. Er war aufgeregt wie ein junger Bub, hat sie gesagt. Da war für sie der Fall klar. Außerdem kennt sie jemanden aus dem Dorf bei Schloss Kehl. Ein Vetter ihres Onkels, glaube ich. Und der hat ihr bei einem Familientreffen erzählt, dass der Privatwagen des Vicequestore regelmäßig vor dem Schloss zu sehen ist. Damit war alles klar. Und den Artikel hat sie halt ausgeschnitten und mir gezeigt. So einfach ist das.«
»Und seit wann läuft das so?«
»Begonnen hat das im letzten Jahr. Spätes Frühjahr, früher Sommer, glaube ich. Carlotta hat mich aber erst vor kurzem eingeweiht. Und du bist jetzt unser Kronzeuge. Du hast die beiden gesehen.«
Fabio nickte: »Nicht nur das. Ich darf auch Victoria zur Gräfin sagen. So ist das. Und den Landeshauptmann kennt der Vice auch. Sie duzen sich sogar.«
Fabio erzählte nun auch Francesca kurz, was er im Miil erlebt hatte.
Sechs
(Tag 2 – Dienstag – Abend)
Lena hatte sich für ein Auslandspraktikum als Instrumentierende entschieden. Sie fand es spannend, verschiedene Operationstechniken kennenzulernen. Und als sie die Chance bekam, einen Teil ihres Praktikums im Bozner Krankenhaus zu absolvieren, hatte sie sofort zugesagt. Allerdings war das Praktikum nicht so gut bezahlt, dass sie sich allein damit den Aufenthalt in Südtirol hätte leisten können. Und so war sie froh, als man ihr anbot, auf den Krankenstationen zusätzlich die Nachtwache zu übernehmen. Sie sollte Routinearbeiten verrichten und wenn sie nicht weiterwusste, konnte sie erfahrene Krankenschwestern rufen.
Sie hatte den Mann schon fast vergessen. Als er nach der Nachtschwester läutete, ging sie hin, um nachzusehen. Der Mann erkannte sie nicht. Aber sie wusste sofort, dass er es war. Das Bein war geschient und am Bett fixiert, sodass er es nicht bewegen konnte. Der Mann hatte Schmerzen und verlangte nach einem Mittel. Lena stellte ihm ein Glas Wasser hin und sagte, dass sie ein Schmerzmittel holen würde. Sie musste erst die Krankenschwester fragen, was sie ihm geben durfte. Das musste außerdem protokolliert werden. Dazu war sie nicht befugt.
Als sie mit dem Mittel zurückkam, schlief er schon wieder. Er atmete flach. Sie beobachtete sein Gesicht. Ein leichtes Zucken durchlief seine Wangen. Plötzlich schrie er. Dabei riss er die Augen auf und starrte Lena entgeistert an.
»Was, was machen Sie hier? Wer sind ...«
Dann erkannte er sie. Sein Atem wurde wieder ruhiger. Er schluckte. Seine Augen wanderten an die Decke. Ein feiner Schweißfilm lag auf seiner Stirn. Lena nahm ein Tuch aus dem Papierspender und tupfte ihm die Stirn ab. Der Mann ließ es geschehen.
»Danke.«
Er blickte Lena erleichtert an. »Erleichtert, nicht dankbar«, dachte Lena.
»Ich habe das Schmerzmittel für Sie.«
Sie gab ihm die Tablette und reicht ihm das Glas, das er sonst nur mit Mühe erreicht hätte.
»Jetzt blickt er dankbar«, dachte Lena.
Er nickte ihr zu.
Sie fragte: »Wie stark sind die Schmerzen?«
Er wiegte den Kopf: »Ich kann es aushalten. Aber nachts sind sie manchmal arg.« Er nahm noch einen Schluck Wasser und reichte Lena das Glas zurück.
»Wie ist das denn passiert?«, fragte Lena.
Der Mann verzog ein wenig den Mund. »Ein Unfall. Blöde Sache. Habe nicht aufgepasst.«
»Kompliziert gebrochen?« Lena war sich sicher, dass er an sie keine Erinnerung hatte, denn die Narkose hatte schnell eingesetzt, nachdem er in den OP gebracht worden war. Er konnte nicht wissen, dass sie bei der Operation dabei gewesen war.
Der Mann nickte leicht: »Ja, sieht so aus. Die Ärzte meinen, dass ich noch in die Reha muss. Ganz schön blöd.«
Lena nickte und versuchte ein Lächeln. Manchmal nutzte das, wenn sie etwas von einem anderen wissen wollte.
»Dann sind sie also länger außer Gefecht. – Schlimm?«
Der Mann lächelte etwas gequält zurück.
»Schlimm? Irgendwie schon. Ich bin Maler. Ich verdiene nur, wenn ich arbeite und verkaufe. Wenn ich nicht malen kann, kann ich auch nichts verkaufen. Also schon schlimm.«
»Was malen Sie denn?«
Der Mann lächelte jetzt entspannter. »Alles, was Sie wollen. Landschaften, Portraits, Stillleben, alles halt. Meist gegenständlich. Aber ich kann auch abstrakt.« Jetzt schien es, als grinste er leicht. Oder verzog er nur die Mundwinkel?
»Und wo haben Sie Ihr Atelier?« Lena stellte die Frage ganz ohne Hintergedanken, nur um den Gesprächsfaden nicht abreißen zu lassen. Deshalb war sie auch erstaunt, dass er sich nicht darauf beschränkte, diese Frage nicht zu beantworten, sondern das Gespräch an dieser Stelle abrupt unterbrach.
»Lassen Sie mich bitte jetzt allein. Ich möchte schlafen.« Dabei schloss er seine Augen. So schottete er sich von der Situation ab.Lena ging, schaute noch mal kurz zurück und meinte sehen zu können, wie er leicht zitterte.
*
»Ob sie auch dazugehört?« Er versuchte sich ein wenig zu bewegen. Nicht nur das Bein schmerzte. Alles tat ihm weh. »Quatsch. Sie kann nicht dazugehören. Sie wollte nur nett sein.« Er grübelte. Ärgerte sich, dass er die Unterhaltung so brüsk abgebrochen hatte. »Ob ich noch einmal nach ihr läute?« Er verbot es sich.
»Was soll ich jetzt bloß machen?« Er musste schlucken. Er spürte, wie es ihn leicht schüttelte. Die Erinnerung an das, was sie mit ihm angestellt hatten, machte ihm Angst. Es war ihm klar, was sie wollten. Aber das Geld konnte er nicht besorgen. Wenn er doch wenigstens telefonieren könnte. Er wollte gleich morgen darum bitten, ihm einen Telefonapparat ans Bett zu stellen. Er musste das mit Nina besprechen. Sie musste eine Lösung finden. Sonst würde er das nicht überleben. »Die finden mich, egal, wo ich mich verstecke«, dachte er.
»Wie bin ich bloß in diesen Schlamassel hineingeraten?« Er spulte seine Erinnerungen zurück. Auf den frühen Sommer des vergangenen Jahres.
Er war in Bruneck gewesen. Hatte abends in der »Stadtenothek« ein paar Bekannte getroffen. Künstler wie er. Teils begabt, teils unbegabt, was jedoch keinen Schluss auf ihren wirtschaftlichen Erfolg zuließ. Da war Toni, ein nur gering begabter Holzschnitzer, aber ein Verkaufstalent. Der konnte gut von seinen dilettantischen Arbeiten leben. Und da war das andere Extrem. Hugo. Extrem begabt, aber introvertiert. Der konnte was, künstlerisch – und konnte gleichzeitig verkaufstechnisch nichts. Und mit Hugo hatte er sich lange unterhalten. Er war wie eine Auster. Verschlossen. Aber eben ein Könner. Das schätze er an ihm. Irgendwann an diesem Abend war die Auster aufgegangen. Ob es am Wein gelegen hatte oder daran, dass sich Hugo geschmeichelt gefühlt hatte, wusste er nicht mehr. Jedenfalls war Hugo, nachdem er ihm ein ehrliches Kompliment über seine Kunstfertigkeit bei der naturalistischen Landschaftsdarstellung gemacht hatte, nah an ihn herangerückt. Ganz nah, so, dass die anderen nicht hören konnten, was er ihm fast ins Ohr flüsterte:
»Otmar, ich bin an einer ganz dicken Sache dran. Wenn das klappt, werden alle staunen. Ich habe einen Interessenten für meine Bilder. Der ist millionenschwer. Wenn der meine Bilder kauft, kann ich damit berühmt werden.« Seine Augen hatten dabei einen ihnen sonst fremden Glanz angenommen.
Er hatte Hugo aufmunternd angeschaut. Neugierig war er natürlich. Wen hatte der kauzige Hugo da wohl an der Angel? Jemanden, den man noch nicht kannte? War eigentlich ausgeschlossen. Denn die Kunstszene in Südtirol, im angrenzenden Österreich, aber auch im Rest der Welt war eine geschlossene Gesellschaft. Einmal drin, lief es gut. So wie bei Toni. Aber reinzukommen war schwer. Zu viele kratzten an der Eingangstür. Und nur wenige entschieden, wer rein durfte. Und vor allem, wer bleiben durfte. Es ging dabei nicht immer um Qualität.
»Also, wer ist es, Hugo, sag es mir«, hatte er gedacht. Aber bevor er etwas sagen konnte, war Hugo schon nochmals näher gekommen und kroch fast in sein Ohr. Und er hatte kaum glauben können, um was Hugo ihn bat.
»Du musst für mich die Verhandlungen führen. Ich kann das nicht. Ich kann nur malen. Aber nicht reden und verhandeln. Du musst das für mich übernehmen.« Und fast flehentlich: »Otmar, du machst das doch für mich?« Er hatte ihn dabei angeschaut, als hätte man ihn geprügelt.
Otmars Neugier war längst geweckt. Aber er wollte alles weitere ohne eventuelle Zeugen abwickeln. Deshalb nickte er Hugo zu, zwinkerte und rief die Bedienung, um für sie beide zu zahlen.
»Hey, ihr Spielverderber, wo wollt ihr denn jetzt noch hin?« Das war Toni, im Vollbesitz seiner raumgreifenden Art. »Oder behagt euch unsere Gesellschaft nicht? Die Herren Maler wollen wohl nicht mit dem Holzschnitzer zusammen feiern?« Otmar grinste. Toni nannte sich gerne den »Holzschnitzer«, weil er seine »Karriere« mit dem Holzschnitzen begonnen hatte. Dabei hatte Otmar hundert Mal mehr Ahnung vom Holz. Toni wollte auch keine Antwort von ihnen, sondern nur laut kundtun, dass er hier alle kannte und überhaupt der tollste Hecht im Teich war. Sie winkten ihm kurz zu und verschwanden in die Nacht. Sie waren dann in der frühsommerlich lauen Luft durch Bruneck spaziert. Hugo ließ sich treiben. Altstadt rauf und runter, Promenade am Rienzufer und zurück. Währenddessen erzählte Hugo alles, was Otmar wissen musste, um die Verhandlungen zu führen. Der Interessent sei ein »reicher Russe« namens Oleg. Und er habe mit ihm eine Verabredung morgen Mittag im Hotel Elephant in Brixen. Eine Uhrzeit hatte ihm der Russe nicht genannt. Nur, dass er morgen Mittag dort sein solle.