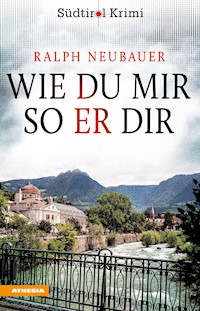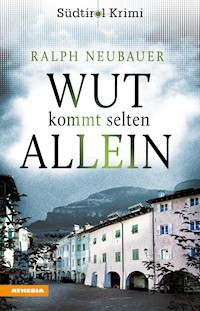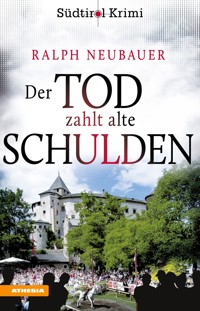Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Athesia Tappeiner Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Mehrfacher Mord in einer Bozener Villa, ein Betrugsfall, der Staub aufwirbelt, und ein scheinbar gewöhnlicher Diebstahl stehen im Mittelpunkt des kriminellen Geschehens. Es zeichnet sich ein undurchsichtiges Gefüge aus Einfluss, Macht und Manipulation ab. Das zwingt die bekannten Figuren, Entscheidungen zu treffen. Die Rollen ändern sich, jeder nimmt eine neue Position ein. Im Finale Curioso bleibt nichts so, wie es war. Das Leben ist wie ein Fluss und das Wasser findet seinen Weg, egal, wie der Untergrund beschaffen ist. Die Figuren des Krimis treiben auf der Wasseroberfläche mit dem Strom. Dieser Krimi spielt an einem fiktiven Ort in Bozen, aber vor allem an authentischen Orten im Dorf Prissian, wo die Krimiserie ihren Anfang genommen hat. Sie endet auch hier.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 523
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Für Dirk
Inhaltsverzeichnis
Sonntag
Null
Eins
Zwei
Drei
Vier
Fünf
Sechs
Sieben
Acht
Neun
Zehn
Elf
Montag
Eins
Zwei
Drei
Vier
Fünf
Sechs
Sieben
Acht
Neun
Zehn
Elf
Zwölf
Dreizehn
Vierzehn
Dienstag
Eins
Zwei
Drei
Vier
Fünf
Sechs
Sieben
Acht
Neun
Zehn
Elf
Zwölf
Dreizehn
Vierzehn
Fünfzehn
Sechzehn
Mittwoch
Eins
Zwei
Drei
Vier
Fünf
Sechs
Sieben
Acht
Neun
Zehn
Elf
Zwölf
Dreizehn
Vierzehn
Fünfzehn
Sechzehn
Siebzehn
Achtzehn
Neunzehn
Zwanzig
Einundzwanzig
Zweiundzwanzig
Dreiundzwanzig
Vierundzwanzig
Fünfundzwanzig
Sechsundzwanzig
Donnerstag
Eins
Zwei
Drei
Vier
Fünf
Sechs
Sieben
Acht
Neun
Zehn
Elf
Zwölf
Dreizehn
Vierzehn
Fünfzehn
Sechzehn
Siebzehn
Achtzehn
Neunzehn
Freitag
Eins
Zwei
Drei
Vier
Fünf
Sechs
Sieben
Acht
Neun
Zehn
Elf
Zwölf
Dreizehn
Vierzehn
Fünfzehn
Sechzehn
Siebzehn
Achtzehn
Neunzehn
Samstag
Eins
Sonntag
Eins
Zwei
Montag
Eins
Zwei
Drei
Vier
Fünf
Sechs
Sieben
Acht
Neun
Zehn
Dienstag
Eins
Zwei
Drei
Vier
Fünf
Sechs
Sieben
Acht
Neun
Zehn
Mittwoch
Eins
Zwei
Drei
Vier
Fünf
Sechs
Donnerstag
Eins
Zwei
Drei
Freitag
Eins
Zwei
Samstag
Eins
Montag
Eins
Zwei
Drei
Vier
Dienstag
Eins
Zwei
Prissian im Spätherbst
Eins
Winter
Nachwort
Sonntag
Null
Wo ist er hin? Was hat er vor? Ist er weg? Ist er unverrichteter Dinge abgehauen? Sie stellte sich diese Fragen nicht bewusst. Im Gegenteil befand sie sich nahe an einer Bewusstlosigkeit. Zu viele Schläge gegen den Kopf, zu viele Fausthiebe in die Rippen, in den Bauch, in die Nieren. Sie hatte sich übergeben, aber er hatte auch dann nicht von ihr abgelassen.
»Rück die Nummer raus!«, hatte er sie angeschrien. »Rück sie raus oder ich schneide dir die Kehle durch!«
Er hatte sie an einen Stuhl gefesselt. Bewegungsunfähig war sie. Ihr Kopf dröhnte, pochte, schmerzte.
Der Mann war reingekommen, hatte ihr keine Sekunde Zeit zum Überlegen gelassen. Sofort war er mit harten Schlägen auf sie losgegangen. Sie wusste nicht gleich, was er meinte. Aber klar, er wollte die Kombination für den Tresor. Gleich hinter ihrem Schreibtisch. Ein Überfall. Sie war allein gewesen. Niemand war da, der ihr hätte beistehen können. Es hätte dieser Brutalität nicht bedurft. Gegen den Mann hätte sie ohnehin keine Chance gehabt, sie hätte ihm den Safe geöffnet.
Eins
»Was macht Papa da?« Die Zwillinge Paula und Frieda beobachteten durch die Ritzen des Scheunentores ihren Vater, der unter dem Nussbaum saß und sich nicht rührte.
»Papa meditiert«, sagte Laurin, ihr großer Bruder.
»Was ist das, meditieren?«, fragte Paula und kicherte, weil sie das Wort lustig fand und gleich neue bildete: »Meditieren, medidieren, medidingsen, medisitzen, medimachen.« Lauter lustige Wörter, wie sie fand.
Frieda meinte: »Er sitzt doch nur rum. Warum hat er die Augen dabei zu? Schläft er vielleicht? Aber warum denn im Sitzen? Und warum unter dem Nussbaum? Wenn er müde ist, kann er doch ins Bett gehen? Aber es ist doch noch früh, wir haben noch nicht einmal gefrühstückt. Wieso ist er denn müde? Hat er eigentlich die Semmeln geholt?«
»Die habe ich schon geholt«, sagte Laurin. »Papa hat mich losgeschickt und dann hat er sich unter den Baum gesetzt.«
»Und ist dann eingeschlafen«, meinte Frieda. »Ts, ts, ts, was Mama dazu sagen wird?«
»Er schläft nicht, er meditiert. Hab ich euch doch schon gesagt. Er übt das. Nehm ich an. Er geht doch mit Mama einmal die Woche zu einer Frau in Kaltern. Das üben sie dort. Yoga nennt er das. Mama macht das schon länger. Papa muss das noch üben.«
»Man sitzt da nur so rum? Mit den Augen zu? Was soll das?« Paula wurde neugierig.
»Ich glaube, dass es … « Laurin wusste es nicht, weil es ihn bisher nicht interessiert hatte, was meditieren ist. »Ich glaube, dass er sich ausruht. Einfach eine Weile nichts tun. Ist wohl nicht so leicht. Muss man üben.«
»Au ja! Das kann ich auch. Nichts tun.« Paula setzte sich in den Schneidersitz und schloss die Augen. Es dauerte nicht lange und ihre Mundwinkel zogen sich nach oben. Sie hatte Mühe, ein Kichern zu unterdrücken.
»Du kannst das nicht«, meinte Frieda. »Still sitzen konntest du noch nie.«
»Selber nicht«, konterte Paula und kicherte jetzt laut.
Laurin betrachtete seine Schwestern. Die beiden hatten seit jeher ihren Spaß daran, einander zu überbieten, einander nachzueifern, sich miteinander zu messen. Er überlegte, ob er ihnen erzählen sollte, dass er gehört hatte, wie Mama und Papa gemeinsam einer CD gelauscht hatten. Von dieser CD kam eine Stimme, die ihnen erklärte, wie man atmen solle. Also wie lange man einatmen, wie lange man die Luft anhalten und wie lange man ausatmen solle. Die Stimme sagte: »Jetzt atme ein und zähle bis fünf. Halte die Luft an und zähle bis acht, dann atme langsam aus und zähle bis zwölf. Jetzt atme wieder ein und zähle bis fünf.« So ging das eine Weile. Laurin hatte beobachtet, wie sie sich dabei abwechselnd das eine, dann das andere Nasenloch zugehalten hatten. Er fand das lustig, seine Eltern so dasitzen zu sehen. Ob er seinen Schwestern sagen könnte, dass sie fünf Sekunden einatmen, dann acht Sekunden die Luft anhalten und anschließend zwölf Sekunden ausatmen sollten? Wäre das ein Spaß? Nein. Nicht mit diesen beiden Kichererbsen. Inzwischen hatte sich Frieda hingesetzt, ihre Augen geschlossen und angefangen zu kichern. Laurin spähte wieder durch die Ritze des Scheunentores. Sein Vater saß nicht mehr unter dem Baum.
Er stand vor dem Scheunentor und blinzelte seinerseits durch die Ritze in die Scheune hinein. Ihre Blicke trafen sich. Sein Papa raunte: »Hast du Semmeln geholt?«
Laurin nickte. »Dann ab in die Stube, frühstücken!« Fabio grinste. Er hatte das Kichern seiner Töchter laut und deutlich vernommen. Das Sich-Versenken, der Versuch, die Gedanken loszulassen, schärfte auch die Sinne, kam ihm vor. Außerdem hatte er das Gefühl gehabt, dass hinter seinem Rücken Bewegung war. Da setzten auch schon die Gedanken wieder ein und er kombinierte schnell, wer wohl die Verursacher sein konnten. Ist schon genial, wie viel man wahrnimmt, wenn man die Gedanken ruhen lässt. Hätte ich nicht gedacht. Aber Lissy hat damit wohl recht.
Zwei
Eduard hatte Bereitschaftsdienst. An den Sonntagen war selten viel los, aber es kam vor, dass Bürger die Questura aufsuchten, um eine Anzeige zu machen oder um sich anderweitig zu äußern. Es war auch die Zeit der Querulanten, der nach Gerechtigkeit Suchenden, der ertappten, aber uneinsichtigen Falschparker, die meinten, ihre Sicht der Dinge ausgerechnet an einem Sonntag einer Amtsperson vortragen zu müssen. In neun von zehn Fällen war die Questura dafür ohnehin nicht die richtige Anlaufstelle. Das musste der Diensthabende, heute Eduard, geduldig den Frage- oder Antragstellern erklären. Und zwar so, dass sie sich nicht abgewiesen, sondern mit ihrem Anliegen ernst genommen fühlten, auch dann, wenn man ihnen nicht im Entferntesten helfen konnte. Solche Wochenenddienste kamen zum Glück nicht allzu häufig vor.
Eduard hatte heute sogar einen interessanten Fall. Obwohl? So interessant auch wieder nicht, wenn er es recht bedachte. Wie dumm doch die Leute manchmal waren. Oder wie sehr auf ihren Vorteil bedacht. Vielleicht auch nur zu gierig. Mitleid hatte er jedenfalls keines. Der Typ kam aus Köln und sagte, er sei wegen einer Uhrenauktion in Bozen, da er Sammler wäre. Paul Ehrlich hieß er, vielleicht knapp 30. Vielleicht auch jünger. Er berichtete, dass er im Hotel Laurin logiere. Gestern, am Samstagmorgen, als er sein Frühstück auf der Terrasse des Hotels einnahm, sprach ihn ein Mann vom Nebentisch an, der Eindruck auf ihn gemacht habe. Auf dem Stuhl neben ihm habe eine Louis-Vuitton-Tasche gestanden − mindestens 5.000 Euro teuer. Der Mann sei sportlich und chic gekleidet gewesen, akkurater Bartschnitt, am Handgelenk eine dicke goldene Uhr, die nicht zu übersehen war. Der Mann habe ihn in ein Gespräch verwickelt und natürlich schnell erfahren, dass er wegen der Uhrenauktion in Bozen war. Im Laufe des Gesprächs habe sein Tischnachbar ihm von seinen Problemen erzählt. Dass er auch wegen der Auktion hier war, daran aber nicht mehr teilnehmen konnte wegen eines Notrufs seiner Familie aus der Heimat, sein Vater liege im Sterben. Dass er nur noch eine komplizierte Flugverbindung bekommen habe, Bozen – Düsseldorf, dann Istanbul, von da in die Emirate. Und dass er zwei wertvolle Uhren dabeihabe, die er eigentlich bei der Auktion verkaufen wollte. Weil ihm aber eine Tasche mit den Frachtpapieren gestohlen worden war, mit denen er nachweisen konnte, dass diese Uhren versteuert worden waren, befürchte er, dass er bei den Kontrollen an den verschiedenen Flughäfen die Uhren erneut versteuern müsse, was sehr teuer sei − ein Dilemma.
Neugierig geworden, habe er, Paul Ehrlich, nachgefragt, um welche Uhren es sich denn handle, woraufhin der Mann aus seiner Tasche zwei Originalverpackungen einer Rolex und einer Audemars Piguet gezogen habe. Dieser Anblick habe ihn begeistert. Der Mann hingegen schien ihm sichtlich mitgenommen zu sein, vor allem wegen des bevorstehenden Ablebens seines Vaters, dann wegen der komplizierten Heimreise, wegen der langen Flugdauer und schließlich auch wegen der Angst vor dem Zoll. Er habe noch gesagt, sie würden ihm die Uhren wegnehmen, wenn er nicht nachweisen könne, dass er sie ordnungsgemäß gemeldet habe, und Ersatzpapiere seien in der Kürze der Zeit nicht zu beschaffen und das Risiko beim Versuch, die Uhren durch den Zoll zu schmuggeln, sei hoch. Falls die Uhren entdeckt würden, könne es sein, dass sie ihn festhalten, er den Anschlussflug verpassen und sein Vater sterben würde, ohne dass er sich von ihm verabschieden könne.
Paul Ehrlich hatte offenbar Mitleid mit dem Mann gehabt, aber dabei auch, so stellte es sich Eduard vor, ein begehrliches Funkeln in seinen Augen. Denn seinem Bericht zufolge fragte er den Mann, was dieser für die Uhren verlangen würde. Daraufhin war der Mann in Tränen ausgebrochen und dankte ihm überschwänglich, dass er ihm aus der Notlage helfen wolle. Schließlich hätten sie sich auf 1.000 Euro pro Uhr geeinigt, was ein schier unglaublicher Schnäppchenpreis für diese Uhren gewesen wäre, wenn, ja wenn sie denn echt gewesen wären. Denn heute, am Tag der Auktion, habe er die Uhren einem Experten gezeigt. Der habe nur gelacht und gemeint, dass er auf einen Betrug hereingefallen sei. Die Verpackungen schienen echt zu sein, oder zumindest gut gefälscht, aber die Uhren waren wohl Schrott, keine 100 Euro wert. Alles Fake. Alles billiger Nachbau. Erkenne jeder, der etwas von Uhren verstehe. Das habe ihn doch sehr verletzt, da ihm bescheinigt wurde, dass er keine Ahnung habe, obwohl er von sich dachte, dass er sich mit teuren Uhren auskenne. Dieser Paul Ehrlich hatte dann noch eine Beschreibung des Mannes abgegeben, Eduard hatte alles aufgenommen und eine Akte angelegt. Ob er den Mann noch mal gesehen hätte, hatte Eduard Paul Ehrlich gefragt. Dieser hatte geantwortet: »Nein. Der Mann hat das Geld genommen und dann hatte er es auch schon eilig, weil sein Flugzeug in einer Stunde fliegen würde.« Paul Ehrlich hatte erst heute, als er von dem Betrug erfuhr, nachgesehen, ob am Samstag eine Maschine von Bozen nach Düsseldorf gegangen war. Auch das war gelogen.
Eduard sinnierte über die Techniken und Taktiken des Betrugs. Mitten in seine Gedanken schrillte das Telefon. Es war die Zentrale, und was sie Eduard mitteilte, ließ ihn schlagartig alles vergessen, was zuvor noch sein Hirn umwölkt hatte. Er notierte schnell, legte auf und wählte danach Francescas Nummer.
Drei
Nur zehn Minuten später stoppte er sein Auto vor einer großen, prächtigen Villa im Bozner Norden. Francesca würde länger brauchen, das wusste er. Neben Eduard waren weitere Einsatzkräfte der Questura vor Ort und sperrten die Zufahrt zur Villa ab. Einer seiner Kollegen nahm ihn in Empfang und führte ihn über eine repräsentative Treppenanlage in die Eingangshalle der Villa.
»Wir haben eine Leiche. Übel zugerichtet. Die Zeugin, die die Leiche gefunden hat, sitzt draußen im Mannschaftsbus. Ihr geht es nicht gut. Schock. Kann man verstehen, wenn man die Leiche sieht. Wahrscheinlich Raubüberfall. Es steht ein Tresor offen. Mehr wissen wir noch nicht.«
Während des kurzen Gesprächs hatten sie die Eingangshalle durchquert und näherten sich einem Zimmer, dessen Tür weit offen stand. Als Eduard hineinblicken konnte, musste er schlucken.
Eine Frau saß in einem Stuhl. Ihre Hände waren an die Armlehnen, ihre Beine an die Stuhlbeine gefesselt. Ihr Kopf war leicht nach hinten überstreckt, ihre Kehle durchgeschnitten. Ein kleiderschrankgroßer Tresor befand sich hinter der Frau, die schwere Tür geöffnet, alle Fächer waren leer.
»Spurensicherung? Dr. Phillipi?«, fragte Eduard.
»Ist informiert.«
»Habt ihr schon woanders nachgesehen? Oben? Unten? Wohnt hier jemand? Gibt es weitere Opfer?«
»Wir haben bisher nur die Einfahrt abgesichert.«
»Na, dann los. Schauen wir uns um. Hier können wir nicht mehr helfen.« Eduard musste einen Brechreiz unterdrücken. Das hatte er noch nicht erlebt, dass ihm bei so etwas schlecht wurde. Vielleicht lag es auch am Geruch nach Erbrochenem, denn es gab eine große Pfütze davon auf dem Boden.
Eduard und der Kollege sahen sich in der großen Eingangshalle um. Ein Raum mit hoher Decke. Gegenüber dem mit viel Zierrat versehenen Eingangsportal befand sich ein Treppenaufgang, der sich nach einigen mittigen Stufen nach links und rechts teilte und zur ersten Etage führte. In den Handläufen des Aufgangs spiegelte sich der Zierrat des Eingangsportals. Alles aus einem Guss. Alles vornehm und edel anmutend. Ein wenig wie aus der Zeit gefallen.
»Sie übernehmen die Zimmer rechts und links der Halle, ich gehe nach oben«, befahl Eduard. In dem Moment trat Francesca durch das Eingangsportal. Eduard musste sie niemandem vorstellen. Alle Polizisten kannten Commissaria Francesca Giardi. Eduard zeigte ihr kurz das Opfer und ging mit ihr Richtung Aufgang.
»Bist du geflogen?«, versuchte Eduard die Situation zu überspielen.
»War in der Nähe«, kam es knapp zurück.
Eduard spürte, wie der Anblick der Leiche auch Francesca angegriffen hatte. Trotz ihrer Professionalität.
Francesca ließ ihre Blicke schweifen. »Ganz schön nobel hier«, murmelte sie. Eduard nickte zustimmend, während sie die Treppe nach oben nahmen. Er war kein Experte, aber ihm schien, dass diese Villa aus dem 19. Jahrhundert stammen musste. Einer Zeit, in der es aufwärtsging, und vermögende Industrielle Villen in diesem Stil bauen ließen.
»Schau, hier«, Francesca deutete auf den Boden, auf dem sich dunkle Streifen entlangzogen – was auffiel, weil diese hellen Marmorböden ansonsten makellos waren und perfekt gepflegt. Sie folgten den Schleifspuren, die zu einer Tür führten. Die Tür war nicht verschlossen und hinter ihr lag eine weitere Frau. Offensichtlich tot. Ihre Gesichtszüge verzerrt, die Zunge hing heraus, die Haut war bläulich und eine dicke Kordel um ihren Hals geschlungen. Die Schleifspuren stammten von den Absätzen ihrer schwarzen Schuhe.
Eduard prüfte mit einem Griff an die Halsschlagader, ob er ein Pulsieren spüren konnte, und fühlte die Haut.
»Noch warm«. Dann ein lauter Ruf von unten: »Hier ist was, kommen sie. Schnell. Eine weitere Tote!«
Eduard und Francesca liefen nach unten, folgten den Rufen. Sie kamen aus dem Bereich hinter dem großen Treppenaufgang. Der Raum, den sie betraten, war die Küche. Eine richtig große Küche. Auf dem mittig stehenden Herd lag eine Frau. Ihr Körper war von Blut bedeckt, alle Kleidungsstücke waren vollgesogen, das Blut auf der Herdoberfläche sah noch frisch aus und so roch es auch. Wie schon bei der Frau oben, kam auch hier jede Hilfe zu spät.
»Mein Gott, was ist hier passiert? Wer tut so was?« Der junge Polizist, der bisher nur Streife gefahren war, hatte noch nie zuvor einen solchen Tatort gesehen. Sein Gesicht war kreidebleich.
Francesca und Eduard schauten sich an. »Los, weiter! Das ganze Haus muss abgesucht werden − jedes Zimmer.« Francesca nickte dem jungen Kollegen zu: »Sie machen uns jetzt nicht schlapp, oder?« Und als er den Kopf hob, fügte sie hinzu: »Sie suchen jetzt bitte die anderen Zimmer auf dieser Ebene ab, und wir beide«, sie deutete auf Eduard, »machen oben weiter. Dort liegt auch eine Tote. Erdrosselt, wie es aussieht.« Sie nickte aufmunternd und nahm Eduard mit.
»Das war ein Gemetzel. So etwas habe ich noch nie gesehen. Komm! Nicht, dass wir noch mehr Tote finden.« Sie liefen die Treppe hoch, gingen systematisch von Zimmer zu Zimmer, Francesca auf der einen, Eduard auf der anderen Seite des langen Flurs. Für die aufwendige Gestaltung des Flurs und die Einrichtung der einzelnen Zimmer hatten sie vorerst keinen Blick. Aber es fiel ihnen auf, dass die Zimmer nur wenige Möbel enthielten und dass die Betten jeweils den meisten Platz einnahmen.
»Hier ist nichts mehr. Alle Zimmer sind leer.« Francesca fragte Eduard, ob er gesehen habe, ob es irgendwo noch weiter nach oben ging. Eduard verneinte. »Nichts gesehen, müssen wir noch genauer überprüfen. Soll ich?«
»Nein, wir gehen jetzt nach unten, suchen im Keller weiter.«
Der junge Kollege kam ihnen entgegen: »Nichts, unten war nichts mehr. Alle Zimmer sind leer. Aber es gibt im Erdgeschoss eine grandiose Bar. Superedel. So stelle ich mir einen englischen Herrenclub vor, obwohl ich noch nie einen von innen gesehen habe.«
»Schauen wir uns gleich an. Aber zuerst müssen wir prüfen, ob es noch weitere Räume gibt.«
»Es gibt eine Tür neben der Küche, sie könnte in einen Keller führen.«
»Dann los.«
Die Tür war nicht verschlossen, stand sogar leicht offen. Ab hier roch es modrig, die Wände dünsteten aus, was die Steine in mehr als 100 Jahren an Gerüchen in sich aufgenommen hatten, gemischt mit einer Feuchtigkeit, die aus dem Erdreich in das alte, nicht isolierte Gemäuer eingedrungen war. Licht gab es. Eduard und Francesca sahen einen langen Gang, von dem rechts und links weitere Gänge abzweigten. In jedem der Seitengänge sahen sie Türen. Keine war verschlossen. Es gab Vorratskammern für die Küche mit Regalen und Gefriertruhen. Es gab Weinkeller, sogar mehrere und recht große.
Eduard pfiff anerkennend, als er zufällig auf eines der Etiketten blickte. »Au Mann, das sind echt edle und teure Tropfen, die hier lagern. Schau mal, eine ganze Lage Sassicaia. Das ist ein Kultwein, richtig berühmt ist der. Den gibt es nur an ausgewählten Orten, in besonderen Hotels und Sterneküchen.«
»Bist du jetzt ein Weinkenner?« Francesca wusste nichts damit anzufangen, was Eduard gesagt hatte.
»Ich meine nur, dass diese Weinkeller einen Hinweis darauf geben, was hier in dieser Villa abgeht.«
Francesca verstand, was Eduard meinte. Es formte sich ein Bild. Oben nur Schlafzimmer, unten eine Bar im Stil eines englischen Herrenclubs, im Keller teure Weine. Diese Villa wurde interessant. Offensichtlich kein Wohnhaus für eine Familie. Sowohl die erstochene als auch die erdrosselte Frau waren blutjung. Die Frau, der man die Kehle durchgeschnitten hatte, durfte in ihren 50ern gewesen sein.
»Lass uns weitersuchen, los.«
Sie öffneten alle Räume und hinter der letzten Tür fanden sie eine weitere blutjunge Frau. Sie lag regungslos auf dem Rücken, die Augen starrten ins Leere. Sie trug ein schickes Abendkleid. Der Rock war hochgerutscht und zeigte ihre makellosen Beine. Am Hals, seitlich-vorn, waren deutliche Spuren von Daumenabdrücken zu sehen. Eduard fühlte ihren Puls und schüttelte leicht den Kopf, als er sich erhob. »Auch noch warm.«
Sie fanden keine weiteren Leichen. Inzwischen war die Spurensicherung mit Dr. Phillipi eingetroffen, und sie hatten sich an die Arbeit gemacht. Francesca traf auf ihn, als sie aus dem Keller kam, und informierte ihn über das, was sie bisher gesehen hatten.
»Vier Frauenleichen, Doktor. Eine oben, eine im Keller, zwei hier im Erdgeschoss. Hier muss etwas passiert sein, das man nur als Raserei bezeichnen kann. Eine wurde erdrosselt, eine erwürgt, eine erstochen, einer wurde die Kehle durchtrennt. So einen Tatort habe ich noch nie gesehen. Ich lasse Sie jetzt ihre Arbeit machen. Draußen im Mannschaftsbus sitzt die Zeugin, die uns gerufen hat. Ich werde sie jetzt vernehmen. Doktor, für uns wäre es fürs Erste wichtig zu wissen, wann das alles passiert ist.«
Dr. Philippi nickte nur und dachte: Schon klar, Commissaria. Das Gutachten am besten schon vorgestern auf Ihren Schreibtisch.
Vier
»Mama, was ist meditatieren?« Paula war neugierig. »Machst du das auch, oder nur der Papa, wenn er unter dem Nussbaum sitzt?«
»Es heißt meditieren«, Fabio musste schmunzeln. »Man kann es überall machen. Man braucht keinen Nussbaum dazu. Im Sitzen geht es am besten. Es geht aber auch im Liegen, im Stehen, sogar beim Gehen. Aber das ist schwierig.«
Paula kräuselte ihre Nase. »Beim G-e-h-e-n? Aber du hast doch die Augen zu. Das ist doch blöd, beim Gehen, da fällt man hin, oder etwa nicht? Mir sagt ihr immer, ›Augen auf, schau wohin du läufst‹, und das soll für euch nicht gelten?«
»Beim Gehen sollte man die Augen nicht geschlossen haben. Meditation ist eine Art Gedankenentspannung. Man lässt die Gedanken los. Man denkt an nichts. Das ist nicht so einfach, wie es sich anhört. Das muss man üben.«
»Hä? Man lässt seine Gedanken los? Wie soll das denn gehen?«, Frieda war auch neugierig.
»Das ist ein bisschen so, als ließest du einen Luftballon fliegen«, sagte Fabio. »Jedenfalls kommt es mir manchmal so vor. Du lässt ihn fliegen, schaust ihm eine Weile hinterher und irgendwann ist er aus deinem Blickfeld verschwunden. Dann ist da nichts mehr, nur noch das Nichts.«
»Das Nichts?« Laurin schaute seinen Papa interessiert an. »Aber das Nichts ist doch nicht nichts. Wenn es ein Nichts gibt, dann ist da doch was.«
»Oh, jetzt wird es schwierig. Was ist das Nichts? Eine schwierige Frage. Auf die habe ich, ganz ehrlich, keine passende Antwort. Ich bin froh, wenn es mir gelingt, meine Gedanken anzuhalten. Das ist schwer genug.«
»Wieso anhalten?« Paula ließ nicht locker. »Wie soll das denn gehen? A-n-h-a-l-t-e-n? Die sitzen doch nicht in einem Auto, die Gedanken. Oder bewegen die sich?«
»So könnte man es sagen. Sie sitzen in einer Art Karussell, würde ich meinen. Dem Gedankenkarussell. Es ist unglaublich schwierig, dieses anzuhalten. Es dreht sich ohne Unterlass. Morgens, wenn ich aufwache, denke ich schon darüber nach, was ich alles an diesem Tag zu erledigen habe. Dann denke ich, was es zum Frühstück geben wird, ich denke darüber nach, was ich anziehen soll, wie das Wetter sein wird, denn vom Wetter hängt es ab, welche Schuhe ich wähle und je nachdem, welche Schuhe ich wähle, denke ich darüber nach, welcher Anzug zu den gewählten Schuhen passt. So geht es weiter, den ganzen Tag lang. Ein Gedanke kommt nach dem anderen. Das passiert automatisch. Der Kopf ist voll von Gedanken: einfachen Gedanken, komplizierten Gedanken, ganzen Gedankengirlanden, dann wieder nur einem einzelnen Gedanken. Das alles ist uns nicht bewusst. Es läuft wie ein Grundrauschen im Hintergrund. Ist auch nicht schlimm. Es ist normal. Beim Yoga üben wir, dieses Karussell anzuhalten. Das ist dann entspannend. So, wie man seine Muskeln entspannen sollte, wenn man viel Sport getrieben hat. Die wollen danach ihre Ruhe haben. Für eine kurze Zeit. So wie die Gedanken auch. Wenn ich den ganzen Tag denken muss, bin ich froh, wenn ich meinen Kopf endlich entspannen kann. Habe ich das verständlich erklärt?«
Alle drei Kinder hatten gut zugehört. Sie dachten nach. Dann sagte Laurin: »Ja, ich denke jetzt darüber nach, was du uns erklärt hast. Das sind ja diese Gedanken. Gleichzeitig denke ich darüber nach, was ich nach dem Frühstück spielen will. Denn heute ist Sonntag und ich muss nicht in die Schule. Aber wenn ich ›Schule‹ denke, denke ich auch an die Hausaufgaben, die ich noch nicht gemacht habe, und das macht mir schlechte Laune. Bei schlechter Laune denke ich an ›Semmeln mit Honig‹, denn die machen mir gute Laune. Das alles denke ich gleichzeitig.«
»Ein gutes Beispiel. Das ist so ein Gedankenkarussell. Wenn du es anhalten willst, empfehle ich dir, eine entspannte Sitzposition einzunehmen, die Augen zu schließen und nur deinen Atem zu beobachten. Wie die Luft einströmt, wie sie wieder hinausfließt. Mit ein bisschen Übung wird es dir sicher gelingen, das Karussell anzuhalten.«
»Mmh. Wenn ich nicht mehr an die Hausaufgaben denke, habe ich auch keine schlechte Laune mehr, richtig?«
»Richtig. Der Gedanke verweht.«
»Wie ein Luftballon«, krähte Paula, die das Prinzip verstanden hatte. »Wie ein Luftballon«, rief auch Frieda und beide tollten davon.
Da klingelte Fabio Fameos Handy. Er blickte kurz darauf und sah, dass Francesca anrief. »Das verspricht nichts Gutes.«
Fünf
Francesca informierte Fabio über die Anzahl der Toten, die Art, wie sie zu Tode gekommen waren, soweit sie das ohne Bericht von Phillipi schon einschätzen konnte, und darüber, was die Zeugin ihr berichtet hatte.
Diese sei am Nachmittag in die Villa gekommen, in der sie wohne. Sie habe durch die geöffnete Tür des Büros die ermordete Verwalterin der Villa gesehen und daraufhin sofort das Haus verlassen, weil sie Angst gehabt habe, der Mörder sei noch im Haus. Sie sei auf die Straße gelaufen und habe einen Streifenwagen angehalten, der in diesem Moment durch die Allee gefahren sei.
»Die Frau steht unter Schock. Ich habe veranlasst, dass man sie ins Krankenhaus bringt.« Damit schloss Francesca ihren Bericht.
»Phillipi ist noch in der Villa?«
»Ja, er wird viel zu tun haben. Wir haben vier Leichen.«
»Danke für die Information. Sollte ich mir das selbst ansehen? Ich wäre in 40 bis 50 Minuten vor Ort.«
»Ist die dickste Sache, die wir je hatten. Ich würde sagen, komm vorbei und mach dir ein Bild.«
Als Fabio den Knopf mit dem roten Hörersymbol drückte, schaute er Elisabeth an.
Seine Frau wusste, was dieser Blick zu bedeuten hatte.
Sechs
Tommaso war guter Laune. Es war ein schöner Sonntag. Die Vögel zwitscherten, die Frühlingsluft war mild. Anna bereitete das Abendessen vor. Es würde ein Ochsenschwanzragout geben und dazu hatte sie ein neues Gericht mit Steinpilzen versprochen, das sie ausprobieren wollte. »Geh ein bisschen spazieren«, hatte sie ihm zugerufen. »Ich kann dich nicht in meiner Küche brauchen.«
Das war nicht böse gemeint. Er verstand das. Zwei gleichzeitig in der Küche, nun, sie hatten es probiert. Es funktionierte nicht. Immer stand er Anna im Weg oder umgekehrt. Seit Tommaso in Pension war, hatte er sich einbringen wollen, auch in der Küchenarbeit. Es machte ihm Spaß, zu schnibbeln, zu brutzeln, Schmackhaftes auf den Tisch zu bringen. Oft gelang das auch. Allerdings war es leicht, zuzugeben, dass Annas Kochkünste die seinen bei Weitem übertrafen. Sie war geübt, erfahren, machte keine Fehler mehr. Er hingegen schon, aber das war egal. Schließlich lernte er dazu, wurde besser, und Anna unterstützte ihn auch, wenngleich Tommaso den Eindruck hatte, dass sie ihn dabei ein wenig fernsteuerte. So fand er sich öfter im Garten wieder, von Anna leise gedrängt. Befohlen wäre zu hart ausgedrückt. Aber ja, sie gab schon die Richtung vor. Sie organisierte ihren Mann, so kam es ihm vor. Ist vielleicht auch besser so, dachte Tommaso. Dann gibt es keinen Streit. Schließlich war Anna zu Hause die Chefin, all die Jahre, in denen er als Carabiniere im Dienst stand. In ihrem Revier aufzutauchen war schon heikel. Eine Katastrophe wäre es gewesen, hätte er das Kommando übernehmen wollen. Das war Tommaso bewusst und er bot daher zunächst nur kleine Dienste an. Schaute, was sie zulassen konnte.
Anna hatte Tommasos Bemühungen mit einem Schmunzeln akzeptiert und ihm dabei geholfen, sich in seine neue Rolle zu fügen. Sie hatte ohnehin einen Plan. Männer brauchen Beschäftigung, ein Tun, das ihnen Spaß macht, eine Aufgabe, die sie fordert, und sie brauchen auch einen guten Freund, mit dem sie sich austauschen können. Mindestens einen. Sie hatte sich mit einer alten Bekannten – ja, man könnte sagen, Freundin – verbündet. Deren Mann, Claudio, war ebenfalls Carabiniere und gleichzeitig mit Tommaso in Pension gegangen. Annas Freundin Magdalena hatte die Befürchtung, dass Männer sich gehen lassen würden, wenn sie keine Aufgabe mehr hatten. Sie hatte Angst, dass sie nur noch in alten Klamotten herumlaufen, sich nicht mehr pflegen und an allem herummeckern würden. Solche Ängste hatte Anna nicht, und sie konnte Magdalena überzeugen, dass es mit ihren Männern nicht so weit kommen würde.
Magdalena und Anna hatten daher für ihre Männer beschlossen, dass diese regelmäßig Zeit miteinander zu verbringen hatten. Sie trafen sich zum Wandern, besuchten gemeinsam mit ihren Frauen die Aufführungen der Freilichtbühnen, hatten Spaß miteinander.
Tommaso hatte durch Zufall Anschluss an die Musikkapelle Tisens gefunden, weil deren Paukist sich einen Arm gebrochen hatte und der Obmann Tommaso gefragt hatte, ob er aushelfen könne, bis der Arm des Paukisten geheilt sei.
Anna hatte den Eindruck, dass es ihrem Mann ganz gut gefiel, in der Gemeinschaft der Musikanten mitmachen zu können. Er erzählte ganz begeistert von den Proben, von dem Miteinander. Aber er meinte auch, dass er mit dem Orchester nicht mithalten könne. Die Pauke sei ein schwieriges Instrument. So ganz ohne Erfahrung könne man sie nicht spielen, sodass er den Eindruck gewonnen habe, dass man die Stücke wegen ihm ein wenig umgeschrieben hatte. Er müsse nur auf ein Zeichen des Dirigenten hin kurz auf die Pauke schlagen, genau so wie der Kollege mit der großen Trommel, hatte man ihn angewiesen. Bei YouTube habe er sich einige Stücke angesehen, in denen die Pauke eine Rolle spielt. Mein Gott, habe er gedacht, was der Paukist alles können muss. Er selbst könne höchstens kurz auf das Fell schlagen, um einen Ton zu erzeugen, mehr eben nicht. Er bezweifele daher, ob das für ihn das Richtige sei. Aber die Gemeinschaft, die habe ihm gut gefallen.
Jedenfalls bummelte Tommaso an diesem Sonntagnachmittag in Vorfreude auf das Abendessen durch die Apfelplantagen von Tisens, genoss die Ruhe, die gut riechende Frühlingsluft, traf bekannte Gesichter. Grüßte, sprach ein paar Worte, fühlte sich wohl in seiner Haut. Es waren einige Apfelbauern unterwegs und inspizierten die Baumreihen. Wie oft schaut sich der Bauer wohl jeden Baum an, fragte er sich. Was da für eine Arbeit dahintersteckt, bis der Apfel geerntet wird. Die Bäume standen kurz vor ihrer Blüte. Bald würde das ganze Tal rosa-weiß leuchten und ein feiner Duft die Luft durchziehen. Wenn Frost und Hagelschlag kein Unheil anrichteten, konnte man zusehen, wie die Äpfel wuchsen, dicker wurden. Ab August konnte die Ernte beginnen. Zuerst die frühen Sorten. Dann zog es sich bis Ende Oktober, Anfang November, bis die späten Sorten von den Bäumen geholt werden konnten. Die ganze Zeit über musste das Wetter mitspielen.
Ein Zuruf aus einer der Baumreihen stoppte seine Gedanken. »Hallo Tommaso, warte bitte.« Hinter dem Hagelnetz konnte Tommaso eine Bewegung wahrnehmen und er erkannte den Obmann der Musikkapelle. Ein Obstbauer, wie so viele in dieser Gegend.
»Wie sehen die Knospen aus?«, fragte Tommaso. »Bist du zufrieden?«
»Ja, schon. Bisher keine Frostschäden. Die Frostberegnung für die Blüten ist eingerichtet und ausprobiert. Sie hat funktioniert. Jetzt könnten wir mehr Sonne brauchen. Aber das wird schon. Ist immer schön, ins neue Jahr zu starten.«
»Das ist gut zu hören, freut mich für dich.«
Der Obmann wurde ernst. Tommaso konnte es an seiner Mimik ablesen.
»Du, ich wollte schon länger mit dir reden. Schau, es ist so …«
Der Obmann druckste ein wenig herum, kam es Tommaso vor. Er ahnte, was kommen würde.
»Unser Paukist ist wiederhergestellt«, platzte es aus dem Mann heraus. »Es war toll, dass du ihn ersetzt hast, als sein Arm gebrochen war.« Dann verstummte er. Es war ihm unangenehm.
Tommaso wollte es ihm leicht machen: »Ich verstehe das schon. Ihr seid froh, euren Paukisten wieder unter euch zu haben. Das ist doch klar. Ich war nur eine Aushilfe. Mir ist bewusst, dass ich einen gelernten Paukisten nicht ersetzen kann. Ich habe nie ein Instrument gelernt. Aber es hat mir viel Freude gemacht, euch kennenzulernen. Eine Musikkapelle ist eine besondere Vereinigung, das habe ich gespürt. Also vielen Dank, dass ich reinschnuppern konnte.«
Der Obmann wirkte sichtlich erleichtert. »Danke, dass du es mir so leicht machst. Es war damals von mir nicht gut durchdacht, als ich dich angesprochen habe. Ich stand so unter Druck, und als ich dich sah, dachte ich nur, dass du dich hinter der Pauke gut machen würdest, was auch so war. Aber es war für dich schon eine arge Zumutung, denn die Pauke ist nicht so leicht zu spielen. Die anderen mögen dich, wirklich, du hast da Freunde gewonnen, aber es ist halt so …« Er holte Luft. »Es ist halt so, dass das Niveau der Kapelle inzwischen so hoch ist, dass ein Laie wie du es bist … also bitte, nicht böse gemeint, das verstehst du doch? Also ein Laie stoppt quasi die Entwicklung. Es ist so, als würdest du in einem Staffellauf mit vier Läufern einen Spitzenathleten durch einen Jogger ersetzen. Die Staffel kann so nicht gewinnen. Niemals. Ach, bitte, Tommaso, das war jetzt vielleicht ein blödes Beispiel, aber ich meine es nicht böse. Du bist ein prima Kerl, alle mögen dich, aber …«
»Aber es geht halt nicht«, ergänzte Tommaso. »Das verstehe ich doch. Habe ich schnell verstanden. Ich bedauere jetzt, dass ich nie ein Instrument gelernt habe. Denn die Begeisterung, mit der bei euch gespielt wird, hat mich mitgerissen. Meinst du, ich könnte das aufholen? Wenn ich Unterricht nehmen würde?«
Der Obmann klopfte Tommaso auf die Schultern. »Du bist mir also nicht böse?«
»Nein, nein, keinesfalls. Mir ist schon klar, dass ich jetzt raus bin. Ist schade, aber ich kann das verstehen.«
»Zu deiner Frage. Die jungen Musikanten in der Kapelle haben meist neben der Schule die Musikschule besucht und werden dort mit ihrem Instrument gründlich vertraut gemacht. Sie üben fleißig und vor allem regelmäßig und erreichen über Jahre des Übens ein solides Niveau, das sie in die Jugendkapelle, und später, wenn sie das Leistungsabzeichen in Bronze erworben haben, in die Kapelle bringt. Bronze ist meistens die Basis, um in einer Kapelle mitspielen zu dürfen. Danach gibt es noch die Leistungsabzeichen Silber und Gold, also nach oben ist noch Luft. Bis du ein solches Niveau erreichen wirst, kann es viele Jahre dauern, außer, du bist ein Naturtalent. Deshalb würde ich dir raten, es zu versuchen, wenn es dir Freude bereitet. Such dir ein Instrument, das dir gefällt, und besuche eine unserer Musikschulen. Dann wirst du sehen, wie schnell du weiterkommst. Um es mit dem Bild zu sagen, das ich eben strapaziert habe: Auch ein Jogger ist vielleicht ein guter Athlet, er weiß es nur nicht, bis er sich ins strenge Training begibt.«
Tommaso setzte seinen Weg fort, aber seine Gedanken waren umwölkt. Musste ja so kommen. Wie konnte ich auch nur annehmen, dass ich als Dilettant einfach so in der Tisner Kapelle mitspielen könnte. Ihm war bewusst, dass er dort auf bestens ausgebildete Musikanten getroffen war. Schon bei den Proben hatte er ihre Blicke bemerkt, wenn er sich hinter die Pauke gestellt hatte. Hätten diese Blicke sprechen können, dann wohl etwas wie: »Ach je« oder »Wenn das mal gut geht« oder »Wenn der uns mal nicht den Einsatz vermasselt«.
Menschlich war alles bestens, die Musikanten waren eine tolle Truppe und er hatte die Gemeinschaft sehr genossen.
Sieben
Fabio ließ sich von Francesca durch die Villa führen. Alle vier Frauen befanden sich jeweils noch an dem Platz, an dem sie gefunden worden waren. Fabio wollte die Arbeit der Kollegen von der Spurensicherung nicht behindern und warf jeweils nur einen kurzen Blick auf die Leichen. Phillipi trafen sie in der ersten Etage, als er gerade vor der Leiche kniete, die der Täter mit einem Strick erwürgt hatte.
»Na, Doktor, wie sieht es aus?«
Phillipi blickte zu Fabio und Francesca auf. »Scheiß Sonntag, würde ich sagen. Vier auf einmal.« Er erhob sich. Selbst diesem Mann, der wirklich vieles gesehen hatte, konnte man ansehen, wie ihn diese Leichenfunde aufgewühlt hatten. »Kommen Sie mit.« Phillipi ging voraus auf den Flur. »Sehen Sie sich um. Sie sehen aufwendig dekorierte Wände. Nicht mein Geschmack, alles viel zu plüschig, vor allem aber pompös. Vielleicht haben sich die Sonnenkönige Frankreichs so eingerichtet. Sehen Sie die schweren Vorhangstoffe, die nur dazu dienen, ein altes Bild einzurahmen – sie haben keinen anderen Zweck.« Er trat zu einem dieser Vorhänge aus Brokatstoff. »Sehen Sie das? Hier ist die Kordel samt der Quaste abgerissen. Damit ist die junge Dame erdrosselt worden. Was sagt uns das fürs Erste?« Er schaute Francesca auffordernd an.
»Der Täter hat die Kordel hier heruntergerissen, sie als Strangulationswerkzeug benutzt, anschließend die Dame hinter sich hergeschleift, bis er die Leiche hinter der Tür des Zimmers, in dem wir sie gefunden haben, abgelegt hat.«
Dr. Phillipi hob seine Augenbrauen. »Sehr gut kombiniert. Bravo. Sie hatten also die Schleifspuren schon gesehen.«
»Wir sind ihnen gefolgt und haben die Leiche entdeckt.«
»Weiter. Was können wir aus alledem folgern?«
»Ich denke, dass der Täter die Kordel abgerissen hat, da er nicht bereits ein anderes Mordwerkzeug in der Hand hatte.« Francesca dachte weiter nach. »Das könnte bedeuten, dass er auf den Mord nicht vorbereitet war, ihn nicht geplant hatte. Die anderen Frauen, bis auf die Gefesselte, sind mit einem Werkzeug ermordet worden, das schnell zur Hand war. Die Frau in der Küche wahrscheinlich mit einem der Küchenmesser, die Frau im Keller mit bloßen Händen. Nur die gefesselte Frau wurde nicht zufällig Opfer. Ihr wurde bewusst die Kehle durchtrennt.«
»Sehr gut kombiniert. Ich bin noch nicht am Ende meiner Untersuchungen, und die Kollegen der Spurensicherung werden noch das eine oder andere Detail ans Licht bringen. Aber mir kommt die ganze Situation vor wie in dem Märchen ›Der Wolf und die sieben Geißlein‹. Wir haben es hier mit vier Frauenleichen zu tun. Jede wurde in einem anderen Raum der Villa ermordet. Die Dame hier oben wurde im Gang überrascht, die Dame im Keller hatte sich im hintersten Winkel versteckt, so stelle ich es mir jedenfalls vor, die Dame in der Küche hatte keine Chance, sie wurde mit mehreren Messerstichen hingerichtet. Der Täter muss wie ein Berserker auf sie eingestochen haben. Blutrausch vielleicht. Gibt es bei Füchsen und Wölfen, gibt es aber auch bei Menschen. Die Dame im Büro mit dem offenen Safe wurde wahrscheinlich gefoltert, bevor er ihr die Kehle durchgeschnitten hat. Es gibt Schnitte an den Beinen und Armen.«
»Klar, könnte sein.« Francesca war ein Gedanke gekommen. »Der Täter wollte an den Safe. Die Frau im Büro wollte ihm die Kombination nicht sagen, daraufhin hat er sie gefoltert. Im Haus waren aber noch die drei anderen Frauen. Als er sie entdeckte, oder sie ihn, hat er sie gejagt und eine nach der anderen ermordet. Mit dem, was gerade zur Hand war: die Kordel, das Messer, die eigenen Hände.«
Fabio mischte sich ein: »Doktor, glauben Sie, dass es nur ein Täter war? Könnten es nicht mehrere gewesen sein?«
Phillipi schaute Fabio an und dachte nach. »Es ist vielleicht noch zu früh, das festzustellen. Mehrere – könnte sein, aber die Theorie von Francesca hat was. Die Tötungen geschahen in einer Art Raserei, würde ich vermuten. Zuerst die Frau in der Küche. Blutrausch, dann vielleicht die Frau oben, denn ich habe Blut an der Kordel entdeckt. Das Blut könnte von der Frau in der Küche stammen. Wissen wir morgen, spätestens übermorgen. Dann hat er alles abgesucht und die Frau im Keller entdeckt und mit eigenen Händen erwürgt. Blut war auch am Hals der Frau, aber nur ganz wenig, weil das meiste Blut, das an seinen Händen war, an der Kordel kleben geblieben war. So könnte die Reihenfolge gewesen sein. Das lässt auf einen Einzeltäter schließen. Auf einen rasenden Einzeltäter. Einen skrupellosen Einzeltäter. Zum Schluss hat er der gefesselten Frau die Kehle durchgeschnitten. Das verschaffte ihm einen Vorteil. Er konnte in Ruhe fliehen, musste nicht befürchten, dass die Gefesselte um Hilfe rufen würde.«
»Oder sie hat ihn erkannt.«
»Gut möglich. Also brauchen wir alles über dieses Opfer: wer war sie, was war ihre Aufgabe in der Villa, mit wem pflegte sie Umgang. Wissen wir da schon etwas?« Fabio schaute dabei auf Francesca.
»Die Zeugin, die diese Frau gefunden hat, sprach von der ›Madame‹. Sie nannte sie ›Madame‹. Mehr war nicht aus ihr herauszubekommen. Sie stand unter Schock.«
»Weiß die Zeugin von den anderen Toten?«
»Nein. Sie hat die ›Madame‹ entdeckt und ist ganz schnell aus dem Haus gelaufen, quasi direkt vor das Auto einer unserer Streifen. Die Kollegen haben sich dann weiter um sie gekümmert und die Zentrale informiert.«
»Wohnt sie denn hier?«
»Das hat sie nicht gesagt, aber ich vermute es. Wir besuchen sie gleich im Krankenhaus. Vielleicht ist sie schon stabil genug für eine Vernehmung. Sonst morgen.«
»Was, denkst du, ist das hier? Wir haben einige der Zimmer gesehen. Alle ähnlich eingerichtet. Wie der Doktor meinte, plüschig, aus der Zeit gefallen, aber in jedem Zimmer steht ein XXL-Bett, sonst nur wenig, was darauf schließen ließe, dass hier Leute wohnen.«
»Unten gibt es eine große Bar, und Eduard hat im Keller extrem teure Weine gesehen, also Edelstoff für große Geldbeutel.«
Dr. Phillipi räusperte sich: »Nach der allgemeinen Lebenserfahrung würde ich es für ein ›Etablissement‹ halten, aber ich bin hier nur der Gerichtsmediziner, der Ihnen in den nächsten Tagen ein Gutachten über die Tötungsarten und dies und das liefern wird, aus dem Sie Ihre Schlüsse ziehen werden. Die jungen Damen aus der ersten Etage, dem Keller und der Küche sind höchstens 20. Die Dame im Büro dürfte so um die 50 Jahre alt sein. Wie alt war die Zeugin, wenn ich fragen darf?«
Francesca schaute den Doktor an: »Höchstens 20, würde ich schätzen.«
»Also ein Bordell«, schloss Fabio die Überlegungen ab. »Es spricht einiges dafür. Und das in Italien, wo Bordelle und Zuhälterei verboten sind.«
»Wo es aber Prostitution an den bekannten Stellen in Bozen gibt«, ergänzte Francesca.
»Straßenstrich, ja, der ist bekannt und auch legal. Aber ein Bordell? Mitten in der Nobelgegend von Bozen. Wir, als Polizia, haben davon nichts gewusst. Das wird interessant.«
Acht
Tommaso war nicht betrübt, aber es rumorte in ihm. Er konnte verstehen, dass er nicht so einfach mitmachen konnte. Als Musikant jedenfalls nicht, es sei denn, er lernte ein Instrument und das möglichst schnell. Er überlegte: Wenn junge Menschen Jahre brauchten, um ein Instrument so zu beherrschen, dann brauchte ein älterer Mensch wie viele Jahre? Was Hänschen nicht lernt, lernt Hans nimmermehr. Er seufzte laut auf, und das hörte jemand. Beim Brunnen an der Weggabelung zwischen der Bäckerei Zöggeler und dem Restaurant Zum Löwen kam ihm Renate entgegen.
»Hoi Tommaso! Einen schönen Sonntag. Lässt dich Anna allein raus heute?« Renate verbreitete gute Laune. Immer. Tommaso kannte sie schon länger. Renates Familie war durchwegs musikalisch. Alle spielten sie mehrere Instrumente, Renate war Musiklehrerin an einer Musikschule, leitete einen Chor und war die Kapellmeisterin der Musikkapelle Prissian, dem Nachbardorf.
Tommaso hatte eine Idee. »Renate, ich hätte da eine Frage.«
Sie hörte geduldig zu, verstand sofort, was Tommaso umtrieb: dass es ihm darum ging, ein Instrument zu lernen, möglichst bei ihr in der Musikschule. Aber sie spürte auch, dass Tommaso noch viel stärker die Geselligkeit suchte, den Zusammenhalt, das Gemeinschaftserlebnis, das eine Kapelle bieten kann.
»Was machst du denn heute Abend?«, fragte sie ihn.
»Anna kocht heute ein Ochsenschwanzragout und ein Gericht mit Steinpilzen. Also ich erwarte mir einen schönen Abend.«
Renate musste schmunzeln. Männer und Essen. Zwei, die zusammenpassen. »Wenn du danach Zeit hast, so ab 9 Uhr am Abend, dann komm doch Zum Mohren. Da bin ich nach der Probe mit der Musikkapelle Prissian. Einige von uns gehen danach gerne noch einen trinken. Da können wir vielleicht besprechen, was für dich passen könnte. Bring Anna doch mit, wie wäre das?«
Neun
»Hier sind wir erst mal fertig. Morgen, wenn die Leichen abtransportiert sind, schaut ihr euch die Villa von oben bis unten an. Ermittelt, wem sie gehört, was wir über den Eigentümer wissen.« Fabio, Francesca und Eduard standen jetzt draußen auf der großen Treppe, mit Blick auf die mit weißen Kieselsteinen belegte Auffahrt. »Hier müssten doch eigentlich Kameras sein, irgendwo. So ein Anwesen schreit geradezu nach Überwachung.« Die drei schauten sich um, konnten aber keine Kameras entdecken.
»Also, was machen wir jetzt?« Fabio stieß den Ball an.
»Wir beide fahren ins Krankenhaus und befragen die Zeugin«, sagte Francesca und blickte dabei Eduard an. »Morgen durchsuchen wir die Villa gründlich. Wir ermitteln im Grundbuchamt, wer als Eigentümer eingetragen ist. Ich würde außerdem vorschlagen, dass wir die Aufzeichnungen aller Kameras auf dieser Straße einsammeln und auswerten. In dieser Allee stehen nur Villen. Ich schätze, dass die meisten von ihnen mit Kameras überwacht werden. Irgendwann wird unser Täter, oder die Täter, hierhergekommen sein. Eher mit einem Auto als zu Fuß. Da helfen uns sicher die Aufzeichnungen. Sobald uns Phillipi mehr über den Todeszeitpunkt sagen kann, können wir darin nach den Fahrzeugen suchen, die zum Tatzeitpunkt hier vorbeigefahren sind.«
»Gute Idee, Francesca. Macht das bitte. Ich denke, ich fahre jetzt nach Hause. Morgen früh Besprechung. Marzollo wird alles wissen wollen.«
»Am besten, wir präsentieren ihm schon morgen den oder die Täter, damit er seinen Erfolg in die Medienwelt hinausposaunen kann«, ergänzte Eduard.
Alle lachten, aber ihnen war nicht nach Lachen zumute. Marzollo drangsalierte sie seit Monaten mit seiner Macke, den Drogensumpf zu bekämpfen. Seither gingen sie gegen Kleinkriminelle, kleine und größere Dealer, Konsumenten und manchmal auch gegen Drogenschmuggler vor. Sie ahnten, dass Marzollo Informationen aus einer Quelle erhielt, die er vor ihnen geheim hielt. Francesca war es durch Zufall gelungen, ihn zusammen mit einem schwer einzuordnenden Geschäftsmann namens Rustam Karimov zu beobachten. Karimov könnte den Drogenschmuggel von Neapel über die Brennerroute kennen, vermuteten sie, weil ihnen Tommaso mitgeteilt hatte, dass die großen Player auf dem Drogenmarkt in Neapel nervös geworden waren, was er wohl von seinen Kollegen erfahren hatte. Man wusste also nichts Genaues, aber dieser Karimov tummelte sich unter anderem auch in Neapel, wie zu hören war. Allerdings auch in Südtirol. Irgendwie jedenfalls, aber auch das war undurchsichtig. Sein Sohn Yurii, das stand fest, führte die Geschäfte vom Hotel Trafoi aus – nahe am Stilfser Joch –, dessen Geschäftsführer auf tragische Weise zu Tode gekommen war. Die Karimovs waren überall und nirgends, und Marzollo stand Rustam Karimov auf noch ungeklärte Art nahe.
Zehn
Die Bar des Hotels Zum Mohren war nach der Probe ein beliebter Ort zur Einkehr für die Mitglieder der Musikkapelle Prissian, zumal der Seniorchef Raimund seit Jahrzehnten Flügelhorn in der Kapelle spielte. Renate, die Kapellmeisterin, genoss nicht nur bei ihm einen sehr guten Ruf. »Du musst sie singen hören«, ließ Raimund hie und da verlauten. »So eine tolle Stimme«, lobte er gern. Auch die Kapelle als Ganzes war glücklich, Renate als Kapellmeisterin zu haben. Sie hatte über ihr musikalisches Können hinaus einen Blick für die Menschen und das kann eine Kapelle zusammenschweißen. Als sie am Nachmittag mit Tommaso gesprochen und gespürt hatte, was in ihm vorging, fiel ihr etwas ein, das sie unmittelbar nach der Probe mit dem Obmann, Kurt Dirler, und dem Stabführer, Martin Egger, besprochen hatte. Beide hatten ihre Idee gut gefunden.
Nach der Probe kamen alle in der Bar zusammen: Tommaso, der Anna mitbrachte, Renate, Kurt und Martin. Raimund spendierte eine Runde, und nachdem sie einander zugeprostet hatten, eröffnete Renate dem erstaunten Tommaso, dass er in der Prissianer Kapelle willkommen sei.
»Aber ich kann doch nichts. Ich kann nicht Pauke spielen und ein anderes Instrument schon gar nicht.« Tommaso war baff. Anna begriff sofort.
»Das wissen wir, Tommaso. Das wissen wir. Ich weiß auch nicht, ob wir dich als Musikant brauchen können. Aber wir bräuchten einen guten Vertreter für unseren Stabführer.« Renate zeigte auf Martin. Der wandte sich an Tommaso: »Du bist doch Carabiniere. Als Carabiniere kannst du marschieren und bist es gewohnt, Kommandos zu geben. Als Stabführer brauchst du diese Eigenschaften. Natürlich wäre ein musikalisches Grundverständnis gut. Ich denke, das bekommen wir hin. Ich würde mich jedenfalls freuen, wenn ich dir dieses Geschäft beibringen könnte.«
»Und wir brauchen jede starke Hand, die mit anpackt«, fügte Kurt hinzu. »Jedes Konzert braucht Helfer, Leute, die anpacken können. Auf- und Abbau, wenn du verstehst. Also, wenn du magst, bist du dabei. Vielleicht kann ich dich an der großen Trommel einsetzen. Ich bin fürs Schlagwerk insgesamt zuständig. Wir von der Rhythmusgruppe sind eine nette Truppe, und für die große Trommel brauchst du keine aufwendige Ausbildung, aber ein gutes Gefühl für die Stücke, die wir spielen. Also, wie wär’s?«
Tommaso war begeistert und wusste gar nicht recht, wie ihm geschah. Die Blicke von Renate und Anna trafen sich. Es waren keine Worte nötig.
Elf
»Ich weiß nicht.«
»Was weißt du nicht?« Elisabeth verstand nicht, was Fabio meinte. Jedenfalls nicht genau, aber sie ahnte, was ihn umtrieb.
»Diese Immobilien. Ich meine, ich sollte doch froh sein, dass mich meine Eltern so großzügig damit bedacht haben. Aber es ist auch ganz schön viel Arbeit.« Er drehte sich im Bett zu Elisabeth um. »Ich könnte den ganzen Verwaltungskram an eine Immobilienverwaltung geben. Das wäre eine Lösung. Die kostet zwar Geld, aber die Kosten werden die Einnahmen nicht auffressen. Damit gebe ich aber auch alles aus der Hand, bin nicht mehr der, der alles entscheidet, oder?«
Elisabeth schwieg. Sie hatte die Entwicklung seit Herbst vergangenen Jahres miterlebt. Zuerst war Fabio euphorisch. Das konnte sie gut verstehen. Seine Eltern hatten ihm einige größere Zinshäuser in italienischen Großstädten überlassen. Im Zuge der vorweggenommenen Erbfolge. Steuerlich war das vorteilhaft. Sie hatten ihm auch angeboten, ihre Firma zu übernehmen. Sie hatten einen Handel mit exklusiven Stoffen aufgebaut, der sehr profitabel war. Den hatten sie, weil Fabio nicht ins Geschäft einsteigen wollte, verkauft und wollten den Erlös verleben. Den anderen großen Teil ihres Vermögens, die Immobilien, hatten sie auf Fabio übertragen. Steine also. Fabio war jetzt steinreich. Elisabeth musste bei diesem Gedanken schmunzeln. Aber Steine, die bewohnt waren, machten auch Arbeit. Es gab Mietverträge, Unterhaltungsarbeiten, Handwerker waren zu beauftragen, es gab Streitigkeiten, die man außergerichtlich oder gerichtlich austragen musste. Alles kostete Zeit und Mühe. Dann hatte Fabio die Idee, das Hotel in Torbole am Gardasee, welches zu den Immobilien gehörte, mit einem Penthouse aufzustocken. So hätten sie eine exklusive Ferienwohnung am See, hatte er gemeint. Auch dieses Projekt machte Arbeit, denn es musste ein fähiger Architekt gefunden werden, der es schaffen sollte, alle Umbaumaßnahmen außerhalb der Saison durchzuführen, also von November bis März. Jetzt war schon Frühjahr, die Saison hatte begonnen, Bauarbeiten waren erst wieder im November möglich und es gab noch keinen Plan. Außerdem gab es auch noch keine Baugenehmigung. Der Architekt drängte aber, denn auch er brauchte einige Monate als Vorlauf.
Über all diese Probleme hatten sie den Winter über gesprochen. Zudem nervte Marzollo zunehmend. Fabio wurde immer unzufriedener mit der Situation. Sein Chef wollte hoch hinaus. Das war allen klar. Auch, dass es ihm nur um schnelle Erfolge ging, weniger um die konzeptionelle Bekämpfung von Kriminalität. Marzollo liebte es, in der Öffentlichkeit wahrgenommen zu werden, und meinte, dass ihm das auch die Aufmerksamkeit im fernen Rom sichere, die er für sein Weiterkommen nötig hatte.
Elisabeth verstand gut, dass sich Fabio zerrissen fühlte, aber sie konnte ihm da nicht helfen. Er musste jetzt Entscheidungen darüber treffen, was ihm wichtig war und was weniger wichtig. Elisabeth wusste, dass Fabio mit Leib und Seele Polizist war. Wenn ihm dieser Beruf so sehr am Herzen lag, war es klug, sich hierauf zu konzentrieren und die Arbeit rund um die Immobilien anderen zu übertragen. Aber wenn ihm sein Beruf nun vergällt würde? Was wäre dann die Alternative? Versetzung? Eher nein, wegen der Familie käme das nicht in Betracht. Elisabeth würde ihre Apotheke nicht aufgeben, auch wenn sie woanders vielleicht eine bekommen könnte. Doch sie war hier zu Hause, ihre Eltern lebten hier, hier war sie geboren. Sie würde nicht gehen. Die Kinder auch nicht.
»Was soll ich bloß machen?« Fabio schaute seine Frau an.
Die schaute zurück. »Das musst du schon selbst wissen. Wir haben über alles gesprochen. Monatelang haben wir das getan. Es gibt verschiedene Optionen. Du musst wählen, nicht ich. Wähle klug, wäre mein Ratschlag.«
Montag
Eins
Die Frühbesprechung brachte kaum neue Erkenntnisse. Die Zeugin, die Francesca und Eduard im Krankenhaus am Vortag aufgesucht hatten, war nicht vernehmungsfähig gewesen. Die Ärzte hatten ihr ein starkes Beruhigungsmittel gegeben, und sie schlief, als sie befragt werden sollte.
»Dann gehe ich jetzt zu Marzollo, Bericht erstatten.« Fabio hatte auch Eduards Bericht über den Betrugsfall gelesen. »Was wissen wir über den Fall? Wahrscheinlich noch nichts, oder gibt es Neues hierzu?«
»Nein, nichts Neues. Der Geschädigte wollte am Sonntag zur Auktion. Er ist vielleicht auch nicht mehr in Bozen. Wenn uns hier nicht der Zufall hilft, würde ich es so einschätzen, dass wir dafür nicht zu viel Energie aufwenden sollten, zumal die Morde unseren ganzen Einsatz erfordern.«
Fabio nickte. »Ihr fahrt jetzt ins Krankenhaus?«
»Wir fahren ins Krankenhaus, dann nehmen wir uns die Villa vor. Eduard hat schon beim Grundbuchamt angerufen, hat aber so früh niemanden erreicht. Da bleiben wir dran und wissen im Laufe des Tages, wem die Villa gehört.«
Zwei
Die junge Frau saß aufrecht in ihrem Bett und hatte ihr Frühstückstablett gerade erst zur Seite geschoben, als Francesca und Eduard ihr Zimmer im Krankenhaus betraten. Sie erkannte Francesca sofort wieder, lächelte.
»Wie geht es Ihnen?«
»Ist das ein Kollege?«
»Das ist mein Kollege, Eduard Thaler. Wir arbeiten im Team.«
Die junge Dame nickte freundlich. »Ich war gestern nicht ganz bei mir. Danke, dass Sie sich um mich gekümmert haben. Aber jetzt geht es schon wieder.«
»Werden Sie heute schon entlassen?«
»Ich wüsste nicht, warum ich länger hierbleiben sollte, außer …«
»Außer?«
»Ich weiß nicht, wohin. In das Haus gehe ich nicht mehr.«
»Sie haben dort gewohnt?«
Die junge Frau wirkte jetzt verlegen, unsicher. Es war ihr anzumerken, dass sie sich unwohl fühlte.
»Ich kann da nicht mehr hin. Dieser Anblick. ›Madame‹. Wer hat das getan?«
»Das werden wir herausfinden«, sagte Francesca, die sich einen Stuhl ans Bett gestellt hatte, um nicht länger von oben auf die Frau herabzuschauen.
Eduard trat einen Schritt zurück. Von Frau zu Frau geht es leichter, dachte er.
Die Augen der jungen Frau saugten sich an Francesca fest.
»Wie heißen Sie, bitte? Wir haben noch nicht nach Ihrem Namen fragen können.«
»Valentina. Valentina Pichler.«
»Darf ich Sie Valentina nennen?«
Die junge Frau nickte. Francesca hatte das Gefühl, ein Kind vor sich zu haben. Valentina mochte knapp 20 sein, eher jünger. Zusammengekauert im Bett sitzend, unter der Bettdecke fast verschwindend, wirkte sie zerbrechlich wie ein Küken.
»Danke, Valentina.« Francesca machte eine Pause. »Das war schlimm für Sie gestern. Das kann ich gut verstehen.«
Valentina nickte schwach. Sie zitterte leicht.
»Wir werden Ihnen helfen. Wir kümmern uns. Vielleicht können Sie uns auch helfen? Wir müssen Sie einiges fragen. Fühlen Sie sich hierfür stark genug?«
Das Zittern nahm zu, aber Valentina nickte und ein leises »Ja« war zu vernehmen.
»Danke.« Francesca wusste genau, wo sie hinwollte. »Sie haben gestern die Tote als ›Madame‹ bezeichnet. Kennen Sie ihren richtigen Namen?«
»Wir haben sie alle so genannt.« Valentina schluchzte. »›Madame‹. Sie war auch eine ›Madame‹. Sie leitete alles. Sie war die Chefin.«
Francesca wollte hier nachhaken, fragen, wovon »Madame« Chefin gewesen war, da sprach Valentina bereits weiter.
»Ihr richtiger Name ist Gabi Armbruster.«
Eduard notierte alles fleißig, hielt sich zurück. So mochte es Valentina vorkommen, als sei er gar nicht im Raum.
»Gabi Armbruster also. Danke. Das hilft uns schon mal. Diese Gabi Armbruster war die Chefin, haben Sie gesagt. Nicht die Vermieterin?«
Valentina schaute Francesca lange an. Dachte nach, wog ab, was sie erzählen konnte. Schließlich sagte sie: »Sie haben sich doch umgesehen?«
Francesca nickte.
»Und was haben Sie da gesehen?«
»Wir haben Zimmer gesehen, deren Einrichtung weniger auf Wohnzwecke hindeutete.«
Valentina schnaubte leicht. »Sie können es ruhig aussprechen.«
»Wir glauben, dass die Villa ein ›Etablissement‹ ist. Liegen wir damit richtig?«
Valentina bekam jetzt einen harten Zug um den Mund. »Klar, das ist ein Puff, was denken Sie denn. Gabi war die Chefin. Sie kassierte und wir haben gearbeitet.«
»Danke für Ihre Offenheit. Das macht es uns leichter. Diesen Eindruck hatten wir auch. Ich habe in diesem Zusammenhang noch einige Fragen.«
»Nur zu.«
»Wie viele Damen waren dort? Gab es eine Stammbesetzung?«
Valentina schien mit nichts hinter dem Berg halten zu wollen.
»Man könnte sagen, dass es eine Stammbesetzung gab. Oder auch nicht. Also, wir vier Mädchen waren meist ständig im Haus: Aksana, Antonia, Alicia und ich. Wir waren immer in der Villa. Aber bei Bedarf kamen andere, viele, wenn eine Party stieg oder besondere Wünsche zu erfüllen waren.«
»Besondere Wünsche?«
»Muss ich Ihnen das erklären? So was kennt die Polizei nicht? Bei uns kann jeder die Behandlung bekommen, die er sich wünscht. Wir machen alles. Für einige Behandlungen gibt es Spezialistinnen. Dominas, wenn Sie es genauer wissen wollen. Das mache ich nicht. Die anderen drei auch nicht. Das ist so ein Spiel mit Macht und Macht abgeben, wenn Sie verstehen. Andere machen Doktorspiele, manche mögen es, in Windeln gelegt zu werden. Also diesen krassen Scheiß halt.«
Francesca nickte. Natürlich wusste sie, was es da alles gab.
»Danke, dass Sie so offen erzählen. Diese Gabi Armbruster war also die Chefin. Gehört ihr auch die Villa? Wissen Sie das?«
»Nein, keine Ahnung. Aber ich glaube nicht. Ich vermute, sie war nur die Geschäftsführerin. Ihr Macker, vielleicht auch ihr Mann, was weiß ich, der schien die Nummer eins zu sein.«
»Das ist interessant. Kennen Sie seinen Namen?«
»Und ob. Er ist der Inhaber eines der großen Laufhäuser in Innsbruck. Da komme ich her. Er hat mich nach Bozen gebracht. Als Aushilfe, hat er gesagt.«
»Dann kennen Sie ihn also?«
»Er ist mein Onkel! Leopold Pichler. Kennt in Innsbruck jeder. Leo, der Lude, oder auch Puff-Leo ist sein Übername. Eine honorige Person in Innsbruck, mein Herr Onkel. Bozen ist so eine Art Zweigstelle. Die Mädchen kommen alle aus Innsbruck, sobald in Bozen welche gebraucht werden. Wenn in Bozen wenig zu tun ist, gehen sie ins Laufhaus. So läuft das.«
»Und wie sind Sie in das Gewerbe gekommen?«
»Das geht Sie nichts an. Das ist allein meine Sache. Sonst noch was?«
Valentina hatte sich verändert. Eben noch zitternd, jetzt hart, fast aggressiv.
Francesca musste ab jetzt vorsichtiger sein. Es war offensichtlich falsch, danach zu fragen. Vielleicht, weil man nicht an dem Elend rühren sollte.
»Sie haben uns gut geholfen. Was können wir für Sie tun?«
»Ich weiß nicht. Nur, dass ich nicht in das Haus zurück will.«
»Wird Ihr Onkel sie abholen kommen?«
Valentina schnaubte leise. »Mein Onkel? Ja, nein, vielleicht. Keine Ahnung. Aber er wird schon kommen, wenn er erfährt, dass seine Freundin oder Frau oder was weiß ich umgebracht worden ist. Das ist sicher.«
»Haben Sie vielleicht die Telefonnummer Ihres Onkels? Wir würden ihn gern über das Geschehene informieren und haben auch einige Fragen an ihn.«
Valentina blickte sich verstört um. »Ich weiß nicht. Haben Sie meine Handtasche gesehen? Da ist mein Handy drin.«
Eduard öffnete den Spind, und tatsächlich fand er darin die Tasche, reichte sie Francesca, die sie Valentina weiterreichte. Valentina nahm Eduard erst jetzt wahr, was einen eigenartigen Effekt auslöste. Sie lächelte wieder. Sie lächelte Eduard an. So, als hätte man bei ihr einen Knopf gedrückt.
Sie kramte dabei das Handy hervor und nannte Francesca bald darauf eine Nummer aus Österreich.
»Valentina, da ist noch etwas. Sie haben eben drei Namen genannt. Aksana, Antonia und Alicia, habe ich die richtig verstanden?«
»Richtig verstanden. Warum?«
»Wissen Sie, wo diese drei jetzt sind?«
Valentina stutzte. »Wieso fragen Sie das? Sie müssten doch in der Villa sein?« Da wurde ihr bewusst, worauf diese Frage zielen konnte. »Oh Gott, was ist mit ihnen? Ist ihnen etwas passiert?«
Francescas – und auch Eduards – Gesichtsausdruck ließ Valentina ahnen, was passiert war.
Drei
Marzollo hörte sich an, was ihm Fabio über den vierfachen Mord in der Villa berichtete. Es schien, als würde er nervöser, je mehr Details Fabio schilderte. Solch entsetzliche Morde hatte auch Marzollo noch nie erlebt. Einen Massenmord in einem Puff. So jedenfalls sah es aus.
»Ein Puff, mitten im Nobelviertel von Bozen. Die Polizia hat nichts davon gewusst. Peinlich. Peinlich das alles. Ganz großer Mist. Sie werden uns zerreißen, falls wir Pech haben. Wir müssen jetzt vorsichtig mit den Medien sein. Was schlagen Sie vor?«
Das hatte Fabio nicht erwartet. Dass Marzollo ihn um Rat fragen würde. Das hatte es zuvor nicht gegeben. »Wir müssen es verkünden, dürfen aber derzeit keine Fragen zulassen. Das wird