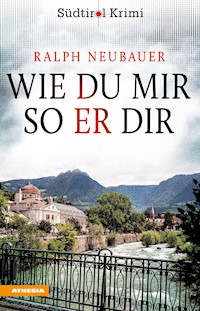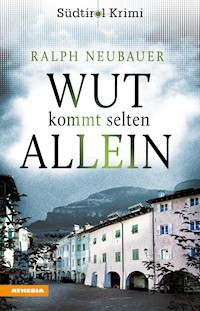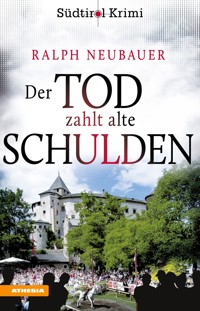
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Athesia Tappeiner Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Ein Mann verschwindet spurlos im Gebiet der Seiser Alm. Ein spektakulärer Reitunfall gibt Rätsel auf. Fabio Fameo ermittelt vor der Kulisse des »Oswald-von-Wolkenstein-Ritts«. Die Geschichte hat ihren Ursprung im Vergangenen und leuchtet die Gegenwart aus. Das Geschehen reißt alte Wunden auf. Es soll an heikle Seilschaften angeknüpft werden. Wer im Wege steht, kommt zu Schaden. Die Tragik des Falls rührt aus Südtirols Geschichte her und findet ihr Ende in der mythischen Landschaft des Schlerngebiets. Der Krimi führt zur Seiser Alm, über die Trostburg nach Kastelruth, Seis, dem Völser Weiher und Schloss Prösels und lässt den Leser den »Oswald-von-Wolkenstein-Ritt« hautnah miterleben.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 481
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Null
Eins
Zwei
Drei
Vier
Fünf
Sechs
Sieben
Acht
Neun
Zehn
Elf
Zwölf
Dreizehn
Vierzehn
Fünfzehn
Sechzehn
Siebzehn
Achtzehn
Neunzehn
Zwanzig
Einundzwanzig
Oswald-von-Wolkenstein-Ritt
1. Turnierspiel am Kofel – Ringstechen
2. Turnierspiel in Seis – Vierergalopp mit Labyrinth
3. Turnierspiel am Völser Weiher – Galopp mit Hindernissen
4. Turnierspiel in Prösels – Torritt
Danksagungen
Weitere Informationen
Erläuterungen
Kleine Literaturliste
Leseprobe: Rache ist honigsüß
Eins
Zwei
Null
30. April
Felicitas Bös zerrte am Reißverschluss ihres Koffers und musste schließlich ihr ganzes Körpergewicht einsetzen, um den Inhalt so zusammenzupressen, bis der Schieber alle Rundungen nahm. »Fertig.« Ihr Blick streifte über das Chaos in ihrem Zimmer. »Nichts vergessen? Hab ich alles?« Ihrer Mitbewohnerin legte sie noch einen vorbereiteten Zettel auf den Küchentisch: »Bin ein bis zwei Wochen in Südtirol. Sollte sich die Uni bei dir melden, schicke mir eine Nachricht über WhatsApp. Wäsche ist noch in der Maschine. Bitte aufhängen. Feli.«
»Die wird sich wieder aufregen«, dachte sie. Sie schaute auf die Küchenuhr. »Es wird Zeit.« Sie zog den Rollenkoffer hinter sich her. »Zwei Wochen ausspannen wäre prima. Hoffentlich ist Thomas nicht zu anhänglich.« Sie überlegte: »Wenn er mir komisch kommt, fahre ich wieder zurück. Oder ich suche mir was anderes. So, wie das Geld reicht.«
»Das Dorf heißt Seis«, hatte Thomas gesagt. »Du fährst bis Bozen und dann nimmst du den Bus direkt vom Bahnhof. Der fährt circa 40 Minuten bis Seis. Ich hole dich ab. Die Pension liegt direkt gegenüber der Haltestelle.«
Schön war, dass sie im Institut nur wenige Urlaubstage einsetzen musste, da morgen ohnehin frei war und für sie ab Mitte Mai die Semesterferien begannen. Sie hatte eine billige Zugfahrt im Nachtzug ergattert und würde am »Tag der Arbeit« in Bozen ankommen. »Festa del Lavoro«. Gegen Mittag würde sie in Südtirol sein.
Sie war schon mit »Google Earth« in Seis gewesen. Die Bilder hatten sie neugierig gemacht. Thomas hatte ihr erzählt, dass das Mittelalter in Seis und den anderen Dörfern noch präsent sei. Sie hatte davon bei ihrer Google-Earth-Tour nicht viel bemerken können. Aber Thomas hatte zu diesem Thema auch einen speziellen Zugang. Felicitas wusste nur, dass dort ein berühmter Ritter gewohnt haben soll. Und Ritter waren seine Leidenschaft. Sie seufzte.
*
Er hörte das leise »Plopp« gar nicht. Die Kugel drang durch seine Schädeldecke, bevor der gedämpfte Schall des Schusses sein Ohr erreichen konnte. Sie zerstörte das Gewebe schlagartig, sodass er keinen Schmerz empfand. Sein Körper sackte nach vorne und fiel der Länge nach in die Grube, an der er drei Tage gearbeitet hatte.
»Es ist immer so einfach.« Der Mann verzog keine Miene, schaute auf den toten Körper. Er murmelte: »Jetzt bist du nicht mehr allein.«
Er blickte sich um. Diese Stelle war einsam, aber nicht weit von hier ging ein Wanderweg entlang. Skrupel, zufällige Zeugen ebenfalls zu liquidieren, hatte er keine. Er fühlte sich beobachtet. »Das war damals genauso«, erinnerte er sich. »Vielleicht ist es dieser Ort?« Sein Blick bewegte sich forschend zwischen den Bäumen des dunklen Waldes oberhalb von Hauenstein. Nichts. Nur diese Raben. Aber die waren auch schon vor Tagen hier, als er den jungen Mann an genau diesem Ort beobachtet hatte. Als er den Abzug betätigt und die Kugel mit einem leisen »Plopp« den Lauf verlassen hatte, waren die Raben nicht aufgeschreckt. Sie saßen in beträchtlicher Zahl auf den Bäumen, die den Ort der Tat umgaben. Sie blickten auf die tiefe Grube, in der der junge Mann in sich zusammengesunken war. Die Kugel im Hinterkopf. Einige der Raben waren kurz aufgeflogen, als der Mann zusammenbrach, hatten sich dann aber sofort wieder einen Ast gesucht. »Was wollt ihr Viecher?«
Der Mann schraubte den Schalldämpfer ab, verstaute ihn und die Pistole in seiner Jacke. Dabei befiel ihn wieder dieses unwirkliche Gefühl. Er fühlte nichts. Nichts. Nie hatte es ihm etwas ausgemacht, wenn er einen Menschen getötet hatte. Es machte ihm nichts. Es machte nichts mit ihm. Er fühlte nichts. Absolut nichts.
Wohlüberlegt verrichtete er jetzt die mechanische Arbeit. Der junge Mann hatte alles an diesen Ort hochgeschleppt, was er hier gebraucht hatte. Der Mann warf alles in die Grube, bis auf die Schaufel. Schippe für Schippe warf er Erde in das Loch, das jetzt ein Grab war. »Ein Doppelgrab«, sagte er leise zu sich selbst. Die Raben sahen ihm dabei zu.
Eins
1. Mai
Die neuen Mischungen der Kräutertees waren Elisabeths Mutter gut gelungen. Fabio musste alle neuen Mischungen »blind« verkosten und sein Urteil abgeben. Elisabeth tat es ihm gleich und war im Erkennen der verwendeten Kräuter und Pflanzen nicht zu übertreffen. Sie schmeckte fast jede Zutat heraus.
»Hier hast du vielleicht einen Hauch zu viel Pfefferminze hineingegeben. Das macht den Tee etwas zu streng, finde ich.« Das war ein typischer Kommentar von Elisabeth. Ihre Mutter nickte dazu oder wiegte ihren Kopf. Je nachdem. Nicken bedeutete: »Du hast vielleicht recht. Ich werde das überprüfen.« Kopfwiegen bedeutete: »Ich bin da aber ganz anderer Meinung. Die Mischung bleibt so.«
Die »Trafojer-Frauen« hatten ihren eigenen Kopf. Elisabeths Vater saß im Herrgottswinkel und schaute sich das Treiben entspannt an. Fabio saß – aus Sicht des Hundes – günstig auf einem Stuhl, sodass er seine Schnauze auf dessen Oberschenkel legen konnte. Das und sein Blick sprachen eine deutliche Sprache. Iro war ein bayerischer Gebirgsschweißhund, rehbraun, glatthaarig, schlank wirkend, aber dennoch ein Muskelprotz. Iro mochte Fabio seit ihrer ersten Begegnung. Vor knapp fünf Jahren, kurz nachdem Fabio Elisabeth kennengelernt hatte, musste er mit Elisabeths Vater gleich mit auf die Jagd. So eine Art Test war es wohl. Zu schauen, ob der Schwiegersohn in spe etwas tauge. Und tatsächlich war die Gamsjagd nicht einfach gewesen. Es ging steil hinauf, es wurde spät und der Weg im Dämmerlicht zurück zur Hütte war nicht leicht zu finden. Aber nach dem ersten gemeinsamen Abend auf der Berghütte hatte er bei Iro und dessen Herrchen einen guten Stand.
Der kleine Laurin lief schon in der Stube herum. Seine ersten Gehversuche hatte er erfolgreich gemeistert und freute sich über jeden seiner Fortschritte. Die Großeltern hatten ihre Freude, wenn Elisabeth und Fabio mit ihrem jetzt zweijährigen Jungen den Weg von Tisens ins Ultental fanden. Elisabeths Eltern lebten auf dem »Oberen Hof« in Kuppelwies.
Der Vater hatte noch fünf Stück eigenes Vieh im Stall, die Kühe mussten jeden Tag auf die steilen Weiden gebracht werden. Die Mutter baute Heilkräuter an, aus denen sie aromatische Heil- und Genusstees mischte. Elisabeths Eltern waren aber nicht mehr die eigentlichen Herren auf dem Hof. Den hatte der älteste Bruder überschrieben bekommen. Luis hatte für seine eigene Herde einen recht großen Stall gebaut, modern und luftig. 35 Stück Vieh wurden hier versorgt, gingen jeden Morgen auf die Weidegründe und lieferten prima Milchqualitäten. Luis hatte für sich und seine Familie ein eigenes Haus bauen können. Die Eltern konnten daher im »Oberen Hof« weiter alleine leben. Elisabeths Vater dachte auch darüber nach, die Viehwirtschaft ganz aufzugeben. Die fünf Grauen waren ihm aber ans Herz gewachsen. »Das sind meine letzten Viecher«, sagte er immer. Und die Mama war ganz vernarrt in ihre Bio-Kräuter. So bestimmten die Milchwirtschaft und die Kräuter immer noch den Jahreslauf auf dem »Oberen Hof«, einem Gehöft aus dem 12. Jahrhundert. Der Hof atmete, wie die meisten alten Höfe im Ultental, Geschichte. Im unteren Geschoss soll sogar ein Gefängnis gewesen sein, wurde erzählt. Was dafür sprach, dass dieses Haus möglicherweise früher auch ein Gericht gewesen war. Der Hof wies einen besonderen Baustil auf. Ungewöhnlich für das Ultental. Er bestand aus einem Mauerhaus mit Erker und war nicht, wie sonst hier üblich, aus Holz gebaut. Auch das sprach dafür, dass dieses Haus in früheren Jahrhunderten möglicherweise eine andere Funktion als die eines Bauernhauses hatte.
Elisabeths Mutter stellte nun den letzten der drei neu komponierten Tees zum Verkosten auf den Tisch. Fabio und Elisabeths Vater nippten von dem heißen Getränk. Elisabeth zog den Duft ein und benannte die ersten Eindrücke: »Ein Hauch von Apfelminze, etwas Zitronenmelisse.« Sie überlegte: »Orangenminze auch. Und Kornblumen. Aber da ist noch etwas?«
Die Mutter schmunzelte: »Edelweiß ist auch drin!«
Dann nahm Elisabeth einen Schluck und nickte anerkennend. »Der ist richtig gut!«
Ihre Mutter nickte. »Ich nenn ihn ›Jochwind‹. Er hat was von der Frische des Winds, der über das Joch bläst«.
Sie blickte ihre Tochter etwas länger als sonst an und nickte ihr anerkennend zu: »Du bist gut im Erkennen der Kräuter.«
»Ich hatte ja auch eine gute Lehrmeisterin«, gab diese zurück. Beide lächelten einander zu.
Fabio kraulte den Kopf des Hundes, betrachtete dessen Mimik, die ihm zeigte, dass er völlig entspannt war. Als er aufblickte, nahm er auf dem Gesicht seiner Frau wahr, dass sich hinter ihrer Stirn ein Gedanke formte.
»Wenn ich deine Kräutertees in meiner Apotheke verkaufen würde, wie fändest du das?«
Elisabeths Mutter schmunzelte. »Du kannst es versuchen. Ich gebe dir ein paar Päckchen mit.«
Fabio konnte sehen, wie es hinter Elisabeths Stirn weiterarbeitete. Sie hatte dann einen intensiven Blick und ihre Stirn zog sich dabei leicht nach oben.
»Und wenn ich später selber Kräuter anbauen würde?«
Elisabeths Mutter lächelte wieder: »Dann würde mich das sehr freuen. Solange ich kann, will ich dir gerne mein Wissen um die Kräuter weitergeben. Du musst Wetter und Wuchs im Auge haben. Manche Kräuter darf man nur zu bestimmten Tageszeiten ernten, es muss bei einigen trocken sein, manchmal muss es bedeckt sein, weil zu viel Sonne die Schnittstellen verbrennt. Du brauchst viel Erfahrung für die Ernte und für das Trocknen der Kräuter. Es ist viel Arbeit, das musst du vorher wissen. Aber es macht auch viel Freude.«
Fabio wollte einwenden, dass sie doch überhaupt keinen Garten hätten, unterließ dies aber. Dann wäre sofort wieder die Diskussion losgegangen, ob, wo und wann sie bauen oder ein Haus kauften. Seine Frau war der Meinung, dass ihre Wohnung bald zu klein werde. Klein-Laurin tobte durch die drei kleinen Zimmer ihrer Wohnung, und es war klar, dass weiterer Familienzuwachs mehr Platz benötigte, als sie derzeit zur Verfügung hatten. Elisabeth hatte seit Laurins Geburt dieses Thema immer wieder einmal angeschnitten. Fabio spürte, dass sie in diesem Jahr eine Entscheidung von ihm erwartete. Da gab es Pläne für ein Neubaugebiet in Prissian. Frei stehende Einfamilienhäuser nach modernem Standard sollten dort entstehen. Und es gab den alten »Ansitz Esser« unterhalb der Fahlburg. Ein Baudenkmal. Riesig groß mit nicht kalkulierbarem Renovierungsaufwand. Sie hatten sich seit Laurins Geburt mit dem Thema beschäftigt. Fabio liebäugelte eher mit dem Neubau, Elisabeth mit dem alten Gemäuer. Aber eine Entscheidung hatten sie bisher nicht getroffen. Fabio hatte seine Arbeitsbelastung als Grund für seine Unentschlossenheit vorgeschoben.
Allerdings musste er sich eingestehen, dass in den vergangenen zwei Jahren keine Fälle zu lösen gewesen waren, die ihn übermäßig gefordert hätten.
Das einzige Thema, das etwas mehr Brisanz hatte, waren die zunehmenden Schleppertransporte über den Brenner. Immer mehr Flüchtlinge, meist aus afrikanischen Staaten, versuchten über die Brennerroute in den »goldenen Norden« zu gelangen. Schlepperbanden sorgten für den Transport dieser Menschen, oft versteckt zwischen anderen Gütern, die mit Tausenden von Lkws über den Brenner fuhren. Anschließend ging es in aller Herren Länder, meist dorthin, wohin es schon andere aus derselben Flüchtlingsregion geschafft hatten. So wie damals ab Anfang 1940, als die ersten ausreisewilligen Optanten dorthin gingen, wo schon andere aus ihrem Dorf waren. Die beiden faschistischen Diktaturen Deutschland und Italien hatten die deutschsprachigen Südtiroler und Ladiner gezwungen, ihre Heimat zu verlassen und die Option für Deutschland auszuüben oder in Südtirol zu verbleiben, wo sie weitere sprachliche und kulturelle Unterdrückung erwartete.
Heute wie damals reiste man in eine fremde Welt, ließ die alte Heimat zurück. Die Zukunft war und ist für Entwurzelte ungewiss, eine Planung unmöglich. Heute wie damals vertraute man Versprechungen, die schon damals nicht gehalten wurden und heute wahrscheinlich auch nicht gehalten werden würden. Alle Reisenden nahmen große Strapazen in Kauf. Die Afrikaner setzen auch heute noch ihr Leben aufs Spiel. Alles in der Hoffnung, es woanders besser zu haben und die zurückgelassenen Familien aus der Fremde zu unterstützen. Damals profitierten die Herrschenden, heute profitierten Schleuserbanden, deren Hintermänner mit dem Geld der Ärmsten reich werden.
Außer den Lkw-Kontrollen mit Erfolgen, die lediglich zeigten, dass der Flüchtlingsstrom zugenommen hat, hatte Fabio in den letzten zwei Jahren eigentlich ein ruhiges Berufsleben führen können. Er war froh darüber. Konnte er doch deshalb jede Phase des kleinen Laurin hautnah miterleben. Das Krabbelalter, die ersten Gehversuche, die Zeit, als die Windel überflüssig wurde, und die Freude, dass es jetzt so gut klappte.
Aber die in dieser Zeit immer wieder mal zwischen Elisabeth und ihm diskutierte Frage, ob und wann sie bauen oder kaufen sollten, war bisher nicht beantwortet. Und Elisabeths harmlos klingende Frage: »Und wenn ich später selber Kräuter anbauen wollte?«, zielte deshalb genau in diese Richtung. Denn ein eigener Kräuteranbau setzte eine große, geeignete Fläche voraus. Die hatten sie aber erst, wenn sie bauten oder kauften.
Und so ging es eigentlich schon seit Längerem. Elisabeth konnte mit kleinen Bemerkungen das unterschwellig gärende Thema beliebig oft an die Oberfläche spülen. Fabio spürte an der Schlagzahl, mit der sie das tat, dass sich ihre Gedanken mit diesem Thema intensiv beschäftigten.
Auch Elisabeths Eltern hatten sich in das Thema eingebracht, indem sie Baugrund angeboten hatten. Genauso, wie sie es Elisabeths älteren Bruder, Luis, und dem jüngeren Bruder, Sebastian, angeboten hatten. Luis hatte zugegriffen. Sebastian nicht. Luis war der bodenständige der Brüder. Sebastian hatte vor einigen Jahren noch als Redakteur bei einer Zeitung gearbeitet. Jetzt arbeitete er als freier Reisejournalist, weil er seinen Drang, die Welt zu erkunden, so am besten ausleben konnte. Er war auf der ganzen Welt zu Hause. Ein Häuschen, egal wo, war derzeit nichts für ihn, konnte ihn nicht reizen.
Fabios Gedanken kehrten an den Tisch zurück, als Elisabeths Mutter fragte: »Habt ihr euch denn schon entschieden, wo ihr bauen wollt? Denn, wenn du Kräuter anbauen willst, brauchst du schon einen guten Boden.«
Elisabeth sah Fabio an. Fabio sah seine Schwiegermutter an. Die schaute ihn an. Elisabeths Vater schmunzelte. Der Hund hob den Kopf.
»Ähm. Nein. Wir sind da noch nicht weiter. Ihr wisst ja. Da gibt es vieles zu bedenken.« Fabio schwieg. Der Hund legte den Kopf wieder auf seinen Oberschenkel.
*
Eduard war auf dem Rücken der Pferde aufgewachsen. Auf dem Hof seiner Eltern, in der Fraktion Auen, am Sonnenhang oberhalb von Sarnthein, hatte er schon als Knirps auf seinem Pony, Charlie, gesessen. Später hatte er eine Haflingerstute, Holde, mit der er fast täglich ausgeritten war. Er konnte also wirklich reiten. Hatte er bisher gedacht. Als ihn sein Freund Peter vor einer Woche gefragt hatte, ob er als Ersatz für den verletzten Daniel beim »Oswald-von-Wolkenstein-Ritt« mitmachen würde, hatte er freudig zugestimmt. Diesen Wettbewerb hatte er immer schon mitreiten wollen. Bisher hatte sich keine Gelegenheit dazu gefunden. Denn hierfür brauchte es eine Mannschaft von vier Reitern.
Die anderen, Peter, Patrizia und Siegfried trainierten schon seit März. Außerdem ritten sie in dieser Formation – zusammen mit Daniel – schon zum x-ten Mal den Ritt. Daniel hatte sich Ende März bei einem Arbeitsunfall die linke Schulter so stark verletzt, dass sie ihm den linken Arm und die Schulter mit einer im rechten Winkel angebrachten Stütze »stillgelegt« hatten. Peter war froh, dass sie mit Eduard so schnell Ersatz gefunden hatten. »So können wir es wenigstens versuchen«, hatte Peter gesagt, als er Eduard gefragt hat.
Alle vier Turnierspiele waren auf Peters Hof in Rabenstein nachgebaut worden:
1. Turnierspiel am »Kofel« – Ringstechen
Der Kofel in Kastelruth war bereits in der Bronzezeit besiedelt. Ende des 16. Jahrhunderts eingeebnet, erhielt er mit sieben Kapellen sein heutiges Aussehen. Es war ein kreisrunder Platz, dessen Mitte am Tag der Veranstaltung zum Festplatz wurde. Von dort aus verfolgten die Zuschauer, wie Pferd und Reiter im vollen Galopp diesen Kreis ritten, eine Stange in der Hand, die sie durch insgesamt drei frei hängende Ringe werfen und wieder auffangen mussten, um sie anschließend dem nächsten Staffelreiter zu übergeben. Wurde ein Ring nicht »gestochen«, musste der glücklose Reiter eine neue Runde starten. Verlor er seinen Stab, musste er sich einen neuen aus einer Tonne fischen und ebenfalls sein Glück erneut versuchen.
2. Turnierspiel am »Matzlbödele« – Vierergalopp mit Labyrinth
Das »Matzlbödele« in Seis war die Disziplin, bei der es im Wesentlichen auf die Mannschaftsharmonie ankam. Pferde und Reiter mussten wie ein Körper sein, solange es um den Vierergalopp ging. Dazwischen kam es auf Konzentration und Geschicklichkeit an, wenn jeder einzeln durch das Labyrinth musste. Die gesamte Strecke war mit lose aufgelegten Stangen markiert. Warf man eine runter, wurden auf die Gesamtzeit Strafzeiten hinzugerechnet, und der Parcours war eng. Stangenabwürfe kamen daher häufig vor.
3. Turnierspiel am Völser Weiher – Galopp mit Hindernissen
Am Völser Weiher wartete ein Parcours, der viel Geschick und höchste Konzentration abverlangte. Nur ein Reiter, der Vierte, musste lediglich die Stange halten, weshalb man diese Position auf Eduard übertragen hatte. Es galt unter anderem eine hölzerne Kugel bei vollem Galopp in eine tief stehende niedrige Tonne zu werfen, bei der es häufig vorkam, dass die Kugel wieder heraussprang. Kniffelig.
4. Turnierspiel in Prösels – Torritt
Vor der Kulisse von Schloss Prösels galt es in einem rasanten Slalom insgesamt acht Stangen im Galopp zu umreiten – hin und wieder zurück. Die Stangen standen nur fünf Meter voneinander entfernt, was für Pferd und Reiter bei vollem Tempo nicht viel Platz bedeutete. Auch hier wurde die Standarte von Reiter zu Reiter in einer Art Staffellauf übergeben. Schwierig und temporeich.
An diesem Wochenende war Eduards erstes Training. Heute übten sie den zweiten Wettbewerb. Das »Labyrinth«. Dabei galt es vor allem, als Mannschaft zu harmonieren. Die vier Pferde mussten die rechtwinklige Galoppstrecke gleichzeitig und nebeneinander bewältigen. Das Ziel war die »Festung«, ein Geviert, dessen bemalte Wände ihm die Anmutung einer Burg gaben. Aus dieser Festung musste nun jeder Reiter einzeln einen komplizierten und sehr engen Parcours reiten, bei dem nur ein gut eingespieltes und geschicktes Team aus Pferd und Reiter ohne Strafpunkte durchkam. Zum Schluss gab es einen dramatischen Schlussspurt, bei dem alle vier Pferde, wieder dicht an dicht, im vollen Galopp eine 90-Grad-Kurve nehmen mussten. Die vier Reiter hatten dabei eine lange Stange zu halten, die auf keinen Fall losgelassen werden durfte. Die Galoppstrecke war durch lose aufgelegte Stangen markiert. Fiel eine runter, gab es Strafsekunden. Es war verdammt eng.
Eduard hatte die Position zwei eingenommen. Direkt neben dem innen laufenden Pferd. Das war die sicherste Position für einen Anfänger. Allerdings hatte er dann auch links und rechts ihn bedrängende Nachbarn. Die »Beide-Beine-blau-Position«. Das galt allerdings auch für die Position drei.
Die Pferde und ihre Reiter mussten alle Turnierspiele blind beherrschen. Jede Bewegung musste bis ins Detail einstudiert werden. Eduard hatte noch nie vorher eines dieser Turnierspiele geritten. Jetzt wusste er, dass er noch viel lernen konnte. So wie es einem passionierten und gut trainierten Rennradfahrer ergehen würde, wenn sich ihm die Chance eröffnete, bei der Tour de France als Ersatzmann mitmachen zu dürfen.
Der Oswald-von-Wolkenstein-Ritt war Premium-Liga, Champions League, hatte Spitzenniveau. Er war durch Zufall dort hineingeraten. Peter hatte gesagt: »Eigentlich müssten wir absagen, weil Daniel ausgefallen ist. Aber mit dir würden wir es dennoch wagen. Das wird hart für dich, so kurz vor der Qualifikation. Wenn du zusagst, musst du fast täglich mit uns trainieren. Dann können wir die ›Quali‹ schaffen.«
Die Qualifikation war am 15. Mai. Also noch genau fünfzehn Tage bis dahin. Heute, an der »Festa del Lavoro«, war sein erster Trainingstag. Und seine Beine waren jetzt schon blau.
Daniel hatte Eduard sein Pferd, »Siria«, geliehen. Das kannte sich aus. Hoch motiviert nahm es die Aufgabe an, akzeptierte die anderen Pferde, was nicht selbstverständlich war. Pferde lebten in einer klaren Hierarchie. Es gab unter ihnen keine Demokratie. Das Innenpferd, Patrizias »Sanny«, musste sich zurücknehmen und das Außenpferd rennen lassen, auch wenn es lieber selbst vorne wäre. Also mussten die Reiter auch die Rangordnung ihrer Pferde beachten und sehr feinfühlig die Kommandos geben können. Um ein Pferd zu steuern, braucht es fast nichts. Es reichen kleinste Bewegungen aus. Es gibt Reiter, die sagen, »man kann ein Pferd auch mit den Gedanken lenken«. Eduard kannte das aus seinen vielen Jahren als »normaler« Reiter. Deshalb gelang es ihm auch, Daniels Pferd so zu lenken, dass es mit den andern lief, dicht an dicht. Das war nicht so leicht, bei dem Tempo und bei dem Gedränge. Hier kamen ihm aber seine vielen Jahre Erfahrung zugute.
In der Mittagspause meinten Peter und Daniel: »Geht gut mit dir und Siria. Passt schon.« Daniel grinste Eduard an. »Und? Was machen die Beine?«
*
Als Felicitas Bös in Seis aus dem Bus stieg, konnte sie Thomas nirgendwo entdecken. Die Sonne wärmte Anfang Mai selbst auf dieser Höhe schon ganz ordentlich, tauchte die »Festa del Lavoro« in ein müßiges Licht. Es war sehr still in Seis. Als der Bus wieder anfuhr und sich das Fahrgeräusch in der Ferne verlor, war, außer einem leichten Wind, zunächst nichts zu hören. »Idylle pur«, dachte sie. Da knatterte es zunächst leicht, dann aber zügig und lauter werdend vom Tal hoch. Ein Hubschrauber der Carabinieri überflog das schläfrige Dorf und schraubte sich den Berg hoch, flog langsam über das Waldgebiet, das Felicitas oberhalb von Seis ausmachen konnte.
Sie blickte sich erneut um. Thomas tauchte nicht auf.
Schon im Zug hatte sie vergeblich versucht, ihn zu erreichen. Er ging nicht an sein Handy. Auf ihre WhatsApp-Nachricht hatte er auch nicht reagiert. Felicitas war sauer.
Ihre Beziehung zu Thomas war nicht eindeutig definiert. »Wir sind ganz sicher kein Paar. Denn dazu gehören immer zwei«, dachte Feli. »Und ich bin nicht die Zweite. Punkt.« Ihre Beziehung fand auf einer höheren geistigen Ebene statt. So könnte man das vielleicht ausdrücken. Keine platonische Beziehung, kein Bruder-und-Schwester-Verhältnis. Felicitas brauchte Leute um sich, die viel wussten und sich auch ausdrücken konnten. Sie brauchte den intellektuellen Austausch, den Diskurs, den Disput. Ihr zukünftiger Partner musste dasselbe Format haben. So sah sie das. Thomas hatte die intellektuelle Kapazität. Vielleicht sogar im Übermaß. Aber es fehlte ihm das Gefühl, das, was eine Paarbeziehung braucht. Er war noch mehr Hirn als Felicitas, aber irgendwie nur wenig Fleisch und kaum Seele. Thomas sah das möglicherweise anders. Aber auch das war nicht klar. Waren sie »Freunde«?
Sie hatten sich an der Uni kennengelernt. Beide standen kurz vor ihrem Abschluss. Felicitas studierte Latein und Germanistik, Thomas Archäologie und Geschichte. Seinen Schwerpunkt hatte er auf das 14. und 15. Jahrhundert gelegt. Er konnte sich für die hohe Zeit der Ritter begeistern, studierte deren Sitten und Gebräuche, Ehrenkodex, Aufstieg und Niedergang. Thomas hatte viele Talente und er sprach fließend Latein, was Felicitas beeindruckt hatte. Wenn er ihr schrieb, dann ausschließlich auf Latein. So hatten sie eine Art Geheimbund – so kam es ihr jedenfalls eine Zeit lang vor. Für sie war Thomas ein interessanter Gesprächspartner, manchmal mit Witz, immer mit viel Wissen und Weitblick. Aber nicht mehr. Er hatte sich möglicherweise auch erhofft, Felicitas als Freundin zu gewinnen. Sie hatte ihm aber klar gemacht, dass da nichts laufen würde. Thomas machte danach auch keine Anstalten mehr, sich ihr zu nähern.
Als er ihr vor vier Wochen vorgeschlagen hatte, ihn in Südtirol zu besuchen, hatte sie zunächst gezögert. Eine Auszeit schien ihr verlockend, denn sie steckte in ihrer Arbeit fest, die sie für ihren Studienabschluss brauchte. Aber als Thomas ihr von der Bergwelt des Schlern vorschwärmte, dem guten Essen, der guten Luft und so weiter, ließ sie sich überreden. »Ich kann aber nicht ewig«, hatte sie ihm gesagt. Was nicht stimmte, denn sie hatte bis Ende Juni Zeit für ihre Arbeit eingeplant und musste bis dahin nicht mehr im Institut arbeiten, wo sie als wissenschaftliche Hilfskraft angestellt war.
Felicitas konnte einige Tage in schöner Umgebung gut gebrauchen. Das letzte Jahr war anstrengend gewesen. Zudem hatte Thomas sie auch mit den günstigen Kosten gelockt. Als sie dann noch eine billige Zugfahrt ergattert hatte, war alles perfekt. Sie hatte sich gefreut. Auch auf die Gespräche mit Thomas. Und jetzt war der Kerl nicht da, um sie abzuholen.
»Das fängt ja gut an«, brummelte sie und blickte sich um. Thomas hatte ihr gesagt, dass die Pension gegenüber der Bushaltestelle sein sollte. Es gab mehrere Häuser, die infrage kamen. Sie seufzte und marschierte zum ersten Haus. Sie hatte Glück. Es war die Pension, in der er wohnte. Die Wirtin machte aber ein entsetztes Gesicht, als Felicitas nach Thomas fragte.
»Jesses, Mädchen, komm rein. Oh Gott, oh Gott.« So war die Begrüßung. Was sie dann erfuhr, gefiel ihr gar nicht.
Die Wirtin, eine kleine, drahtige Frau führte sie in die Küche und bedeutete ihr, auf der Eckbank Platz zu nehmen. Sie stellte Felicitas unaufgefordert ein Glas Saft hin. »Sie sind vielleicht durstig. Nach der Reise …«, sagte sie leise und blickte sie dabei sorgenvoll an.
Felicitas begriff, dass die Wirtin über ihr Erscheinen informiert gewesen war, dass aber irgendetwas mit Thomas nicht stimmte. Sie trank einen Schluck und wartete.
»Ihr Verlobter«, fing die Wirtin an und Felicitas spürte, wie ihr die Hitze bis ins Gesicht schoss.
»Hat der mich als seine Verlobte hier vorgestellt«, wütete es in ihr. »Ich hätte es mir denken können …«
Die Wirtin hatte Felicitas rot werdendes Gesicht wahrscheinlich anders interpretiert, denn sie legte ihre Hände sorgend und tröstend auf Felicitas Hände.
Die Frau erzählte: »Also, Ihr Verlobter ist gestern, so wie jeden Tag, nach dem Frühstück losgegangen. Mit seinem Rucksack. Und bis jetzt ist er nicht wieder zurück. Ich habe heute Morgen die Carabinieri angerufen. Jetzt wird die Suchaktion anlaufen. Ich höre schon den Hubschrauber. Aber ich weiß ja gar nicht, wo Ihr Verlobter immer hingegangen ist.«
Sie vernahmen ein Klopfen. Die Wirtin stand auf, ging hinaus und kam mit einem Carabiniere wieder in die Küche.
»Das ist die Verlobte von meinem Gast«, stellte sie Felicitas vor. Der Carabiniere begrüßte sie knapp, setzte sich.
Er blickte die beiden Frauen nacheinander an, wandte sich an die ältere: »Sie haben die Vermisstenmeldung gemacht?« Die Wirtin nickte zur Bestätigung. Felicitas meinte wahrzunehmen, dass sie dem Polizisten gegenüber etwas zurückhaltend war. Da war ein Misstrauen. Zumindest war da nicht diese Herzlichkeit, mit der sie ihr gegenübergetreten war. Felicitas empfand das Auftreten des Polizisten als höflich und eher angenehm, denn der Mann wirkte in seiner tadellosen dunklen Uniform und seinem korrekten Auftreten wie die Verkörperung einer Instanz, die über den Dingen stand.
»Wir haben schon mit der Suche begonnen. Unser Hubschrauber ist im Einsatz, die Bergrettung informiert. Auch die Feuerwehr ist informiert. Allerdings haben wir von Ihnen keine Einschätzung erhalten, in welchem Gebiet wir suchen sollen. Deshalb bin ich hier.« Er blickte die ältere Frau fragend an.
»Ich kann Ihnen da leider nicht viel sagen. Der junge Mann wohnt seit drei Wochen bei mir. Er hat mir erzählt, dass er Archäologe sei und sich für das Schlerngebiet interessiere. Er sagte, hier gäbe es viel Interessantes zu erforschen.« Sie machte eine Pause. Es schien, als versuche sie, sich die Gesprächsinhalte wieder ins Gedächtnis zu holen. »Eigentlich hat er mir nichts Konkretes erzählt. Er hat aber allerhand Gerät dabei gehabt, das er auf seinen Touren mitgenommen hat. So einen langen Stecken mit einem Teller dran. Damit kann er Metall in der Erde finden, hat er mir erklärt …« Sie schaute Felicitas an. »Aber mehr weiß ich nicht. Morgens ging er weg und abends kam er wieder. Manchmal erst, nachdem es schon dunkel war. – Dann hat er oft noch in seinem Zimmer gesessen, denn ich habe noch Licht gesehen. Was er da gemacht hat, weiß ich nicht. Er war immer freundlich. Und irgendwie auch komisch. So abwesend. Manchmal habe ich mit ihm geredet und er hat das gar nicht verstanden, glaube ich.«
»Sie können uns also nicht sagen, wo genau er sich aufgehalten hat. Nur, dass er an jedem Tag wieder zurückgekommen ist?«
»Genau.«
»Hatte er ein Auto dabei?«
»Nein, der junge Mann war immer zu Fuß unterwegs. Er hat auch kein Auto. Er kam mit dem Bus.«
Der Carabiniere notierte etwas in seinem Block.
»Dann kann er sich also nur hier in einem Umkreis bewegt haben, den man mit einem Tagesmarsch umschreiben kann. Wissen Sie zufällig, ob er sich mit jemand anderem über seine Exkursionen unterhalten hat?«
»Nein. Das weiß ich nicht. Er ist auch abends nie in ein Gasthaus gegangen. Ich hatte ihm erlaubt, meinen Kühlschrank zu benutzen. Sie können sein Fach sehen.« Sie stand auf, öffnete den Kühlschrank und deutet auf das obere Fach. Darin lagen, in Papier eingewickelt, Essensvorräte. Der Form nach zu urteilen waren es Wurst, Käse und Butter sowie zwei Flaschen Bier. Das war alles.
Der Carabiniere wandte sich an Felicitas: »Sie sind seine Verlobte?«
»Nein, das bin ich nicht!«, kam vielleicht etwas zu entschieden, denn die Wirtin blickte sie erstaunt und auch etwas irritiert an. »Ich kenne Thomas von der Uni. Wir studieren zusammen in Münster. Er hat mich eingeladen, ihn hier zu besuchen. Ich bin gerade erst angekommen. Mit dem Bus aus Bozen.«
Die Wirtin schaute Felicitas fragend an.
»Ich weiß nicht, warum Thomas Ihnen erzählt hat, dass wir verlobt sind, aber das sind wir definitiv nicht. Er ist auch nicht mein Freund. Wir sind Kommilitonen und kennen uns halt.«
Der Carabiniere schaute die beiden mit leicht gerunzelter Stirn an, sagte aber zunächst nichts. Als die Pause, die entstanden war, eine Länge erreichte, die unangenehm wurde, wandte er sich Felicitas zu: »Wenn Sie den Vermissten gut gekannt haben, können Sie uns aber vielleicht dennoch helfen. Bitte beschreiben Sie mir den Mann«, und mit einer Wendung zur Wirtin, »Sie ergänzen bitte. Wichtig wäre zu wissen, was er getragen hat, als Sie ihn zum letzten Mal gesehen haben.«
Der Carabiniere notierte: 29 Jahre, circa 1 Meter 85 groß, hellblondes, volles Haar, schlank, breites Kreuz, muskulöse Figur. An dem Tag, als er verschwand, trug er eine normale Jeans, ein olivgrünes Hemd, darüber eine grüne Jacke mit vielen Taschen, wie sie beim Militär Verwendung findet. Außerdem hatte er einen Rucksack, blau, den er jeden Tag dabei hatte. Darin, so vermutet die Wirtin, hatte er Brote, eine Trinkflasche, Obst und vielleicht die Dinge, die er brauchte. »Er hat sich immer Brote geschmiert, bevor er losging. Und in der ersten Woche hatte er auch diese technischen Geräte dabei. Aber die hat er in einem Versteck gelassen, hat er mir erzählt. Damit er die nicht immer wieder mitschleppen muss.«
Der Carabiniere hatte alles in seinem Block notiert. »Was waren das für Geräte?« Die Wirtin zuckte mit den Schultern. »Irgendwas, womit man Metall finden kann.«
Felicitas schaltete sich ein: »Da kann ich helfen. Thomas studiert Archäologie. Er hat schon viele Ausgrabungen mitgemacht und er hat entsprechende Gerätschaften. Das, was Sie meinen, ist ein Metalldetektor. Den brauchen auch Schatzsucher, um zum Beispiel alte Münzen im Boden zu finden. Ansonsten brauchen Archäologen nicht sehr viel. Eine Schaufel, meist reicht auch schon ein Klappspaten, Pinsel und einige Spatel. Das meiste davon passt in einen Rucksack. Entscheidend ist eigentlich immer nur, dass man die eine Stelle findet, an der das Graben lohnt. Wenn man die einmal hat, dann muss man die Erdschicht vorsichtig Schicht für Schicht abtragen. Bei größeren Ausgrabungsstellen braucht man dann einen Wetterschutz, den man über dem Erdloch aufbaut. Das ist dann eine Art Zelt. Das wird schon etwas komplizierter mit dem Transport.«
»Wissen Sie denn, wonach er gesucht hat?«
Felicitas schüttelte ihren Kopf. »Thomas sucht immer irgendwo etwas. Das ist seine Berufung. Was genau er hier gesucht hat, weiß ich nicht. Er hat mir erzählt, dass es hier ›von Mittelalter‹ nur so wimmelt. Aber das sagt er immer, denn er geht nur dahin, wo es etwas zu erforschen oder zu finden gibt. Er ist halt ein Fachmann für das ausgehende Mittelalter. Hier in der Gegend interessierte ihn »Oswald von Wolkenstein«, ein Ritter, der hier irgendwo gewohnt haben soll.«
Die Wirtin meldete sich zu Wort: »Ja, der wohnte auf Burg Hauenstein, nicht weit von hier. Wenn man zur Santnerspitze blickt, liegt die Burgruine in Blickrichtung. Mitten im Hauensteiner Wald.« Der Carabiniere schrieb fleißig mit und blickte dann auf: »Dann können wir vielleicht das Suchgebiet etwas eingrenzen. Wäre es denkbar, dass er seine Arbeit, nennen wir sie ›Ausgrabungen‹, in oder in der Nähe der Ruine gemacht hat?«
Die Wirtin und Felicitas zuckten fast gleichzeitig mit den Schultern.
Der Carabiniere seufzte. »Aber es wäre denkbar, wenn wir davon ausgehen können, dass er morgens los ist und abends, nach vollendeter Arbeit wieder hierhergekommen ist?«
Die Wirtin bejahte.
»Gut, dann werden wir zunächst das Gebiet rund um die Ruine absuchen. Irgendwo müssen wir ja anfangen.« Nach einer kurzen Pause an Felicitas gewandt: »Haben Sie die Anschrift seiner Angehörigen?«
»Er hat keine Angehörigen mehr. Seine Eltern sind vor drei Jahren bei einem Unfall ums Leben gekommen. Geschwister hat er keine und es gibt meines Wissen nach auch keine Tanten oder Onkel. Thomas war Vollwaise.«
Der Carabiniere notierte auch das.
»Kann ich noch einen Blick in sein Zimmer werfen?«
Die Wirtin ging voraus und Felicitas folgte der kleinen Prozession, ohne dazu aufgefordert worden zu sein.
Das Zimmer von Thomas war ein typisches Pensionszimmer. Ein Doppelbett, Nachttischchen rechts und links daneben. Leselampen am Betthaupt. In der Mitte des Zimmers eine runde Deckenlampe. Ein Schrank, ein kleiner Tisch und zwei Stühle. Eine Tür führte wahrscheinlich zum separaten Badezimmer. Auf dem Schrank lag ein Koffer. Im Schrank hingen einige Hemden, Hosen, und auf den Regalböden lagen Unterwäsche und Socken. Der Carabiniere warf nur einen flüchtigen Blick hinein. Er interessierte sich mehr für die Notizbücher auf dem kleinen Tisch. Darin blätterte er. Dabei stutzte er. »Das ist ja Latein!«, entfuhr es ihm.
Felicitas musste schmunzeln. »Kann gut sein. Thomas spricht fließend Latein. Und er schreibt auch in dieser alten Sprache.«
Der Carabiniere musste lachen. »Das ist wirklich selten. Mir hilft das aber nicht weiter. – Was studieren Sie eigentlich?«
»Latein und Germanistik.«
»Dann können Sie das hier lesen?«
»Klar. Thomas und ich haben uns auch auf Latein unterhalten.«
»Gut, dann schlage ich vor, dass Sie das hier alles sichten. Wenn Sie darin einen Hinweis finden, wo wir suchen sollten, bitte rufen Sie mich an.«
Er reichte Felicitas eine Visitenkarte: »Maresciallo Stefan Kofler«.
Er grüßte kurz und verließ das Haus. Felicitas und die Wirtin sahen durch das Fenster, wie er von seinem Wagen aus telefonierte und kurz darauf hörten sie den Hubschrauber wieder, der jetzt Kurs auf den Hauensteiner Wald nahm.
*
Stefan Kofler kannte die Gegend im Schlerngebiet wie seine Westentasche. Er war hier aufgewachsen. Die Ruine Hauenstein lag mitten in einem großen Waldgebiet am Fuße des Santner, dem Frontberg des Schlernmassivs. Vom Hubschrauber aus würde man eine verletzte Einzelperson nur dann erkennen können, wenn die Sicht auf die Person nicht von den Baumwipfeln verdeckt wurde. Das Waldgebiet war zwar steil ansteigend, aber selbst für unerfahrene Wanderer nicht besonders gefährlich. Allerdings gab es viele Stellen, an denen sich Freeclimber ausprobierten. Auch die Ruine selber war ein beliebter Klettergarten für Jungalpinisten. Das Gute daran war, dass diese Gegend fast täglich von vielen Menschen besucht wurde. Sollte dort jemand verunglücken, war die Chance gefunden zu werden relativ groß.
»Er ist jetzt seit gestern Abend vermisst. Er könnte somit im Laufe des gestrigen Tages irgendwo da oben verunglückt sein. Welchen Weg würde ich nehmen, wenn ich von hier aus starte, um nach Hauenstein zu kommen?« Er ging den Weg in Gedanken durch, zog dann einen Kreis von zwei Kilometern um die Burg und sah das Gebiet, in dem er zunächst suchen würde, vor seinem geistigen Auge. Dann informierte er die Hubschrauberbesatzung, die Feuerwehr und die Hundeführer des Bezirks.
»Wenn wir ihn heute nicht finden, wird es kompliziert«, überlegte er.
*
Felicitas schaute sich in Thomas’ Zimmer um. Die Wirtin hatte ihr noch erzählt, dass er kein separates Zimmer für sie gebucht hatte. Sie war davon ausgegangen, dass sie dieses Zimmer teilten, wo er sie doch als seine Verlobte angekündigt hatte.
»Was der sich vorstellt?«, wütete es in ihr. Aber die Wut wurde auch von der Sorge um Thomas gedämpft. Was, wenn er in den Bergen verunglückt war? Hier war sie die Einzige, die etwas über ihn wusste. Sein Schicksal war nicht einfach. Seine Eltern hatten ihm ein beträchtliches Vermögen hinterlassen, sodass er keine materiellen Sorgen hatte. Aber er war von heute auf morgen auf sich alleine gestellt gewesen. Seine Familie hatte nur aus seinen Eltern bestanden.
Felicitas hatte bis heute nicht in seine Seele blicken können. Nach außen war er eher der fröhliche Typ, den nichts umhauen konnte. Gut, er war schon ein wenig speziell mit seinem »Rittertick« wie sie es nannte. Bastelte sich Rittergewänder, Kettenhemden und so ein Zeug und machte bei diesen Ritterspielen mit, die es seit einigen Jahren überall gab. Er kannte über diese Community auch relativ viele Leute. Aber ihm ging es um mehr als das Gemeinschaftserlebnis. Er forschte wirklich über diese Zeit, las unglaublich viel, hatte in seiner kleinen Wohnung die Wände tapeziert mit Karten, Skizzen und Zeitabläufen.
Was wollte er hier in Seis? Was hatte er ihr erzählt? Sie wusste es nicht mehr so genau, weil es sie auch nicht interessiert hatte. Irgendetwas mit diesem Oswald von Wolkenstein, da war sie sich sicher.
Die Wirtin sagte, dass er das Zimmer im Voraus bis Mitte Juli bezahlt hätte. Er plante also einen längeren Aufenthalt. So gut kannte sie ihn, dass sie jetzt annehmen konnte, dass er einen Plan hatte. Er wusste, was er hier wollte. Dass sie hier war, hatte sie dem Umstand zu verdanken, dass sie ihm gegenüber geäußert hatte, dass sie dringend erholungsbedürftig sei. Er hatte sie auf diese Äußerung hin spontan nach Seis eingeladen. Er kümmere sich um alles.
Mangels anderer Gelegenheit und weil sie selber keine Zeit gefunden hatte, für sich zu sorgen, hatte sie zugestimmt. Sie hatte nie Zeit. Immer war viel zu tun. Im Institut, in der Uni, am Schreibtisch. Felicitas lebte auf der Überholspur und konnte sich daher um so profane Dinge wie Ordnung, Urlaub, Einkäufe nur selten kümmern. In ihrem Kopf war allerdings Ordnung. Da war Analyse, da war Stringenz, da herrschte Logik. Das Äußere beachtete sie nicht. Als Jahrgangsbeste Abitur gemacht, ein Förderprogramm nach dem anderen gewonnen, ein »Erasmusjahr« in Italien verbracht, zwei Jobs an der Uni, mit denen sie ihre Studienzeit finanzierte. Da blieb keine Zeit für die unwichtigen Dinge des Lebens. Dementsprechend chaotisch sah es um sie herum aus. Ihr Studienzimmer in Münster quoll über von Papieren. Niemand außer ihr wusste, was wo lag. Aufgeschlagene Bücher überall. »Nur das Genie beherrscht das Chaos«, war einer ihrer Sprüche, mit denen sie auf die Kritik ihrer Mitbewohnerin zu reagieren pflegte.
Und als Felicitas ihren kleinen Rollenkoffer ausgepackt hatte, sah auch Thomas’ Zimmer so aus wie ihre Studienbude zu Hause. Ihr Laptop lag auf dem Bett, auf dem Boden türmten sich die vier Bücher, die sie mitgenommen hatte, zu einem kleinen Stapel, ihre Wäsche und ihre übrige Garderobe hatte sie in das freie Fach eines kleinen Regals gestopft. Die Wirtin hatte nur dieses eine Zimmer frei, denn sie erwartete für das einzige weitere freie Zimmer heute noch ihren Sohn, der für einige Wochen zu Besuch kommen wollte. So hatte Felicitas beschlossen, dieses Zimmer zu akzeptieren. Für den Fall, dass er wieder auftauchte, was sie sehr hoffte, würde sie schon dafür sorgen, dass er den Abstand hielt, auf den es ihr ankam.
Sie hatte sich an den Vorräten von Thomas im Kühlschrank bedient und stöberte jetzt in seinen Aufzeichnungen. Auf dem kleinen Tisch lagen einige Kladden, die er häufig für seine Aufzeichnungen verwendete. Die meisten Dinge hatte er auf Latein verfasst. Felicitas musste schmunzeln. Sie konnte alles fließend lesen. Eine der Kladden hatte die Überschrift: »OvW«. »Klar: ›OvW‹ heißt Oswald von Wolkenstein.« In der Kladde fand sie Stichworte, Zitatstellen, Sätze und Worte, die wahrscheinlich nur für Thomas Sinn machten.
Zum Beispiel fand sich da folgender Eintrag:
Dieter Kühn: Seiten 266 ff / »überaus wertvolle Robe«
»Der plötzliche Reichtum des Wolkensteiners.«
»Brokatrobe«
»Golddurchwirkter quftan (Kaftan)« – mehrere Kilo Gold eingewebt (Seite 270)
Geraubt in Ceuta.
Und so ging es weiter. »Typisch Thomas«, dachte Felicitas. »Er war wieder einer These auf der Spur, las viel, notierte sich Fundstellen, die für seine Gedankenwelt wichtig waren.« Aber alle diese Eintragungen ergaben nur dann einen Sinn, sobald er diese Gedankensplitter und Erinnerungsfetzen in einen Text goss. Und das machte er natürlich nicht mit der Hand, sondern am Rechner.
Was Felicitas wunderte, war, dass sie keinen Laptop fand. Thomas hatte natürlich einen Laptop, ohne kam niemand mehr aus. Seine Kladden waren nur Skizzenhefte, die er brauchte, um Gedanken zu Papier zu bringen, Stichworte zu notieren, Fundstellen schnell zu skizzieren. Alles, um seine wissenschaftlichen Texte auf dem Rechner zu schreiben. Wo aber war der Laptop? »Er könnte ihn natürlich mitgenommen haben. In seinem Rucksack. Das wäre zwar ungewöhnlich, aber denkbar.«
*
»Dann ist das also beschlossene Sache!«
»Ja. Es gilt.«
Die Männer gaben sich feierlich die Hand. Das war nicht so einfach. Denn sie konnten sich nicht sehen, nur hören. Rainer Delago hatte darauf bestanden, dass das Gespräch im »Blindprobe-Sensorium« in Völs geführt wurde. Er wollte erleben, wie sein Gast darauf reagierte. Johann Spögler musste sein Handy und seine superteure Uhr im Vorraum abgeben, weil das die Regel so wollte. Das Blindprobe-Sensorium war ein absolut schwarzer Raum, dessen Dunkelheit niemals durch leuchtende Uhrzeiger oder Handydisplays Licht erfahren sollte. Diese Regeln hatten die Blinden aufgestellt, die im Sensorium den Service leiteten. »Es soll einen Ort geben, an dem Sehende nicht sehen können. Daran werden sie sich immer erinnern«, so ihr Wunsch. Und Rainer Delago, gedanklicher Vater des Sensoriums und treuester Wächter dieser Einrichtung, hielt sich daran. Außerdem war es für ihn immer wieder spannend zu erleben, wie die Menschen auf diese undurchdringliche Dunkelheit reagierten. Wenn der Sehsinn nicht eingesetzt werden konnte, kam mit der Zeit ein besonderes Empfinden empor. Die anderen Sinne wurden stärker. Insbesondere der Geschmacks- und der Geruchssinn wurden geschärft, was Spitzensommeliers gerne nutzten. Sie buchten das Blindprobe-Sensorium als Trainingslager. Aber auch die Kommunikation veränderte sich. Der nonverbale Teil der Kommunikation, die Mimik, der Gesichtsausdruck fiel als Informationsquelle weg. Worte wurden ganz anders benutzt. Man musste den anderen aussprechen lassen, konnte ihm nicht ins Wort fallen, da man nicht sehen konnte, wann der andere zu Ende gesprochen haben würde.
Delago hatte noch einen Grund, warum er das Gespräch im dunklen Raum führen wollte. Johann Spögler war eine imposante Erscheinung. Er hatte eine faszinierende Ausstrahlung. »Augen, so klar und so scharf, wie bei einem Greifvogel«, hatte Delago assoziiert, als er diesen Mann das erste Mal gesehen hatte. Er war Johann Spögler zuvor schon öfter im Romantik Hotel Turm begegnet. Sein Sensorium lag in unmittelbarer Nähe und es verging kaum ein Tag, an dem er nicht mit dem Inhaber des Hotels, das alle nur »Turm« nannten, etwas zu besprechen hatte. Johann Spögler war großgewachsen und füllte jeden Türrahmen, wenn er ihn durchschritt. Er hatte eine aristokratische Haltung, seine Bewegungen wirkten edel. Sein volles, dunkles Haar trug er stets streng nach hinten gekämmt.
Er musste alt sein, denn seine Gesichtsfalten zeugten von einem bewegten Leben. Aber die Dynamik, mit der er auftrat, gab ihm einen sportlichen Anstrich. Das ließ ihn jünger wirken, als er vermutlich war. »Als junger Mann hätte er ein Zehnkämpfer sein können«, dachte Delago, als er ihn zusammen mit seinen beiden Begleitern durch die große Bar des Hotels schreiten sah. Die Männer an seiner Seite hielten zwar Schritt, aber Spögler wirkte stets so, als gebe er das Tempo vor. Er erfasste blitzschnell, wer sonst noch im Raum war. Betrat er einen Raum, blickte er kurz zu jedem Anwesenden hin und erreichte so, dass sich alle ihm zuwandten. Auch die Menschen, die mit anderen Dingen beschäftigt waren, konnten sich seiner Präsenz nicht entziehen. Zu seinem Freund, dem Hotelinhaber gewandt, raunte Rainer: »Dein Gast zieht hier die Luft raus.« Stephan Pramstrahler nickte nur, grüßte dann freundlich Richtung Spögler, der, als er die beiden passierte, ganz kurz die Augenbrauen hob, was wie ein Gruß wirkte.
»Der ist schon anders als die anderen. Speziell. Aber ein guter Gast«, was so viel hieß, dass er nicht aufs Geld achten musste.
Als ihn sein Freund später darauf ansprach, dass Johann Spögler sein Sensorium für eine Veranstaltung mieten wollte, hatte Rainer Delago darauf bestanden, das Gespräch im dunklen Teil des Sensoriums zu führen. »Da, wo man nicht sehen kann, siehst du, mit wem du es zu tun hast«, hatte er gesagt. Er wollte sich nicht durch die durchdringende Präsenz von Spögler ablenken lassen. Und er wollte herausfinden, ob und wie diese Präsenz im Dunkeln wirkte.
Johann Spögler war mit allem einverstanden. Das Gespräch nahm dann auch einen unerwarteten Verlauf.
»Legen Sie bitte Ihre Uhr und Ihr Handy ab, bevor wir in das Sensorium gehen. Hier ist eine Schublade, in die Sie alles legen können.«
Dann ging Delago voraus und bedeutete seinem Gesprächspartner, ihm seine Hand auf die Schulter zu legen. Man ging durch eine Art Schleuse und erreichte einen tiefschwarzen Raum. Zunächst gaukelte das Auge dem Gehirn vor, dass es etwas gäbe, was man sehen konnte. Das waren aber nur die letzten Lichteindrücke auf der Netzhaut, die bald schon vergehen sollten. Dann umfing einen jeden, der im Sensorium war, reine Schwärze, tiefste Dunkelheit.
»Wenn sich Ihre Augen und Ihr Gehirn an die Dunkelheit gewöhnt haben, werden Sie spüren, was dieser Raum mit Ihnen macht«. Rainer Delago erzählte ruhig, dass viele Menschen, die diesen Raum erlebt hatten, ihm später erzählten, dass sie hier zur Ruhe kommen könnten. Viele meinten auch, dass die Zeit hier ein anderes Tempo habe. »Sie werden erleben, dass Sie, wenn wir diesen Raum verlassen, mehr Zeit darin verbracht haben, als Sie es einschätzen.«
»Aber jetzt gebe ich Ihnen etwas zum Fühlen.«
Johann Spögler hörte, wie Delago aufstand, sich im Raum bewegte und wieder zum Tisch zurückkam und ihm etwas in die Hand gab. Es fühlte sich glatt an. Warm. Es hatte eine Form, die nicht schnell darauf schließen ließ, was es war.
»Sie müssen es nicht erraten. Das ist keine Aufgabe. Aber spüren Sie, wie sich die Form in Ihren Händen zu einem Bild vor Ihrem inneren Auge entwickelt? Sie fühlen und tasten. Ihr Gehirn nutzt jetzt nur Ihren Tastsinn. Und Sie werden erleben, dass Sie die Dinge erkennen.«
Er wurde nicht ungeduldig. Er war ruhig. Sehr ruhig sogar. Rainer Delago hörte ihn kaum atmen. Er hörte nur das leichte Streichen der Finger über den Gegenstand.
»Es ist ein Engel. Abstrakte Form. Auf das Wesentliche reduzierte Form. Schmaler, edler Kopf, Flügel, die so angeordnet sind, dass ich davon ausgehe, dass er die Schultern leicht gedreht hat, so als blicke er nach links oben. Das senkt die rechte Schulter. Schlanker Körper, der nur leicht angedeutet ist. Füße sind nicht zu tasten. Ein sphärisches Wesen.«
Die Analyse kam knapp, schnell und präzise. Seine Stimme war leise, sanft und ruhig.
Aber es fehlte ihr etwas. Delago war sich nicht sicher, was es war. »Sie sind gut im Erkennen der Form. Für Sie ist die Form jetzt ein Engel. Dann ist es ein Engel. Wir sehen immer nur das, was wir aufnehmen.«
»Ich habe für Sie jetzt drei Weine vorbereitet, die ich mit Ihnen gemeinsam verkosten möchte.« Er holte zwei Gläser mit dem ersten Wein, den er zuvor im Sensorium abgestellt hatte.
Spögler probierte. Sagte zunächst nichts. Dann musste er leise lachen. »Ist gar nicht so einfach. Ist das jetzt ein roter oder ein weißer Wein. Schwer zu sagen. Ich hätte zuvor geschworen, dass ich zumindest den Unterschied sofort schmecke.«
Über die Weine kamen sie ins Gespräch und Delago erfuhr so manches.
Seinem Gegenüber war das Schlerngebiet nicht unbekannt. Er war 1937 in Südtirol geboren worden. »Dann ist er jetzt 78 Jahre«, rechnete Rainer Delago schnell. »Dann sieht er aber bedeutend jünger aus, als er ist.« Seine Eltern hatten 1939 optiert und waren mit einem der ersten Züge raus aus Südtirol. Das war im Winter 1939/40. Seine Familie war nicht mit materiellen Gütern gesegnet gewesen. Sein Vater war Schuster, trank gerne und seine Mutter war oft krank. Die Lunge. Kaum in Deutschland angekommen, wurde sein Vater eingezogen und war bis Kriegsende im Russland-Feldzug gewesen. Als er nach Hause kam, hatte er sich verändert. Er sprach kaum, trank noch immer, war schnell gereizt und gewalttätig.
1951 waren sie nach Südtirol zurückgekehrt. Kurz darauf starb seine Mutter. Sie hatten keine anständige Wohnung bekommen, sodass die Lungenkrankheit der Mutter nicht besser werden konnte. Der Vater hatte ihn mit vierzehn zu einem Bekannten auf den Hof gegeben. »Schau zu, dass du was wirst«, war der letzte Satz, den er von ihm gehört hatte. Der Hof, auf den er als Knecht gegeben wurde, lag in Seis. Aus dieser Zeit kenne er die Gegend hier ganz gut. Seis, Völs, Kastelruth und die anderen Dörfer seien ihm vertraut, auch wenn sich viel getan habe, seit der Zeit, als er von hier weggegangen war. »Denn hier war kein gutes Leben damals«, sagte er. »Arbeit von früh bis spät. Schläge, wenn es nicht recht war.« Er erzählte, dass er mit siebzehn abgehauen war. Seine Stimme hatte sich bei dieser Erzählung verändert. Sie wirkte traurig, aber auch trotzig.
»Und jetzt sind Sie wieder hier«, sprach Delago in die entstandene Pause hinein.
»Ja, jetzt bin ich wieder hier.« Und nach einer längeren Pause, die Rainer Delago nicht unterbrach, weil er spürte, dass sich hier etwas Bahn brach, fügt er hinzu: »Und ich bin gespannt, wie mich meine alte Heimat aufnimmt.«
Nach dem dritten Wein wurde Spögler dann wieder geschäftlich. Er wolle das Sensorium für den Tag des Festumzugs aus Anlass des 33. Oswald-von-Wolkenstein-Ritts mieten. »Ich möchte hier ausgewählte Gäste exklusiv bewirten. Ich plane, in Südtirol einige exquisite Restaurants einzuführen, die ihren Schwerpunkt auf meine Edelprodukte Kaviar, Hummer, Austern legen. Treffpunkte für die, die an solchen Genüssen ihre Freude haben. Ich möchte den Ritt nutzen, um mich hier bei den maßgebenden Leuten bekannt zu machen.«
»Daher weht der Wind«, dachte der Gastronom. Er wusste, dass Johann Spögler hier kein Unbekannter war. Er hatte sich im vorausgegangenen Jahr als Sponsor für den 33. Ritt beworben. »Beworben« war vielleicht nicht ganz richtig. Er hatte eine so große Summe angeboten, dass die Initiatoren der Veranstaltung gar nicht nein sagen hätten können. Warum er so großzügig war, konnte sich niemand erklären. Er tauchte plötzlich auf, fragte sich nach den Verantwortlichen durch und bot eine Riesensumme Sponsorengeld. Mehr als die Raiffeisenkasse jemals aufgebracht hatte, und die war seit Jahren der Hauptsponsor gewesen. Rainer Delago wusste das alles aus »dem Turm«. Alle Initiatoren des Ritts trafen sich hier regelmäßig, und natürlich war das Auftreten eines generösen Sponsors Thema über das Jahr gewesen. »Was sollen wir von ihm halten? Wird er wirklich diese große Summe zahlen? Warum macht er das überhaupt? Wo kommt der eigentlich her, denn von hier ist er nicht.« Und so weiter.
»Der will hier ins Geschäft kommen und mein Sensorium für eine Präsentationsveranstaltung nutzen«, dachte Rainer Delago, und im selben Moment sagte dieser Mann: »Ich werde Sie großzügig dafür entschädigen. Ich werde aber Ihre Hilfe benötigen, denn vor Ihrem Haus werde ich ein größeres Zelt aufbauen lassen, wenn Sie das gestatten. Die eigentliche Kaviarprobe kann dann gerne hier im Sensorium durchgeführt werden. Wie viele Personen passen hier gleichzeitig rein?«
Sie besprachen weitere Details, und es zeigte sich, dass Johann Spögler schon an vieles gedacht hatte. So wusste er, dass am Tag des Festumzugs der gesamte »Kirchplatz«, also auch der Platz vor dem Sensorium, durch den Mittelaltermarkt besetzt war. Aber er hatte schon um eine Ausnahmegenehmigung für ein Zelt angesucht und diese erhalten.
»Da wird er auch ordentlich gespendet haben«, dachte Delago. Und, als könne Spögler seine Gedanken lesen, sagte er: »Es war nicht billig, diese Ausnahmegenehmigung zu erhalten, aber es ist in unser aller Sinne. Ihr Sensorium wird eine Sonderrolle am Abend des Festumzugs spielen, die Gemeindekasse ist zufrieden und ich habe eine Plattform, die mir für meine Zwecke passend erscheint.« Und wie um die Sache abzuschließen, fügte er hinzu: »Am Anfang muss man immer klotzen, wenn man eine Geschäftsidee etablieren will. Also, dann ist das also beschlossene Sache!«
»Ja. Es gilt.«
Zwei
2. Mai
Als Felicitas zum Frühstück hinunterging, war sie nicht allein, als sie einen Blick in die Küche warf. Am Tisch saß ein Typ, der sie fröhlich und neugierig ansah. Sie hatte schlecht geschlafen. Die Sorge um Thomas hatte sie nicht zu Schlaf kommen lassen. Zu viele Gedanken schossen ihr durch den Kopf. Was, wenn die Carabinieri ihn nicht finden würden? Wo könnte man am sinnvollsten nach ihm suchen? Warum war sein Laptop nicht auffindbar?
Sie hatte in der Nacht noch einige seiner Aufzeichnungen studiert, aber nichts gefunden, das einen Hinweis darauf gab, was er genau hier wollte. Die meisten Eintragungen bezogen sich auf Oswald von Wolkenstein.
»Hallo, ich heiße Benjamin Malfertheiner.« Der junge Mann nickte ihr aufmunternd zu und deutete auf ein Frühstücksgedeck, das ihm gegenüber auf dem Küchentisch stand, an dem Felicitas schon gestern Nachmittag Platz genommen hatte.
»Die Pension hat also kein Frühstückszimmer – auch gut.« Und der junge Mann, der sie weiter freundlich interessiert ansah, schien ihre Gedanken lesen zu können.
»Meine Mutter hat nur zwei Fremdenzimmer. Deshalb sitzen alle Gäste immer in ihrer Küche zum Frühstück.« Er lachte. »Und ich bin der Gast von Zimmer 2.«
Felicitas schaute ihr Gegenüber an. Kräftig war er. Groß auch, soweit man das beurteilen kann, wenn einer vor einem sitzt. »Hübsch geschnittene Gesichtszüge, so wie ein römischer Feldherr«, dachte sie. Felicitas liebte Italien, die italienische Sprache, die Kultur und war deshalb so oft wie sie konnte dort auf Studienreisen gewesen. Sie liebte die Skulpturen, die das alte Römische Reich hervorgebracht hatte. »Und vor mir sitzt jetzt so eine Skulptur«, sinnierte sie schlaftrunken und deshalb noch nicht ganz in der Gegenwart angekommen.
»Frische Brötchen?« Die Skulptur reichte ihr einen Korb. »Habe ich selber vom Bäcker geholt. Ich bin nicht nur der Gast von Zimmer 2, sondern auch der Sohn des Hauses. Muss mir meinen Aufenthalt eben erarbeiten«. Zwei schneeweiße Zahnreihen strahlten sie an.
»Was?«
»Du bist noch nicht ganz wach?«
Felicitas schüttelte leicht den Kopf.
»Kaffee?«
Felicitas nickte leicht mit dem Kopf.
Benjamin griff nach einem Brötchen, schnitt es durch, strich Butter darauf, belegte es mit Käse und biss hinein. Felicitas begleitete sein Tun mit ihren Blicken. Ihr war, als schaute sie in einen Fernseher. Alles, was sie sah, schien ihr nicht echt, nicht wirklich. Alles, was sie hier erlebt hatte, war nicht so, wie sie es erwartet hatte. Konnte es ja auch nicht sein. Thomas war nicht hier und er sollte doch hier sein. Jetzt saß da ein anderer, der sie immer nur ansah. Nicht blöd, aber doch irgendwie schon. Also nicht der Typ, aber die ganze Situation.
Nach dem ersten Schluck Kaffee ging es besser. Sie sortierte ihre Gedanken. Blickte sich auf dem Tisch um und fand dort eine appetitliche Auswahl. Ihr Hunger meldete sich. Sie seufzte leicht und griff dann zu.
Der Wirtssohn hatte sie nicht aus den Augen gelassen. Er wusste von seiner Mutter, dass die junge Deutsche die Verlobte eines abgängigen Gastes war. Oder auch nicht Verlobte, das wusste die Mutter nicht so genau. Der Gast hatte sie als seine Verlobte angekündigt, aber die junge Deutsche hätte es abgestritten, als man sie darauf angesprochen hatte. »Die ist hübsch«, war sein erster Gedanke, als sie durch die Tür kam. Seine italienischen Freunde würden sofort die »blonde Tedesca« umschwärmen, weil sie immer alle Frauen mit langen blonden Haaren umschwärmten. Schwedinnen, Däninnen gehen auch. Aber eine »blonde Tedesca« stand, warum auch immer, im Kurs ganz oben.
Felicitas hatte bemerkt, dass Benjamin sie interessiert musterte. Das gefiel ihr besser, als wenn er das nicht getan hätte. Heute Morgen war ihr aber nicht nach einem Flirt über die Kaffeetasse hinweg. Sie wollte aber auch nicht unhöflich wirken. Deshalb fragte sie: »Der Gast aus Zimmer 2 ist also der Sohn des Hauses? Zu Besuch hier?«
Benjamin lachte sie an: »Zu Besuch im alten Jugendzimmer. Und Zimmer 1 war das Zimmer meiner älteren Schwester. Meine Mutter hat unsere Zimmer in Fremdenzimmer umgewandelt, als wir hier raus sind. Der Vater ist leider früh verunglückt, und die Pacht und der eigene Garten werfen nicht so viel ab, dass sie davon leben kann. Aber mit der Vermietung kommt sie über die Runden.«
Felicitas köpfte eines der Frühstückseier.
»Das Ei ist von der Elsa.« Und auf Felicitas fragenden Blick hin: »Du erkennst es daran, dass die Schale leicht rötlich ist und kleine rote Sprengsel hat. Solche Eier legt nur die Elsa. Unsere Hühner haben alle Namen!«
»Ein Elsa-Ei also. Sehr angenehm.«
Felicitas musste lachen. Benjamin freute sich, die junge Frau aus Zimmer Nummer 1 aufgemuntert zu haben.
»Wie heißt du eigentlich?«
»Felicitas«
»Meine Mutter hat mir erzählt, dass du die Verlobte bist, von dem Gast, der seit Donnerstagabend vermisst wird?«
Felicitas schüttelte den Kopf: »Wir sind nicht verlobt. Thomas ist nur ein Studienfreund von mir. Ich wollte hier ein, zwei Wochen ausspannen. Er hat mich quasi eingeladen. Dass er mich hier als seine Verlobte ausgegeben hat, ist schon schräg. Ich weiß auch nicht, warum er das getan hat.«
Benjamin blickte kurz zur Tür, so als wolle er sicher sein, dass seine Mutter nicht plötzlich hier erschien. »Vielleicht war es eine Notlüge. Wenn dein Studienfreund dich hier einquartieren wollte, dann wäre das vielleicht nur so gegangen. Meine Mutter ist, na ja, sagen wir es so: Sie ist sehr konservativ und ein zweites Zimmer hätte sie für dich nicht gehabt, denn das bewohne ich seit gestern Abend. Aber wenn dein Studienfreund dich als seine Verlobte ausgegeben hat, dann wird meine Mutter ihr konservatives Auge zugedrückt haben.«
»Du meinst, wenn ich nur seine ›Freundin‹ gewesen wäre, dann hätte sie uns nicht zusammenwohnen lassen? – Gibt es so was noch?«
Ihr Gegenüber grinste: »Ich glaube, das gibt es nur noch hier. Meine Mutter ist da halt speziell. Und wenn dein Studiosus das geschnallt hat, dann hat er das schon ganz richtig angestellt.«
»Das ließe Thomas dann doch wieder in einem besseren Licht erscheinen, als ich zunächst gedacht habe«, überlegte Felicitas. Ihre Laune stieg langsam.
»Was machst du eigentlich hier in deinem alten Jugendzimmer? Urlaub?«