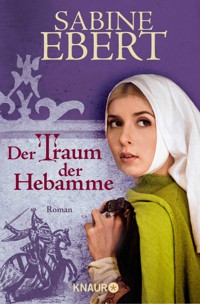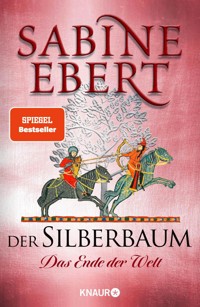
18,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Knaur eBook
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Der Silberbaum
- Sprache: Deutsch
Kommen Sie mit auf Zeitreise ins deutsche Hochmittelalter »Der Silberbaum. Das Ende der Welt« ist der 2. Band der Mittelalter-Saga »Der Silberbaum« von Bestseller-Autorin Sabine Ebert: akribisch recherchiert – herausragend erzählt! Der noch junge Meißner Fürst Markgraf Heinrich muss sich einer nie da gewesenen Bedrohung stellen. Doch als endlich bessere Zeiten anbrechen, er glänzende Turniere veranstaltet, die Aussicht bekommt, Thüringen zu erben und seinen Sohn mit einer Kaisertochter zu vermählen, trifft ihn ein schmerzlicher Verlust. Dann wird auch noch der Stauferkaiser Friedrich II. von der Kirche für abgesetzt erklärt. Heinrich muss viele Stufen von Verrat miterleben, als sogar enge Verwandte die Seiten wechseln. In diesen dunklen Zeiten stehen ihm vor allem Marthes Sohn Thomas, ihr Enkel Christian und ihre Enkelin Änne zur Seite. Die Dichterin Milena wird nicht nur zur Chronistin der Ereignisse, sie beweist auch die Kraft von erzählter Geschichte. Die historische Roman-Reihe um den vielleicht außergewöhnlichsten Fürsten des Mittelalters Heinrich der Erlauchte gilt bis heute als Herrscher mit glanzvoller Hofhaltung und Förderer der Städte. Er zählt auch zu den bekanntesten Minnesängern seiner Zeit. Sabine Eberts "Silberbaum"-Trilogie schlägt den Bogen zu ihrer beliebten Bestseller-Reihe um die Hebamme Marthe. Wie es Heinrich trotz des viel zu frühen Todes seines Vaters gelingt, dessen Erbe anzutreten, erzählt der 1. Band der Reihe, »Der Silberbaum. Die siebente Tugend«. Band 3 der als Trilogie konzipierten Mittelalter-Reihe ist in Vorbereitung.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 536
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Sabine Ebert
Der Silberbaum
Das Ende der Welt
Roman
Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.
Über dieses Buch
Der noch junge Meißner Fürst Markgraf Heinrich muss sich einer nie da gewesenen Bedrohung stellen. Doch als endlich bessere Zeiten anbrechen, er glänzende Turniere veranstaltet, die Aussicht bekommt, Thüringen zu erben und seinen Sohn mit einer Kaisertochter zu vermählen, trifft ihn ein schmerzlicher Verlust. Dann wird auch noch der Stauferkaiser Friedrich II. von der Kirche für abgesetzt erklärt. Heinrich muss viele Stufen von Verrat miterleben, als sogar enge Verwandte die Seiten wechseln. In diesen dunklen Zeiten stehen ihm vor allem Marthes Sohn Thomas, ihr Enkel Christian und ihre Enkelin Änne zur Seite. Die Dichterin Milena wird nicht nur zur Chronistin der Ereignisse, sie beweist auch die Kraft von erzählter Geschichte.
Weitere Informationen finden Sie unter: www.droemer-knaur.de
Inhaltsübersicht
Karte: Mitteldeutschland 1241
Karte: Mitteldeutschland 1250
Widmung
Dramatis Personae
Motto
ERSTER TEIL
Kriegsrat
Warten in Dresden
Die letzten Anweisungen
Aufruhr in Freiberg
Abschied
Warten
Nürnberg, Sommer 1241
Der junge König
Warten auf ein Wunder
ZWEITER TEIL
Festvorbereitungen
Das große Fest
Verdeckte und offene Kämpfe
Beinahe zu spät
Eine unerwartete Begegnung
Unglaubliche Geschichten
Die lange Schicht
Ohne Ausweg
Unglücksbotschaft
Trauer
DRITTER TEIL
Ein bemerkenswertes Gespräch
Nachricht aus Quedlinburg
Unerwünschte Besucher
Zukunftspläne
Träume und Albträume
Heimkehr
Eine aufregende Reise
Ein gutes Jahr
Jäher Abschied
Abschied
Der Preis des Krieges
VIERTER TEIL
Die Tochter des Kaisers
Familienstreitigkeiten
Angriff auf den Kaiser
Eine Farce von einem Prozess
Ein ungeheuerlicher Verrat
Drei unerwartete Ereignisse
Noch mehr Familienstreitigkeiten
Gute und schlechte Nachrichten
Hoffnungen und Träume
Ein unerwarteter Besucher
FÜNFTER TEIL
Der Pfaffenkönig
Die Schlacht bei Frankfurt
Die Schlacht der Könige
Schlimme Nachrichten
Ein Irrtum mit fatalen Folgen
Abschied und Ausblick
Nachwort
Danksagung
Anhang
Stammtafeln
Die Staufer
Die Wettiner
Die Ludowinger
Die Babenberger
Glossar
Zeittafel
Mitteldeutschland 1241
Diese Landkarte finden Sie auch im Internet unter folgendem Link: www.droemer-knaur.de/buch/sabine-ebert-der-silberbaum-das-ende-der-welt-9783426227909
Mitteldeutschland 1250
Diese Landkarte finden Sie auch im Internet unter folgendem Link: www.droemer-knaur.de/buch/sabine-ebert-der-silberbaum-das-ende-der-welt-9783426227909
Für meine Schwester, die mir in schwerer Zeit eine große Bürde abgenommen und selbst getragen hat, damit ich dieses Buch schreiben konnte
Dramatis Personae
Historisch belegte Personen sind mit * gekennzeichnet.
Meißen
Heinrich* von Wettin, Markgraf von Meißen und der Lausitz
Konstanze* von Babenberg, Tochter des Herzogs Leopold VI.* von Österreich, Herzog der Steiermark, und Gemahlin Heinrichs
Albrecht* und Dietrich*, Söhne von Heinrich und Konstanze
Agnes* von Böhmen, Tochter von König Wenzel und Heinrichs zweite Gemahlin
Thomas, Sohn des Begründers von Freiberg, Christian*, und dessen Frau Marthe, Erzieher und Ratgeber Heinrichs
Christian, Ritter, sein Sohn
Mariam, seine Frau
Hanka, ihre Tochter, und Lukas, ihr Sohn
Reinhard, sein Knappe, Sohn von Änne und Simon von Werratal
Marek von Storchenheim, Ritter und Freund von Christian
Milena, seine Frau, Geschichtenerzählerin
Mathilda, ihre Tochter, und Roland, ihr Sohn
Meinher* von Werben, Burggraf
Heinrich* von Borna, Truchsess
Heinrich* von Gnandstein, Marschall
Alwina, seine Frau
Konrad* von Gnandstein, Kämmerer, Bruder des Marschalls
Alexander*, Kaplan
Christoph*, markgräflicher Notar
Konrad* von Wallhausen, Bischof von Meißen
Heinrich*, Geistlicher, unehelicher Sohn Markgraf Dietrichs, später Dompropst von Meißen
Tammo* von Schönfeld, meißnischer Ritter
Sophia, seine Frau
Matej von Zbor, meißnischer Ritter
Jolanda, Witwe aus Böhmen
Magister Giacomo, Medicus
Freiberg
Simon von Werratal, Burghauptmann
Änne, seine Frau und Stieftochter von Boris
Boris* von Zbor, slawischer Ritter
Mattheus, Pfarrer von St. Marien
Alma, Witwe
Ezra ben Moses, Rabbi
Gerhard*, Bergmeister
Thüringen
Landgraf Heinrich* Raspe
Beatrix* von Brabant, seine Frau
Rudolf* von Vargula, Herr auf Saalfeld und Tautenburg, Schenk
Graf Hermann* von Henneberg-Schleusingen, Stiefbruder Heinrichs aus der zweiten Ehe seiner Mutter Jutta* von Thüringen
Udo von Hörselgau, thüringischer Ritter
Hochadel und Geistlichkeit
Kaiser Friedrich II.* von Staufen
König Konrad VI.*, sein Sohn
Graf Hugolino* de Segni, als Gregor IX.* Papst bis 1241
Sinibaldo* de Fieschi, als Innozenz IV.* Papst ab 1243
König Wenzel* von Böhmen
König Bela IV.* von Ungarn
Herzog Heinrich* von Schlesien (fällt in der Schlacht bei Liegnitz)
Friedrich* der Streitbare, Herzog von Österreich und Herzog der Steiermark, Schwager von Markgraf Heinrich*
Siegfried* von Eppstein, Erzbischof von Mainz und Reichsgubernator
Wilbrand* von Käfernburg, Erzbischof von Magdeburg
Dietrich* von Naumburg, Stiefbruder Heinrichs und Bischof von Naumburg
Johann I.* und Otto III.*, Markgrafen von Brandenburg
Otto II.* von Donin, Burggraf von Dohna
Christine* von Schwarzburg-Käfernburg, seine Frau
Ulrich* Graf von Württemberg
Furcht lag über dem Land wie ein bleiernes Joch.
Zwar ängstigten Mütter ihre unfolgsamen Kinder schon seit Jahren mit Schauergeschichten über die barbarischen Horden aus dem Osten, über wilde, der Hölle entsprungene Wesen, die sich in Tierhäute kleideten und ihre Opfer am Spieß rösteten, um sie zu verspeisen. Doch anfangs waren es nur grausige Gerüchte, vielleicht sogar Hirngespinste. Wer wusste das damals schon genau? Nun aber wetterten selbst die Geistlichen lautstark gegen die Meute von zehntausenden Reitern, die unaufhaltsam näher preschte. Wie ein Feuersturm hatten die Mongolen – oder Tartaren, wie sie auch genannt wurden – die Weiten Asiens durchquert, die russischen Fürstentümer vernichtet, Kiew und nun sogar schon Krakau in Schutt und Asche gelegt. Keiner Macht gelang es, ihnen Einhalt zu gebieten; weder Heere noch Gebet kamen gegen sie an.
Und jetzt wurde ängstlich gewispert, die blutrünstige Horde, die auf ihrem Weg keinen Menschen am Leben ließ, nicht einmal Hund und Katze, sei nur ein paar Tagesritte von Meißen entfernt.
Wanderprediger strömten durch die Lande und prophezeiten mit flammenden Worten das Ende der Welt. Noch nie schien es so nah.
ERSTER TEIL
1241 – Ein unbesiegbarer Feind
Kriegsrat
Bedrückt sah Markgraf Heinrich von Meißen und der Lausitz, ein schlanker Mann von dreiundzwanzig Jahren, zu seiner schönen Frau. Konstanze, die Tochter des Herzogs von Österreich und der Steiermark, saß neben einer der Fensteröffnungen der Kemenate und wiegte zärtlich ihren gemeinsamen Sohn, beider erstes Kind. Seit ihrer prachtvoll gefeierten Hochzeit in Wien vor sieben Jahren hatten sie lange vergeblich auf einen Erben gehofft. Schließlich geschah doch noch ein Wunder, und im vorigen Spätsommer gebar die inzwischen fast Dreißigjährige zu aller Freude einen gesunden und kräftigen Jungen.
Angesichts des endlich hereingebrochenen Frühlings waren erst vor wenigen Tagen die hölzernen Laden von den Fensteröffnungen der markgräflichen Burg entfernt worden. Licht und klare Morgenluft durchfluteten die Räume. Ein leuchtend blauer, wolkenloser Himmel und die schon kräftig strahlende Aprilsonne umhüllten die Kontur von Mutter und Kind, ließen Konstanzes kastanienbraunes, lockiges Haar rötlich schimmern und verliehen ihr etwas Madonnenhaftes.
Heinrich sog den Anblick in sich auf und spürte dabei einen Stich ins Herz.
Würde sein Sohn, der noch nicht einmal laufen konnte, das Erwachsenenalter erreichen und zu gegebener Zeit das Erbe seines Vaters übernehmen? Zwei kaiserliche Lehen und die Verantwortung für viele tausend Menschen, deren Hab und Gut? Oder würden sie alle schon in wenigen Tagen einen grausamen Tod sterben?
Drei Tagesritte östlich von Meißen, im schlesischen Liegnitz, stellte sich der bislang unbesiegten, gewaltigen Reiterhorde aus den Weiten Asiens gerade ein letztes Aufgebot christlicher Ritter entgegen, um die Eindringlinge abzuwehren. Dieses Heer aus Ordensrittern und einigen wenigen Kontingenten deutscher Fürsten zählte samt Fußvolk kaum viertausend Mann, während der Feind in angeblich mehr als zehnfacher Überzahl heranbrauste. Vielleicht schon morgen würden beide Streitmächte aufeinanderprallen. Dann konnte nur Gott ihnen helfen.
Diese düsteren Gedanken versuchte er zu verbergen, als er näher trat, erst seiner Frau einen Kuss auf die Stirn gab, dann seinem Sohn zärtlich über die weiche Haut strich.
»Ich kann dich und unseren kleinen Albrecht nach Freiberg geleiten lassen, wenn du dich hinter den dicken Mauern der Silberstadt sicherer fühlst«, schlug er vor.
Das verhaltene, aber hörbar erleichterte Seufzen einer Hofdame bewies einmal mehr die Furcht der Dienerschaft vor den nahenden Horden. Seit Tagen schlichen sich Bedienstete davon, um so weit wie möglich Richtung Westen zu fliehen und damit hoffentlich den gefürchteten Feinden zu entkommen.
Doch Konstanze nahm allen Mut zusammen und schüttelte den Kopf, während sie ihr Kind noch enger an sich presste. Sie wollte nicht fort von ihrem Gemahl.
»Es ist in Freiberg kaum sicherer als hier, sollten die Tartaren durchbrechen«, sagte sie mit brüchiger Stimme und schaute ihm in die Augen. »In solchen Zeiten bleibt jede Familie besser zusammen.«
Obwohl Heinrich die Sorge um Frau und Sohn quälte, durchflutete ihn doch eine Woge von Dankbarkeit bei diesen Worten. Konstanze wusste, dass ihr Platz hier in Meißen war, an seiner Seite. So wie er diesen Ort nicht verließ, würde auch sie sich nicht durch Flucht entziehen. Als Markgräfin wollte und musste sie den Menschen Vorbild sein und Mut spenden.
»Außerdem …« Die junge Mutter verstummte, und ihre Miene wurde noch düsterer. Doch Heinrich wusste, woran sie dachte.
Zu der kleinen Schar tapferer Verteidiger in Liegnitz gehörte auch Konstanzes jüngerer Bruder, Herzog Friedrich von Österreich und der Steiermark, genannt der Streitbare. Das war so wagemutig, dass ihm Heinrich sogar den unrühmlichen Auftritt bei seiner Hochzeit mit Konstanze verzieh, als der Schwager betrunken ins Brautgemach stürmen und die Mitgift zurückfordern wollte.
Hier in Meißen waren sie der erste ernstzunehmende Posten, wo sie den Eindringlingen Widerstand leisten konnten, falls die Schlacht mit einer Niederlage der Ritter endete.
Hierher – oder nach Dresden, das hing von vielen Zufällen ab – würden die Boten kommen und vermelden, ob den Menschen im Land Vernichtung und Tod drohten oder die wilde Reiterhorde aufgehalten worden war. Natürlich wollte Konstanze so bald wie möglich aus sicherer Quelle erfahren, ob ihr Bruder noch lebte.
Gern hätte der junge Fürst, Ehemann und Vater ihr etwas Tröstliches gesagt. Doch nicht hier vor der Dienerschaft.
Und war nicht jeder Trost eine Lüge oder zumindest geheuchelt? Falls nicht in Liegnitz ein Wunder geschah – was konnte sie noch retten?
Die Menschen außerhalb der Burg flüchteten sich bereits in Gebete oder in wilde Trinkgelage, verschleuderten ihr Geld in Hurenhäusern oder aber waren so vor Angst erstarrt, dass sie ihre Wohnstätten nicht mehr verließen. Zerlumpte Wanderprediger strömten durch die Lande und überboten sich lautstark mit immer schrecklicheren Visionen des nahen Weltuntergangs, der für zwei Generationen nach dem Jahr 1200 berechnet war; also unmittelbar bevorstand.
Der Markgraf trat an ein Fenster, starrte hinaus und verfolgte den Flug eines seiner Falken, um – unbemerkt von den anderen im Raum – seine Gesichtszüge wieder unter Kontrolle zu bekommen.
Dann räusperte er sich.
»Ich muss gehen. Der Kriegsrat erwartet mich.«
Noch einmal strich er sanft über die Wangen seines Söhnchens, nickte seiner Gemahlin aufmunternd zu und verließ dann mit eiligen Schritten die Kemenate.
Mit seinen dreiundzwanzig Jahren war Markgraf Heinrich eindeutig der Jüngste unter den Männern, die zusammengekommen waren, um mit ihm und unter seinem Kommando Kriegsrat zu halten. Dennoch lag bei ihm die Verantwortung für das Land und unzählige Menschenleben.
Die Runde in dem mit Bannern, Wappen und vergilbten, aber kunstvoll bestickten Wandbehängen geschmückten Raum war deutlich größer als sonst. Nicht nur seine wichtigsten Berater standen hier; er hatte auch sämtliche von ihm eingesetzte Burgkommandanten nach Meißen beordert, um sich über ihre Vorbereitungen auf eine Invasion zu informieren und neue Erkenntnisse über den Gegner weiterzugeben.
Heinrich musterte die Runde der kampferprobten Männer und fragte sich, wie wohl sein Vater in dieser Lage gehandelt hätte. Doch er konnte sich nicht einmal mehr an ihn erinnern, kannte ihn nur aus den Erzählungen anderer.
Er sah zu Thomas von Christiansdorf, seinem engsten Vertrauten. Dieser in vielen Kämpfen und zwei Kreuzzügen bewährte und dennoch besonnene Mann hatte ihn von Kindheit an erzogen, beraten und an den Waffen ausgebildet. Im dunklen Haar seines Bartes schimmerten erste silberne Fäden. Doch nickte er jetzt seinem Schützling aufmunternd zu. Sie hatten wochenlang beraten, oft auch unter vier Augen, wie sie der Gefahr am besten begegnen konnten.
Jetzt musste Heinrich nur noch die anderen dazu bringen, ihm zu folgen; etliche bereits grauhaarig wie sein Marschall Heinrich von Gnandstein, der seit vielen Jahren dieses Amt ausübte, und dessen Bruder, der Kämmerer Konrad von Gnandstein.
Zu den Rittern mittleren Alters gehörten Thomas’ Sohn Christian von Christiansdorf, der Anführer seiner Leibwache, und dessen angeheirateter Verwandter Simon von Werratal, der Burgkommandant von Freiberg und Ehemann von Christians Base Änne.
Erschienen war bemerkenswerterweise auch der Meißner Burggraf Meinher von Werben, der im Auftrag des Kaisers für die Sicherheit des Burgbezirks zuständig war. Dass er persönlich hier auftauchte, statt einen Vertreter zu schicken, war trotz des kurzen Weges – nur ein paar Schritte über den Domplatz – ungewöhnlich und kündete vom Ernst der Lage. Denn üblicherweise herrschte verbissene Konkurrenz zwischen den drei Mächtigen auf dem Meißner Burgberg: dem Markgrafen, dem kaiserlichen Burggrafen und dem Bischof.
Doch jetzt war nicht der Moment für derlei Machtgerangel.
Deshalb hatte der junge Fürst Heinrich auch die kriegerischen Auseinandersetzungen mit den beiden Markgrafen von Brandenburg um Köpenick, Teltow und Mittenwalde beendet. Statt sich gegenseitig zu bekämpfen, sollten sich alle christlichen Fürsten gegen die Gefahr aus dem Osten vereinen. Zu seinem Leidwesen dachte nicht jeder so.
Respektvoll begrüßten die Männer ihren Anführer.
Sie hatten auf seine Weisung hin bereits ein frühes Mahl mit Starkbier, Brot, gedörrtem Obst und Fisch bekommen. In wenigen Tagen war Ostern, doch bis dahin galten die Fastenregeln, weshalb Wein, Fleisch, Eier, Käse und vieles andere nicht auf die Tafel durften.
Heinrich erwiderte die Begrüßung und lud die Männer zum Tisch in der Mitte des Raumes ein, auf dem eine ausgerollte Karte lag. Rundgeschliffene Steine beschwerten die Ecken des Pergaments. Ein begabter Schriftgelehrter aus der Kanzlei des Markgrafen hatte die Zeichnung nach seinen Wünschen angefertigt.
Der junge Fürst beugte sich vor und deutete auf ein Symbol am rechten Rand. »Hier, in Liegnitz, wird sich ein Heer unter dem Herzog von Schlesien den Gegnern stellen. Dieses Heer ist das Letzte, was zwischen uns und den Tartaren steht. Es sind etwa tausend Ritter, dazu das Dreifache an Fußvolk.«
Die Zahlen sorgten für bestürztes Raunen, jemand zog scharf die Luft ein.
»Mehr nicht? Das reicht nie im Leben gegen diese Übermacht!«, empörte sich der stämmige Burggraf von Rochlitz und schnaufte. »Wo bleibt der Kaiser mit einem großen Heer? Wo bleiben die Böhmen, die Ungarn?«
Heinrich richtete sich auf und fixierte den übelgelaunten Mann ihm gegenüber.
»Der Kaiser ist in Italien in heftige Kämpfe verwickelt. Und König Bela von Ungarn muss sein eigenes Reich verteidigen, denn dorthin ist die Hauptstreitmacht der Tartaren unterwegs, angeblich mehr als einhunderttausend Reiter unter einem Anführer namens Batu Khan. Wer da auf Liegnitz zureitet und bald auch uns direkt bedrohen könnte, diese angeblich vierzigtausend Mann, ist nur die nördliche Abteilung der riesigen Tartarenarmee. Ihr Fürst Batu nennt sie übrigens die Goldene Horde.«
»Das ist … ungeheuerlich! Ich wüsste nicht, wann es jemals ein ähnlich großes Reiterheer gegeben haben könnte«, schnappte der Rochlitzer.
»Die Ritterorden, insbesondere der Deutsche Orden, sowie mein Schwager, der Herzog von Österreich, und der Herzog von Schlesien stellen sich mit ihren Männern dem Feind entgegen«, fuhr Heinrich beherrscht fort. »Außerdem marschiert König Wenzel von Böhmen mit einem hastig einberufenen Heer nach Liegnitz. Lasst uns beten, dass er dort vor den Feinden eintrifft.«
Heinrich verschwieg an dieser Stelle, dass Papst Gregor IX., der seit seinem Amtsantritt den Kaiser heftig befehdete und nun schon zum zweiten Mal exkommuniziert hatte, für Ostern – also in wenigen Tagen – ein Konzil nach Genua einberufen hatte, um den Kaiser abzusetzen. Eine Ungeheuerlichkeit!
Doch der streitbare und sich seines Ranges sehr bewusste Friedrich II. würde natürlich nicht tatenlos hinnehmen, wenn die Kurie ihn einfach absetzte. Es war ein großes Übel, dass die beiden mächtigsten Männer Europas verbittert gegeneinander kämpften, statt geeint gegen den Feind zu stehen.
»Wir müssen also mit dem Schlimmsten rechnen. Binnen drei Tagen kann diese blutrünstige Horde hier sein«, konstatierte der Rochlitzer bitter.
»Deshalb rief ich Euch hierher«, erwiderte Heinrich gefasst. »Seit Monaten bereiten wir uns auf diesen Fall vor. Burgmauern wurden verstärkt, Armbrustschützen ausgebildet, Proviantlager angelegt. Es werden Boten kommen, die uns über den Ausgang der Schlacht berichten, und ich werde jedem von Euch auf schnellstem Wege Nachricht schicken. Dann lasst so viele Menschen wie möglich auf die Burgen oder hinter die Stadtmauern und bemannt die Mauerkronen und Türme in voller Stärke mit Schützen. Sobald der Feind auf einen Tagesritt heran ist, mauert die Stadttore zu.«
Wie gut, dass er den Leipzigern erlaubt hatte, die Stadtmauern wieder aufzubauen, die sein Vater im Streit mit ihnen hatte schleifen lassen!
Der junge Fürst sah in die Runde seiner Männer, bevor er fortfuhr.
»Inzwischen wissen wir dank der Nachforschungen des Kaisers etwas mehr über diese wilden Fremden. Entgegen früheren Gerüchten haben sie keinen Hundekopf und auch nicht nur ein einziges riesiges Bein.« Er zwang sich zu einem Lächeln, ehe er fortfuhr. »Aber sie sind exzellente Reiter, die mit ihren Pferden wie verwachsen scheinen, und äußerst treffsicher mit den Bögen. Sie schießen aus dem Sattel, selbst in vollem Galopp, und ihre Pfeile haben enorme Durchschlagskraft und Reichweite. Wir können uns ihnen nicht auf offenem Feld stellen, sondern müssen auf starke Mauern und die feste Entschlossenheit bauen, unser Leben und das unserer Familien zu schützen. In den Gebieten, die sie vermutlich durchstreifen werden, dürfen wir ihnen keine Nahrung lassen. Ihre Pferde sind allerdings auch mit kargstem Futter zufrieden.«
»Die Leute reden … dass sie ihre getöteten Feinde am Spieß braten und essen«, warf mit gesenkten Lidern einer der jüngeren Burgkommandanten ein.
»Die Leute reden viel in ihrer Angst«, konterte Heinrich unwirsch – allerdings ohne das Gerücht zu bestreiten. Niemand wusste, ob es zutraf.
»Doch es ist richtig, diesen Feind zu fürchten, denn er geht mit äußerster Grausamkeit gegen alles Leben vor. Es heißt, sie hacken Gefangene in Stücke oder häufen Steinplatten auf sie, setzen sich darauf, tafeln und quetschen dabei die Opfer qualvoll zu Tode. Also sorgt dafür, dass möglichst viele Menschen hinter unseren Mauern Schutz finden! Sie sollen sich nicht um ihre Häuser und ihren sonstigen Besitz kümmern, bloß alles an Proviant mitbringen, was sie haben. Wer es nicht auf eine Burg oder in eine gut befestigte Stadt schafft, soll sich im dichten Wald oder in Höhlen verstecken. An den Flüssen müssen sämtliche Boote zerstört werden, falls sie heranpreschen, damit sie nicht übersetzen können. Aber stellt Euch darauf ein, dass dieser Gegner auch breite und wilde Flüsse zu Pferde durchqueren kann.«
Von den Burgkommandanten ließ er sich berichten, wie weit deren Verteidigungsmaßnahmen gediehen waren.
»Und noch etwas müsst Ihr wissen«, erklärte der Fürst dann mit Nachdruck. »Wenn sie angreifen, täuschen sie gern Rückzug vor, kommen plötzlich aber in weitem Bogen zurück. Vergesst das nicht!«
Nun wandte er sich an seinen engsten Vertrauten.
»Thomas von Christiansdorf, Ihr reitet nach Dresden, sprecht dort mit Burggraf Otto von Dohna und haltet Ausschau nach Boten. Wir wissen nicht, wo die Nachricht vom Ausgang der Liegnitzer Schlacht zuerst eintrifft – dort oder hier. Nehmt Euer schnellstes Pferd und kommt umgehend zurück, sobald Ihr etwas erfahrt.«
Der bewährte Ritter, wie jeder Mann in seiner Familie ein begnadeter Reiter, nickte zustimmend.
Er war stolz darauf, wie umsichtig und entschlossen sein einstiger Schützling in dieser nie da gewesenen Situation handelte. Thomas von Christiansdorf wusste besser als alle anderen hier, welche Gefahr diese Krieger aus dem Osten darstellten. Er hatte viele Jahre in Akkon gelebt, im Heiligen Land, bis er als Mentor und Beschützer des damals noch kleinen Heinrich nach Meißen zurückbeordert worden war. Selbst die kampferprobten Sarazenen fürchteten jene wilde Reiterhorde; sie hatten sogar zeitweise erbitterte Feindschaften untereinander ruhen lassen, um diesen Gegner gemeinsam abzuwehren. Doch das behielt er für sich. Es hatte sich schon genug Furcht breitgemacht.
»Wenn Ihr es wünscht, Durchlaucht, breche ich umgehend auf.«
»Tut das. Ihr anderen lasst Euch in der Halle beköstigen und vom Küchenmeister mit Proviant versorgen. Dann reitet zurück und erfüllt Eure Pflicht, so gut Ihr könnt. Von uns hängen unzählige Menschenleben ab, sollte der Herzog von Schlesien scheitern.«
Thomas von Christiansdorf nickte seinem Lehnsherrn zu, dann seinem Sohn Christian, und verließ eilig den Raum.
Als auch die anderen Männer nach einer Verbeugung gehen wollten, hielt der junge Markgraf zwei von ihnen zurück.
»Simon von Werratal und Christian von Christiansdorf, mit Euch beiden will ich noch ein paar Worte wechseln.«
Der Burgkommandant von Freiberg und der Anführer von Heinrichs Leibwache verharrten im Schritt und kehrten zurück.
Sobald sie nur noch zu dritt waren, erkundigte sich Heinrich mit einem versonnenen Lächeln: »Simon, wie geht es Eurer wunderbaren Gemahlin?«
Er hegte eine große Zuneigung für Änne, die warmherzige und heilkundige Frau des Burgkommandanten. Sie war ihm wie eine Mutter gewesen, als er mit nicht einmal drei Jahren durch den plötzlichen Tod seines Vaters zur Halbwaise geworden war und seine eigene Mutter mit tausend Hindernissen zu kämpfen hatte, um ihm das Erbe ihres verstorbenen Gemahls bis zu seiner Volljährigkeit zu erhalten.
»Sie sehnt sich nach ihren Kindern. Aber sie ist dankbar dafür, dass sie hier an Eurem Hof erzogen werden«, berichtete Simon, ein aus Thüringen stammender Ritter Ende vierzig mit blondem Haar. Sein und Ännes erstgeborener Sohn Reinhard war fast fünfzehn Jahre alt und seit kurzem ein Knappe, ihre dreizehnjährige Tochter Clara wurde unter der Aufsicht der Markgräfin am Meißner Hof erzogen.
»Allerdings kommt meine Gemahlin derzeit kaum zum Nachdenken. Sie hat beide Hände voll zu tun, um Vorräte an Heilkräutern und Leinen anzulegen«, erklärte der Burgkommandant. »Außerdem pflegt sie ihren Vater, den schwer das Wasser in den Beinen plagt, auch wenn er so tut, als wäre das nicht weiter schlimm.«
Boris von Zbor war ebenfalls ein bewährter Ritter des Markgrafen, nur mittlerweile vom Alter gezeichnet.
»Simon von Werratal, überbringt den beiden meine besten Grüße.«
»Danke, Euer Durchlaucht.«
»Also sind in Freiberg die Stadtmauern verstärkt, der Burggraben vertieft?«
»Freiberg ist so reich, dass wir sogar Armbrüste mit einem Vorderbogen aus Stahl statt aus Horn haben«, berichtete Simon stolz. Solche Waffen waren teurer, aber deutlich stabiler als jene nur aus Holz, Horn und Sehnen. »Bauleute stehen bereit, um die Stadttore zuzumauern, sollte der Feind in unsere Nähe kommen.«
»Gut«, bekräftigte der junge Fürst. »Doch es muss auch der Schutz der Bergleute in den Gruben vor der Stadt sichergestellt werden, falls der Feind naht. Deshalb hebe ich den Erlass meines erlauchten Großvaters Markgraf Otto vorübergehend auf, dass jede Grube an einen anderen Eigner fällt, wenn dort länger als drei Tage nicht gefördert wird. Sollte uns in Liegnitz eine Niederlage ereilen, schicke ich sofort Christian, den Vetter Eurer Gemahlin, als Boten zu Euch. Dann sollen alle umgehend in die Stadt flüchten, die vor der Stadtmauer wohnen oder arbeiten: die Bergleute aus der Sächsstadt und die Juden aus der Siedlung südlich der Mauer.«
Thomas’ Sohn Christian, dunkelhaarig und Mitte dreißig, trat hastig einen Schritt vor.
»Durchlaucht, als Anführer Eurer Leibwache darf ich nicht von Eurer Seite weichen, falls die Tartaren durchbrechen!«, protestierte er vehement.
»Ihr seid schneller zurück, als die Tartaren hier sein können«, widersprach der Markgraf. »Sollten sie siegen, werden sie ihren Triumph erst einmal mit wilden Trinkgelagen feiern, sie werden plündern und sengen. Bis zu Eurer Rückkehr kann also Euer treuer Freund Marek den Platz an meiner Rechten einnehmen.«
Sein strenger Blick brachte den gefürchteten Schwertkämpfer zum Verstummen.
»Außerdem habe ich noch einen Grund, gerade Euch nach Freiberg zu entsenden, Christian, und den könnt Ihr unschwer erraten. Euer Großvater, dessen Namen Ihr tragt, gründete diesen Ort und ist dort eine Legende. Euer Wort hat in Freiberg Gewicht. Ich will verhindern, dass es Unruhen gibt, wenn die Bewohner des jüdischen Viertels südlich der Stadt hinter den Mauern Schutz suchen.«
Es war eine traurige Tatsache, dass viele Menschen in ihrer Angst vor den feindlichen Horden den Juden die Schuld am Auftauchen der Tartarenmeute gaben, was vollkommen unsinnig war. Genauso unsinnig wie die Behauptung des Papstes, der Kaiser mit seinem lasterhaften Lebenswandel habe sie gerufen. Jenseits von Elbe und Saale hatte es in mehreren Gegenden sogar schon Pogrome gegeben. In Notlagen suchten die Menschen gern nach jemandem, den sie zum Sündenbock machen konnten.
Das Gesicht des Freiberger Burgkommandanten verfinsterte sich, als der Markgraf Christian diesen Auftrag erteilte. Traute ihm der Fürst etwa nicht zu, seiner Verantwortung gerecht zu werden? Musste immer wieder die Familie des sagenumwobenen Dorfgründers ins Spiel kommen? Hatte er selbst nicht sogar eine Frau aus jener Familie zur Gemahlin? Doch Simon von Werratal behielt diese angesichts der Lage etwas kleinlichen Gedanken für sich.
Die beiden Männer zogen sich mit einer Verneigung zurück, um noch ein paar kurze Worte zu wechseln, wie Heinrich hoffte. Er hatte Simons verstimmte Miene durchaus bemerkt, ignorierte sie aber. Schließlich waren beide durch Änne – Simons Frau und Christians Base – miteinander verwandt und Freiberg verbunden.
»Richtet den Kammerdienern draußen aus, ich wünsche die Herrin Milena zu sehen«, befahl Heinrich noch.
Dann trat er in das Hintere des Raumes, wo sich auf einem Pult ein besonderer Schatz befand: ein aufgeschlagenes dickes Buch. Der hölzerne Einband war mit weißem Leder bezogen und Silberbeschlägen verziert, auf den Seiten aus Pergament prangten Illuminationen in leuchtenden Farben. Doch das Kostbarste an diesem Buch waren für ihn die Texte. Die schon in jungen Jahren außergewöhnlich begabte Geschichtenerzählerin Milena hatte sie in seinem Auftrag zusammengetragen und niedergeschrieben. Sie schilderten das Werden und Wachsen der Mark Meißen, denkwürdige Begebenheiten und kuriose Vorfälle, die Geschichte seiner Familie.
Würde all diese Historie in wenigen Tagen ausgelöscht werden?
Denn die Tartaren, so wusste er, hegten keinerlei Interesse an fremden Gepflogenheiten und Traditionen.
Warten in Dresden
Thomas hatte sein schnellstes Pferd genommen und war sofort aufgebrochen.
Das Nötigste war rasch zusammengepackt, und er hatte – abgesehen von seinem Sohn Christian, dessen Frau Mariam und ihren Kindern – keine Verwandten in Meißen, von denen er sich ausgiebig verabschieden musste.
Seit vielen Jahren schon lebte er als Witwer. Die Liebe seines Lebens, eine armenische Christin namens Eschiva, hatte er in Akkon gefunden, wo er als junger Ritter desillusioniert und mit zutiefst wunder Seele das katastrophale Scheitern zweier Kreuzzüge miterleben musste. Eschiva schaffte es, ihn aus seiner Hoffnungslosigkeit zu reißen. Sie verbrachten viele Jahre glücklich miteinander, hatten drei Töchter, die inzwischen alle gut vermählt in Akkon lebten, und etliche Enkel. Doch sie verstarb, kurz bevor er zusammen mit seinem damals vierzehnjährigen Sohn Christian dem Ruf aus Meißen folgte und in seine alte Heimat zurückkehrte.
Das war nun zwanzig Jahre her, und in all dieser Zeit war ihm keine Frau mehr begegnet, die sein Herz berührt hätte.
Sein Pferd genoss den Ritt an diesem sonnigen Frühlingstag. Thomas hatte darauf verzichtet, einen Knappen mitzunehmen, um Dresden so schnell wie möglich zu erreichen.
Die Ansiedlung an der Elbe, der Markgraf Heinrichs Vater Dietrich das Stadtrecht verliehen hatte, wuchs rasch. Die steinerne Brücke über den Fluss war von enormer Bedeutung für den Fernhandel, und eine Reliquie aus Konstanzes Mitgift, ein Splitter vom Heiligen Kreuz, lockte unzählige Pilger nach Dresden. Auf Heinrichs Wunsch wurde das kostbare Stück in einer eigens dafür errichteten Kapelle der Dresdner Nikolaikirche zur Schau gestellt.
Thomas ritt entlang der Elbe, sah die Weinhänge auf der anderen Seite des Flusses und vor sich den Hügel, von dem aus sein Vater einst gern ins Land geblickt hatte.
Thomas’ Vater Christian starb, als sein erstgeborener Sohn noch ein Knabe war – getötet im Auftrag eines mächtigen Feindes und vor den Augen des Jungen. Später, als Ritter, hatte Thomas seinen Tod gerächt. Das machte den Mann nicht wieder lebendig. Doch sein Vermächtnis blieb: das von ihm gegründete und nach ihm benannte Rodungsdorf, aus dem rasch eine wehrhafte Stadt wuchs, nachdem dort äußerst ergiebige Silbererze gefunden worden waren.
Besorgt sah Heinrichs Ratgeber, dass etliche Felder rechts des Flusses trotz des guten Wetters unbestellt waren, oft nicht einmal gepflügt.
Die Flut der Wanderprediger mit ihren Schreckensbotschaften hatte viele Menschen in Starre versetzt. Wen interessierte das Morgen, wenn vielleicht noch heute die Welt unterging?
Falls wir die Tartaren schlagen, erwartet uns womöglich eine Hungersnot, grübelte er. Zu anderen Zeiten würde es der Reichtum der Freiberger Silberbergwerke ermöglichen, nach Missernten Getreide von den Böhmen hinzuzukaufen. Doch jetzt wusste niemand, welche Schäden das Hauptheer der Horde auf seinem Weg nach Ungarn angerichtet hatte.
Er brachte sein schweißbedecktes Pferd zum Stehen, saß ab und führte es zum Ufer, um es zu tränken.
Während das Tier soff, zogen mehreren Gruppen von Menschen an ihm vorbei. Sie waren schwer beladen mit dem, was sie von ihrer Habe tragen konnten, und eindeutig auf dem Weg nach Westen, so schnell sie konnten.
Ihr solltet bleiben und euer Land beschützen!, dachte der kampferfahrene Ritter zornig. Das ist unsere einzige Chance.
Stadtbürger waren sogar in Friedenszeiten zu Wachdiensten verpflichtet, im Krieg erst recht zur Verteidigung ihres Heimatortes. Auch die Bauern mussten im Kriegsfall Kontingente an Fußvolk stellen. Die Frauen konnten Armbrustbolzen befiedern und durch die Pechlöcher in den Burgen kochendes Wasser schütten, falls Feinde eindringen wollten. Die halbwüchsigen Burschen konnten Steine auf die Angreifer hinabschleudern. Jeder, der einigermaßen bei Kräften war, vermochte einen Beitrag zu leisten.
Doch dieser Ansicht hatte erst am Vorabend die rotblonde Sophia, Gemahlin seines Freundes Tammo von Schönfeld, entschieden widersprochen.
»Nach all dem, was die Geistlichen über diese Tartaren erzählen …. Wenn du kleine Kinder hättest und kein Schwert führen dürftest, würdest du vielleicht auch dein Heil in der Flucht suchen«, hatte sie ihm vorgehalten. Ganz von der Hand weisen konnte er ihr Argument nicht. Das Schwert machte den Unterschied.
Am frühen Nachmittag erreichte Thomas das sonnenbeschienene Dresden und ritt direkt zum gut befestigten Sitz des kaiserlichen Burggrafen.
Otto von Dohna, ein energischer Mann in reich verzierten Gewändern und nicht viel älter als der Meißner Markgraf, empfing ihn sofort. Es lag erst wenige Jahre zurück, dass Otto sein wichtiges Amt von seinem Vater übernommen hatte. Nun musste er beweisen, dass er auch in dieser nie da gewesenen Bedrohung Dresden und Dohna sichern konnte. Zumal er nur der zweitgeborene Sohn war – sein älterer Bruder hatte Grafenstein übernommen, ein vielversprechendes Lehen in Böhmen.
Thomas berichtete vom morgendlichen Kriegsrat und seinem Auftrag. Sofort befahl der Burggraf mit kraftvoller Stimme, dem meißnischen Ritter ein Quartier herzurichten.
»Ihr seid nicht überrascht, mich hier anzutreffen statt auf meiner Wallburg weiter südlich in Dohna«, konstatierte er zufrieden. »Wenn sie kommen, müssen wir hier alles tun, um sie aufzuhalten. Sie werden versuchen, über die Brücke zu reiten oder die Furt zu nutzen.«
»Der Markgraf war überzeugt, dass Ihr so denkt.«
Otto nickte. »Meine Gemahlin und die Kinder habe ich allerdings zu ihren Verwandten nach Thüringen geschickt«, fügte er an, hielt kurz inne und sagte besorgt: »Haltet mich nicht für verzagt deswegen. Sie ist wieder gesegneten Leibes.«
Thomas gratulierte. Burggräfin Christine, weithin berühmt für ihr schönes blondes Haar, entstammte dem mächtigen und reichen Haus der Grafen von Schwarzburg-Käfernburg. Wenn jemand für ihre Sicherheit sorgen konnte, dann ihre für militärische Stärke gefürchteten Verwandten in der entfernten Landgrafschaft.
Die Tage in Dresden vergingen für Thomas nur schleppend. Jeder Mann und jede Frau auf der Burg erwartete nervös die ersten Boten aus Liegnitz. Wie würde die Schlacht ausgehen? War sie überhaupt schon entbrannt?
Waren sie gerettet oder verloren?
Das Osterfest verlief in ungewöhnlich verhaltener Stimmung. Selbst beim Fastenbrechen kam nur wenig Freude auf. Doch während der Prozession zur Nikolaikirche am Karfreitag brodelten die Emotionen. Zu Hunderten strömten Menschen herbei. Viele brachen angesichts der Reliquie in Tränen aus, baten schluchzend auf Knien um Rettung vor dem Bösen in Gestalt der blutrünstigen Reiterhorde. Kirchendiener mussten die Menschen mit aller Kraft und lauten Worten dazu bringen, endlich für jene Gläubigen Platz zu machen, die sich weiter hinten drängten und auch beten wollten.
Die Unruhe in Burg und Stadt wuchs in beängstigender Weise. Tag und Nacht hielten Wachen Ausschau nach Boten. Warum kam niemand mit Nachrichten? Hatte etwa kein Einziger überlebt?
In der Burgschmiede wurde von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang gehämmert. Nicht nur Waffen mussten ausgebessert werden. Der Schmied und seine Gehilfen fertigten körbeweise Krähenfüße – Fußangeln mit vier Spitzen, von denen immer eine nach oben zeigte, wenn man die Eisengebilde auf den Boden warf. Sie waren bereits vor tausend Jahren genutzt worden, um berittene Feinde abzuwehren.
Thomas weilte schon fast eine Woche in Dresden, als er von der Burgmauer aus einen Reiter entdeckte, der schwankend und in schmerzgekrümmter Haltung auf einem völlig erschöpften Pferd saß. Trotz seines Alters hatte der meißnische Ritter immer noch gute Augen, zumindest für die Ferne. Bei dem Anblick durchfuhr ihn die Gewissheit: Jetzt entscheidet sich unser Schicksal.
»Hol den Burggrafen, rasch!«, wies er eine der Frauen an, die Wasserkrüge zu den Wachen auf der Mauer trugen. Sie knickste, drückte ihren Krug einer anderen in die Hand und eilte davon.
Während sich Reiter und Pferd näherten, sah Thomas dem Mann schon von weitem an, welche Kunde er bringen würde – und der soeben zu ihm getretene Burggraf Otto ebenso. Rasch stiegen sie hinab zum Tor.
»Helft ihm vom Pferd!«, rief der Burggraf und ging dem Neuankömmling entgegen. »Nachricht aus Liegnitz?«, fragte er.
Der staubbedeckte und schweißüberströmte junge Mann nickte nur. Seine einst edle Kleidung war zerrissen, blutig und staubig.
»Hier kein Wort!«, befahl der Burggraf streng. »Begleitet mich. Muss eine Eurer Wunden dringend versorgt werden?«
Der Reiter schüttelte den Kopf. »Hat Zeit«, krächzte er. »Erst berichten …«
Mit steifen Gliedern ließ er sich von zwei Stallknechten aus dem Sattel ziehen. Thomas stützte ihn, und von Dutzenden Augenpaaren verfolgt, begaben sie sich zur Kammer des Burggrafen.
»Hier!« Otto reichte dem Boten persönlich etwas zu trinken.
Dieser wollte niederknien, aber der junge Burggraf in seiner Ungeduld gab sich großzügig gegenüber dem vollkommen erschöpften Mann und bedeutete ihm, wieder aufzustehen. Durstig stürzte der staubbedeckte Reiter das Bier hinunter.
»Alle hinaus bis auf ihn!« Mit einer Kopfbewegung wies der Burggraf auf Thomas. Eilig und mit düsteren Mienen verließen seine Männer den Raum.
Otto, der nicht wollte, dass sofort das Gerede auf seiner Burg einsetzte und Panik sich in ganz Dresden ausbreitete, wartete angespannt, bis die Tür geschlossen war und die Schritte sich entfernt hatten. Dann holte er tief Luft.
»Nun berichtet!«, befahl er dem Boten und deutete erneut auf Thomas. »Dieser meißnische Ritter wird dem Markgrafen umgehend eure Kunde überbringen. Ihr müsst also nicht gleich dorthin weiterreiten.«
Der junge Bote nickte, sank kurz in sich zusammen, dann blickte er auf. Entsetzen stand in seinem Gesicht.
»Wir haben verloren. Es hatte nie auch nur die geringste Aussicht bestanden, dass wir diese Übermacht besiegen. Sie waren zehnmal mehr, zwölfmal mehr … Ich weiß es nicht. Und so schnell … Sie tauchten auf, kehrten um, waren plötzlich wieder da … Wir wurden mit Pfeilen niedergemäht, der Rest von der riesigen Horde niedergeritten.«
»Was ist mit dem Herzog von Schlesien?«, wollte der Burggraf erfahren.
»Tot … Er ritt an der Spitze seiner Männer hinaus, flankiert von polnischen Reitern … Ich weiß nicht genau, was geschah, sah aber später, dass die Tartaren seinen Kopf auf einen Spieß gesteckt hatten und damit als Trophäe umherritten.«
Der Burggraf bekreuzigte sich und murmelte etwas.
»Die Böhmen?«, drängte Thomas.
»Sind nicht gekommen … Es hieß, sie seien noch einen Tagesmarsch von uns entfernt …«
»Habt Ihr den Herzog von Österreich gesehen?«, fragte der meißnische Ritter weiter.
»Ja, Herr. Er kämpfte mutig, aber blieb unverletzt. Er sorgte dafür, dass wir wenigen Überlebenden entkommen konnten, und schickte Boten aus, auch mich … Der Rest des Heeres wurde niedergemetzelt. Zerstückelt, zermalmt, enthauptet …«
Burggraf Otto sah mit gefurchter Stirn zu Thomas. »Ihr wisst, was Ihr wissen müsst. Reitet zum Markgrafen und berichtet. Ich schicke den jungen Ritter …«
»Bertram von Grüntal«, stellte der sich etwas verspätet vor und ächzte: »Die sind … Gestalten aus der Hölle!«
Erneut flackerte das Entsetzen in seinen Augen. »Wenn sie kommen … Ihr dürft nicht vor die Mauern! Auf offenem Feld sind sie nicht zu schlagen.«
»Ich schicke ihn Euch nach, sobald er wieder etwas zu Kräften gekommen ist«, fuhr der Burggraf fort, nun zu Thomas gewandt. »Derweil weise ich an, unverzüglich alle Posten doppelt mit Bogen- und Armbrustschützen zu besetzen und sämtliche Boote an das diesseitige Ufer zu bringen. Auf der Brücke soll ein mannshohes Hindernis aus Holz errichtet werden, das wir mit Öl tränken und anzünden, falls sie kommen. Das wird sie davon abhalten, über die Brücke zu reiten. Vielleicht stürzt sie auch ein. Wir hatten sie nach einem Hochwasser erst aufwendig instand setzen müssen. Aber wir bauen sie schon wieder auf«, verkündete Otto grimmig. »Wenn sie also durch die Furt kommen, erwarten sie überall Krähenfüße, die sie im Wasser oder im Gras nicht sehen können. Wer dann noch auf den Beinen ist, für den stehen wir mit Pfeilen und Schwertern bereit.«
Thomas nickte, verneigte sich kurz und ging mit hastigen Schritten hinaus. Hinter sich hörte er den Dohnaer Befehle brüllen.
Mit wenigen Handgriffen klaubte er in seinem Quartier die Sachen zusammen und hastete zu den Ställen, um sich sein Pferd geben zu lassen.
Während ein dürrer Stallbursche es zu ihm führte und ein weiterer den Sattel heranschleppte, sah Thomas bestürzt, dass schon Panik um sich griff, ehe überhaupt ein Wort aus der Kammer des Burggrafen gedrungen sein konnte.
Auf dem Burghof liefen Dutzende Menschen zusammen, die aus dem Erscheinen des blutbefleckten Boten die richtigen Schlüsse gezogen hatten. Sie schrien, manche gestikulierten wild, andere wehklagten weinend oder sanken zu Boden und reckten die Hände zum Gebet empor.
Eine junge Frau kreischte immerzu: »Wir werden alle sterben!«, und mehrere andere – der Kleidung nach diejenigen Hofdamen, die Burggräfin Christine nicht nach Thüringen begleitet hatten – fielen in ihr Gezeter ein.
»Schweigt still, ihr Gänse!«, herrschte eine dunkelhaarige Frau mit Witwenschleier, die ein blaues Kleid über roter Kotte trug, die anderen an. »Noch wissen wir gar nichts! Jetzt folgt mir in die Kapelle zum Gebet!«, forderte sie und stimmte einen beliebten Singsang an: »Komm Maria, komm Maria, hilf!«
Eine nach der anderen fielen die Frauen in das Bittgebet an die Heilige Jungfrau ein, während sie ihr nachliefen, und vergaßen darüber ihr Gejammer. Der Tumult erstarb im Gesang.
Was für eine Frau!, dachte Thomas beeindruckt und sah ihr kurz hinterher. Die Unbekannte war erst am Vortag aus Böhmen eingetroffen; frisch verwitwet, so hatte er gehört, aber auf Geheiß ihres Vaters sollte sie gleich wieder mit einem reichen Böhmen vermählt werden.
Doch er hatte jetzt keine Zeit für solche Gedanken.
Schwungvoll stieg er auf und ritt los Richtung Meißen.
Die letzten Anweisungen
Als Thomas nach hartem, schnellem Ritt am Fuß des Meißner Burgbergs ankam, da fürchtete er schon, die schlimme Nachricht sei hier längst eingetroffen. Die Bewohner der Stadt waren von wilder Panik gepackt.
Nur mit Mühe konnte sich sein Pferd den Weg durch die gewundenen Gassen bahnen. Auf dem Platz vor der Frauenkirche standen Franziskanermönche, barfuß und in zerschlissenen Kutten, und schrien in vielfach geübter Abfolge auf die wogende Menschenmenge ein.
»Das Ende der Welt ist nah!«
»Ihr seid verdammt! Niemand wird eure toten Körper begraben! Die Barbaren werden euch verbrennen, und ihr schmort auf ewig im Höllenfeuer!«
»Das ist Gottes Strafe für all eure Sünden! Tut Buße und bereut!«
»Ihr seid verloren, weil euer Fürst dort oben auf dem Burgberg dem Antichristen folgt, dem falschen Kaiser Friedrich!«
Dutzende Zuhörer sanken tränenüberströmt auf die Knie, verhärmte Frauen zogen ihre Kinder an sich, manche bekreuzigten sich, andere rauften sich die Haare, schrien und wehklagten vor Angst und Verzweiflung.
Ein Mann – dem Aussehen nach ein Händler – riss sich seine Kleidung vom Leib und warf sie zu Boden, bis er nur noch in Unterhemd und Beinlingen dastand. Er sank auf die Knie und streckte den Mönchen die Arme entgegen. »Rettet mich! Rettet meine Seele!«, schrie er, und mehrere Männer in seiner Nähe taten es ihm nach.
»Rettet uns!«, gellte es nun verzweifelt aus Dutzenden Kehlen.
»Schwört ab dem Bösen, schwört ab dem Antichristen, der sich Kaiser nennt, und eurem Fürsten, der ihm folgt!«, kreischte der älteste der Mönche.
Thomas, der innerlich vor Wut kochte ob dieser Parolen, wäre gern eingeschritten. Doch hier bot sich keine Aussicht auf Erfolg. Außerdem durfte er sich nicht aufhalten lassen; seine wichtigste Aufgabe war es, die Hiobsbotschaft aus Liegnitz so schnell wie möglich dem Markgrafen und seinen Kampfgefährten zu überbringen.
Kraftvoll nahm sein Pferd den steilen Weg hinauf zum Burgberg.
Das vordere Tor war stark bewacht. Aber die Männer kannten ihn und ließen ihn passieren. Thomas ritt am Palas des Burggrafen und am Dom vorbei. Genau in diesem Moment begannen die Glocken ohrenbetäubend zu läuten – als Künderinnen von Unheil?
Dem dichten Gewimmel auf dem Burghof nach zu schließen, waren in den letzten Tagen etliche weitere Berittene eingetroffen.
»Wessen Pferde sind das?«, fragte er den Stallmeister, der herbeieilte, um ihm seine Stute abzunehmen.
»Der Graf von Henneberg ist vorgestern eingetroffen«, antwortete der Graubart mit sichtlicher Erleichterung.
Also war Heinrichs jüngerer Bruder Hermann gekommen. Sein Stiefbruder, um genau zu sein. Der Sohn aus der zweiten Ehe von Heinrichs Mutter Jutta, die selbst vor einigen Jahren verstorben war.
Die Nachricht vom Eintreffen des thüringischen Grafen erleichterte Thomas. Jegliche Unterstützung war höchst willkommen, auch wenn Hermann von Henneberg-Schleusingen erst siebzehn Jahre zählte.
Zwar war Heinrich der einzige legitime Erbe seines Vaters, doch er hatte neben Hermann noch zwei weitere, deutlich ältere Halbbrüder: uneheliche Söhne seines Vaters aus der Zeit vor dessen Ehe mit Jutta. Einer war Dompropst in Meißen, der andere gehörte zum Domkapitel in Naumburg. Heinrich sorgte dafür, dass sie alle vier als Brüder zusammenhielten. Deshalb war Hermann jetzt auch hier.
Thomas von Christiansdorf ließ sich beim Markgrafen melden, wurde sofort vorgelassen und sah den jungen Grafen Hermann an Heinrichs Seite.
Mit düsteren Mienen standen Marschall, Burggraf und weitere bewährte Ritter in der Kammer verteilt, darunter auch Thomas’ Sohn Christian und dessen bester Freund Marek mit den leuchtend roten Haaren. Von Mareks Neigung zu Scherzen war schon seit Wochen nichts mehr zu spüren.
Alle Blicke richteten sich auf die Gestalt in der Mitte.
Vor dem Markgrafen und seinem Bruder kniete schwankend ein Mann in schmutziger und blutverschmierter Kleidung. Sein ehemals weißer Umhang mit schwarzem Kreuz wies ihn als Ritter des Deutschen Ordens aus. Der linke Ärmel seines Gambesons war abgetrennt, der ganze linke Arm gefährlich angeschwollen und stellenweise schon schwarz verfärbt. Das Gesicht des Ritters war hochrot, die Augen fiebrig glänzend. Übler Geruch ging von der Wunde aus.
Nachdem Thomas seinen Fürsten und den jungen Grafen gegrüßt hatte, wollte der Ordensritter weitersprechen.
Aber in seinem fiebrigen Zustand brachte er nur Satzfetzen hervor.
»Überall Tote … und Pferde … So viele reiterlose Pferde nach der Schlacht … durchgegangen aus Angst und Schmerz, mit Pfeilen in den Flanken und blutenden Wunden«, röchelte er, blankes Entsetzen in den Augen.
Konstanze, die bis soeben von Thomas unbemerkt in einer Nische am Fenster gesessen hatte, trat vor und wollte dem Boten einen Becher Wein anbieten. Doch noch bevor sie ihn erreichte, sackte der Sterbenskranke zu Boden.
»Rasch, bringt ihn zum Medicus!«, befahl Heinrich.
Zwei Diener zerrten den Ordensritter hoch und trugen ihn hinaus, wobei sie sich bemühten, seinen grotesk angeschwollenen Arm nicht zu berühren.
Thomas, zu dessen Familie mehrere begabte Heilerinnen gehörten und der auf zwei Kreuzzügen unzählige schwere Verwundungen gesehen hatte, begriff es vielleicht als Erster in diesem Raum: Der Mann würde mindestens seinen Arm verlieren. Einzig eine sofortige Amputation verschaffte ihm eine Überlebenschance, und auch die war gering. Er war schon so gut wie tot. Nur um den Preis seines Lebens konnte der Ordensritter seine Nachricht so schnell überbringen, weil er aus Zeitnot darauf verzichtet hatte, zuerst einen Wundarzt aufzusuchen.
Endlich wandte sich Markgraf Heinrich seinem einstigen Erzieher und Ratgeber zu.
»Wir wissen kaum mehr als das, was der Unglückliche eben noch zu sagen fertigbrachte. Unser Heer wurde also geschlagen«, repetierte er düster. »Bringt Ihr mehr Einzelheiten aus Dresden?«
Thomas gab wieder, was er dort erfahren hatte, und sprach über die Maßnahmen, die Burggraf Otto von Dohna ergriffen hatte.
»Wisst Ihr, ob mein Bruder noch lebt?«, fragte Konstanze dazwischen. Sie war kreidebleich geworden, als sie vom Tod des schlesischen Herzogs und von der Schändung seines Leichnams hörte.
»Ja, Durchlaucht. Der Bote, der vorhin in Dresden eintraf, berichtete, der Herzog sei unversehrt, habe die wenigen Überlebenden gesammelt und den Rückzug angeführt.«
Die Markgräfin schlug die Hände vors Gesicht. »Der Herr sei gepriesen!« Ihr Bruder war ein Jahr jünger als sie und in seiner Streitlust oft unbedacht.
»Euer Schwager wird Euch aber nicht aufsuchen, Durchlaucht«, fuhr Thomas fort. »Er reitet, so schnell er kann, nach Wien, um seine Ländereien gegen die Tartaren zu verteidigen. Der größte Teil der Horde ist bereits unterwegs nach Ungarn, und vorerst weiß niemand, welche Richtung die Sieger von Liegnitz einschlagen – nach Westen, also hierher zu uns, oder gen Süden, Richtung Mähren oder Wien.«
Thomas zögerte kurz, doch dann sprach er es aus.
»Noch etwas, Durchlaucht! Da unten in der Stadt braut sich Übles zusammen. Wandermönche …«
»Ich weiß, was sie sagen – über den Kaiser und über mich«, erwiderte der junge Markgraf mit finsterer Miene. »Sie machen den Menschen Angst statt Hoffnung. Aber ich kann sie nicht aufhalten, ich darf nicht Hand an einen Geistlichen leg-«
Ein schauriger, lang anhaltender Schmerzensschrei gellte durch die Burg und unterbrach ihn mitten im Wort.
Die kampferfahrenen Männer wussten sofort, was vor sich ging. Der Medicus oder ein Wundarzt sägten dem Ordensritter den Arm mit der schwärenden Wunde ab.
Während die Schreie anhielten, fiel in der Kammer kein Ton. Nach schier endlosen Momenten verstummten die Schmerzensschreie abrupt.
Heinrich tauschte einen Blick mit seinem Bruder Hermann, der sehr blass war. Doch er selbst verzog keine Miene.
Mehrere Männer bekreuzigten sich.
»Ich danke Euch, Thomas von Christiansdorf. Nun, wir alle haben gehört, wie die Dinge stehen. Also sprecht ein Gebet mit Euren Lieben, und dann jeder ab auf seinen Posten! Marschall, sendet die Boten aus wie geplant. Christian, Ihr reitet sofort nach Freiberg. Marek, seid so gut, sucht Eure Frau und kommt beide umgehend zu mir.«
Er ließ seinen Blick über die Runde schweifen und wiederholte: »Jeder ab auf seinen Posten!«
Niemand sagte ein Wort.
Mit einem Nicken, finsteren Mienen und voller Entschlossenheit stapften die Männer davon.
Sobald sie die markgräfliche Kammer verlassen hatten, legte Thomas seinem Sohn den Arm um die Schulter. »Grüße Änne, Simon und Boris von mir, wenn du in Freiberg bist. Und komm wieder, sobald du kannst!«, sagte er. »Gott steh uns allen bei.«
Christian nickte und sah seinem Vater wortlos in die Augen.
Sie wussten beide, wie ihre Chancen standen. Nun musste sich Christian in aller gebotenen Eile von seiner geliebten Frau verabschieden.
»Kümmere dich um Mariam und unsere Tochter, während ich fort bin«, bat er den Vater. Thomas nickte nur und zog seinen Sohn kurz an sich. Natürlich würde er das tun.
Christian hastete zu seiner Kammer, um die nötigsten Dinge für seine Reise zusammenzupacken, und rief seinen Knappen zu sich, den fünfzehnjährigen Reinhard – Ännes und Simons Sohn.
»Wir reiten jetzt gleich nach Freiberg, um eine wichtige Nachricht zu überbringen. Pack deine Sachen und sattle unsere Pferde. Beeile dich!«, befahl er ihm. Der Junge besaß ein schnelles Pferd und war ein guter Reiter. Er würde ihn nicht in seinem Tempo aufhalten. Christian wollte es Änne und Simon ermöglichen, ihren einzigen Sohn noch einmal zu sehen – vielleicht zum letzten Mal.
Bevor Reinhard an der Tür war, hielt Christian den Jungen kurz zurück: »Aber zuerst hole meine Frau aus der Kemenate. Sag, ich wünsche sie dringend zu sehen.«
Der Knappe nickte und schritt los, ohne eine Miene zu verziehen.
Mariam, die zarte Schönheit aus Akkon, kam schnell.
»Also ist es wahr«, sagte sie nur. Sie war bleich, aber gefasst, griff mit eiskalten Händen nach Christians Rechter und drückte sie.
Christian rechnete seiner Frau hoch an, dass sie ihre Tränen zurückzuhalten versuchte. Er zog sie an sich, damit sie ihr Gesicht an seiner Brust bergen konnte.
»Spätestens morgen bin ich zurück«, versprach er. »Bis dahin wird euch hier nichts geschehen.«
Mariam hob den Kopf und sah ihm in die Augen.
»Erinnerst du dich noch an die uralte Geschichte aus dem Heiligen Land über die Menschen in jener Bergfestung in der Wüste?«
Christian wusste sofort, was sie meinte. Der Legende nach hatten die auf dem Bergplateau Eingeschlossenen angesichts ihrer unaufhaltsam nahenden Feinde eine Reihenfolge ausgelost, in der sie alle Kinder, Frauen und schließlich sich selbst töteten, um Schändung und Sklaverei zu entgehen.
»Das ist eine Sage aus längst vergangener Zeit. So weit wird es hier nicht kommen«, versprach er. »Hier seid ihr sicher. Und die Tartaren haben nach allem, was wir wissen, im Gegensatz zu den alten Römern nicht die Geduld für eine lange Belagerung. Sie reiten weiter und suchen sich ein neues Ziel.«
»Hier seid ihr sicher« – diese Feinheit war Mariam nicht entgangen. Sollten die Feinde kommen, würde ihr Mann natürlich auf den Burgmauern oder sonst irgendwo an der Seite des Markgrafen stehen, um sie abzuwehren. Ein einziger Pfeil konnte seinem Leben ein Ende bereiten. Aber es hatte keinen Sinn, sich jedwedes Unglück auszumalen, das geschehen könnte. Er war ein Ritter und würde seinen Schwur halten, das Land und seine Bewohner zu schützen. Auch sie und ihre Tochter, von der er sich jetzt bewusst nicht verabschiedete, um sie nicht weinend zurückzulassen.
Mariam gab ihm einen langen, innigen Kuss, dann trat sie – normalerweise eine anmutige Erscheinung – mit ungelenken Schritten zur Truhe, holte von dort seinen gefütterten Umhang und stellte sich hinter ihm auf die Zehenspitzen, um ihm das wärmende Kleidungsstück über die Schultern zu legen. Wehmütig schmiegte sie sich an seinen Rücken, und dabei spürte er die Wölbung an ihrem Körper – das Kind, das sie erwartete und dessen Bewegungen er schon wahrnehmen konnte. Während Christian die Tasselschnur einhängte, hätte er sich am liebsten umgedreht, sie aufs Bett getragen und so innig und sanft geliebt, wie er nur konnte angesichts ihres Zustandes. Als sei es das letzte Mal. Vielleicht wäre es das ja auch.
Sie erriet seine Gedanken mit dem sicheren Gespür langjährig vertrauter Liebender. Das erkannte er an ihrer Verlegenheit, als sie sich von ihm löste und vor ihn trat, um den Umhang mit ihren eiskalten Händen zurechtzurücken.
»Reite los – und komm bald zurück!«, flüsterte sie.
Noch einmal zog Christian sie an sich, küsste ihr schwarzes Haar und schritt dann schweren Herzens davon. Er war in Eile, und den Abschied hinauszuzögern, würde es für sie beide nur noch belastender machen. Rasch schloss er die Tür hinter sich. Sofort schossen Mariam die mühsam zurückgehaltenen Tränen in die Augen, aber sie wischte sie mit dem Ärmel fort. Sie musste sich um die Kinder kümmern, um ihre erst sechsjährige Tochter und die anderen Kinder hier am Hof. So klein sie auch sein mochten – sie schnappten vieles von dem auf, was die Älteren erzählten. Nachts fuhren dann einige schreiend und weinend, von Albträumen geplagt aus dem Schlaf.
Unterdessen meldete sich Christians gleichaltriger Freund Marek wieder in der Kammer des Markgrafen, diesmal wie befohlen in Begleitung seiner Frau Milena, der Geschichtenerzählerin.
Bleich, aber gefasst verneigte sie sich vor dem jungen Fürsten. Vor ein paar Tagen hatte er sie angewiesen, in der Halle und vor allem in der Kemenate, wo die jungen Mädchen von Stand unterrichtet wurden, fröhliche Geschichten und alte Mythen vorzutragen, um die Burgbewohner von ihren Ängsten abzulenken.
»Nichts von großen Schlachten, sondern etwas von gütigen Wesen und von Helden, die einen Drachen oder Riesen besiegen« – so lauteten Heinrichs Instruktionen. Da sie über einen großen Vorrat solcher Märchen und Sagen verfügte, hatte sie also in den zurückliegenden Tagen in großer und kleiner Runde vorgetragen, bis ihr Hals vom vielen Reden schmerzte und sie sich vom Küchenmeister etwas Honigmilch bringen ließ.
Was würde der Markgraf diesmal von ihr erwarten?
Gegen die Feinde, die vielleicht schon hierher unterwegs waren, kamen Geschichten nicht an. Marek hatte ihr gerade in knappen Worten erzählt, was in Liegnitz geschehen war. Nun wollte sie nur noch ihre Kinder in den Arm nehmen und an sich pressen.
Markgraf Heinrich bat das Paar näher zu sich heran und trat mit ihnen vor das prächtig verzierte Buch auf dem Pult, das Milena zusammengestellt hatte und das von begabten Buchmalern ausgeschmückt worden war.
»Ich habe einen besonderen Auftrag für Euch beide«, sagte er, hielt kurz inne und sah beiden nacheinander fest in die Augen.
»Wenn all unsere Gebete und Waffen nichts nützen … Sollten die Feinde diese Burg einnehmen und wir alle sterben … dann wird dieser Landstrich auf lange Zeit verwüstet sein und niemand erfahren, was geschah. Aber irgendwann – selbst wenn es hundert oder noch mehr Jahre dauert – werden hier wieder Menschen siedeln und in den Ruinen nach Spuren von uns suchen. Milena, ich zeige Euch und Eurem Gemahl jetzt ein sicheres Versteck, um dieses Buch zu retten. Falls die Barbaren die Burg angreifen, fügt rasch noch hinzu, was Ihr seht, und bringt es in das Versteck. Marek, Ihr begleitet sie die ganze Zeit und sorgt dafür, dass Eure Gemahlin diesen wichtigen Auftrag erfüllen kann.«
Heinrich hatte auch den Mönchen im nahen Kloster Marienzell angeboten, ihre kostbare und sehr umfangreiche Klosterbibliothek hier auf der Burg aufzubewahren. Das Kloster lag südwestlich von Meißen auf flachem Land, ungeschützt vor der blutrünstigen Horde. Er konnte keine Männer zur Verteidigung der Mönche abstellen, denn sie mussten den Feind, wenn er kam, mit gebündelten Kräften hier in Meißen aufhalten. Aber der Abt hatte ihm versichert, sie bauten auf Gottes Schutz und hätten gute Verstecke sowohl für sich selbst als auch für ihre Bücher in den nahen, sehr ausgedehnten Wäldern.
Heinrich hoffte, der Klostervorsteher irrte sich nicht. Ein christlicher Gegner würde im besten Fall respektieren, dass Menschen Schutz in einer Kirche suchten, weil er die Strafe Gottes fürchtete. Aber nicht diese wilden Reiter. Denen bedeutete der Glaube anderer nichts.
Er sah, dass Marek die Stirn unter seinem leuchtend roten Haar in Falten zog.
»Mein Fürst, so gern ich bei meiner geliebten Frau bleiben würde – aber ich will lieber die Tartaren bekämpfen, als mich in irgendwelchen Kellergewölben zu verkriechen«, protestierte Milenas Mann.
»Seid froh, dass ich Euch an die Seite Eurer Gemahlin stelle!«, widersprach der Markgraf streng. »Diese Aufgabe ist äußerst wichtig. Falls wir den Feind nicht aufhalten können, falls hier alles verwüstet und zerstört wird … Irgendwann wird jemand kommen und erfahren wollen, was geschehen ist.«
Niemand wusste es besser als Milena: Niedergeschriebene Geschichten hielten die Erinnerung an ein Volk lebendig, über viele Generationen und den Tod hinaus. Plötzlich musste die leidenschaftliche Erzählerin an etwas denken, das weniger als hundert Jahre zurücklag. Damals lebten östlich von Saale und Elbe bis hoch ans Meer noch mehrere große slawische Völker im Kaiserreich – die Ranen, die Abodriten, die Lutizen und weitere –, die anders als die meißnischen Slawen noch ihrem alten Glauben anhingen und ihre eigenen Bräuche pflegten. Vor fast einem Jahrhundert, anno 1147, hatten sich mehrere Fürsten – unter ihnen auch der Urgroßvater des jetzigen Markgrafen – zusammengeschlossen, um diese Stämme mit einem »Wendenkreuzzug« zu christianisieren. Sie zerstörten die alten Heiligtümer und führten massenhaft Zwangstaufen durch. Da die Slawen keine Schriftsprache hatten, war von ihrer einst reichen Kultur fast nichts erhalten geblieben. Nach nicht einmal hundert Jahren waren sie in Vergessenheit geraten.
In Mareks Hirn wühlten hingegen immer noch die Worte Markgraf Heinrichs, von ihnen allen könnten in ein paar Tagen nur noch Knochen und Asche übrig sein.
Und als sei dieses Bild nicht schon dramatisch genug, fügte der junge Fürst sehr ernst hinzu: »Milena. Wenn Ihr diese Zeilen an diejenigen niederschreibt, die hier einmal nach uns suchen werden – bittet sie, unsere Gebeine in geweihter Erde zu begraben, damit unsere Seelen Erlösung finden.«
Aufruhr in Freiberg
Der Weg von Meißen nach Freiberg war inzwischen so gut und breit angelegt, dass Christian und sein Knappe auf ihren schnellen Pferden kaum mehr als zwei Stunden benötigen würden.
Aus alten Geschichten wusste Christian, dass sein gleichnamiger Großvater dafür anfangs mehr als einen halben Tag gebraucht hatte, weil er sich den größten Teil der Wegstrecke von seinem abgelegenen Siedlerdorf mitten im Dunklen Wald durch schmale Hohlpfade bahnen musste. Doch das lag länger als ein halbes Jahrhundert zurück.
Je näher die beiden Reiter ihrem Ziel kamen, desto mehr Schnee lag noch. In Freiberg am Fuße des Gebirges war es deutlich kälter als im sonnigen Meißen. Immerhin, die Wege waren schon von umgestürzten Bäumen befreit. Kurz vor Freiberg setzte ein unangenehmer, zum Glück aber nur kurzer Hagelschauer ein.
Reinhard hatte während des gesamten Ritts kein Wort gesprochen. Dabei platzte er fast vor Fragen. Doch die grimmige Miene seines Herrn hielt ihn vom Reden ab. Christian hatte einen besonderen Ruf unter den Knappen: Er galt als so streng, dass es genügte, wenn er die Augenbrauen hob, damit die Jüngeren bereitwillig nachgrübelten, was sie falsch gemacht hatten. Christian ließ ihnen nichts durchgehen, wenn er eine Lektion im Schwertkampf erteilte, denn von ihren Fähigkeiten in der Waffenkunst würde einmal ihr Überleben in der Schlacht abhängen.
Als sie sich der Silberstadt näherten, stellte der Anführer der markgräflichen Leibwache zufrieden fest, dass die mächtige Stadtmauer und sämtliche Türme mit einer dichten Reihe Wachposten besetzt waren.
Sie passierten das Meißner Tor im Nordosten der Stadt, eines von fünf Freiberger Stadttoren, und wurden von den Wachen freudig begrüßt. Als Enkel des Begründers der Stadt haftete Christian der Ruhm seines Großvaters und seines Vaters an, ob er wollte oder nicht. Doch hatte er sich bereits selbst einen guten Ruf erworben – durch Tugenden, die auch seine Vorfahren ausgezeichnet hatten. Er war ein begabter Reiter, ein hervorragender Schwertkämpfer und bekannt für seinen Gerechtigkeitssinn.
Vom Stadttor gelangten sie schnell bis zur Freiberger Burg. Der Burggraben war mit Wasser gefüllt und so tief und steil, dass es Angreifern unmöglich war, ihn zu durchqueren. Falls sie es versuchten, wären sie dabei hervorragende Ziele für Bogen- und Armbrustschützen.
Die beiden Reiter passierten die Brücke über den Burggraben und saßen ab. Unverkennbar herrschte auch hier große Anspannung. Auf dem Burghof hielten sich viel mehr Menschen auf als sonst. Doch der Anblick war für Christian beruhigend vertraut: der runde Bergfried mit der Silberkammer, die markgräfliche Münze, Schmiede, Backstube, Stallungen und alles, was sonst noch zu dieser Burg gehörte.
»Kümmere dich um die Pferde und iss etwas«, wies Christian seinen Knappen an. »Ich treffe mich derweil mit dem Kommandanten.«
Zu gern hätte Reinhard mitgehört, was es da zu besprechen gab. Schließlich war sein Vater der Burgkommandant! Aber er war nur ein Knappe. Und vermutlich würde er es ohnehin bald erfahren. Also hielt er Ausschau nach dem Stallmeister und Freunden aus seinen Freiberger Kindertagen. Von denen konnte er sich den neuesten Stadtklatsch erzählen lassen, sobald die Pferde versorgt waren. Ob wohl auch seine Mutter gerade auf der Burg weilte? So gern würde er sie sehen. Aber auf keinen Fall wollte er eine öffentliche Begrüßungsszene. Er war schließlich fünfzehn und kein Muttersöhnchen.
Christian ging sofort hinauf in die Kammer des Burgkommandanten, ohne auf die Fragen zu antworten, die ihm von allen Seiten zugerufen wurden.
Sein angeheirateter Vetter Simon von Werratal erkannte schon am Gesicht, welche Nachricht er zu hören bekommen würde. Zur Sicherheit sah er Christian fragend in die Augen, und der nickte nur mit finsterer Miene.
Simon riss die Tür auf und befahl ein paar Männern in seiner Nähe: »Ich will den Bürgermeister und zwei seiner Konsuln, den Bergmeister, den Rabbi, den Abt des Franziskanerklosters und den Pater der Marienkirche hier sehen – umgehend! Bittet sie höflich, aber lasst euch nicht abweisen. Sie sollen stehen und liegen lassen, was immer sie gerade zu tun haben. Es eilt!«
Während die Männer losliefen, wies Simon seinem jüngeren Verwandten einen Platz zu und schenkte ihm einen Becher Wein ein, den Christian mit Wasser verdünnte. Dann ließ er sich berichten.
Simon war entsetzt, aber wenig überrascht.
»Das Warten ist das Schlimmste«, gestand der Burgkommandant. »Wir haben alle Vorbereitungen getroffen. Aber wenn jetzt ein Tumult ausbricht …«
»Ist deine Frau nicht auf der Burg? Ich dachte, sie würde hier die Versorgung von Verwundeten vorbereiten.«
Simon rieb sich müde das Gesicht.
»Änne hat hier schon alles dafür eingerichtet und auch Helferinnen angelernt. Doch sie wurde ganz früh am Morgen zu einer Entbindung gerufen, weil die zwei hiesigen Wehmütter bereits in der Sächsstadt bei den Frauen der Bergleute beschäftigt waren. Und inzwischen wird sie wohl nach Boris von Zbor sehen. Sie sagt, dem alten Kämpen bleiben nur noch wenige Tage. Also reibt sie sich zwischen all ihren Pflichten auf. Dabei ist sie auch nicht mehr die Jüngste. Aber du weißt, wie innig sie ihren Vater liebt. Der ist nur leider kein sehr einsichtiger Patient.« Simon lächelte schief. »Obwohl er kaum noch Luft bekommt, wettert er die ganze Zeit, er sei sehr wohl in der Lage, ein paar Tartaren umzuhauen. Das lasse er sich nicht entgehen.«
Der Burgkommandant seufzte resigniert. »Man möchte es kaum glauben … Aber selbst in solch einer Lage werden Kinder geboren und schwinden Alte dahin. Das Leben schert sich nicht um Dinge, die vielleicht erst in drei Tagen geschehen.«
Sie schwiegen eine Weile und warteten. Derweil deckten Mägde den großen Tisch in der Kammer, brachten Becher, stellten Schüsseln und Platten mit Brot, Schinken, Käse und kaltem Geflügel auf.