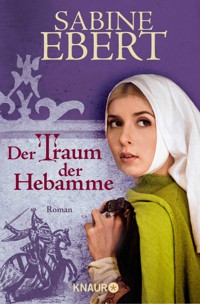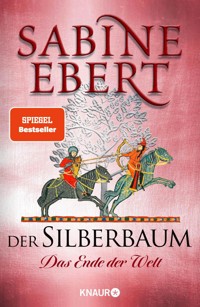9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Knaur eBook
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Das Barbarossa-Epos
- Sprache: Deutsch
Der fünfte Band und krönende Abschluss des großen Mittelalter-Epos von Bestseller-Autorin Sabine Ebert und das grandiose Finale der großen Saga der Barbarossa-Zeit 1167. Friedrich Barbarossas Italien-Feldzug endete verheerend. Nur mit Mühe entkommen er, seine geliebte Kaiserin Beatrix und ihre Kinder der Seuche, die unter seinen Männern wütet, und den Angriffen der Lombarden. Zwischen Heinrich dem Löwen und seinen zahllosen Feinden sind die Kämpfe mit großer Heftigkeit von Neuem entflammt. Friedrich muss schlichten, doch das gelingt ihm nur vorübergehend. Heinrichs Hochmut und Macht steigern noch, als er die blutjunge englische Königstochter Mathilde heiratet. Während sich Mathilde an das Leben an einem deutschen Hof gewöhnen muss, entfremden sich Kaiser Friedrich und seine Gemahlin Beatrix voneinander. In der Mark Meißen wird in Ritter Christians Siedlerdorf Silber gefunden. Markgraf Otto zögert nicht, daraus den größten Nutzen zu schlagen - ein Entschluss auch mit Auswirkungen auf das Machtgefüge im Kaiserreich. Die Front der Fürsten gegen Heinrich den Löwen, an der Otto und seine Brüder maßgeblich beteiligt sind, zwingt den Kaiser zu handeln, obwohl er dem Löwen bislang jedes Unrecht nachsah. Wer wird sich am Ende behaupten? Sabine Ebert schreibt Geschichte, unsere Geschichte – brillant, berührend, spannend! Der fulminante Abschluss des Barbarossa-Epos von der Königin des historischen Romans. Die Bände der großen Mittelalter-Saga sind in folgender Reihenfolge erschienen: - Band 1: Schwert und Krone. Meister der Täuschung - Band 2: Schwert und Krone. Der junge Falke - Band 3: Schwert und Krone. Zeit des Verrats - Band 4: Schwert und Krone. Herz aus Stein - Band 5: Schwert und Krone. Preis der Macht
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 636
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Sabine Ebert
Schwert und Krone - Preis der Macht
Roman
Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.
Über dieses Buch
1167. Friedrich Barbarossas Italien-Feldzug endete verheerend. Nur mit Mühe entkommen er, seine geliebte Kaiserin Beatrix und ihre Kinder der Seuche, die unter seinen Männern wütet, und den Angriffen der Lombarden. Zwischen Heinrich dem Löwen und seinen zahllosen Feinden sind die Kämpfe mit großer Heftigkeit von Neuem entflammt. Friedrich muss schlichten, doch das gelingt ihm nur vorübergehend. Heinrichs Hochmut und Macht steigern noch, als er die blutjunge englische Königstochter Mathilde heiratet. Während sich Mathilde an das Leben an einem deutschen Hof gewöhnen muss, entfremden sich Kaiser Friedrich und seine Gemahlin Beatrix voneinander.
In der Mark Meißen wird in Ritter Christians Siedlerdorf Silber gefunden. Markgraf Otto zögert nicht, daraus den größten Nutzen zu schlagen - ein Entschluss auch mit Auswirkungen auf das Machtgefüge im Kaiserreich. Die Front der Fürsten gegen Heinrich den Löwen, an der Otto und seine Brüder maßgeblich beteiligt sind, zwingt den Kaiser zu handeln, obwohl er dem Löwen bislang jedes Unrecht nachsah. Wer wird sich am Ende behaupten?
Sabine Ebert schreibt Geschichte, unsere Geschichte – brillant, berührend, spannend!
Inhaltsübersicht
Karte: Römisch-Deutsches Kaiserreich um 1181 – Nordteil
Dramatis Personae
Historisch belegte Personen der Handlung:
Staufer
Welfen
Wettiner
Askanier
Ludowinger
Geistlichkeit
Italien
England
Böhmen
Wichtige fiktive Personen
Erster Teil
Tod vor Rom
Ungewissheit
Der sächsische Krieg
Flucht in die Wälder
Eine königliche Braut von elf Jahren
In der Falle
Gewagtes Spiel
Der Letzte seines Hauses
Tröstungen
Gefährlicher Streit
Zwiegespräche
Beschwörende Worte
Des Kaisers Befehl
Kontrollverlust
Ein Geständnis zum Abschied
Zweiter Teil
Für ein Jahr allein
Ein Lied von Liebe und Schmerz
Geheime Ängste
Die Rückkehr der Pilgerfahrer
Große Pläne
Begegnungen in Goslar
Des Kaisers Wille
Verzweifeltes Sehnen
Lehrzeit
Das Turnier
Sühne
Rachefeldzug
Asche und Rauch
Aussichtslos
Vor Alessandria
Unter einer Bedingung
Dritter Teil
Legnano
Schreckensbotschaft
Tod und Leben
Gewitterstimmung
Der Unfriede von Venedig
Letztes Angebot
Gefährlicher Auftrag
Herausforderung
Feuersbrunst
Willkommen in der Hölle
Bitteres Zugeständnis
Die Beute wird verteilt
Bemerkenswertes Eingeständnis
Ein Wiedersehen nach langer Zeit
Ultimaten
Sieger und Besiegte
Epilog
Fünfzehn Jahre später
Historische Anmerkungen der Autorin
Danksagung
Stammtafeln
Die Staufer I
Die Staufer II – Die Nachkommen Friedrichs I. Barbarossa
Die Welfen
Das Haus Anjou-Plantagenêt – Die Könige von England
Das Haus Estridsson – Die Könige von Dänemark
Die Wettiner – Die Markgrafen von Meißen
Die Askanier – Die Markgrafen von Brandenburg
Die Ludowinger – Die Landgrafen von Thüringen
Glossar
Weiterführende Fachliteratur für Interessierte (kleine Auswahl)
Zeittafel
Römisch-Deutsches Kaiserreich um 1181 – Nordteil
Diese Landkarte finden Sie auch im Internet unter folgendem Link: www.droemer-knaur.de/preis-der-macht-bilder
Dramatis Personae
Historisch belegte Personen der Handlung:
Staufer
Friedrich I., römisch-deutscher König und Kaiser, König von Burgund (später genannt Friedrich Barbarossa)
Beatrix von Burgund, seine zweite Gemahlin
Ihre Söhne: Friedrich (früh gestorben), Heinrich (später Kaiser Heinrich VI.), Konrad (später Friedrich, Herzog von Schwaben), Otto (später Pfalzgraf von Burgund), Konrad (später Herzog von Rothenburg), Philipp (nach dem Tod seines Bruders Friedrich Herzog von Schwaben und bis zu seiner Ermordung 1208 König)
Weltliche Verbündete:
Berthold IV., Herzog von Zähringen und Burgund
Pfalzgraf Otto von Wittelsbach, Bannerträger Friedrichs und enger Freund
Graf Guido von Biandrate
Graf Goswin von Heinsberg
Burggraf Heinrich von Dohna, kaiserlicher Ministerialer
Gefolge:
Hartmann von Siebeneich, Kämmerer
Heinrich II. von Pappenheim, Marschall
Magister Guido, Leibarzt
Magister Kuno, Leibarzt und Kaplan
Gottfried von Viterbo, Kaplan und Geschichtsschreiber
Heinrich, Notar
Welfen
Heinrich der Löwe, Herzog von Sachsen und Bayern
Mathilde Plantagenet, seine Gemahlin, Tochter des englischen Königs Heinrich II.
Welf VI., Herzog von Spoleto und Markgraf der Toskana, Oheim Heinrichs des Löwen und Friedrich Barbarossas
Uta von Calw und Schauenburg, seine Gemahlin
Welf VII., beider Sohn
Weltliche Verbündete:
Dietho von Ravensburg, Gefolgsmann von Welf VI.
Adela von Vohburg, seine Ehefrau, einstige Gemahlin Friedrichs von Staufen
Graf Gunzelin von Hagen, Statthalter im Abodritenland, später Graf von Schwerin
Graf Bernhard von Lippe, Burgkommandant von Haldensleben
Graf Ludolf von Peine, Statthalter im Abodritenland
Heinrich von Weida, Ratgeber Heinrichs des Löwen
Graf Adolf III. von Holstein
Ekbert von Wolfenbüttel, Ministerialer
Heinrich von Lüneburg, Ministerialer
Pfaffe Konrad, Dichter und Verfasser der ersten mittelhochdeutschen Fassung des Rolandsliedes
Eilhart von Oberg, ebenfalls Dichter am Braunschweiger Hof und Verfasser der mittelhochdeutschen Fassung des Tristan
Wettiner
Otto, Markgraf von Meißen, später genannt Otto der Reiche
Hedwig, seine Gemahlin, Tochter Albrechts des Bären
Albrecht und Dietrich, beider Söhne
Dietrich, Ottos Bruder, Markgraf der Lausitz bzw. Ostmark (später Dietrich von Landsberg)
Konrad, sein Sohn
Dietrich, außerehelicher Sohn Dietrichs mit Kunigunde von Plötzkau
Dedo, Graf von Groitzsch (später Markgraf der Lausitz, Beinamen: Dedo der Fette oder Dedo der Feiste)
Mathilde von Heinsberg, seine Gemahlin, Schwester des Erzbischofs Philipp von Köln
Heinrich von Wettin und Friedrich von Brehna, weitere Brüder Ottos
Boris von Zbor, slawischer Ritter
Christian, Ritter in Ottos Diensten
Askanier
Albrecht von Ballenstedt, ehemals Herzog von Sachsen, Markgraf von Brandenburg, genannt Albrecht der Bär
Otto, Hermann, Adalbert, Dietrich, Siegfried, Heinrich und Bernhard, seine Söhne
Adele, Schwester des Meißner Markgrafen Otto, Witwe des Königs Sven von Dänemark, Gemahlin von Graf Adalbert von Ballenstedt
Ludowinger
Landgraf Ludwig II., genannt der Eiserne (gestorben 1172)
Landgraf Ludwig III., genannt der Fromme
Geistlichkeit
Alexander III., Papst (ehemals Rolando Bandinelli)
Viktor IV., Papst
Paschalis III., Papst
Philipp von Heinsberg, Kanzler Friedrich Barbarossas und Erzbischof von Köln
Wichmann, Erzbischof von Magdeburg, Vetter der Markgrafen Otto von Meißen und Dietrich von der Lausitz
Christian von Buch, Erzbischof von Mainz
Martin, Bischof von Meißen
Hartwig, Erzbischof von Bremen
Ulrich, Bischof von Halberstadt
Italien
Meister Marchese, Kriegsmaschinenkonstrukteur
Graf Guido von Biandrate, Mailänder und Vertrauter des Kaisers
England
König Heinrich II. Plantagenet
Eleonore von Aquitanien, Königin
Mathilde Plantagenet, beider Tochter, Gemahlin Herzog Heinrichs des Löwen
Richard Löwenherz, beider Sohn, späterer König von England
Böhmen
Soběslav II., Herzog von Böhmen und Landgraf von Mähren aus dem Geschlecht der Přemysliden
Wichtige fiktive Personen
Stefano di Stella, Dolmetscher in Diensten des Kaisers
Marie Claire, seine Frau, Hofdame der Kaiserin Beatrix
Marthe, Heilkundige in Christiansdorf
Lukas und Raimund von Muldental, Ritter und Christians Freunde
Randolf von Muldenstein, Ritter am Hof des Markgrafen von Meißen, Christians Erzfeind
Witko, ein Spielmann aus Meißen
Erster Teil
Fiasko im Süden, Revolte im Norden
Tod vor Rom
Kaiser Friedrich I., seine Gemahlin Beatrix, der Dolmetscher Stefano di Stella und seine Frau Marie Claire, Hofdame der Kaiserin; auf dem Monte Mario vor Rom, Mitte August 1167
Der Gestank war unerträglich.
In den Straßen von Rom und im Heerlager des Kaisers vor der Stadt lagen verwesende Leichen zuhauf in der Sommerhitze, und niemand war noch kräftig genug, sie zu begraben. Die vor einigen Tagen ausgebrochene Seuche hatte in den Zeltlagern schon hunderte Männer hinweggerafft – und das in beängstigender, bislang nie erlebter Geschwindigkeit. Die Opfer starben binnen Stunden nach Auftreten der ersten Anzeichen.
Und immer wieder trug der Wind den Gestank auch hinauf auf den Monte Mario, wo der Kaiser mit seinen engsten Vertrauten Quartier genommen hatte. Zwar wütete die furchtbare Heimsuchung auf diesem höchsten Hügel vor Rom nicht so heftig wie im Tal. Doch auch hier war das Grauen allgegenwärtig. Boten kamen und überbrachten immer neue Schreckensnachrichten. Es starben Geistliche wie Ritter, es starben Bischöfe und Fürsten zu Dutzenden, Männer von Rang mit großen Namen. Weder Namen noch Titel noch Reichtum konnten sie schützen.
Und auch hier oben auf dem Hügel hafteten die grauenvollen Ausdünstungen des Todes an allem, der Geruch nach Exkrementen, Schweiß, Blut und Erbrochenem. Er setzte sich auf der Haut und in den Haaren der Menschen fest, in den Kleidern, den Stoffbahnen der Zelte, und er heftete sich an die Schuhe.
Totenbleiche Gestalten mit dunklen Augenringen und eingefallenen Wangen wankten Geistern gleich durch das Lager. Die meisten Männer hatten sich die Haare scheren lassen, weil dies als wirksames Mittel gegen das Fieber angesehen wurde. Die kahlen Schädel ließen sie noch unheimlicher wirken.
Angst beherrschte das Lager des Kaisers.
Als deutlich wurde, wie erbarmungslos und rasend schnell diese Seuche zuschlug, hatten die Leibärzte des Kaisers darauf bestanden, dass die Kaiserin und ihre kleinen Söhne – dreijährig, zweijährig und erst wenige Monate alt – zusammen mit einigen Kammerfrauen in einem Zelt einquartiert wurden, vor dem Wachen standen und jedermann den Zutritt verwehrten, der die Krankheit zu ihnen tragen könnte. Die Gemahlin und die Erben des Kaisers sollten vor Ansteckung bewahrt werden. Im Prunkzelt des Herrschers gingen notwendigerweise zu viele Männer ein und aus, von denen jeder Einzelne den Tod schon in sich tragen konnte, ohne es zu ahnen.
Das Innere des Zeltes der Kaiserin war von der gleißenden Augustsonne bis zur Unerträglichkeit aufgeheizt, und seine Leinenwände verströmten jenen schrecklichen Gestank, der überall waberte. Beatrix meinte, ihn nie wieder loszuwerden.
Sie trat zur Öffnung des Zeltes und schob in der Hoffnung auf eine Brise frischer Luft die Stoffbahn vorsichtig ein wenig beiseite.
Die beiden Wachen blickten besorgt, wagten aber nichts zu sagen. Schließlich hatte die zierliche junge Kaiserin das Zelt noch nicht verlassen.
Sie sah die beiden an und stellte fest, dass sie nur einen von ihnen kannte; der Zweite war neu.
»Wo ist Gottfried?«, fragte sie stirnrunzelnd.
Dessen Gefährte senkte den Blick, doch ihm entglitten die Gesichtszüge.
»Er erkrankte in der Nacht, Euer Majestät. Seine Gedärme sind … Nein, ich mag es Euch nicht beschreiben, Majestät, ich will weder Anstoß erregen noch Euch Furcht einjagen. Als ich ging, um meine Wacht hier anzutreten, da krümmte er sich vor Schmerz am Boden. Ich fürchte, inzwischen ist er tot.«
Der Mann bekreuzigte sich und flüsterte ein Gebet, während ihm Tränen über die Wangen liefen. Dann versicherte er hastig: »Ich habe ihn nicht berührt, Majestät!«
Hoffnungslos ließ Beatrix ihren Blick über die Ansammlung von Zelten und Koppeln schweifen. Hier mochten sie von dem Unheil zwar weniger betroffen sein als unten im Heerlager auf den Neronischen Feldern. Stefano di Stella, der einhändige Dolmetscher Friedrichs und Ehemann ihrer Vertrauten Marie Claire, hatte dem Kaiser bei der Ankunft in Rom geraten, auf dem Hügel Stellung zu beziehen, weil um diese Jahreszeit häufig schwere Unwetter über der Stadt niedergingen und danach oft Seuchen entbrannten.
Aber niemand hatte ahnen können, dass sich seine Warnung schon wenige Tage später auf so grauenvolle Art erfüllen würde. Nach einem heftigen Unwetter stiegen Schwärme von Insekten und üble Dünste aus den Sümpfen auf, und nur Stunden später begann der Tod, seine Ernte einzuholen.
Stefano war es zu danken, dass die kaiserliche Familie noch lebte. Doch Hunderte waren gestorben. Und wohin Beatrix auch sah – es war gespenstisch.
Ein Stück links von ihr versuchte jemand, auf sein Pferd zu steigen, und brachte dafür nicht mehr die Kraft auf. Rechter Hand sackten zwei Männer mitten auf dem Pfad in die Knie, falteten die zitternden Hände und flehten Gott an, sie vor dem qualvollen Tod zu bewahren, dem so viele ihrer Weggefährten zum Opfer gefallen waren.
Wir müssen diesen Ort schleunigst verlassen, dachte Beatrix verzweifelt. Meine Kinder! Wie soll ich meine Kinder sonst lebend nach Hause bringen? Noch nie, nicht einmal in den ersten Jahren ihrer Ehe, hatte sie sich so sehr nach Burgund gesehnt. Dort wäre sie in Sicherheit, geschätzt und behütet.
Plötzlich war ein Wimmern aus dem hinteren Teil ihres Zeltes zu hören. Beatrix erstarrte vor Schreck und ließ die Stoffbahn fallen.
Hat die Seuche meinen Erstgeborenen befallen, Friedrich, der ohnehin schon kränklich ist? Oder Heinrich? Oder gar den kleinen Konrad, der kaum ein halbes Jahr zählt?, fragte sie sich entsetzt und lief nach hinten.
Doch was sie sah, ließ sie erleichtert aufatmen – wenn auch nur für den Moment. Die hübsche Marie Claire hatte den greinenden jüngsten Prinzen schon auf den Arm genommen, wiegte ihn und sprach beruhigend auf ihn ein, bis die Amme ihn anlegte.
»Er hat Durst«, sagte Marie Claire beschwichtigend zu Beatrix. »Kein Wunder bei dieser Hitze.« Sie rang sich ein Lächeln ab und wischte sich ein paar Schweißtröpfchen mit dem Saum ihres Schleiers von der Stirn.
Beatrix konnte den Blick kaum von dem Säugling wenden, der nun glucksend trank.
Dann nahm sie Marie Claire an der Hand und zog sie ein paar Schritte zur Seite, weg von den Ammen und Kinderfrauen.
»Dein Mann ist schon gestern zum Kaiser gegangen, um ihn zu unserem raschen Aufbruch zu drängen«, raunte sie ihr zu. »Wie es scheint, hat er nichts bewirkt. Wir müssen diesen unheilvollen Ort verlassen! Hier erwartet uns sonst der Tod.«
Marie Claire hob bedauernd die Hände. Auch sie wollte fort von hier, auch sie ängstigte sich um ihr Kind, um das Töchterchen, das sie und Stefano bekommen hatten und das sie innig liebten. Sie fürchtete um sich selbst und Stefano, und das Grauen über das allgegenwärtige, qualvolle Sterben um sie herum bescherte ihr Alpträume.
Stefano hatte die relative Sicherheit dieses Zeltes verlassen, wo er im Auftrag des Kaisers für Beatrix, Marie Claire und ihre Kinder sorgen sollte, um Friedrich davon zu überzeugen, sich mit den Resten seines Heeres unverzüglich nach Norden durchzuschlagen. Fort von diesem verseuchten Ort.
Ohne Erfolg bislang.
»Es tut mir leid«, sagte die junge Frau leise.
Beatrix wog kurz den Impuls ab, der sie überkam. Doch was sie auch tat, warten oder handeln, brachte ihre Kinder in Gefahr. Und das Nichtstun angesichts dieser Katastrophe hielt sie nicht länger aus. Also warf sie noch einmal einen prüfenden Blick auf ihren Jüngsten, der zufrieden trank, machte entschlossen auf der Hacke kehrt und lief zurück zum Eingang des Zeltes.
Die beiden Wachen wollten sie daran hindern, die Unterkunft zu verlassen, und stellten sich ihr in den Weg.
»Euer Majestät der Kaiser hat ausdrücklich verfügt …«, begann kleinlaut der ältere von ihnen, der aus Schwaben stammte, wie sie wusste und auch am Dialekt heraushörte.
Sie richtete sich kerzengerade auf, womit sie immer noch anderthalb Köpfe kleiner war als er, sah ihm ins Gesicht, reckte das Kinn und sagte streng: »Ich bin deine Kaiserin. Und ich wünsche dringend meinen Gemahl zu sprechen, den Kaiser. In einer überaus wichtigen Angelegenheit, die keinen Aufschub duldet!«
Nach kurzen, verunsicherten Blickwechseln zwischen den Wachen wandte der Schwabe ein: »Aber die Seuche … Euer Majestät …«
»Seht Ihr Siechende oder Tote auf dem kurzen Weg von diesem Zelt zu dem meines Gemahls? Nein. Die Ärzte sagen, es sind die üblen Dünste, die uns krank machen, und sie könnten überall aus dem Boden aufsteigen, auch in diesem Zelt. Also lasst mich durch, sofort!«
Wieder sahen sich die beiden Wachen unentschlossen an.
Doch Beatrix’ forderndem Blick hielten sie nicht stand und traten schließlich zögernd zur Seite.
Mit raschen Schritten durchquerte die junge Kaiserin das Lager bis zum Zelt ihres Gemahls, den Blick starr auf den Boden gerichtet, als könnte dieser jederzeit aufbrechen und sie mit einer Wolke giftigen Nebels umhüllen, aus der es kein Entrinnen gab. Aus den Augenwinkeln bekam sie mit, dass links und rechts von ihr Männer erstarrten oder forthuschten. Erst fünf Schritte vor dem roten Zelt ihres Gemahls, ein Geschenk des englischen Königs zu ihrer Hochzeit, richtete sie den Blick gebieterisch auf die Wachen, die sich respektvoll vor ihr verneigten und widerspruchslos zur Seite traten, um sie einzulassen.
Der Anblick, der sich ihr im Inneren bot, traf sie völlig unvorbereitet.
Friedrich hatte in den Jahren seit ihrer Vermählung viele Auseinandersetzungen und Kriege bestritten, war dabei aber stets kampflustig und unbeirrbar geblieben.
Doch jetzt saß er zusammengekrümmt in seinem Stuhl, eine Hand um die Stirn gewölbt, die Augen geschwollen und gerötet. Hinter ihm standen mit bedrückten Mienen der Erzbischof von Mainz und Philipp von Heinsberg, der Kanzler und Domdekan von Köln.
Ist Friedrich auch erkrankt?, dachte Beatrix entsetzt. Wird er auch sterben? Was soll dann aus mir und den Kindern werden?
Doch da hatte er sie schon gesehen und stemmte sich taumelnd hoch. Er streckte ihr die Arme entgegen und fragte erschrocken: »Was tust du hier, Liebste? Ist etwas mit unseren Söhnen?«
»Nein. Noch geht es uns gut«, sagte sie, und erleichtert sank er zurück auf seinen Stuhl. Im Gegensatz zu den meisten Männern hatte er sich das Haar nicht scheren lassen; es wäre der Würde eines Herrschers abträglich.
Rasch glitt der Blick der Kaiserin über die Runde der Männer, um zu prüfen, wer unter ihnen ihr Verbündeter in dieser Angelegenheit sein könnte. Stefano und die Leibärzte, befand sie ohne Zögern und fing den Blick des jungen Übersetzers auf, der seine rechte Hand vor einigen Jahren in den Kämpfen um Rom eingebüßt hatte. Stattdessen trug er über dem Armstumpf eine kunstvoll konstruierte Hand aus Metall, die ihm einer der besten italienischen Maschinenbauer, Meister Marchese, auf Bitten der Kaiserin entworfen hatte.
»Lass uns von hier fortgehen, mein liebster Gemahl, fort von diesem Ort des Todes! Ich flehe dich an! Gib den Befehl zum Aufbruch, sonst werden wir alle qualvoll sterben, und unsere Söhne zuerst.«
Sie deutete auf den aus Rom stammenden Dolmetscher. »Niemand kennt sich so gut in dieser Gegend aus wie er. Und sein Rat lautet, gen Norden zu ziehen. Stefano, steht mir bei! Dank Eurer Voraussicht haben wir bisher hier auf diesem Hügel überlebt. Doch wie lange noch?«
Da sie ihren Gemahl nicht durch offenen Widerspruch im Beisein seiner Gefolgsleute diskreditieren durfte, sank sie vor ihm auf die Knie. Aber bevor sie den Blick senkte, forderte sie Stefano mit einer Geste zum Sprechen auf.
»Ja, Euer Majestät, auch ich flehe Euch an: Verlasst diesen Ort!«, riet er eindringlich. »Zieht Richtung Norden! Dort gibt es kühle Wälder, reich an Bächen und frischem Quellwasser.«
Die beiden Leibärzte, die Magister Guido und Kuno, nickten eifrig.
Friedrich sah von einem zum anderen und rieb sich über das bleiche Gesicht.
Nach langem Schweigen befahl er schließlich: »Steht auf, meine teure Gemahlin! Und Ihr anderen: Geht alle hinaus! Ich möchte allein mit der Kaiserin sprechen.«
Sobald die anderen das Zelt des Kaisers verlassen hatten, streckte Friedrich Beatrix beide Hände entgegen, um ihr aufzuhelfen. Er zog sie zu einem mit Krug und Bechern gedeckten Tischchen, wo sie sich nebeneinander auf einer schmalen Truhe niederließen, die davor stand.
Von draußen drangen verzweifelte Rufe durch die Leinenwände. Drinnen saß reglos Friedrichs liebster Jagdfalke auf der Stange und starrte sie an.
Beatrix hatte inzwischen vorsichtig die Züge ihres Gemahls erkundet und kam zu einer schlimmen Erkenntnis.
»Wer?«, fragte sie ohne jede Vorrede.
Stündlich erreichten sie neue Todesnachrichten. Ein halbes Dutzend Bischöfe waren der Seuche schon binnen weniger Tage erlegen, vertrauenswürdige Berater und erfahrene Schlichter, Kampfgefährten, angesehene Fürsten und auch sein Vetter Friedrich von Rothenburg, der Sohn des alten Königs Konrad.
Zweifellos hatte jeder einzelne Tod ihren Gemahl getroffen. Doch geweint hatte er bisher noch nie. Wenn ihm jetzt Tränen in die geröteten Augen schossen, dann ahnte sie die Antwort.
»Wer?«, wiederholte sie leise, während Friedrich Kraft für die Antwort sammelte.
»Rainald.«
Die zwei kurzen Silben waren eine einzige Wehklage, ein Aufschrei der Verzweiflung. Der Kaiser bedeckte seine Augen mit der Hand, und seine Schultern bebten.
Beatrix legte ihm tröstend und beruhigend ihre Rechte in den Nacken, strich mit der Linken durch sein Haar wie bei einem Kind.
Dabei jagten ihre Gedanken wild durcheinander. Rainald von Dassel, Erzbischof von Köln und einflussreichster Mann des Reiches nach dem Kaiser selbst … Friedrich vertraute ihm uneingeschränkt, er hatte Rainalds Winkelzüge und durchtriebene Strategien stets ohne Zögern befolgt. Wobei sie einräumen musste, dass es Rainald dabei stets um das Wohl und die Ehre des Kaisers gegangen war. Genauer gesagt: darum, was er dafür hielt. Er hatte auch häufig Streit vom Zaun gebrochen, vor allem den mit dem Papst. Die Folgen mussten sie nun tragen.
So schwer Friedrich von Rainalds Tod getroffen sein mochte – Beatrix hatte den Kölner nie leiden können. Sie war nicht nur eifersüchtig auf seinen übermächtigen Einfluss; sie hatte ihn gefürchtet. Früher oder später wäre er auch ihr gefährlich geworden.
Sanft löste sie Friedrichs Hand von seinen Augen.
»Ein Platz im Himmelreich ist ihm gewiss«, sagte sie leise. Doch dann blickte sie ihm ins Gesicht und sagte mit fester Stimme: »Siehst du es nicht, Geliebter? Der Tod rückt immer näher an die Menschen heran, die dir am Herzen liegen. Er greift sich deine besten Freunde und engsten Berater. Willst du erst warten, bis er sich unsere Söhne holt?«
Wieder kniete sie vor ihm nieder, obwohl keine Zeugen zugegen waren, und umfasste seine Hände.
»Bitte, lass uns von diesem Ort fliehen! Um das Leben unserer Kinder willen! Lass uns gen Norden reiten, der Seuche, der Hitze, dem Gestank entkommen, Zuflucht in lauschigen Wäldern finden, durch die klare Bäche sprudeln.«
Friedrich stöhnte auf und zog sie erneut hoch, bestand darauf, dass sie wieder neben ihm Platz nahm.
»Wie denn?«
Seine Frage war fast ein Aufschrei.
»Die Männer sterben mir weg, ehe mein Befehl sie erreicht. Das Fußvolk ist aus Angst vor dem Tod in Scharen davongelaufen. Wer von den Rittern noch lebt, hat keine Kraft mehr, die Rüstung anzulegen. Selbst die Pferde sind zu schwach. Es ist ja nicht nur diese schreckliche Seuche … Wir haben auch kaum noch Proviant und Futter. Die norditalienischen Städte schlossen sich zu einem so mächtigen Bündnis gegen uns zusammen, dass ich einen Kampf gegen sie nicht gewinnen kann. Wir müssten uns zu den Alpenpässen durchschlagen. Doch wie soll das gehen in diesem Zustand?«
Nach einem tiefen Atemzug zuckte er mit den Schultern und sagte mit stumpfem Blick: »Wir können nicht fort.«
Beatrix war erschüttert vom Umfang der Niederlage, die ihr sonst stets zum Kampf bereiter Gemahl da eingestand.
»Wenn wir bleiben, sterben wir auch!«, mahnte sie verzweifelt.
Friedrich stöhnte.
»Soll ich etwa den Rückzug befehlen? Eine wilde Flucht? Du verstehst nicht …«
Er stockte, wohl um zu überlegen, wie er ihr am besten klarmachen konnte, dass sein Dilemma sogar noch größer war, als er bisher zugegeben hatte.
»Ich erlebte bereits einige schlimme Niederlagen in meinem Leben«, begann er mit rauer, brüchiger Stimme. »Selbst eine, bei der wir neun Zehntel des Heeres binnen weniger Stunden verloren … Beim Zweiten Kreuzzug nahe Doryläum, vor genau zwanzig Jahren.«
Beatrix nickte; sie hatte von den entsetzlichen Ereignissen gehört.
»Doch damals konnten wir den Seldschuken die Schuld geben, die uns überfielen, dem Hunger, dem Wassermangel … Und auch dem Wechselfieber, das in den südlichen Ländern viel häufiger auftritt.«
Er sah sie an, und erneut nickte sie zustimmend. Das wusste schließlich jeder, der viel reiste.
»Aber noch nie hat irgendwer eine Seuche so schnell zuschlagen sehen wie hier! Noch nie hat ein lebender Mensch von etwas Ähnlichem gehört. Die Rede geht leise und zunehmend auch laut, Gottes Zorn habe uns heimgesucht, weil ich mit dem Schisma die Christenheit spalte. Weil ich Alexander nicht als Papst anerkenne.«
Müde strich er sich durch die rötlichen Locken, ehe er mit seinem Eingeständnis fortfuhr.
»Sieh doch: Als Erste starben diejenigen Bischöfe, die sich im Streit um den wahren Papst auf meine Seite gestellt hatten – gegen Alexander und für Paschalis. Und nun ist Rainald gestorben. Derjenige, der das Zerwürfnis geplant und Paschalis zum wahren Papst gemacht hatte. Muss das nicht Wasser auf die Mühlen der Zweifler sein? Bin ich schuld an alldem, weil ich zuließ, dass eine kostbare, uralte Kirche zerstört wurde, als wir uns zum Petersdom durchkämpften?«
»Dann wäre ich genau so schuldig, denn du tatest es, damit ich zur Kaiserin gekrönt werde«, entgegnete Beatrix erschrocken. »Und unsere Kinder wären erst recht in Gefahr. Ich flehe dich an: Verlassen wir diesen unheilvollen Ort!«
Ihr Blick war herzerweichend, und Friedrich rang sich zu einem Entschluss durch.
Er rief laut den Markgrafen der Lausitz herein, einen Jugendfreund und langjährigen Vertrauten. Dietrich war mit dreißig Rittern nach Rom gekommen, von denen fast alle in den letzten Tagen gestorben waren.
»Gebt Befehl, Fürst Dietrich, unseren Aufbruch vorzubereiten! Morgen früh verlassen wir diesen Ort und ziehen in die Waldgebiete weiter nördlich. Die Erkrankten müssen zurückbleiben. Wir haben niemanden, der sich um sie kümmern kann. Vielleicht finden sich ein paar Mönche dazu bereit.«
Markgraf Dietrich, staubbedeckt und verschwitzt von der Glut des römischen Sommers, nickte erleichtert. Dann ging er nach draußen, um den Befehl weiterzugeben und unter all den bleichen, wankenden und kahlgeschorenen Gestalten ein paar Männer zu finden, die noch kräftig genug waren, ihn auszuführen.
Derweil rief der Kaiser den Erzbischof von Mainz zu sich. »Nach diesen Verlusten – es sind schon über tausend Mann in wenigen Tagen – brauchen wir Verstärkung, wenn wir es heil über die Alpen schaffen wollen, vorbei an den Truppen des Lombardischen Städtebunds. Höchstwürden, ich entsende Euch und den Herzog von Zähringen, um meine Fürsten aufzufordern, mir neue Kontingente zu schicken.«
Christian von Mainz war ein kampferprobter Mann, der eine größere Anzahl Krieger nach Italien geführt und erst vor einigen Wochen in der Schlacht um Tusculum in vorderster Reihe gefochten hatte. Wie viele seiner Ritter noch lebten, wusste wohl niemand. Aber kleine Reisegesellschaften waren unauffälliger. Hauptsache, er und der Zähringer konnten sich durchschlagen und die dringend benötigte Verstärkung holen.
Bevor der Erzbischof von Mainz gehen durfte, um seine Reisevorbereitungen zu treffen, hielt ihn Friedrich noch einmal zurück, für einen zweiten Auftrag: »Und sagt den Herren Fürsten, die Krieg gegen meinen Vetter Heinrich den Löwen führen, sie sollen dies gefälligst unterlassen! Ich erwarte einen Waffenstillstand. Umgehend!«
Den Krieg, der nördlich der Alpen in seinem Reich tobte, hätte er über der Katastrophe vor Rom und der Bedrohung durch den Lombardischen Städtebund fast vergessen.
Deshalb beschloss er kurzerhand, dem Markgrafen der Lausitz einen weiteren Befehl zu erteilen, als sich dieser wieder blicken ließ.
»Dietrich, reitet zurück in Eure Lande, heute noch! Ihr habt fast alle Eure Männer verloren und könnt dort mehr ausrichten als hier. Überzeugt Eure Brüder und den Markgrafen von Brandenburg davon, dass sie den Kampf gegen den Herzog von Sachsen und Bayern sofort einstellen, wenn sie nicht meiner Gnade verlustig gehen wollen. Ich verlasse mich auf Euch.«
Ihrem besonnenen Verwandten würden die rebellischen Wettiner und Askanier eher folgen als dem Erzbischof von Mainz oder dem Zähringer.
Dietrich bestätigte den Befehl – teils erleichtert, teils bedrückt wegen der vielen Todesnachrichten, die er in seiner Markgrafschaft zu überbringen hatte – und stapfte los, um die letzten seiner Männer zu sammeln.
Die Damen um Beatrix hatten alle Hände voll zu tun, den Aufbruch am nächsten Morgen vorzubereiten.
Als ihr Zelt abgebrochen wurde, trat sie hinaus und ließ ihren Blick schweifen.
Es waren noch etliche Männer damit beschäftigt, das vierkammerige rote Zelt des Kaisers auseinanderzunehmen und Leinenwände, Masten und Truhen auf mehrere Ochsenkarren zu laden. Sie würden ihnen nachfolgen.
Friedrich stand neben seinem bereits gesattelten Pferd, in seiner Nähe einige seiner engsten Vertrauten.
»Wo bleibt die Vorhut? Wie lange soll ich denn hier noch warten?«, fragte er ungeduldig und schickte zwei ältere Knappen hinunter ins Lager, damit sie der betreffenden Hundertschaft Reiter ausrichteten, sie solle sich gefälligst beeilen.
Das bedeutete zu warten, bis die Knappen zurückkamen, im besten Fall mit der voll bewaffneten Vorhut zu Pferde.
Doch nach schier endloser Zeit kehrte nur einer allein zurück, atemlos und aschgrau im Gesicht.
»Was ist los? Wo steckt dein Begleiter?«, herrschte der Marschall Heinrich von Pappenheim den jungen Burschen an. »Er wird doch nicht unterwegs gestorben sein?«
Japsend fiel der Knappe auf die Knie. »Er ist weggerannt, ich weiß nicht, wohin«, berichtete er weinend. »Er sagte, lieber sei er ein Feigling, als hinunter ins Tal zu gehen und sich im Lager den Tod aufzulesen …«
Der Marschall verzog unmutig das Gesicht. Es war viel Fußvolk desertiert in den letzten Tagen. Ohne Rücksicht auf die Folgen, ohne Mitgefühl mit Freunden und Verwandten. Die Angst war größer, genauso qualvoll zu verrecken wie schon hunderte Männer im Heer.
»Und die Vorhut, wann kommt endlich die Vorhut?«, verlangte der Kaiser zu wissen.
Der Bursche verstummte, rieb sich mit dem Ärmel die Tränen vom Gesicht, und als er sein Antlitz wieder unbedeckt war, stand darauf das blanke Entsetzen.
»Die Pferde grasten in der Koppel, die Bündel lagen dort, sie waren noch gestern Abend gepackt worden. Doch als ich die Zelte betrat, da waren alle Männer tot!«, rief er und schluchzte. »Alle hundert. Alle Männer in sämtlichen Zelten … Nicht ein einziger lebte noch …«
Nun sackte er ganz zu Boden, griff sich mit beiden Händen an den Kopf und wiegte den Oberkörper hin und her.
Entsetztes Schweigen legte sich über den wartenden Hofstaat.
»Eure Majestäten, Ihr müsst diesen Ort verlassen«, drängte Magister Guido in höchster Sorge.
Da endlich gab Friedrich den Befehl zum Abmarsch, doch der glich mehr einer heillosen Flucht als einem geordneten Aufbruch. Sie ritten wie von unsichtbaren Teufeln gejagt, von unheilvollen Dünsten, die den Tod brachten.
Hinter sich hörten sie noch die entsetzten Rufe derer, die im Lager zurückgeblieben waren. »Flieht, flieht!«, schrien sie sich gegenseitig zu. »Der Tod ist uns auf den Fersen!«
Ungewissheit
Der Meißner Markgraf Otto, seine Gemahlin Hedwig, seine Brüder Dietrich und Dedo, Dietrichs Sohn Konrad, Dedos Gemahlin Mathilde; Meißen, September 1167
Der Markgraf von Meißen war wieder einmal ziemlich schlecht gelaunt. Seit Tagen bereits. Seit schlimme Nachrichten vom Verlauf des Italienzuges des Kaisers den Meißner Burghof erreicht hatten, über den längst die schrecklichsten Gerüchte kursierten. Die hatte sein soeben aus Rom zurückgekehrter Bruder Dietrich nun bestätigt – sogar die unglaublichsten! Und Fürst Otto war schon in guter Stimmung ein furchteinflößender Mann.
Kein Wunder also, dass die beiden jungen Pagen vor der Tür zu seiner Kammer miteinander rangelten und sich hektisch gegenseitig Gründe zuflüsterten, weshalb der jeweils andere vorangehen sollte, um den georderten Krug mit kühlem Wasser hineinzutragen.
»Klopf du an, der Fürst ist schließlich dein Oheim!«, versuchte der ältere von beiden, den zehnjährigen Konrad anzutreiben.
Der jedoch glaubte nicht, dass er sich bei seinen gestern angetretenen Pagendiensten am Meißner Hof auf die enge Verwandtschaft mit Markgraf Otto berufen durfte.
Sein gerade erst aus Italien zurückgekehrter Vater – Dietrich von der Lausitz, der jetzt auch in dieser Kammer saß, in die sie sich nicht trauten – hatte ihm das gestern noch einmal ausdrücklich erklärt, bevor er ihn dem meißnischen Truchsess überantwortete.
»Du bist jetzt Page an einem Fürstenhof und sollst alles lernen, was du wissen und können musst, damit du Knappe und später einmal Ritter werden kannst. Dabei spielt es keine Rolle, wer dein Vater ist. Du wirst nur danach beurteilt werden, was du leistest. Eher sogar noch strenger als die anderen – und zwar genau wegen deiner Herkunft und der Verantwortung, die die Zukunft für dich bereithält.«
Wäre er nicht so eingeschüchtert gewesen, hätte Konrad bei dieser Ermahnung die Augen verdreht.
Ja, er war der einzige legitime Sohn eines Markgrafen und sollte nach dessen Tod die Mark Lausitz regieren. Das hatte er schon oft genug zu hören bekommen. Aber in jenem Moment war ihm das Herz schwer gewesen wegen des Abschieds von seinem Zuhause in Eilenburg und der Ungewissheit, ob er die vielen neuen Pflichten bewältigen konnte.
Sein Vater musste das wohl gespürt haben, denn er hatte ihm die Hand auf die Schulter gelegt, ihn angesehen und gesagt: »Mach mir keine Schande!«
Das wollte Konrad auch nicht, um nichts auf der Welt.
Aber es war nicht so einfach, wenn man erst zehn Sommer zählte und von einem Tag auf den anderen in Diensten eines Reichsfürsten stand. Dabei hätte ihn sein erlauchter Vater schon vor drei Jahren in einen anderen Haushalt schicken sollen, wie es üblich war. Weshalb er dies so lange hinausgezögert hatte, wusste Konrad nicht. Die möglichen Gründe dafür nährten seine Selbstzweifel noch mehr. Meinte sein Vater, er würde die Aufgaben nicht bewältigen können, weil er bevorzugt die linke Hand benutzte statt der rechten? Das komplizierte seine Ausbildung an den Waffen. Er hatte schon etliche Lektionen vom Waffenmeister seines Vaters erteilt bekommen – mit eher betrüblichem Ergebnis.
»Du klopfst an und fragst, ich trage den Krug!«, zischte er Jakob zu. Der war elf und schon seit vier Jahren Page am Meißner Hof. Er kannte sich also hier aus und wusste auch, wie sie sich am besten verhielten, um keinen Ärger zu bekommen. Der Markgraf von Meißen hatte heute schließlich nicht zum ersten Mal schlechte Laune.
Und den Krug zu tragen, war auch keine leichte Aufgabe. Was, wenn er ihn fallen ließ oder stolperte und dem Oheim das Wasser über die Kleider oder die Schuhe schüttete?Außerdem: Da drinnen saß sein Vater und würde ihn mit strengen Blicken beobachten. Nicht auszudenken, wenn ihm ein Missgeschick unterliefe.
Mitten im Gerangel und Gezischel der beiden Jungen wurde plötzlich die Tür von innen geöffnet.
Die Knaben fuhren vor Schreck zusammen, und prompt ergoss sich ein Schwall Wasser über Konrads Füße. Rasch wichen sie zwei Schritte zurück, während die Markgräfin heraustrat, Konrads Tante Hedwig.
Er fand sie wunderschön in ihrem roten Kleid und mit dem langen blonden Haar. Sie war die Einzige am Meißner Hof, die ihm keine Angst einflößte.
Hedwig beugte sich zu ihrem Neffen hinab und legte ihm eine Hand auf die Schulter – ganz anders als sein Vater, nicht so fest, sondern sanft, und ihre Hand war warm und weich.
Sie sah ihm in die Augen und sagte mit aufmunterndem Lächeln: »Nun geh schon hinein, ehe Seine Durchlaucht euch noch vermisst.«
Spätestens von diesem Moment an liebte Konrad seine Tante heiß und innig.
Die Liebe einer Mutter hatte er nie erfahren. Seine leibliche Mutter verließ Eilenburg, kaum dass er geboren und getauft worden war. Sein Vater sprach nie von ihr. Der alten Kinderfrau hatte er ab und an ein paar Einzelheiten entlocken können. Zum Beispiel dass im Meißner Dom, nur ein paar Schritte vom markgräflichen Palas entfernt, ein festlicher Taufgottesdienst für ihn stattfand, während draußen ein Unwetter mit Sturm, Blitz und Donner und gewaltigen Regengüssen wütete. Aber vielleicht hatte sie sich das auch nur ausgedacht, damit er sich gruselte.
Hier in Meißen bemühte sich nun seine freundliche Tante, ihm die Mutter zu ersetzen. Doch jetzt konzentrierte er sich besser auf seine Aufgabe.
Während die Markgräfin zur Treppe schritt, traten er und Jakob ein und verneigten sich. Markgraf Otto gab einen mürrischen Ton von sich, bedeutete ihnen, den Krug abzustellen, und schickte sie wieder hinaus, um Sitzkissen zu holen. Den Geräuschen nach, die durch das Fenster vom Hof hereindrangen, war gerade eine größere Gruppe Reiter eingetroffen.
Es wurden weitere Gäste erwartet: der Graf von Groitzsch und Rochlitz samt Gemahlin. Er hieß Dedo und war der jüngere Bruder der beiden Markgrafen, das wusste Konrad. Auch dass Dedos Gemahlin Mathilde von Heinsberg einer sehr mächtigen Familie am Rhein entstammte, war ihm bekannt. Sein Vater hatte darauf bestanden, dass er die Namen, Titel und Verwandtschaftsverhältnisse der bedeutendsten Familien des Kaiserreiches auswendig lernte.
Aus dem Augenwinkel warf Konrad einen verstohlenen Blick auf seinen Vater, nachdem er den Krug auf dem Tisch abgestellt hatte. Doch an dessen Gesicht ließ sich nichts ablesen – außer dass die beiden Fürsten wohl gerade ernsthafte Dinge zu erörtern hatten. Kein Wunder. Dass die Dinge in Italien nicht gut gelaufen waren, wusste selbst Konrad.
Und schon huschten die beiden Jungen wieder hinaus, um die geforderten Kissen zu holen.
Sie hatten länger vor der Kammer gestanden und sich gefürchtet, als sie letztendlich darin gewesen waren.
Das passiert mir nicht noch einmal!, beschloss Konrad insgeheim. Aber gleichzeitig fragte er sich, wie er wohl seine ersten Tage als Page am Meißner Hof überstehen sollte, ohne sich zu blamieren und seinen Vater zu enttäuschen. Überall lauerten Fallstricke.
»Los, komm mit, wir schauen von oben zu, wie der dicke Graf von Groitzsch aus dem Sattel steigt«, raunte Jakob und stieß ihn unternehmungslustig in die Seite. »Vielleicht fällt er ja vom Pferd!« Der Ältere grinste und lief zu einem der Fenster im Gang, von denen man auf den Burghof sehen konnte. Nach kurzem Zögern rannte Konrad hinterher.
»Mein großer Bruder Lukas ist schon Knappe und dient einem der Ritter, die ausgezogen sind, um in Franken Siedler zu werben«, berichtete Jakob und grinste hämisch. »Da tat er immer so wichtig … und jetzt hockt der Dummkopf im Dunklen Wald in Gesellschaft hungriger Bauern und schwingt vermutlich eher die Axt als das Schwert. Während wir hier Spannendes erleben dürfen. Ha!«
Zur Enttäuschung der beiden heimlichen Beobachter fiel Dedo nicht vom Pferd, ächzte aber vernehmlich, als er sich aus dem Sattel hievte. Derweil war seine rundliche Gemahlin Mathilde schon elegant abgestiegen und umarmte ihre Schwägerin Hedwig voller Wiedersehensfreude.
Bedienstete schwärmten herbei, um die Pferde zu versorgen und das Gepäck in die Gästekammern zu tragen.
Der Willkommenstrunk für das Grafenpaar wurde gereicht, und nun kamen auch Otto und Dietrich dazu und begrüßten ihren Bruder und dessen Gemahlin auf dem vom nächtlichen Regen noch schlammigen Burghof.
Man sah den dreien kaum an, dass sie Brüder waren: Otto war stämmig mit markigem Kinn, Dietrich schlank und mit scharf geschnittenen Gesichtszügen, Dedo hingegen war beleibt, weshalb er insgeheim nur »der Fette« genannt wurde.
»Verlief eure Reise ohne Zwischenfälle?«, erkundigte sich Hedwig bei den frisch eingetroffenen Gästen.
Noch ehe jemand antworten konnte, drängte Otto: »Wenn ihr nicht zu erschöpft seid, sollten wir gleich in meine Kammer gehen.«
Wichtige Dinge waren zu bereden. Um dem noch mehr Nachdruck zu verleihen, fragte Otto mit gedämpfter Stimme seine Schwägerin Mathilde: »Du bringst hoffentlich Nachricht von deinen Brüdern. Gute oder schlechte?«
Mathildes Brüder Goswin und Philipp von Heinsberg waren ebenfalls mit dem Kaiser nach Rom geritten. Doch was Dietrich vom Verlauf dieses Kriegszuges berichtete, hatte nicht nur für das Reich enorme Tragweite, sondern auch für das Haus Wettin. Und ganz besonders für die Rebellion gegen den mächtigen Herzog Heinrich den Löwen, Freund und Vetter des Kaisers, an der sie maßgeblich beteiligt waren. Würde Mathildes Bruder Philipp, bislang Domdekan von Köln, das Amt und die Intentionen ihres verstorbenen mächtigsten Verbündeten Rainald von Dassel übernehmen? Die Ungewissheit darüber schlug Otto nicht nur aufs Gemüt, sondern mittlerweile auch aufs Gedärm und machte ihn noch reizbarer als sonst.
Mathilde nickte bedächtig. »Ihr werdet alle sicher gleich erfahren wollen, welche Kunde wir von meinem Bruder Philipp bringen. Wir müssen nicht erst ruhen, und auch das Bad kann warten.«
»Nun sag schon!«, platzte Otto heraus.
»Nicht hier auf dem Hof«, raunte Mathilde geheimnisvoll und ließ unbeantwortet, ob es gute oder schlechte Nachrichten waren.
Genauer gesagt: Ob es nur schlechte waren oder auch einige, die Hoffnung verhießen. Ihr Schweigen und ihre undurchdringliche Miene verstärkten noch das mulmige Gefühl des Meißner Markgrafen. Denn offenbar waren diese Nachrichten nicht für fremde Ohren bestimmt.
Mathilde tat, als habe sie das Missbehagen auf Ottos Gesichtszügen nicht bemerkt. Insgeheim belustigt über seine Ungeduld, hakte sie sich bei Hedwig unter, während sie Richtung Palas schritten, vorbei am Backhaus und der Schmiede. Um ihren Schwager zu ärgern, sagte sie so laut, dass die Männer es hören mussten: »Hedwig, meine Liebe, ich will die Zeit hier in Meißen unbedingt nutzen, um zwei Dutzend von diesen schönen Bechern mit den slawischen Mustern zu erwerben, die eure Töpfer feilbieten. Ich habe dich schon immer darum beneidet, und wir können auf Rochlitz dringend ein paar neue Stücke brauchen. Es geht einfach zu viel kaputt.«
Erwartungsgemäß drehte sich Otto zu ihr um und warf ihr einen strafenden Blick dafür zu, dass sie – typisch Weib! – an solche Nichtigkeiten dachte, wo doch so Großes auf dem Spiel stand.
Gleich quillt ihm Rauch aus den Ohren und den Nasenlöchern, dachte Mathilde amüsiert.
Sie tat, als habe sie den stummen Vorwurf nicht bemerkt, und obwohl sich Otto mit keiner Silbe danach erkundigt hatte, ob sie eine gute Anreise gehabt hatten, strahlte sie ihn an und sagte im Plauderton, nach außen hin völlig unbeschwert: »Danke der Nachfrage, geehrter Schwager! Wir brachen gestern in Rochlitz auf und übernachteten in der Herberge des Klosters, das du im Dunklen Wald errichten lässt. Von dort sind es keine fünfzehn Meilen mehr bis hierher, und die haben wir an diesem schönen Herbsttag ohne Zwischenfälle genossen.«
Sie zupfte ein leuchtend rotes Blatt von ihrem Umhang und deutete lächelnd auf den blauen Himmel, um dann ernsthafter fortzufahren: »Es ist ganz erstaunlich, was die Zisterzienser dort in so kurzer Zeit erschaffen haben – einen Ort der Geschäftigkeit mitten im Wald! Die ersten Felder sind schon angelegt, ein Garten voller Heilpflanzen, eine Mühle und mehrere Häuser sind errichtet, die Kirche befindet sich im Bau … Und die frommen Brüder gaben sich größte Mühe, uns den Aufenthalt angenehm zu machen.«
Dedos gequälte Miene deutete darauf hin, dass seine Reisebeschreibung wohl weniger begeistert ausfallen würde. Andererseits bewunderte er seine Gemahlin auch dafür, dass sie die Widrigkeiten einer langen Reise klaglos ertrug und ihnen sogar noch etwas Gutes abzugewinnen vermochte. Er schätzte sie dafür, ebenso wie für ihre Klugheit und die Söhne, die sie ihm geschenkt hatte.
Mathilde hielt mit raschem Griff den Schleier fest, den eine Windbö zum Flattern brachte, und wandte sich wieder Otto zu.
»Dies bestärkte meinen guten Dedo darin, ein eigenes Kloster zu stiften, auch als künftige Grablege für uns. Wir haben schon einen geeigneten Ort dafür ausgewählt: Zschillen, südlich von Rochlitz …«
»Das ist nicht in Vaters Sinne«, beanstandete Dietrich, der bislang auffällig geschwiegen hatte. »Er erkor den Petersberg als Grablege unserer Familie.«
»Lässt du nicht selbst ein Kloster in Dobrilugk bauen?«, konterte Otto bissig. Er grollte seinem Vater über dessen Tod hinaus und war nicht einmal zur Beerdigung des alten Markgrafen erschienen.
Klöster zu stiften, Siedler in die Mark Meißen und in die Lausitz zu holen, waren wichtige Maßnahmen zum Ausbau des Landes. Endlich konnten sie sich diesen Aufgaben widmen – sofern die Ereignisse in Italien und der offen ausgebrochene sächsische Krieg nicht alles Erreichte in Frage stellten.
Ehe Dietrich antworten konnte, erreichte die kleine Gruppe den Palas und stieg hinauf zur Kammer des Fürsten. Dort hatten die beiden Pagen ihre Sitzkissen verteilt und standen mit Schüssel, Krug und Leinentuch bereit, damit sich die hohen Gäste erfrischen und die Hände waschen konnten.
Der Küchenmeister hatte auf dem Tisch schon Schalen mit Braten, Käse und Schinken abgestellt, der Mundschenk hielt verschiedene Weine und kühles Wasser zum Verdünnen bereit.
Otto ließ einschenken und schickte dann alle außer seinen Brüdern, Hedwig und Mathilde hinaus.
»Du, Bürschlein, stellst dich draußen hin und passt auf, dass uns niemand belauscht!«, wies er Konrad an.
Der verneigte sich höflich und ging, von wechselnden Gefühlen hin- und hergerissen. Denn einerseits erfüllte es ihn mit Stolz, solch einen wichtigen Auftrag zu erhalten. Doch anderseits fragte er sich: Was, wenn jemand kam, ein Ritter zum Beispiel, und sich nicht von einem Pagen vertreiben lassen wollte?
Plötzlich wurde der Zehnjährige gewahr, dass er noch ein viel größeres Problem hatte: Er musste dringend auf die Heimlichkeit, durfte aber seinen Posten nicht verlassen. Hoffentlich dauerte die Beratung der Fürsten da drinnen nicht zu lange … Nervös blickte er in den Gang vor sich, als er Schritte auf der Treppe hörte.
Zu seiner Erleichterung war es kein Ritter, der herantrat, sondern Boris von Zbor, ein auffällig großer Knappe slawischer Herkunft.
»Na, Kleiner, was stehst du da herum und trampelst von einem Bein aufs andere?«, fragte er belustigt.
Konrad schilderte ihm sein Problem, und Boris’ Grinsen wurde immer breiter.
Er hieb ihm mit dem Arm so wuchtig auf die Schulter, dass Konrad kurz in die Knie sackte, und meinte: »Nun geh schon, in meiner Großmut übernehme ich so lange deinen Posten. Aber beeil dich!«
»Ist das nicht …?« Konrad wusste nicht einmal, wie er seinen halbherzigen Einwand formulieren sollte.
»Es dient nicht der Würde eines Fürsten, wenn du vor seiner Kammer auf den Boden pinkelst«, sagte der Slawe vergnügt. »Und nun mach schon! Aber nicht hier!«
Erleichtert rannte Konrad los und hörte den ganzen Gang entlang noch Boris vor Lachen prusten.
»Dein Sohn, nicht wahr?«, fragte Mathilde Dietrich, der lächelnd nickte.
Die Gräfin von Groitzsch hatte sofort nach ihrer Vermählung mit Dedo dessen sämtliche Verwandte mit »Du« angesprochen, wogegen Hedwig ihren Schwager Dietrich zumindest vor anderen immer noch mit dem respektvollen »Ihr« anredete. Sie war als dreizehnjähriges Mädchen an den Meißner Hof gekommen und damals von ihrem zwanzig Jahre älteren Gemahl und seinem gestrengen Vater reichlich eingeschüchtert gewesen. Doch inzwischen hatte sie Otto zwei Söhne geschenkt und gelernt, ihn klug zu lenken, ohne dass er es merkte.
»Es ist gut, dass Konrad dich als seine Tante um sich hat«, meinte Mathilde herzlich zu Hedwig.
»Ich versuche mein Bestes, dem Jungen etwas Nestwärme zu geben«, antwortete diese und wandte sich dann direkt an das Groitzscher Paar: »Und wann schickt ihr uns eure Söhne? Hier wären sie gut aufgehoben. Sie sind doch alle wohlauf, nicht wahr?«
Ungeduldig hieb Otto mit einer Hand auf den Tisch.
»Könnt ihr das Geschwätz nicht verschieben, bis wir hiermit fertig sind? Die Zukunft unseres Hauses steht auf dem Spiel!«
Vorwurfsvoll wandte er sich direkt an Mathilde: »Damit du es weißt, teure Schwägerin: Dass Dietrich endlich seinen Jungen hierhergebracht hat, erlaubt uns, diese Zusammenkunft nach außen als Familientreffen darzustellen. Denn Dietrich ist – im Gegensatz zu mir und deinem geschätzten Gemahl – ausdrücklich nicht an der Revolte gegen Heinrich den Löwen beteiligt. Er ist gut Freund mit dem Kaiser und muss bei ihm ein Wort für uns einlegen, falls alle Stränge reißen. Und die Nachrichten, die er bringt …«
Er rieb sich mit der Hand übers Gesicht und krampfte die andere um seinen zinnernen Becher, als wollte er ihn zerknüllen wie ein Stück Stoff.
»Wie oft haben wir hier gesessen und über die Zukunft unseres Hauses diskutiert … Aber ich fürchte, noch nie war die Lage so bedrohlich. Dietrich, Mathilde, ich hoffe, ihr wisst mehr.«
Der sächsische Krieg
Otto, Markgraf von Meißen, seine Gemahlin Hedwig, ihre Brüder Dietrich und Dedo, Dedos Gemahlin Mathilde von Heinsberg; Meißen, September 1167
Am liebsten hätte Otto seiner Schwägerin sofort die alles entscheidende Auskunft entrissen, ob sich der einflussreiche Philipp von Heinsberg auf ihre Seite schlug.
Doch er war der Älteste und der bedeutendste Fürst in seiner Familie, womit er ihr offiziell vorstand. Da konnte er nicht das erste Wort bei einer so schicksalsträchtigen Besprechung einem Weib überlassen. Außerdem ärgerte es ihn, dass sowohl Dietrich als auch Mathilde besser informiert waren als er. Also hob er zum Auftakt zu einer ausführlichen Schilderung der Lage an, während von draußen das Geschrei der Stallknechte und das Hämmern des Schmiedes zu ihnen drang.
»Schon unser Vater kämpfte gegen Heinrich den Löwen – und deiner auch«, erinnerte Markgraf Otto mit Blick auf Hedwig, die Tochter von Albrecht dem Bären. »Seit dreißig Jahren! Doch bei allen Heiligen, dieser Kerl war nie zu bezwingen! Denn er hat den Kaiser auf seiner Seite, der ihn noch reicher und stärker machte, ihm zwei Herzogtümer gab und unsere Vorwürfe und Klagen immer wieder abweist. Also eröffneten wir voriges Jahr die Kämpfe von neuem, kaum dass der Kaiser über die Alpen war. Vor wenigen Wochen erst beschworen wir in Magdeburg ein machtvolles Bündnis mit fast allen Gegnern des Löwen. Doch die Tinte auf dem Pergament war noch nicht trocken, da kam die Nachricht, dass unser neuer, mächtigster Verbündeter und Fürsprecher beim Kaiser tot ist: Rainald von Dassel.«
Er holte tief Atem und trank seinen Becher auf einen Zug leer.
»Wir scheitern gerade auf ganzer Linie«, resümierte er bitter. »Heinrichs Burg Haldensleben konnten wir nicht erobern und mussten uns zurückziehen, weil eine offene Schlacht nicht zu gewinnen war. Christian von Oldenburg, der Bremen für uns eroberte, starb, und der Löwe holte sich Bremen zurück, zum Wehe seiner Bürger. Der Bremer Bischof Hartwig hat eiligst wieder die Seiten gewechselt. Und das Land ist bis vor die Tore Magdeburgs verheert.«
Zu Hedwig gewandt, fuhr Otto in seiner vernichtenden Bestandsaufnahme fort: »Dein Vater ist fast siebzig und kann nicht mehr ewig zu Felde ziehen. Und deine Brüder haben nicht seine Tatkraft und Entschlossenheit.«
»Meine Brüder führen Krieg!«, hielt ihm Hedwig mit Schärfe in der Stimme vor, und jeder in der Kammer durfte den Satz in Gedanken zu Ende führen: … während wir nur herumsitzen und lamentieren, ehe sie wiederholte: »Sie führen Krieg gegen die Heerscharen des Löwen, die das Land bis vor Magdeburg verwüsten.«
»Das hat Wichmann, unser Neffe, nun davon, dass er dem Kaiser Truppen nach Italien sandte! Sein Land ist entblößt von Männern, die es verteidigen könnten«, fuhr Otto in seiner unerfreulichen Bestandsaufnahme fort. »Während der Löwe stärker und stärker wird. Er hat seine Burgen befestigen lassen und überraschend Frieden mit Pribislaw geschlossen, dem Sohn des Abodritenfürsten Niklot. Der bekommt nun sein altes Land zurück, ausgenommen Schwerin, und er gibt Pribislaws Sohn seine uneheliche Tochter zur Frau. Dadurch muss er keine Angriffe der Slawen mehr fürchten; sie müssen ihm in Kriegen sogar Truppen stellen. Und im kommenden Februar heiratet er die Tochter des englischen Königs! Man munkelt von einer gewaltigen Mitgift …«
»Fünftausendeinhundert englische Pfund Silber, das sind über zehntausend Mark«, warf Dietrich ungerührt ein, der dies bei einer Unterredung mit dem Kaiser gehört hatte.
Die anderen erstarrten ob dieser unglaublichen Summe.
»Wisst ihr, welch ein gewaltiges Heer der Löwe dafür aufstellen kann?«, ächzte Otto.
»Ja, wir versuchen gerade, es uns auszumalen«, meinte Dedo sarkastisch.
»Wir verlieren an allen Fronten!«, fauchte Otto ihn an. »Und die Kölner Gesandten, die an Rainalds Statt zum Bündnisschluss nach Magdeburg gekommen waren, werden ohne dessen Rückendeckung die Schwänze einziehen. Sie sind wie Hunde, die sich nicht trauen, das Bein zu heben, weil sie nicht so hoch pissen können wie der Löwe«, meinte er eher zynisch als wütend.
Tadelnd hob Hedwig die Augenbauen angesichts so rüder Vergleiche.
Auch Mathilde fand, sie habe nun lange genug Ottos Lamento über sich ergehen lassen. Wozu war sie denn hergereist?
»Gestatte, dass ich mich hier einmische, geehrter Schwager«, unterbrach sie den Meißner Markgrafen liebenswürdig, aber bestimmt. »So betrüblich der Tod Rainalds ist und zweifellos ein Verlust für das Reich, nicht nur für unser Bündnis …« Eine feine Spitze, die niemand zu bemerken schien, der das ironische Lächeln auf ihrem Gesicht nicht sah. »Wir dürfen auch künftig auf den Erzbischof von Köln hoffen. Auf den neuen Erzbischof von Köln. Denn auf Wunsch des Kaisers wird mein Bruder Philipp dieses Amt übernehmen.«
Diese Entwicklung war selbst für Dietrich neu, denn er war an dem Tag aus Rom aufgebrochen, an dem Rainald gestorben war. Doch sie überraschte ihn nicht, die Weitergabe des Amtes an Philipp lag auf der Hand. Aber es war gut, das nun bestätigt zu wissen. Vor Rom war kaum Gelegenheit gewesen, mit Mathildes Bruder zu sprechen. Sie hatten andere Sorgen gehabt. Und ehrlich gesagt, konnte Dietrich den Heinsberger nicht leiden; aus einem unbestimmten Gefühl heraus traute er ihm und seinen Absichten nicht.
»Womit wir zwei Erzbischöfe in der Familie haben: unseren Vetter Wichmann von Magdeburg und nun meinen Schwager Philipp von Köln«, triumphierte Dedo, damit auch niemand vergaß, dass Mathilde seine Gemahlin war und er also unmittelbar Anteil an dieser günstigen Konstellation hatte. Seine Brüder schätzten ihn einfach nicht genug.
Ob er wohl noch ein Stück von diesem Hirschbraten nahm? Nach einem Blick auf seine Gemahlin und einem zweiten auf den eng den Bauch umspannenden Gürtel ließ er es bleiben.
Doch der mürrische Otto, ganz das Gegenstück zu seiner stets gut gelaunten Schwägerin Mathilde, wollte nicht glauben, dass diese Neuigkeit alle ihre Probleme lösen könnte. Jedenfalls nicht so bald.
»Philipp ist jenseits der Alpen. Er kann in Köln nichts ausrichten und sich dort nicht zur Wahl stellen«, warf er ein.
Mathilde lächelte gelassen.
»Sei unbesorgt, an die Kölner Domherren erging ein Schreiben des Kaisers mit dem ausdrücklichen Wunsch, meinen Bruder in Abwesenheit zu wählen. Und Philipp schickte mir einen verschwiegenen Boten, durch den er ausrichten ließ, er werde unsere Sache vorantreiben. Die Kölner Kirche ist reich. Der Kaiser hat der Erzdiözese unlängst die Einnahmen von Silberbergwerken übertragen. Und die von Rainald aus Mailand gebrachten Reliquien, die Gebeine der Heiligen Drei Könige, ziehen Ströme von Pilgern an.«
Aufatmend ließ sich Markgraf Otto an die Lehne seines Stuhls sinken. »Endlich einmal gute Nachrichten! Das wurde aber auch Zeit.«
Einen Moment herrschte Stille in der Runde. Jedermann schien die Neuigkeiten auf sich wirken lassen zu wollen. Selbst der Schmied draußen hatte sein Hämmern eingestellt, als wolle er seinem Fürsten Zeit geben zu begreifen, was dieser soeben erfahren hatte.
Doch Dietrich, der bislang noch kaum ein Wort gesagt hatte, musste endlich die Befehle des Kaisers loswerden.
Also platzte er ohne Vorrede in das erleichterte Schweigen hinein: »Der Kaiser schickt zwei Gesandte zu uns östlichen Fürsten: den Erzbischof von Mainz und den Herzog von Zähringen. Sie sollen einen Waffenstillstand in unserem Krieg gegen den Löwen aushandeln, zu dem ich euch ausdrücklich ermahnen soll. Vor allem aber verlangt der Kaiser, dass wir ihm Truppen nach Norditalien schicken – nachdem dort fast sein ganzes Heer der Seuche zum Opfer gefallen ist und die Überlebenden Mühe haben, sich durch die feindlichen Heere der lombardischen Städte über die Alpen durchzuschlagen.«
»Das kommt überhaupt nicht in Frage!«, widersprach Otto sofort und sehr entschieden. »Jeder einzelne Kämpfer wird hier benötigt. Wir erleben ja am Beispiel von Vetter Wichmann, wohin es führt, wenn man sein Land weitgehend von Truppen entblößt, um sie dem Kaiser zu schicken. Jetzt muss er tatenlos zusehen, wie Dörfer, Felder und sogar Kirchen niedergebrannt werden.«
Dann ging ihm plötzlich etwas auf.
»Wieso erzählst du mir das erst jetzt, wo du doch schon seit gestern hier weilst?«, fragte Otto seinen Bruder schroff.
»Um genau diesen deinen Ausbruch nicht zweimal anhören zu müssen«, antwortete der gelassen, beinahe teilnahmslos.
Vorsichtig musterte Hedwig Dietrichs Gesicht. Sie schätzte ihren Schwager für seine Klugheit. In Debatten wie dieser war er zumeist der Besonnene, besser Informierte, und wusste gute Ratschläge zu erteilen. Heute hingegen wirkte er merkwürdig ruhig, fast apathisch.
Will er nicht gegen den Kaiser konspirieren? Sind es die Toten in Italien, die ihm auf der Seele liegen? Oder ist es der Abschied von seinem Sohn, der ihn bedrückt?, fragte sie sich. Dietrich weiß doch, dass sein Sohn und Erbe hier in guten Händen ist, und er wird ihn oft genug sehen können!
Er sollte sich wieder eine Frau ins Bett holen, dachte Hedwig. Dass Dietrichs Ehe unglücklich war und sich seine Gemahlin sofort auf ein entlegenes Anwesen zurückgezogen hatte, nachdem sie ihm eine Tochter und einen Sohn geboren hatte, wusste jeder. Dobroniega schien nicht den geringsten Funken Zuneigung für ihren Gemahl aufgebracht zu haben. Ihr trauerte er bestimmt nicht nach. Aber sehr wohl Gunda, seiner großen Liebe, die vor nun schon acht Jahren gestorben war.
Hedwig glaubte sich unbeobachtet, als sie ihren Schwager vorsichtig musterte. Plötzlich sah er sie an und sog ihren Blick auf. Hastig senkte sie die Lider und fühlte sich in ihrem tiefsten Innern berührt, ja aufgewühlt.
Sie konnte nicht ahnen, was Dietrich bewegte: dass er in Liebe zu Hedwig entbrannt war, der klugen Frau seines Bruders. Seiner Schwägerin.
Es gab tausend gewichtige Gründe, dieses Gefühl tief in seiner Brust zu verschließen und vor sich selbst zu verleugnen.
Nicht nur aus familiärer Loyalität, sondern weil die Kirche dies als Blutschande betrachtete.
Doch der allgegenwärtige Tod in Italien, das grausige Ende so vieler Männer, die er kannte, lösten in ihm abwechselnd Bedrücktheit und einen unstillbaren Hunger nach Leben aus.
Um sich nichts von seinen Gefühlen anmerken zu lassen, richtete er seinen Blick auf die mit Bannern geschmückte Rückwand der Kammer. Als sein Vater noch lebte, hingen dort kostbare Stickereien, von denen ihn eine als jungen Ritter im Buhurt mit dem jetzigen Kaiser zeigte, der damals noch Herzog von Schwaben war. Doch Otto hatte die Bilder entfernen lassen.
Der stille Blickwechsel zwischen Hedwig und Dietrich schien den anderen Anwesenden entgangen zu sein. Sie hatten den Moment genutzt, um nach dieser oder jener Köstlichkeit zu greifen, die auf dem Tisch bereitstanden, oder nachdenklich in ihren Becher zu starren.
Dann meldete sich Dedo zu Wort, der selten sprach. Doch wenn er es tat, brachte er zumeist Bemerkenswertes hervor: Überlegungen, die den anderen nicht gekommen waren.
»Wie uns Philipps Bote berichtet und auch Dietrich mit eigenen Augen ansehen musste, sind die Gerüchte über die vernichtende Seuche im Heer des Kaisers nicht übertrieben …«
»Das kann ich bestätigen«, stimmte ihm Dietrich finster zu. »Binnen weniger Stunden raffte der Tod Menschen dahin, die eben noch bei bester Gesundheit waren.«
Einen Moment lang stockte er angesichts der grausigen Erinnerung.
Da ergriff sofort Dedo wieder das Wort.
»Und es stimmt doch auch, dass sich der Kaiser aus Italien herauskämpfen muss, gegen die Heereskontingente der norditalienischen Städte, die sich fast allesamt gegen ihn verbündet haben?«
Alle sahen ihn fragend an. Worauf wollte der Graf von Groitzsch und Herr von Rochlitz hinaus?
»Es kann noch schlimmer kommen«, meinte er dann.
Was seinen Bruder Otto zu der geknurrten Bemerkung hinriss: »Es kann immer noch schlimmer kommen. Aber was sollte schlimmer sein als die rundum missliche Lage, in der wir uns befinden? Der Löwe ist stärker, reicher, mächtiger denn je – als Herrscher zweier Herzogtümer, mit den Abodriten und dem englischen König auf seiner Seite, mit der sagenhaften Mitgift seiner Braut … und dem Kaiser als besten Freund.«
Dietrich hingegen tauschte einen Blick mit Dedo und ahnte schon, worauf der nun hinauswollte.
»Der Rothenburger Sohn des alten Königs Konrad, ein Anwärter auf den Thron, fiel der Seuche zum Opfer«, begann dieser schließlich. »Und es ist nicht auszuschließen, dass auch der Kaiser daran erkrankt. Falls dem Kaiser etwas zustößt, was durchaus möglich ist nach allem, was wir wissen … Wenn er es nicht lebend über die Alpen schafft …«
Er ließ den anderen einen kurzen Moment, dies zu Ende zu denken, und sprach es dann selber aus.
»Falls Friedrich stirbt … Sein ältester Sohn ist kaum drei und kränklich, wie es heißt. Er ist noch nicht zum König gewählt, und sicher wird es auch niemand tun. Der Rothenburger entfällt nunmehr als Anwärter auf den Thron. Und damit wäre unser Erzfeind, der Löwe, mit größter Wahrscheinlichkeit der nächste Kaiser.«
Otto schnappte nach Atem, ein Schauer lief ihm über den Rücken. Die Luft in der Kammer schien plötzlich eisig.
»Beten wir also für das Wohl des Kaisers«, mahnte Dietrich leise.
Flucht in die Wälder
Das Kaiserpaar Friedrich und Beatrix, Philipp von Heinsberg, Welf VII., Vetter des Kaisers und einziger Sohn des Herzogs Welf VI.; Monte Amiata, zwischen Rom und Siena, August und September 1167
Sanfter Wind strich durch die Schatten spendenden Bäume, seitlich des Weges strudelte ein Rinnsal glasklar und verspielt über rundgeschliffene Steine.
Das Grün und der würzige Duft des Waldes verhießen Erholung von dem Grauen, welches das kaiserliche Heer vor Rom heimgesucht hatte. Hier, auf dem Monte Amiata, sollten die Überlebenden auf Befehl ihres Herrschers ein paar Tage rasten und wieder zu Kräften kommen.
Doch wider Erwarten hatten sie die schreckliche Seuche nicht in Rom zurückgelassen. Im Gegenteil: Das Verderben schien sich dem fliehenden Heer unnachgiebig an die Fersen geheftet zu haben. Immer wieder fielen Männer von Schwäche und Schmerz gekrümmt aus den Sätteln, während ihnen Blut und Exkremente die Beine hinabrannen. Gemunkelt wurde, die Seuche habe mittlerweile zweitausend Tote gefordert.
Unter den Überlebenden grassierte die Angst – die Angst davor, als Nächster die Kontrolle über sein Gedärm zu verlieren und nur Stunden später unter Qualen und bar jeder Würde zu sterben. Und die Angst vor Angriffen der Lombarden.
Immer mehr norditalienische Städte traten dem militärischen Bündnis gegen den Kaiser bei. Allerorten konnten ihnen feindliche Truppen auflauern. Die wenigen Überlebenden von Friedrichs Heer hatten deshalb seit der Flucht aus Rom nirgendwo länger als ein oder zwei Tage haltgemacht. Doch die Männer brauchten Erholung. Deshalb sollten sie hier, in dieser Idylle, einige Zeit rasten, um wieder zu Kräften zu kommen.
Beatrix saß mit ihren Hofdamen neben einem Bächlein und ließ deren Geplapper über sich ergehen. Eine von ihnen, die rundliche Margaux, jammerte zum wohl zehnten Mal darüber, dass auf der Flucht eine Truhe mit Kleidern verloren gegangen war.
»Mein schönstes Gewand war darin, das mit den goldenen Ranken am Halsausschnitt und an den Ärmeln, erinnert ihr euch?«, klagte sie. »Ich habe wochenlang daran gestickt und mir dabei fast die Augen verdorben.«
Wehleidig blickte sie in die Runde – vielleicht in der Hoffnung, dass ihr die Kaiserin ein neues Gewand schenkte. Doch Beatrix wies sie verärgert zurecht. »Wir hatten wahrlich schlimmere Verluste seit Ausbruch der Seuche als ein paar Kleider! Lobpreist die Heilige Jungfrau, dass Ihr nicht unter den zahllosen Toten seid! Ihr sitzt hier, lasst es Euch gut gehen und lamentiert herum, statt Gott und dem Kaiser dafür zu danken, dass Ihr lebt!«
Margaux verstummte beleidigt und biss sich auf die Unterlippe.
Die Kaiserin bat Marie Claire, ihre bevorzugte Gesellschafterin, nach den Kindern zu sehen. Denn sie wusste, dass sich die Freundin nach ihrer kleinen Gianna sehnte und ebenso um sie fürchtete wie Beatrix um ihre Söhne.
Die Kaiserin selbst, Mitte zwanzig, zierlich und bildschön mit goldenen Locken und ebenmäßigen Gesichtszügen, erhob sich, wehrte jegliche Begleitung ab und schlenderte auf das rote Zelt des Kaisers zu, das nicht weit von dem Bächlein stand.
Ihr Gemahl hatte sie gebeten, dort zu erscheinen, falls seine Besprechung zu lange dauern sollte.