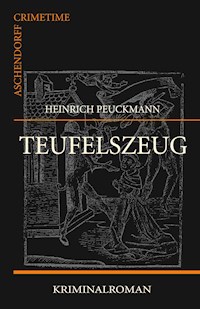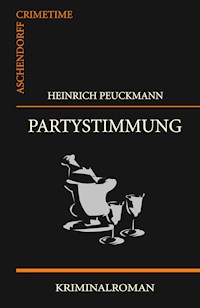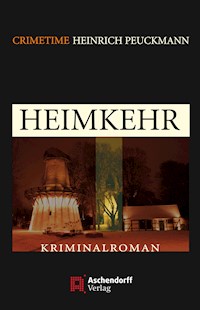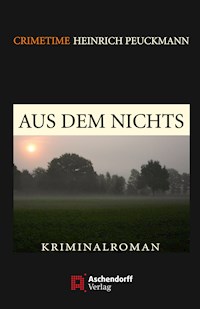Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Kulturmaschinen
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Die tollsten Geschichten schreibt immer noch das Leben. Zum Beispiel die eines Mannes, der eine Tänzerin aus Thailand heiratet. Die Ehe zerbricht. Doch sein Glück findet er in der Erziehung der zwei thailändischen Adoptivsöhne, von denen der eine schließlich zwei Bronzemedaillen im Säbelfechten gewinnt. ... Heinrich Peuckmann hat die Geschichte aufgeschrieben - mit einigen dichterischen Freiheiten, versteht sich.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 399
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhalt
KM-peuckmann-sohn-v2
Impressum
Widmung
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapilte 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Kapitel 29
Kapitel 30
Kapitel 31
Kapitel 32
Werbung
Heinrich Peuckmann
Der Sohn der Tänzerin
Roman
Neuauflage März 2022
Kulturmaschinen Verlag
Ein Imprint der Kulturmaschinen Verlag UG (haftungsbeschränkt)
20251 Hamburg
Die Kulturmaschinen Verlag UG (haftungsbeschränkt) gehört allein dem Kulturmaschinen Autoren-Verlag e. V.
Der Kulturmaschinen Autoren-Verlag e. V. gehört den AutorInnen.
Und dieses Buch gehört der Phantasie, dem Wissen und der Literatur.
Umschlaggestaltung: Sven j. Olsson
Umschlagabbildung: DmitryPoch /depositphotos
Satz: Dino Sirji
Hinterlegt in BoD (Libri)
978-3-96763-205-7(Kart.)
978-3-96763-206-4(Geb.)
978-3-96763-207-1(ePUB)
Meinen drei Söhnen Lukas, Simon und Niklas
Meinen drei Schwiegertöchtern Natalia, Hannah und Linda
1.
Als er vor ein paar Minuten die Halle betreten hatte, waren die meisten Plätze noch frei gewesen, jetzt gab es kaum noch Lücken auf der Zuschauertribüne. Er war erstaunt, wie schnell und unmerklich das gegangen war. Gleichzeitig spürte er, wie sich sein Pulsschlag erhöhte. Ein paar Minuten noch und dann ... Er wischte sich die Handflächen an der Hose ab.
Ein dicker Mann drängte sich zu ihm in die Reihe, stieß ihm heftig seinen Bauch in den Rücken und ließ sich zwei Plätze entfernt von ihm nieder. Er saß noch nicht richtig, da zog er schon eine Plastiktüte aus der Jackentasche und begann, sich Salzchips in den Mund zu stopfen. Das Knistern der Tüte, das schmatzende Kauen, mein Gott, warum brauchten manche Leute zu allem und jedem eine Zusatzbefriedigung? Er schaute sich um, aber jetzt war es zu spät, noch mal den Platz zu wechseln.
Wie immer bei wichtigen Kämpfen hatte er sich in eine der letzten Reihen gesetzt, auf einen Platz direkt neben dem Aufgang. Von hier aus hatte er freien Blick auf die Planche und konnte den Kampf mitfilmen, ohne dass aufspringende Zuschauer ihm die Sicht versperrten. Und von diesem Kampf, der gleich stattfinden würde, wollte er alles festhalten, jede Einzelheit, denn er wusste, dass er sich das, was er gleich passierte, noch in Jahren angucken würde. Immer und immer wieder. Fragte sich nur, welche Gefühle er dann dabeihaben würde.
Er überprüfte den Camcorder. Neunzig Minuten waren auf der Kassette, mehr als genug. Er wusste nicht, wie oft er inzwischen die Kamera überprüft und die Schärfe nachgestellt hatte. Er brauchte etwas, um sich abzulenken.
Hoffentlich ist Roy nicht so nervös, dachte er. Nur noch diesen Kampf musste er gewinnen, nur noch diesen einen und alles hätte sich gelohnt. Die jahrelange Quälerei im Training, die Summen für die teure Fechtausrüstung, die unendlich langen Fahrten in dem klapprigen Mercedes durch halb Europa, um an den Weltcups teilzunehmen. Er immer am Steuer, während Roy bei der Hinfahrt auf dem Rücksitz schlief, um für den Wettkampf am nächsten Tag fit zu sein. Manchmal gewann Roy, dann kletterte er in der Weltrangliste um einige Ränge, manchmal schied er früh aus, dann rutschte er zurück. Ohne in der Weltrangliste einen guten Platz zu belegen, hätte er sich gar nicht für dieses Turnier qualifizieren können.
Und dann die Rückfahrten nach den Weltcups, die langen Gespräche zwischen ihnen, manchmal bis weit in die Nacht hinein. Roy neben ihm auf dem Beifahrersitz, wenn sie zuerst seine Fehler analysierten und die Stärken besprachen. Damit fingen ihre Gespräche immer an. Mit der Analyse dessen, was hinter ihnen lag. Danach schmiedeten sie Pläne, beredeten, was als nächstes anstand und wie sie es angehen wollten. Und schließlich, wenn alles über die Wettkämpfe durchgekaut war, sprachen sie über Gott und die Welt, über Roys Leistungen in der Schule, über die Liebe, über die kleine Helen, die fast ein Jahr alt war und immer strahlte, wenn sie Roy sah, bis Roy, müde vom Gespräch und den Kämpfen am Vor- und Nachmittag, wieder auf den Rücksitz kroch, sich zusammenkauerte und augenblicklich eingeschlafen war, während er den Mercedes weitersteuern musste, auf Fahrten durch halb Europa. Unglaublich, dass sie das alles durchgehalten hatten, unglaublich, dass Roy es bis hierhergeschafft hatte. Bis in dieses kleine Finale bei Olympia, bis zum Kampf um die Bronzemedaille.
Er schaute auf die Wand mit der Trefferanzeige. Dahinter, im verdeckten Teil der Halle, machte Roy sich jetzt warm. Dort übte er Finten und Paraden, automatisierte Bewegungen, die aber vor jedem Kampf neu abgerufen wurden, um den Bruchteil einer Sekunde schneller zu sein als der Gegner. Natürlich übte Roy keinen seiner Spezialtricks, denn sein Gegner, ein Ungar, bereitete sich auf der Bahn neben ihm vor. Er durfte nicht ahnen, welche Tricks Roy draufhatte, mit welcher Taktik er in den Kampf gehen wollte.
Der Dicke neben ihm steckte mit lautem Knistern die Tüte in Tasche, schmatzte noch einen Moment lang, dann war er ruhig. Gott sei Dank.
Er wusste, wie so ein Aufwärmtraining ablief, oft hatte er bei unwichtigen Kämpfen zusehen dürfen. Beide Kämpfer taten dann so, als würden sie den anderen gar nicht beachten. Selber cool wirken, so tun, als interessiere einen die Stärke des Gegners gar nicht, weil man von sich selbst überzeugt war, darauf kam es an. Gleichzeitig war wichtig, sich in den bevorstehenden Kampf hineinzudenken, um Aggressivität aufzubauen. Fechtsport war Konzentration und Willensstärke.
Trotzdem, das wussten beide Kämpfer, blieb keine ihrer Bewegungen dem anderen verborgen. Sie taxierten sich aus den Augenwinkeln. Und wenn es nur eine Kleinigkeit war, die sie dabei herausfanden. Die Art etwa, wie der andere den Arm beim Angriff vorstreckte oder wie weit er nach einer Attacke zurücksprang, schon das konnte, wenn man es in die eigene Taktik einbaute, über Sieg oder Niederlage entscheiden.
Wie knapp so ein Kampf ausgehen konnte, hatte er zuletzt im Viertelfinale gegen den Weltmeister aus Russland erfahren. 14:13 hatte Roy geführt, sein nächster Treffer würde den Sieg bedeuten, aber der Russe hatte ausgeglichen. 14:14, knapper ging es nicht mehr. Jetzt musste der nächste Angriff entscheiden. Beide stürmten gleichzeitig nach vorn, streckten den Arm aus, trafen und beide Lampen leuchteten auf. Rot für den Russen, grün für Roy. Treffer für beide bedeutete das. Was folgte, war ein unendlich langer Moment des Schreckens. Jetzt lag die Entscheidung einzig beim Kampfrichter. Wen hatte er für den Bruchteil einer Sekunde eher im Angriff gesehen, wer hatte seine Attacke einen Hauch früher angesetzt. Dem würde der Kampfrichter den Treffer zuerkennen und der andere wäre draußen! Mit angehaltenem Atem hatte er auf seinem Platz in der letzten Reihe gehockt und auf den Kampfrichter gestarrt. Ein Wimpernschlag würde entscheiden über die große Chance, bei der Olympischen Spielen eine Medaille zu gewinnen oder um Platz fünf bis acht antreten zu müssen. Eine Platzierung, die Morgen in keiner Zeitung stehen würde.
Der Kampfrichter hatte schließlich abgewunken, kein Treffer. Aufatmen, aber nur kurz, denn es war ja nichts gewonnen. Nun kam es auf den nächsten Angriff an. Und dann passierte das Unglaubliche. Roy stürmte nach vorn, wollte dem Kampfrichter endgültig zeigen, dass bei nochmaligem gleichzeitigen Treffer er im Vorteil war, aber für den Bruchteil einer Sekunde blieb er mit der rauen Sohle seiner Turnschuhe an der Planche hängen, strauchelte und knickte nach links ein. Dadurch war er wehrlos, war völlig frei für den entscheidenden Stich des Gegners. Aber der Gegner hatte im Moment des Strauchelns selber seinen Angriff angesetzt und gerade die Tatsache, dass Roy nach links wegkippte, bewirkte, dass sein Hieb ins Leere ging. Durch diesen unglaublichen Zufall war er selbst frei für den entscheidenden Konter. Instinktiv stach Roy zu, ein lächerlich einfacher Treffer angesichts der Bedeutung des Kampfes. Es war das 15:14 gewesen, der Sieg.
Der Russe hatte sich fallen gelassen, wo er getroffen worden war, und losgeheult, hemmungslos. Mit zuckenden Schultern hatte er auf der Planche gelegen, so dass er selbst ihm, der gerade noch über den Sieg seines Sohnes gejubelt hatte, leid tat. So unglücklich bei einer Olympiade auszuscheiden, und dann noch als Weltmeister, war das Schlimmste, was einem Sportler passieren konnte. Wer Sport kannte, wusste, wie sich der Junge fühlen musste.
Im Halbfinale gegen einen Franzosen hatten Roy dann Kraft und Konzentration gefehlt, kein Wunder nach dem nervenaufreibenden Viertelfinale. Klar und deutlich hatte er mit 10:15 verloren. Die erste Chance auf eine Medaille war vertan, blieb also noch diese, die über Bronze oder den undankbaren vierten Platz entschied, für die es die Holzmedaille gab, wie das in Sportlerkreisen hieß.
Plötzlich brandete Beifall auf, die beiden Fechter betraten die Planche. Irgendwo vorn sprang ein Zuschauer auf und schwenkte die ungarische Fahne. Er sah sofort, dass Roy suchend ins Publikum blickte, und wusste im selben Moment, wen er suchte. Er sprang auf und winkte heftig mit der freien Hand, aber der Blick von Roy war schon über seine Sitzreihe hinweg geglitten, suchte weiter hinten in der Halle, fand aber nichts, das seinen Blick festhielt und schaute zurück auf die Planche. Roy hatte ihn nicht entdeckt im Gewühl der Zuschauer. Mist, daran hätte er denken müssen. Er hatte doch gewusst, dass er nach ihm Ausschau halten würde. Dass er diesen letzten Blickkontakt zwischen ihnen brauchte, der Roy zeigte, dass sein Vater da war. Und wenn sich ihre Blicke gefunden hatten, gehörte es zum festen Ritual, dass sein Vater die Faust ballte, um ihm zu zeigen, wie überzeugt er von Roys Sieg war. Und jetzt hatte er sich von dem Fahnenschwenker ablenken lassen, hatte den einzigen Moment verpasst, an dem er Roy helfen konnte. Er versuchte, sich zu beruhigen. Roy wusste doch, dass er da war. Er konnte sicher sein, dass sein Vater sich um nichts in der Welt davon abhalten lassen würde, pünktlich zu kommen, koste es, was es wolle.
Unglaublich, dachte er dann wieder. Unglaublich, dass Roy jetzt da unten steht und um eine olympische Medaille kämpft. Wenn ihm das jemand vor achtzehn Jahren gesagt hätte, er hätte ihn für verrückt erklärt. Ach was, nicht einfach nur für verrückt. Er hätte ihn für jemand gehalten, der nichts versteht vom Leben. Der sich Märchen ausdenkt und in den Tag hineinträumt. Er schüttelte den Kopf. Er konnte selbst nicht begreifen, was hier vor sich ging, so völlig außerhalb jeder Vorstellungskraft war das.
Die beiden Fechter ließen sich an das Kabel anschließen und setzten die Maske auf.
»En Garde!«, befahl der Obmann. Die Fechter nahmen ihre Ausgangsposition ein. Er hob den Camcorder und hatte beide Fechter im Bild.
»Pres!« Der Obmann breitete seine Arme aus, für Götz der richtige Moment, den Auslöser der Kamera zu drücken. Roys Augen, das wusste er, bohrten sich in diesem Augenblick in den Gegner, um eine Schwäche auszumachen.
Im selben Moment schlug der Obmann die Hände zusammen.
»Allez!«
Ein paar Zuschauer schrien auf, der Dicke neben ihm knirschte mit den Zähnen. In der Reihe weiter unten wurde wieder die ungarische Fahne geschwenkt. Der Kampf hatte begonnen.
2.
»Götz zieht in den Krieg!« Der Oberstleutnant lachte und schlug vor Freude mit der flachen Hand auf die Schreibtischplatte. »Wer hätte das gedacht? Ausgerechnet du, der lieber mit dem Kugelschreiber kämpft als mit dem Gewehr. Und dann noch dahin, wo nicht mit Manövermunition geschossen wird. Wie kannst du das mit deiner halbpazifistischen Seele vereinbaren? Zeig mal deine Hand.«
Bevor Götz sie vom Schreibtisch seines Chefs ziehen konnte, hatte der Oberstleutnant schon danach gegriffen. Wolfgang hieß er, aber im Dienst, wenn andere dabei waren, sprach Götz ihn nur mit seinem Rang an. Er wollte Privates und Dienstliches trennen. So sehr Götz auch zog, der Oberstleutnant ließ nicht los.
Verdammt, was fiel ihm ein, sich über ihn lustig zu machen? Und überhaupt, was sollte das heißen, halbpazifistische Seele? Er war Berufssoldat, seit über zehn Jahren schon. Musste hier jeder auf gleicher Wellenlänge senden? Durfte man sich nicht eigenständige Gedanken über die Welt machen? Zum Beispiel darüber, ob es immer Gewaltandrohung sein musste, die zum Frieden führte?
»Na ja, stark ist sie ja«, sagte der Oberstleutnant, »aber nicht aus Eisen. Du weißt ja, da gab’s schon mal einen mit einer Eisenfaust, der gegen alle gekämpft hat. Und du weißt auch, was dabei rausgekommen ist. Also übernimm dich nicht.«
Endlich ließ er die Hand los.
»Ich bin kein Götz von Berlichingen, im Gegenteil. Ich will mir nur die Welt ansehen. Dort, wo es die Menschen schwer haben. Ist das etwa verboten?«
»Wo es am gefährlichsten ist, meinst du. Wo Bürgerkriege toben und es Todesschwadrone gibt, die nachts Häuser überfallen und jeden ermorden, den sie für ihren Feind halten. Und anschließend willst du für Zeitungen und unseren Soldatensender darüber berichten, das meinst du doch, stimmt’s? Aber pass auf, worüber du berichtest. Du bist Major der Bundeswehr. Du darfst nichts schreiben, was den Interessen unseres Landes im Ausland schadet.«
»Ich weiß, was ich schreiben darf und was nicht.« Er sagte das, obwohl ihm längst klar war, dass er sich nicht daranhalten würde. Er hatte schon Absprachen über Artikel mit Zeitungen getroffen, mit kirchlichen, sogar mit linken Blättern, die seine Grenzen weit überschritten und von denen niemand etwas wissen durfte. Selbst sein Chef und Freund Wolfgang nicht.
»Ich weiß nicht, ob es gut war, dass du dich von deiner Frau getrennt hast, Götz«, sagte der Oberstleutnant und ließ die Hand los. »Sie hat immerhin auf dich aufgepasst. Manchmal war das gut für dich, das musst du zugeben. So hitzig, wie du an vieles rangehst.«
»Aufgepasst?« Götz lachte. »Eingesperrt hat sie mich, weil sie ihre Eifersucht nicht unterdrücken konnte. Darin war sie eine echte Spanierin.«
»Und jetzt bist du frei und kannst alles nachholen. Das ist es doch, was du meinst, stimmt’s?«
»Nicht was du denkst. Ich will mir wirklich die Welt ansehen. Ich will wissen, was los ist da draußen, besonders da, wo’s kriselt.«
Er nickte zur Bestätigung, obwohl er wusste, dass es nicht die ganze Wahrheit war. Er wollte etwas über die Welt erfahren, so weit stimmte seine Aussage. Aber er tat es auch, weil ihm zunehmend die Decke auf den Kopf fiel, wenn er nach Hause kam. In den ersten Wochen und Monaten hatte er es noch genossen, allein zu sein, aber mit der Zeit bedrückte es ihn, einzig seine Geräusche in der Wohnung zu hören und sonst nichts. Abends auszugehen in eine Kneipe brachte ihm auch nichts, merkte er. Was ihm fehlte, war richtige Ablenkung, war irgendetwas, das ihn herausriss aus seinem Alleinsein und das seine Gedanken beschäftigen konnte. Auch deshalb war er auf die Reise gekommen. Zu reisen war jedenfalls etwas, das in seiner Familie lag. Aber diesen zweiten Grund zuzugeben fiel ihm schwer, selbst vor seinem Freund.
Der Oberstleutnant grinste. »Weißt du was, Götz«, sagte er. »Ich glaub dir. Bei jedem anderen in der Kaserne würde ich mir wer weiß was denken, aber dir nehme ich das ab. Du bist ein komischer Kerl und hast zu allem und jedem deine eigenen Ideen. Und jetzt, wo ich weiß, was du vorhast, hätte ich selber Lust, mitzufahren. Aber du weißt ja...« Er seufzte.
»Ich weiß, du kannst dich nicht von deiner Frau trennen.«
Jetzt mussten beide lachen.
»Na, wenn’s darauf ankäme, dann würde ich ...« Der Oberstleutnant schwieg einen Moment lang, dann winkte er ab. »Ne, lass mal. Bin froh, dass ich sie habe. Also, dann lass uns nachgucken, wie viel Urlaub dir zusteht. Der von diesem Jahr, der vom letzten, dazu die Überstunden ...«
Er ließ Wolfgang alleine rechnen, denn er hatte es längst ausgerechnet, genauso wie er auch alles andere geplant hatte. Knapp drei Monate Urlaub standen ihm zu, von März bis Mai. Zeit genug für eine Reise rund um den Erdball, um wieder er selber zu werden, nachdem er jahrelang derjenige gewesen war, den die Spanierin aus ihm machen wollte. Mit ein paar kleinen Fluchten natürlich.
Das Flugticket hatte er sich vor einer Woche besorgt. Etwas über fünftausend Mark hatte es gekostet. Von Frankfurt aus sollte es losgehen, immer Richtung Westen, und er durfte die Fahrt unterbrechen, so oft er wollte. Bis er wieder, dann aus dem Osten kommend, in Frankfurt landen würde. Nur zwei Bedingungen musste er einhalten. Er durfte keine Station zurückfliegen, immer nach Westen musste es gehen, und er durfte niemals den Äquator überqueren. Flüge soweit südlich waren nicht inbegriffen.
Zwei Ziele seiner Reise standen fest, den Rest wollte er auf sich zukommen lassen. Nach Thailand wollte er, nach Pattaya genauer gesagt, in das Sündenbabel des Landes, weil sein Freund Ferdi vom Soldatensender, dem er gelegentlich Berichte lieferte, ihn darum gebeten hatte. In dessen Magazinsendung »Blick in die Welt« war Geld gesammelt worden für ein Waisenhaus in Pattaya.
»Wenn du sowieso um die Welt fliegst«, hatte Ferdi ihn gebeten, »kannst da mal nachschauen, was die mit dem Geld gemacht haben. Es wäre mir lieb, wenn ich sicher sein könnte, dass es gut angelegt ist. Dass es wirklich den Kindern zugutekommt und nicht etwa dem Personal oder sonst wem, der sich bereichern möchte. In Thailand soll es viel Korruption geben. In jedem Fall kannst du mir darüber für meine Sendung einen Bericht machen.«
Er hatte genickt. Klar, warum nicht ein Waisenhaus in Thailand? Ein Haus für Kinder inmitten eines riesigen Bordells. Und dann nach Afghanistan, dorthin wollte er vor allem. In Afghanistan waren vor einem Jahr die Russen einmarschiert, um die mit ihnen befreundete linke Regierung gegen islamische Glaubenskrieger, die Mudschaheddin, zu verteidigen. Die Mudschaheddin hatten vor zwei, drei Jahren begonnen, das Land zu erobern und die moskaufreundliche Regierung so sehr in Bedrängnis gebracht, dass sie kurz vor dem Sturz stand. Seit dem Einmarsch der Sowjets wurden die bärtigen Glaubenskrieger im Westen als Freiheitskämpfer gefeiert und mit Waffen versorgt. Nicht, weil sie wirklich Freiheitskämpfer waren, das behaupteten die Verantwortlichen nur in ihren Propagandareden, sondern einfach deshalb, weil sie gegen die Kommunisten kämpften.
Er wollte wissen, was dort genau geschah, militärisch, und wie sich das auf die Menschen auswirkte. Es war der Teil seiner Reise, von dem der Oberstleutnant auf keinen Fall etwas erfahren durfte. Als Geheimnisträger der Bundeswehr durfte er nicht in den kommunistischen Machtbereich. Wer es dennoch tat, bekam ein Disziplinarverfahren. Unklar, wie das ausgehen würde.
Aber er traute den Berichten in den Medien nicht, hielt sie für Schwarzweißmalerei. Schwarz für die Sowjets, die angeblich ohne Rücksicht Bomben auf die Zivilbevölkerung warfen und weiß für die Mudschaheddin, die als Kämpfer für die Demokratie gefeiert wurden. Was waren deren wirkliche Ziele? Wollten sie tatsächlich Demokratie oder einen islamischen Gottesstaat mit Frauen in Burkas und ohne Schulbildung? Wie viel zu Afghanistan gelogen wurde oder nicht, würde sich übertragen lassen auf andere Krisengebiete, glaubte er. Er war ein Mann, der einer Sache gerne auf den Grund ging.
So hatte es auch angefangen mit seiner journalistischen Arbeit neben der Tätigkeit bei der Bundeswehr. In einer Zeitung war ein Bericht über ein Manöver erschienen, das angeblich große Zerstörungen in der Natur verursacht hatte. Wütend hatte er sich hingesetzt und eine Gegendarstellung geschrieben. Er war an der Planung beteiligt gewesen, gerade die Rücksichtnahme auf die Wäldchen und Tümpel im Manövergebiet war ihm bei der Planung wichtig gewesen. Sein Text war tatsächlich ein paar Tage später in der Zeitung erschienen. Kurz danach hatte ihn der Redakteur angerufen und gefragt, ob er nicht öfter über Bundeswehrthemen in seiner Zeitung berichten wollte. Es waren manchmal die merkwürdigsten Anlässe, die einem Leben eine andere Richtung gaben. Inzwischen schrieb er über alles Mögliche, nicht nur für diese Zeitung, sondern auch für eine ganze Reihe anderer. Manchmal auch über Sport, denn Sport war sein Hobby.
Am Ende hatte der Oberstleutnant sogar zwei Tage Urlaub mehr ausgerechnet als er selber. Er musste grinsen. Zwei Tage mehr also, kein Problem. Wie lange seine Reise dauerte, spielte bei dem Flugticket nämlich keine Rolle.
Der Oberstleutnant trug den Urlaub ein, dann reichte er Götz die Hand. »Aber melde dich von unterwegs«, sagte er. »Ruf an, damit ich nicht alles, was du so treibst, aus den Zeitungen erfahren muss.«
»Mach ich, Wolfgang.« Von Orten, an denen es unverfänglich war, könnte er sich wirklich melden, dachte er. Aber nicht zu oft. Er war froh, dass er seine Fesseln losgeworden war. Sich neue anlegen zu lassen, egal mit welcher Absicht das geschah, wollte er nicht. Auf gar keinen Fall!
3.
Als er in Bangkok landete, hatte er den Großteil seiner Abenteuer schon hinter sich und natürlich Berichte darüber verfasst. Mit seinem primitiven Aufnahmegerät hatte er in Mittelamerika Stimmen gesammelt, auf den Straßen, in den Schulen, in Gesprächen mit Priestern, in denen es immer um die Situation der Ärmsten gegangen war, was sie sich leisten konnten, ob sie hungerten, ob ihre Kinder etwas lernen konnten. Später hatte er die Aussagen im Hotel kommentiert, hatte seine eigenen Eindrücke über die Länder Mittelamerikas geschildert und dann die Bänder nach Deutschland geschickt. Zusammenschneiden mussten sie sie in den Hörfunkstudios zu Hause, dazu fehlte ihm die Technik.
Er verbrachte nur einen Tag in Bangkok, richtig Lust auf die hektische Stadt hatte er nicht. Fast vierzig Grad waren es, in den Straßenzügen staute sich die Hitze. Er hatte den alten Flughafen Don Muang nur ein paar Meter verlassen, um zum Taxistand zu kommen, da hatte sein Hemd schon Schweißflecke. Immerhin raffte er sich am späten Nachmittag auf, verließ das klimatisierte Hotelzimmer und ließ sich von einem Taxifahrer zum Königspalast kutschieren. Anschließend ging er durch einen Torbogen zum Jadebuddha-Tempel. Auch vor Wat Arun, den Tempel im kambodschanischen Stil, ließ er den Taxifahrer halten, kletterte auf den Prang mit seinen steil ansteigenden Stufen bis ganz nach oben, während ihm der Schweiß von der Stirn tropfte, und hatte von dort einen wunderbaren Blick über die Stadt und den großen Fluss, den Mae Nam Chao Phraya.
Die meiste Zeit während seiner Taxifahrt stand er allerdings im Stau. Bangkok mit seinem Linksverkehr war eine verstopfte Stadt, weil die Grünphasen auf den Hauptstraßen viel zu kurz und die für die Nebenstraßen viel zu lang waren. Gab es hier keine Stadtplaner, die so etwas steuerten?
Immerhin blieb bei diesen endlosen Stopps Zeit, ein paar Karten zu schreiben. An den Wolfgang schrieb er und an seine Eltern, die – je älter sie wurden – sich immer mehr Sorgen um ihn machten. Da half es auch nichts, dass er längst auf die vierzig zuging. Vor allem seine Mutter wartete auf jedes Lebenszeichen von ihm. Zweimal hatte er sie deshalb aus Mittelamerika angerufen, was jedes Mal teuer gewesen war. Sein Vater dagegen war ruhiger. Er war auch sofort einverstanden gewesen mit der Reise seines Sohnes, als Götz ihm davon erzählte. Die Welt kennen zu lernen, das passte zu ihm, allerdings hatte er selbst diesen Wunsch anders gelöst. Er war in den diplomatischen Dienst eingetreten, hatte an verschiedenen Botschaften gearbeitet und manchmal, wenn auch nicht immer, seine Familie dabei mitgenommen. Götz hatte fast die gesamte Kindheit und Jugend in Österreich und Norwegen verbracht.
An seinen Freund Jo, der eigentlich Johannes hieß und ein erstklassiger Jazzsaxophonist war, schrieb er, an seine Stammkneipe am Rhein und an seinen Freund Harry, der nicht nur genau wie er Jazzmusik liebte, sondern der sich auch dazu überreden ließ, ihn zu Tanzabenden zu begleiten. Harry, auf den er bauen konnte, weil er sich zu allem überreden ließ, nur nicht zum Heiraten. Harry hatte Angst vor endgültigen Bindungen. Von jedem Ort, den Götz besucht hatte, hatte er geschrieben, sogar an seine Spanierin, mit der er, trotz allem, in freundschaftlichem Kontakt geblieben war.
Jetzt dachte er an Afghanistan. So schnell wie möglich wollte er dorthin. Aber erst musste er sein Versprechen einlösen und über das Waisenhaus in Pattaya schreiben. Am nächsten Morgen fuhr er schon früh mit dem Bus dorthin.
Der Fahrer nahm die Straße über Chon Buri, am Golf von Bangkok entlang. Wenn Götz nach rechts blickte, sah er das türkis glitzernde Meer, wenn er nach links blickte, wechselten sich Pfahlhütten, Papayastauden und Reisfelder ab. In den Gräben links der Straße blühte der Lotus, weiß, rosa und blutrot. Manchmal standen Eukalyptusbäume am Straßenrand und spendeten Schatten gegen die brennende Sonne.
Der Busfahrer fuhr ein gleichmäßiges Tempo und hielt nur einmal kurz an einer Garküche, um sich ein Spießchen zu holen. Ein paar Thais schlossen sich an. Es war eine gemütliche Busfahrt, anders als die Taxifahrt durch Bangkok. Und vor allem anders als jene Busfahrt, die er in Panama-City erlebt hatte.
Dort waren es keine Fahrten gewesen, sondern Busrennen. Der Busverkehr in Panama-City war privatisiert worden, die Busse gehörten den Fahrern. Wer zuerst an der Haltestelle ankam, bekam die Fahrgäste und verdiente Geld. Entsprechend heizten die Fahrer durch die Stadt, überholten an unmöglichsten Stellen und scheuten auch nicht davor zurück, den Konkurrenten in den Straßengraben zu drängen. Als er gemerkt hatte, wie die Sache lief, hatte er sich zu einer Extrafahrt entschlossen und seine Eindrücke bei rasendem Tempo, unterbrochen von den Schreckensschreien der Mitfahrer und manchmal seiner eigenen, auf Band gesprochen. Ein Bericht, der mehrfach von Ferdi beim Bundeswehrsender wiederholt worden war.
In El Salvador war seine Reportage über den Bürgerkrieg unter nicht ganz freiwilligen Umständen zustande gekommen. Er war mit einem Taxi unterwegs gewesen, um außerhalb der Stadt einen Priester zu treffen, dessen Leben bedroht wurde, seit er Slumkindern das Lesen und Schreiben beibrachte, als plötzlich, während das Taxi eine Brücke überquerte, von der einen Seite des Flusses Schüsse ertönten, die im nächsten Moment von der anderen Seite erwidert wurden. Entsetzt sah er den Fahrer an, der ihm aber nichts erklärte, sondern sofort bremste, aus dem Wagen sprang und auch ihn herausriss. Nebeneinander lagen sie mit eingezogenen Köpfen unter dem Taxi, von der Angst gepackt, dass ein Querschläger sie erwischen könnte. In den Pausen zwischen dem Rattern der Gewehrstöße erklärte ihm der Fahrer, dass von rechts die Guerilla schoss, bärtige Männer, die sich hinter einer Mauer und zwei Lastwagen verschanzt hatten, von links die Regierungstruppen, die mit Jeeps gekommen waren und das Feuer eröffnet hatten. Eine Zeitlang lag er bewegungslos neben dem Fahrer, hörte das Rattern der Salven, dann kam ihm seine Lage blöd vor. Er war Soldat. Wozu hatte er unzählige Male Kampfeinsätze geübt, wenn er bei der ersten echten Schießerei den Kopf einzog und sich unter einem Auto verkroch? Er robbte zum Vorderreifen, um von dort die Lage zu überblicken. Der Fahrer versuchte, ihn zurückzuhalten, aber er wehrte seine Hand ab. Schließlich kroch er halb unter dem Wagen hervor, öffnete die Tür zum Rücksitz und griff nach seinem Aufnahmegerät. Er kroch zurück unter das Taxi, schaltete das Gerät ein und kommentierte: »Ich liege hier auf einer Brücke unter einem Taxi inmitten einer Schießerei. Von rechts schießen Guerilleros, von links Regierungstruppen ...«
Kugeln pfiffen knapp an dem Taxi vorbei, als hätten die Regierungssoldaten mitbekommen, dass jemand unter dem Taxi Tonbandaufnahmen von ihrem Kampf machte. Als wollten sie die passenden Hintergrundgeräusche dazu liefern oder ihn daran hindern, um nur ja keine Zeugen zu haben. Zwei Kugeln schlugen in das Taxi ein, eine davon zerstörte die Heckscheibe. Aber er hörte nicht auf, das Gefecht zu kommentieren. Mitten im Brennpunkt zu stehen, das war es gewesen, was er sich vor Reisebeginn vorgenommen hatte. Und nun war es eingetroffen. Wenn es auch nicht ganz so gefährlich sein sollte.
Es war ein Bericht geworden, den auch öffentlich-rechtliche Sender übernommen hatten. Die meisten hatten ja keine Korrespondenten in Mittelamerika und wenn doch, dann keine, die in Kampfhandlungen zwischen Guerilla und Regierungstruppen geraten waren. Nicht schlecht, dachte er im Rückblick über dieses Abenteuer. Wenn es so weiterging, hatte er einen Teil seiner Reisekosten wieder eingenommen, bevor er nach Hause zurückgekehrt war.
Das Stadtbild von Pattaya wurde von einer langen Hauptstraße dominiert, die sich zu Teilen am Meer entlang streckte. Auf der einen Straßenseite lag der Strand mit den Palmen und den Frangipani mit ihren stark duftenden rosa Blüten, die zu den Gummibäumen zählten. Manchmal sah er auch Kasuarine-Bäume, die asiatische Variante des Ginkgos. Gruppen oder Pärchen lagen auf Decken oder Liegen im Sand unter den Bäumen. Auf der anderen Seite standen die Hotels, zwischen denen sich das Gewirr an Bars, Nachtclubs und Restaurants befand. Unüberschaubar die Leuchtreklamen, manche darunter in deutscher Sprache. Warme Küche von 10 bis 4 Uhr morgens, Otto’s Calypso Bar, Caligula Club und dazwischen immer wieder Money changer.
Langsam lief er die Straße entlang, seine kleine Gepäcktasche in der Hand. Der Schweiß rann ihm über die Stirn, obwohl die Tasche gar nicht so schwer war, denn das meiste Gepäck hatte er in einem Schließfach in Bangkok zurückgelassen. Dort war es zwar auch nicht sicher, aber immer noch sicherer als in Pattaya. Ferdi hatte ihm geraten, so zu verfahren. Es waren nicht unbedingt die Thais, die klauten, sondern eher die Zugereisten, das menschliche Strandgut aus aller Welt, das es dorthin verschlagen hatte.
Vor den Bars standen junge Männer in schwarzer Hose, weißem Hemd und Schlips, dazu Frauen in langen Kleidern, die an der linken Seite tief eingeschnitten waren, so dass viel Bein sichtbar wurde.
Immer wieder kamen sie auf ihn zu. »Hallo, sit down please«, sagten sie mit leiser Stimme und lächelten dazu. An den Theken sah er Touristen in kurzen Hosen, fast alle hatten ein Thaimädchen an ihrer Seite, das manche mit einem Griff in den Nacken festhielten. Eine seltsam besitzergreifende Geste, die er noch nirgendwo sonst gesehen hatte. Wie ein Beutegriff, dachte er.
Er ging nicht auf die Angebote ein, sondern schüttelte den Kopf. Als sie ihm zu viel wurden, wechselte er die Straßenseite und blickte von dort hinüber auf das Meer. In Ufernähe, wo die Wellen den Sand aufwirbelten, war es milchig, dahinter erstreckte es sich türkisblau. Er hatte Lust zu baden, aber wo sollte er sich umziehen und sein Gepäck so sicher verstecken, dass er ihm keiner klauen konnte?
Zum ersten Mal während seiner Reise fühlte er sich unwohl. Es war ein flaues Gefühl in der Magengegend, wie er es während seiner gesamten Reise noch nicht gespürt hatte. Irgendwie fühlte er sich einsam inmitten des Gewimmels, so einsam wie sich die Männer fühlen mussten, die ihre Mädchen mit Beutegriff festhielten.
Er beschloss, den Auftrag so schnell wie möglich zu erledigen und noch am Abend zurückzukehren nach Bangkok. Wenn alles gut ging, könnte er morgen Richtung Indien fliegen. Und von dort nach Afghanistan.
Er ging auf einen älteren Mann zu, um ihn nach dem Weg zu fragen, aber Waisenhaus, dachte er plötzlich, was hieß noch mal Waisenhaus auf Englisch? Als nach einem »house for poor children« fragte und die entsetzten Augen des Mannes sah, wusste er, dass er einen Fehler gemacht hatte. Herrgott, warum hatte er vor der Fahrt nicht sein Englisch aufgefrischt? Bisher war alles gut gegangen, aber jetzt …
»Oh, excuse me, excuse me!«, rief er und winkte erschrocken mit der Hand. »What I mean is a home for young children without parents, you know? Without parents!«
Hoffentlich denkt er jetzt nicht etwas völlig Perverses, dachte er. Wäre ja kein Wunder angesichts des Umfelds hier. Aber am Leuchten der Augen des Mannes sah er, dass er ihn verstanden hatte. Er atmete durch und wischte sich den Schweiß von der Stirn.
Der Mann zeigte ihm, dass er zur Hauptstraße, der Sukumvit, zurückgehen musste, wo er auf einen kleinen Park stoßen würde und dort, mitten in dem Park, wäre das Heim.
Er nickte und dankte.
So gut es ging, hielt er sich im Schatten der Palmen, Frangipani oder Kasuarine, trotzdem fiel ihm jeder Schritt schwer. Endlich entdeckte er die flachen Gebäude, die von einer mannshohen Mauer umgeben waren. Auf den ersten Blick kam es ihm nicht so vor, als wäre hier viel Geld investiert worden, aber als er durch das Tor trat, sah er, dass alles sauber, fast akkurat war. Sorgfältig geharkte Beete neben den mit Platten belegten Wegen. Aus einem der Seitengebäude erklang das Rufen von Kindern, das im nächsten Moment von der energischen Stimme einer Frau zum Verstummen gebracht wurde. Kurz darauf erklang ein Kinderlied auf Englisch. Er blickte sich um, eine Frau in Nonnentracht kam ihm entgegen, ein in der Sonne blinkendes Kruzifix auf der Brust. Schnell griff er nach einem Zettel in der Hosentasche. Um nicht den nächsten Fehler zu machen, las er schnell noch mal den Namen des Heimleiters und fragte dann nach Pater Bolton. Er hätte sein Kommen angekündigt, erklärte er, allerdings schon vor Wochen und ohne einen genauen Termin zu nennen.
»Oh sorry«, antwortete sie, »Mr. Bolton has travelled to Bangkok. He will be back tomorrow in the afternoon. Can I help you?«
Er zog die Luft zwischen den Zähnen ein. Mist, damit hatte er nicht gerechnet. Mit der Auskunft einer Mitarbeiterin würde Ferdi nicht zufrieden sein, Mr. Bolton musste es sein, der Chef, das hatte er ihm ein paar Mal eingeschärft. Und zeigen lassen sollte er sich außerdem, was mit dem Geld gekauft worden war. Außerdem brauchte er für den Rundfunkbericht geeignete O-Töne, die auch nur von Bolton stammen konnten.
»Okay, I will be back tomorrow in the afternoon.« Er spürte, dass sie ihm zweifelnd, vielleicht sogar beleidigt nachsah.
Wo sollte er jetzt übernachten? In irgendeinem billigen Hotel am besten, dachte er, denn es kam gar nicht drauf an, wie gut das Zimmer sein würde. In der Hitze würde er sowieso kaum schlafen.
Er fand eines in einer kleinen Seitenstraße, direkt gegenüber einer Bar. »Marinebar« hieß sie. Mit schweißverklebtem Hemd stand er am Fenster und schaute hinüber.
Auch vor dieser Bar standen Mädchen. »Hallo darling, please sit down.« Er glaubte, ihre Stimmen zu hören, wenn sie vorbeigehende Männer ansprachen.
Er riss sich los von dem Anblick, streckte sich auf dem Bett aus, fand aber keinen Schlaf. Schweiß rann an seinem Körper herunter.
Marinebar, irgendwie erinnerte ihn das an seinen Beruf, obwohl er nie bei der Marine gewesen war. Er stand auf und ging unter die Dusche. Das Wasser tröpfelte nur, trotzdem tat es ihm gut. Dann zog er sich ein frisches Hemd an und ging hinüber.
Die Mädchen begriffen sofort, was er wollte, und ersparten sich ihren Lockruf. Eine trat auf ihn zu, fasste ihn am Arm und zog ihn sanft ins Lokal. In der Mitte befand sich eine große Tanzfläche mit Stangen an den vier Ecken, auf der sich, im Rhythmus der sanften Musik, einige Pärchen drehten. Drum herum, auf drei Ebenen angeordnet, standen Tischchen mit Stühlen davor, an denen vereinzelnd Männer saßen. Sie wollte, dass er sich an einen Tisch ganz in der Nähe der Tanzfläche setzte, aber die Vorstellung, von jedem, der in die Bar kam, sofort gesehen zu werden, war ihm unangenehm. Lieber wollte er versteckt in der hinteren Reihe sitzen. Wenn sich die Chance auf irgendein Gespräch ergab, konnte er immer noch nach vorn gehen.
Er bestellte eine Cola. Sie rief zur Theke hinüber, die sich im hinteren Bereich der Bar befand und ging zurück zum Eingang. Er ärgerte sich, dass er vergessen hatte, Cola ohne Eis zu verlangen. Man konnte nie wissen, woher die ihr Wasser für das Eis nahmen. Auf keinen Fall wollte er sich eine Diarrhö einfangen.
Die Pärchen auf der Tanzfläche sahen alle gleich aus. Der Mann aus Europa, mancher davon mit unübersehbarer Wampe, dazu ein sehr viel kleineres, feingliedriges thailändisches Mädchen. Fehlte nur noch, dass die Typen diese Mädchen auch beim Tanzen im Beutegriff hielten.
Die Cola wurde gebracht, natürlich mit Eis. Er trank einen Schluck, versuchte sich zu entspannen, schaffte es aber nicht, denn er spürte den Ärger, den der Gedanke in ihm auslöste, in dieser verdammten Stadt ausharren zu müssen, an der ihn nichts, aber auch gar nichts interessierte.
Aber was wäre die Alternative, dachte er dann. Seinem Freund Ferdi, der ihm viele Gefälligkeiten erwiesen hatte, eine Bitte abzuschlagen? Unmöglich. Dann hätte er auch gleich ihre Freundschaft beenden können. Eine Nacht und ein paar Stunden morgen früh, mehr war es doch nicht, versuchte er sich zu trösten. Aber die Verärgerung blieb trotzdem. Er hatte frei sein wollen auf dieser Reise. Durch nichts und niemand wollte er sich etwas vorschreiben lassen. Und nun dies.
Er trank die Cola in einem Zug leer, wollte dem Kellner zuwinken, um zu bezahlen, ließ die gehobene Hand aber sofort wieder fallen, weil die Musik plötzlich abbrach und die Pärchen wie auf Kommando die Tanzfläche verließen.
Was war denn jetzt los? Er blickte sich um, konnte aber nichts Auffälliges entdecken, da die Beleuchtung über den Sitzreihen dunkler geworden war. Im selben Moment richtete sich ein Scheinwerfer auf den Eingang schräg hinter der Theke, in dem, nach einem kurzen Schlagzeugsolo, eine Frau erschien. Sie trug ein türkisfarbenes Trägerkleidchen, das sich eng an ihren Körper anschmiegte und im Licht des Scheinwerfers glitzerte. Gebannt schaute er hinüber.
Für einen Moment stemmte die Frau ihre Hände gegen den Türrahmen und wiegte sich leicht in den Hüften. Aus einer dunklen Ecke brandete Applaus auf.
Mit tänzelnden Schritten kam die Frau die leicht abfallende Rampe herunter und machte zwischendurch immer wieder einen Schritt zur Seite, so dass sich ihr tief geschlitztes Kleid an der Seite öffnete und viel Bein sichtbar wurde. Irgendwann, als sie es wieder tat, grölte einer der Gäste etwas, das Götz aber nicht verstehen konnte. Die Frau reagierte darauf. Sie drehte sich in Richtung des Rufers, hob die Arme wie eine Tempeltänzerin über den Kopf, so dass sich ihr Kleid leicht hob, und nahm eine Spreizstellung ein.
Wieder lautes Gegröle, diesmal aus mehreren Kehlen.
Er ertappte sich dabei, dass er sich aus seinem Sitz erhob, um besser auf das entblößte Bein der Frau schauen zu können, kam sich aber im selben Moment blöd vor. Fehlte nur noch, dass er auch anfing zu grölen.
Dann drehte sich die Frau plötzlich um und blickte direkt in seine Richtung. Unwillkürlich versuchte er, sich zu ducken, fand dann aber, dass es überflüssig war. Geblendet vom Scheinwerferlicht konnte sie ihn unmöglich im Halbdunkel erspähen. Jetzt, da sie ihm ihr Gesicht zuwandte, sah er, dass etwas weiß in ihrem pechschwarzen Haar schimmerte. Es war eine Orchidee.
Plötzlich lächelte sie, und obwohl er glaubte, dass sie ihn nicht sehen konnte, kam es ihm vor, als lächelte sie ihn an. Tatsächlich ihn. Ob sie ihn doch bemerkt hatte trotz des blendenden Scheinwerferlichts? Er begann, unsicher zu werden, und spürte gleichzeitig, wie ihn ihr Auftritt faszinierte.
Sie bewegte sich im Rhythmus der Musik, während sie lässig die Tanzfläche betrat, und griff dort nach einer der Stangen, die die vier Ecken begrenzten. Eine Kugel begann sich in der Mitte der Decke zu drehen und warf abwechselnd rotes, gelbes oder blaues Licht auf sie. Sie schmiegte sich an die Stange, nahm sie zwischen ihre Beine, für einen Moment wurde ihr schwarzer Slip sichtbar, und er spürte, wie er den Atem anhielt. Sie ließ die Stange los, tanzte an der Rampe, streckte die Arme dabei aus, als wäre sie eine Tempeltänzerin, dann bewegte sie sich zurück zur Stange, ließ sich daran hinab gleiten, das Kleid rutschte nach oben und der Slip wurde jetzt deutlich und über einen längeren Zeitraum sichtbar. Es war ein kleines, schwarzes Dreieck, gehalten von zwei schmalen Bändchen.
Dann zog sie sich wieder hoch, die Stange noch immer zwischen ihren Beinen. Und spätestens jetzt musste jeder Mann, der in der Bar saß, auf den Gedanken kommen, wie es wohl wäre, wenn sie sich so eng an ihn schmiegen und eines seiner Beine zwischen ihre klemmen würde.
Er begann, auf seinem Stuhl hin- und herzurutschen, gleichzeitig ärgerte er sich über seine Erregung. Es war die übliche Schau, so gut oder schlecht wie in den anderen Bars dieser Stadt, versuchte er sich einzureden. Obwohl, schlecht war sie nicht, nein wirklich nicht.
Ein Träger ihres Kleidchens war heruntergerutscht, ihr BH wurde sichtbar und er stellte fest, wie groß ihr Busen war.
Sie ließ die Stange erneut los, tanzte weiter, streifte das Kleid ab, danach den BH. Ihr Busen war prall und fest. Sie schaute zwischendurch wieder in seine Richtung, ganz deutlich spürte er ihren Blick, dann schloss sie für einen Moment die Augen und wirkte so selbstvergessen, als käme es ihr beim Tanz nur auf sie selbst an. Auf sie und ihr Verhältnis zu ihrem Körper. Oder, dachte er dann plötzlich, bezog sie ihn mit ein? Hatte sie die Augen nur geschlossen, um in Gedanken bei ihm zu sein? Nur bei ihm.
Den Slip behielt sie bis zum Schluss an, dann streifte sie ihn mit einem Ruck ab und drehte sich im selben Moment zur Seite, so dass ihre Schambehaarung mehr zu ahnen als zu sehen war.
Das Grölen, das nun aus allen Ecken erklang, störte ihn nicht nur, es machte ihn aggressiv. Ein plumpes, primitives Verhalten, das von einem Moment zum anderen den Reiz zerstörte, den sie vermittelt hatte. Wütend blickte er sich um, kriegte sich aber schnell wieder ein. War er etwa eifersüchtig? Ach was, wie konnte er auf so einen Gedanken kommen? Eine Frau wie sie, die jetzt mit hastigen Griffen ihre Kleidung einsammelte, konnte ihn doch nicht aus der Fassung bringen. Doch nicht so eine! Er wischte sich über die Stirn und starrte ihr nach, bis sie in der Tür hinter der Theke verschwunden war.
Die Luft war stickig vom Zigarettenqualm. Seit er vor ein paar Jahren das Rauchen aufgegeben hatte, störte ihn der Qualm. Er sollte gehen, dachte er. Was hatte er hier überhaupt erwartet? In diesem Moment, als hätte sie seine Gedanken erraten und wollte es verhindern, trat eine Kellnerin an seinen Tisch und fragte, ob er noch etwas zu trinken wünsche. Einen Moment lang starrte er sie an. Nein, bloß keine Cola mehr, dachte er. Wenn er sich zusätzlich zu der Hitze auch noch aufputschte, würde er sowieso kein Auge mehr zukriegen.
Die Kellnerin lächelte.
Wieso denke ich eigentlich darüber nach, was ich trinken will, fragte er sich dann. Gerade war er noch sicher gewesen, dass er gehen wollte. Und jetzt … bestellte er ein Bier.
Nein, es lag nicht an der Frau, an der lag es ganz und gar nicht. Er brauchte einfach etwas, das ihn müde machte. Und ein Bier war genau das Richtige.
Gerade in dem Moment, als es gebracht wurde, kam die Tänzerin zurück, diesmal in einem hellblauen Kleid, das am Hals geschlossen war, aber Schultern und Arme frei ließ und natürlich tief geschlitzt war. Noch bevor sie die ersten Schritte die Rampe hinunter gemacht hatte, war er sich sicher. Diesmal sah sie wirklich ihn an, einzig ihn. Er hatte ein Gefühl wie bei seinem ersten Rendezvous.
Sie kam an seinen Tisch und lächelte, die weiße Orchidee steckte noch in ihrem Haar. Einen Moment lang zögerte sie, dann streckte sie ihren rechten Arm vor und bewegte ganz leicht die Finger.
Komm, sollte das heißen. Du hast doch gemerkt, dass ich dich einbezogen habe in meinen Tanz. Jetzt wollen wir ausführen, was wir in Gedanken schon vollzogen haben. Aber das sagte sie nicht, das deutete sie mit der leichten Bewegung ihrer Finger an.
Er konnte gar nicht anders, als aufzustehen und fühlte im selben Moment, dass sie ihn an die Hand nahm. Sie zog ihn auf die Tanzfläche, schmiegte sich an ihn, begann, sich im Rhythmus der Musik zu bewegen und er spürte ihre festen Beine an seinen Oberschenkeln. Er tanzte gerne, zu Zeiten seiner Spanierin waren sie oft am Wochenende ausgegangen und hatten einen ganzen Abend über getanzt.
Die Frau, die er jetzt in seinen Armen hielt, bewegte sich geschmeidiger. Sie bewegte sich langsam, als ginge es darum, jede noch so leichte Bewegung auszukosten, während seine Spanierin die schnellen Rhythmen bevorzugt hatte, bei denen sie ihr Temperament ausspielen konnte, das sich außer beim Tanz vor allem in ihren Eifersuchtsanfällen gezeigt hatte. Er schüttelte ganz leicht den Kopf. Nein, er wollte nicht an seine Spanierin denken. Er wollte sich jetzt ganz auf diese Thailänderin konzentrieren, aus deren Haar ihm der Duft der Orchidee entgegenströmte.
Sie tanzten lange, ohne auch nur ein einziges Wort zu sagen. Zwischendurch spürte er, wie sie ihren Kopf gegen seine Schulter lehnte, dann sah sie ihn an und lächelte. Kleine Grübchen bildeten sich auf ihrer Wange. Sie hielt ihn mit ihrem Blick gefangen, sie ließ nicht zu, dass er wegschaute. Sie wollte ihn mit ihrem Blick fesseln, wie sie es vorhin mit ihrem Tanz getan hatte.
Erst nach mehreren Tänzen sprach sie den ersten Satz.
»Hallo«, sagte sie, »du bist ein guter Tänzer.«
Ihr Englisch klang ein wenig schnarrend, er musste sich erst an den Tonfall gewöhnen. Dann lächelte er.
»Ich habe lange nicht geübt.« Sie tat so, als würde sie ihm das nicht glauben.
»Oh, no no«, sagte sie, hob zum Spaß den Finger und drohte ihm. »Erzähle keine Lügen.«
Es gefiel ihm, wie sie das machte, er drückte sie fester an sich, hob sie hoch und drehte sich zweimal im Kreis. Sie lachte schallend. Jetzt blickten alle, die sich inzwischen auf der Tanzfläche eingefunden hatten, herüber, aber das interessierte ihn nicht. Er sah nur sie.
Sie tanzten lange, zwei, drei Stunden vielleicht und sprachen wenig. Er wollte auch gar nicht sprechen, sondern genoss es, ihren Körper zu spüren. Und sie wiederum war, das merkte er, ganz darauf konzentriert, ihn ihren Körper spüren zu lassen. Mal schob sie den einen, mal den anderen Oberschenkel vor, dann drückte sie ihren Busen gegen seine Brust. Je länger sie tanzten, desto größer wurde ihre Bereitschaft zuzulassen, dass seine Hände sie da anfassten, wo er sie anfassen wollte.
Dann fiel ihm sein Auftrag ein. Ganz plötzlich schoss er ihm der Gedanke durch den Kopf, mitten hinein in die heißen Rhythmen eines Rocksongs. Er musste morgen Pater Bolton treffen, und dann wollte er weg aus diesem Land, hinüber nach Afghanistan, um endlich zu verstehen, was dort passierte.
Er ahnte, was die Frau vorhatte. Sie wollte ihn mitnehmen auf ihr Zimmer in einen Hinterraum dieser Bar oder in irgendeiner Absteige. Sie hatte ihm Zärtlichkeit und Zuneigung demonstriert, aber jetzt, wo er nüchtern darüber nachdachte, wusste er, dass es Teil ihres Jobs war, den sie jeden Abend ausfüllte. Heute mit ihm, morgen mit jemand anderem. Obwohl sie es gut machte, so gut sogar, dass er ihre Absichten zwischendurch vergaß und sogar … Er schüttelte den Kopf. Nein, er sollte Realist bleiben, genau das, worauf er immer Wert gelegt hatte, bei sich und all den anderen, mit denen er zu tun hatte. Deshalb war er sich auch sicher, dass er genau das nicht wollte. Nein, so sollte es nicht enden. Das war … Er überlegte. Unmoralisch etwa, wie Pater Bolton das gesagt haben würde? Zu billig für ihn und seine Ansprüche? Egal was es war, er wollte es nicht.
Er überlegte, wie er es beenden sollte. Sie lebte von dem, was sie den Männern abnahm und hatte fast drei Stunden in ihn investiert. Wenn er ging, ihr zum Abschied einfach die Hand drückte, vielleicht noch ein Getränk an der Theke bestellte, würde sie ihre gemeinsame Zeit als vergeudet ansehen. Dann hätte sie diesen Abend verloren und wäre sauer auf ihn. Nein, das sollte sie nicht, auf keinen Fall sollte sie das. Sie hatte ihm beim Tanzen das Gefühl gegeben, dass es wirklich um ihn ging, aber mehr von ihr wollte er nicht. Wenn doch, wäre der Abend umgekehrt für ihn verloren. Nicht in dem Moment, in dem sie zusammen wären. Aber danach würde ein schaler Beigeschmack zurückbleiben, der die Erinnerung entwerten würde. Diese Begegnung sollte anders verlaufen als all die anderen, die sie sonst erlebte, das war es, was er sich wünschte. Aber einfach gehen konnte er trotzdem nicht. Wie würde dann ihre Erinnerung aussehen?
Die Musik eines Schmusesongs verklang.
»Ich muss gehen«, sagte er in dem kurzen Moment zwischen dem Verklingen des einen und dem Beginn des anderen Songs. Er sagte es in harschem Tonfall, der keinen Widerspruch duldete. »Ich muss jetzt los, sorry.«
Dabei griff er in seine Jackentasche, holte seine Brieftasche heraus und gab ihr fünfhundert Baht.
Erstaunt sah sie ihn an. War ihr die Summe etwa zu gering? Oder war sie erstaunt, allein fürs Tanzen bezahlt zu werden und nichts weiter leisten zu müssen?
Er wusste es nicht, es war ihm egal. Es war gut so, wie es jetzt endete. Ein unverhoffter Flirt, zu dem sie ihn ausgesucht hatte und niemand anderen, das konnte er sich jetzt einbilden und das sollte es auch bleiben.
Als sie ihn weiter erstaunt ansah, drückte er ihr einen flüchtigen Kuss auf die Wange und ging, ohne sich noch einmal umzudrehen.
Er schlief schlecht in dieser Nacht. Es war heiß und drückend im Zimmer. Und von drüben, von der Bar, drang leise und verführerisch Musik herüber. Aber er blieb liegen in seinem Bett, auch wenn ihm noch so heiß war.
4.