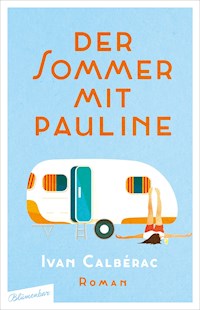
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 3,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Aufbau digital
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
„Wahrscheinlich ist Liebe genau das: die Antwort auf alles.“
Émile ist fünfzehn und zum ersten Mal richtig verliebt. In die charmante Pauline aus seiner Nebenklasse, mit der er über Filme, über Tennishelden und übers Leben reden kann. Wenn sie lächelt, geht die Sonne auf. Als Pauline Émile nach Venedig einlädt, wo sie in einem Jugendorchester Geige spielt, kann er sein Glück kaum fassen. Doch die Eltern und der ältere Bruder wollen ihn begleiten – im Wohnwagen, in dem die Familie übergangsweise lebt. Eine Abenteuerreise beginnt, an dessen Ende Émilie ein anderer und sein Blick auf die Welt ein neuer ist ...
Dieser lebenskluge, humorvolle Roman übers Erwachsenwerden und die Kraft der ersten großen Liebe trifft mitten ins Herz. Der Buchhändlerliebling aus Frankreich vom Drehbuchautor von „Frühstück bei Monsieur Henri“.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 314
Veröffentlichungsjahr: 2019
Sammlungen
Ähnliche
Über Ivan Calbérac
Ivan Calbérac ist vor allem als Regisseur und Drehbuchautor bekannt, sein Film »Frühstück bei Monsieur Henri« lockte 2016 auch hierzulande über 500.000 Zuschauer in die Kinos. Sein Debütroman »Der Sommer mit Pauline« wurde in Frankreich sofort zum Bestseller, als Theaterstück adaptiert und wird zurzeit verfilmt. Ivan Calbérac führt Regie und hat auch das Drehbuch geschrieben.
Anne Maya Schneider, geboren 1990, studierte Französisch, Spanisch und Literaturwissenschaft in Bamberg, Berlin und Lyon. Nach Stationen in Verlagen und Agenturen lebt sie als Übersetzerin und freie Lektorin in Berlin.
Informationen zum Buch
»Wahrscheinlich ist Liebe genau das: die Antwort auf alles.«
Es ist fast Sommer und Émile ist zum ersten Mal richtig verliebt. In die charmante Pauline aus seiner Schule, mit der er über Filme, Tennishelden und übers Leben reden kann. Wenn sie lächelt, geht die Sonne auf. Als Pauline Émile nach Venedig einlädt, wo sie in einem Jugendorchester Geige spielt, kann er sein Glück kaum fassen. Doch die Eltern und der ältere Bruder wollen ihn begleiten – im Wohnwagen, in dem die Familie übergangsweise lebt. Eine Abenteuerreise beginnt, an deren Ende Émilie ein anderer und sein Blick auf die Welt ein neuer ist. Dieser humorvolle Roman übers Erwachsenwerden und die Magie der ersten großen Liebe trifft einen mitten ins Herz.
Der Buchhändlerliebling aus Frankreich vom Drehbuchautor von »Frühstück bei Monsieur Henri«
ABONNIEREN SIE DEN NEWSLETTERDER AUFBAU VERLAGE
Einmal im Monat informieren wir Sie über
die besten Neuerscheinungen aus unserem vielfältigen ProgrammLesungen und Veranstaltungen rund um unsere BücherNeuigkeiten über unsere AutorenVideos, Lese- und Hörprobenattraktive Gewinnspiele, Aktionen und vieles mehrFolgen Sie uns auf Facebook, um stets aktuelle Informationen über uns und unsere Autoren zu erhalten:
https://www.facebook.com/aufbau.verlag
Registrieren Sie sich jetzt unter:
http://www.aufbau-verlag.de/newsletter
Unter allen Neu-Anmeldungen verlosen wir
jeden Monat ein Novitäten-Buchpaket!
Ivan Calbérac
Der Sommer mit Pauline
Roman
Aus dem Französischen vonAnne Maya Schneider
Inhaltsübersicht
Über Ivan Calbérac
Informationen zum Buch
Newsletter
Montag, 12. März
Mittwoch, 14. März
Freitag, 16. März
Dienstag, 20. März
Mittwoch, 21. März
Freitag, 23. März
Montag, 26. März
Dienstag, 27. März
Mittwoch, 28. März
Freitag, 30. März
Samstag, 31. März
Sonntag, 1. April
Montag, 2. April
Mittwoch, 4. April
Samstag, 7. April
Donnerstag, 12. April
Freitag, 13. April
Samstag, 14. April
Sonntag, 15. April
Montag, 16. April
Dienstag, 17. April
Mittwoch, 18. April
Montag, 30. April
Danksagung
Impressum
Venedig ist nicht in Italien, nein,
Venedig ist, wo immer du bist,
Ganz egal wo, es kann überall sein,
Aber nur in Momenten, die du nicht vergisst.
Venedig ist, wenn der Himmel in Blau
Unter goldgelben Brücken fließt,
Venedig, das ist kein Morgen in Grau,
Es ist der Ort, an dem du glücklich bist.
»Venise n’est pas en Italie«
(Text: Claude Lemesle,Interpret: Serge Reggiani,Übersetzung: Anne Maya Schneider)
Montag, 12. März
Wir waren gerade beim Mittagessen, sie saß mir gegenüber. Es gab Radieschen mit Butter und Salz, dann Putenschnitzel auf Reis und Pilzen, megalecker, mein Lieblingsessen. Und dazu: Schweigen. Ich musste an ein Mädchen denken, das ich gar nicht kannte, die hatte auf dem Schulhof gesagt, dass sie Tagebuch schreibt. Das hat mich nicht losgelassen. Während ich mein Schnitzel mampfte, sagte ich wie aus dem Nichts zu Mama: »Wer Tagebuch schreibt, nimmt sein eigenes Leben zu wichtig.« Meine Mutter schaute mich an und erwiderte, viel sanfter als sonst: »Wenn man selbst sein Leben nicht wichtig nimmt, wer dann?« Da kam ich mir echt dämlich vor. Meine Mutter schwingt eigentlich keine großen Reden, eine Intellektuelle ist sie nicht gerade, aber da ist mir die Spucke weggeblieben. Also bin ich letzten Mittwoch, an meinem freien Nachmittag, in die Rue Dorée gegangen, zur Buchhandlung Soret, und habe mir dieses schicke Heft gekauft, in das ich jetzt mit meinem Waterman-Füller schreibe – einer mit diesen Tintenpatronen, die immer irgendwann auslaufen und einem die Finger versauen, und dann gibt das Ding den Geist auf. Angeblich sind Waterman-Füller trotzdem die besten. Bis auf Montblanc, klar, aber das ist ein anderes Kaliber, für das Geld kriegt man ein Moped, und außerdem geben die garantiert auch irgendwann den Geist auf, es dauert nur ein bisschen länger.
Alles gibt irgendwann den Geist auf, das ist ein Naturgesetz, bei den Füllern geht es los und bei der Großmutter hört es auf. Dann klingelt eines Abends das Telefon und Mama sagt dir, sie kommt heute nicht nach Hause, weil Oma von uns gegangen ist. Das Telefon hat geklingelt wie immer, aber nach dem Auflegen fühlt man sich ganz und gar nicht wie immer, da wird es still, so still wie ein See, wie der Spiegel eines Sees in der Nacht, und man sagt sich, der Tod schluckt jeden Lärm. Tja, jedenfalls gibt alles irgendwann den Geist auf, man sollte sich also nicht zu sehr an die Dinge binden, erst recht nicht an sein Schulzeug. Aber das ist gar nicht mein Thema. Sondern Pauline, weil ich praktisch nur noch an sie denke. Sie geht in die Zehnte. Bei uns auf dem Gymnasium gibt es neun Parallelklassen, am besten wäre es natürlich gewesen, wenn wir in dieselbe gekommen wären, aber da hatte ich rein statistisch gesehen schlechte Karten. Außerdem habe ich ein Jahr Vorsprung, ich gehe in die Elfte. Ich hätte also eine Klasse wiederholen müssen, und selbst dann wäre die Chance eins zu neun gewesen. Und wenn ich sitzen bleibe, bringen meine Eltern mich um. Im Ernst.
Pauline habe ich im Freizeitraum getroffen. Also unsere Blicke haben sich getroffen, aber manchmal reicht das ja, um ein Leben zu verändern. Ich spielte gerade Tischtennis, zwischen zwölf und zwei Uhr darf man das dort, echt super. Ich war mal Bester in der Mannschaftswertung der Kreisliga hier im Loiret, ich kann stundenlang spielen, ohne dass mir langweilig wird, und wenn man was pausenlos macht, wird man zwangsläufig ein bisschen besser. Jedenfalls stand ich mit Jérémie an der Platte, und der Ball zog an mir vorbei, oder ich schlug einfach daneben. Ich drehte mich um und da stand sie: Ein braunhaariges Mädchen mit dunklen Augen, etwa fünfzehn, in Jeans und einem blau-weiß gestreiften Pullover mit großen Knöpfen, seitlich von der Schulter bis zum Hals. Sie hockte sich hin, nahm den Ball und richtete sich auf. Sie gefiel mir auf den ersten Blick. Wenn sie ernst guckt, sieht sie abweisend, fast unfreundlich aus, aber sobald sie lächelt, geht die Sonne auf. Ich hatte das Gefühl, sie schon immer zu kennen – vielleicht ist das ja Liebe, wenn dir eine Fremde ganz vertraut vorkommt. So, wie wenn du eine Melodie zum ersten Mal im Radio hörst und sofort weißt, dass dieses Lied dich begleiten wird, dass du es in Dauerschleife hören wirst, und das auch noch Jahrhunderte später. Erklären kann man das nicht, aber es liegt auf der Hand. Pauline war offensichtlich schon immer Teil meines Lebens, auch wenn ich bisher nichts davon wusste.
Sie drückte mir den Tischtennisball in die Hand, das ist nicht weltbewegend, aber der Moment hat sich mir eingebrannt. Selbst auf dem Sterbebett werde ich mich noch daran erinnern, auch wenn bis dahin noch viel Wasser den Fluss hinabfließen wird, wie meine Mutter immer sagt. Ich würde mich so oder so daran erinnern, weil ich mich an alles erinnere. Ich habe ein supergutes Gedächtnis, nicht, dass ich damit angeben wollte, haut sowieso keinen vom Hocker, so ein Elefantengedächtnis. Jedenfalls ist das nicht das Erste, worauf Mädchen bei Jungs achten. Ich kann mir alles merken, was ich jemals gelesen habe, ich muss es nicht mal lernen. PINs, Telefonnummern, Geburtstage … Filmtitel und dazu die komplette Besetzung, keine Ahnung, wo ich das alles aufbewahre. Aber irgendwann kann selbst ich mich garantiert an gar nichts mehr erinnern, Vergesslichkeit macht vor niemandem halt. Das ist wie bei den Füllern, irgendwann gibt auch der eigene Geist auf, aber sogar wenn ich alle Nummern und Namen, Ereignisse und Orte und, schlimmer noch, Bilder und Gefühle vergessen haben werde: Was bleibt, ist das Gesicht von Pauline, als sie mir den Tischtennisball gibt. Und dann kann ich die Augen schließen und sterben.
Mittwoch, 14. März
Irgendwie muss ich einen Weg finden, mit ihr zu reden. Wie soll man ein Mädchen küssen, wenn man noch kein Wort mit ihr gewechselt hat? Okay, manche Jungs kriegen das hin, aber die spielen in einer anderen Liga. So wie Pierre-Emmanuel, eine Art Kumpel, mit dem ich Tennis spiele. Manche Mädchen schauen ihn so versteckt an, aus dem Augenwinkel. Für seine fünfzehn ist Pierre-Emmanuel schon ziemlich behaart, er hat blaue Augen und ein perfekt symmetrisches Gesicht. Er könnte glatt als Fernsehfuzzi durchgehen.
Mich schauen Mädchen eher selten an, egal ob offen oder verstohlen. Meine Mutter sagt, meine Schönheit wäre unauffällig, keine Ahnung, was ich davon halten soll. Unauffällig schön, das grenzt gefährlich an voll hässlich. So schlimm ist es bei mir hoffentlich nicht, ich müsste im Mittelfeld liegen, etwas darüber, etwas darunter, das ist natürlich Geschmackssache. Klein bin ich aber auch noch, und Mädchen stehen auf große Kerle, also muss ich einen auf geistreich, humorvoll und charmant machen, das komplette Programm. Und mich intensiv mit Mädchen befassen, um herauszufinden, wie man ihnen gefällt. Eigentlich mache ich den ganzen Tag nichts anderes. Ein Junge, der gut aussieht, muss kein Frauenversteher sein, der hat das nicht nötig, dem fliegen die Mädchen wie gebratene Hühnchen in den Mund. Ich dagegen muss Experte werden. Wenn ich fertig studiert habe, bin ich Doktor der Frauenkunde. Beziehungsweise der weiblichen Psychologie, wie man’s nimmt.
Dass man unbedingt lustig sein muss, ist allerdings Quatsch. Man sieht ja, was für Spaßbremsen die süßesten Mädchen im Schlepptau haben – Humor beim Verführen, das ist wie Grand Marnier im Crêperezept: das gewisse Etwas, aber definitiv keine Grundzutat. Eins hab ich schon kapiert: Auf den Blick kommt es an. Daran erkenne ich sofort, ob ein Mädchen auf einen Jungen steht, selbst wenn sie es verheimlichen will und ihn so extra unauffällig anschaut, nur eine Hundertstelsekunde bevor sie sich wegdreht, dann sagt sie mit ihren Augen: »Ja«, »Du bist der Richtige«, »Nimm mich mit«. Das denke ich mir nicht aus, das ist sogar wissenschaftlich erwiesen, anscheinend gibt es da ein Phänomen der Pupillenweitstellung, das hat jedenfalls Monsieur Fabre erklärt, unser Physiklehrer. Wenn die Pupillen sich weit stellen, ist das kaum zu erkennen, man muss höllisch aufpassen, aber ich sehe alles. Wahrscheinlich habe ich einen sechsten Sinn. Oder einfach eine gute Beobachtungsgabe. Stimmt schon, für mich stellen sich selten Pupillen weit. Aber vielleicht versagt dann auch mein sechster Sinn, und die ersten fünf gleich mit. Oder man bemerkt solche Naturwunder gar nicht, weil man fest davon überzeugt ist, sie nicht zu verdienen. Genauso wenig wie die schönsten Mädchen. Oder es ist noch viel komplizierter, wer weiß.
Na gut, ich höre jetzt auf, meine Mutter will, dass ich Hausaufgaben mache. Bei ihr heißt es immer Hausaufgaben zuerst, und ich will sie lieber nicht ärgern, weil sie sich ziemlich schnell aufregt, und das kann übel ausgehen. Ich kann noch so oft behaupten, dass Tagebuchschreiben dazugehört, sie denkt nur an mein Hausaufgabenheft und die Liste darin, die immer länger wird. Solange ich damit nicht durch bin, lässt sie mich nicht in Ruhe. Systematisch und extensiv muss es sein. Dieses Wort habe ich vor kurzem gelernt, extensiv, und darauf hätte ich gut verzichten können.
Meine Mutter, die hat etwas Hartes und Kaltes, wie Eisen oder Beton, keine Ahnung weshalb, vielleicht wegen ihrer Jugend, sie beschwert sich manchmal drüber, da gab es offenbar nicht nur Streicheleinheiten. Die unglückliche Kindheit hätte man gleich mit der Todesstrafe abschaffen sollen. Meine Mutter kann auch sehr liebevoll sein. Und ich weiß, dass sie nur mein Bestes will. Selbst wenn sie mir oft erst Angst macht. Oder mir wehtut. Das klingt jetzt vielleicht nach einem Widerspruch, aber das Leben verläuft oft in alle Richtungen gleichzeitig, im Guten ist Schlechtes und andersherum, das ist schwer zu trennen, das habe ich kürzlich festgestellt, ein Problem, das geradewegs zur Philosophie führt. Oder ins Irrenhaus, je nachdem. Nicht, dass sie mich oft schlägt oder so, ich meine eher seelische Gewalt. Etwas Unausgesprochenes, das aber in der Luft liegt und dich bedrückt, manchmal sogar bedroht. Wenn das losbricht, ist das der reinste Horror. Und hinterher, wenn alles wieder abgeflaut ist, schaut sie mich an und erklärt mir, das wäre alles nur zu meinem Besten. Wenn ich mir wie ein Irrer den Schulstoff reinziehen soll, um Klassenbester zu bleiben, heißt es, so bekomme ich mal einen guten Job. Oder gutes Arbeitslosengeld, mal sehen. Und wenn ich zweimal die Woche ohne Ende Bahnen im Schwimmbad ziehen muss, sogar im Winter, sorgt das für einen gesunden Körper in einem gesunden Geist, keine Ahnung, wo sie diese dämliche Redewendung herhat.
Muss man sich wirklich quälen, damit es einem hinterher besser geht? Gibt es Leute, die nicht den kleinsten Regentropfen abkriegen? Und was ist mit denen, die ständig bis zum Hals im Matsch stecken, bringt ihnen dieses saumäßige Elend etwas? Und wenn ja, was? Und wie ist es eigentlich, wenn man älter wird – leidet man dann mehr, so im Durchschnitt? Oder ist die Kindheit die härteste Phase? Als Kind kann man im Normalfall nichts dagegen tun, wenn das Unwetter losgeht. Man bekommt alles ab, man steht an vorderster Front, man muss einstecken können, das ist das Gesetz des Dschungels, und das gilt auch in der Stadt. Und wenn man sich beschwert, wird es doppelt hart. Bei alten Leuten ist das bestimmt auch so, weil sie sich nicht mehr wehren können, und das wird oft ausgenutzt. Und in der Zwischenzeit ist man erwachsen, da herrscht sozusagen Windstille. Aber wenn man sich morgens in der Bahn anguckt, was die für Fressen ziehen, die Erwachsenen, so zwischen dreiundzwanzig und achtundfünfzig, kann man sich nicht vorstellen, dass das die beste Zeit des Lebens sein soll. Die Wahrscheinlichkeit strebt gegen null, wie der Statistiker sagen würde. Vielleicht gibt es einfach keine beste Zeit. Nur kleine Glücksmomente. Die man so lange wie möglich festzuhalten versucht. Wie die Sommerferien. Die sind mir am allerliebsten auf der Welt.
Manchmal hat man so viele Fragen, die einem im Kopf herumschwirren, und so was von niemanden, dem man sie stellen kann, und dann liege ich im Bett und starre an die Decke und kann nicht schlafen. Gegen vier oder fünf döse ich aber doch ein. In Sachen Schlaflosigkeit bin ich noch Anfänger. Und wenn ich morgens aufwache, sehe ich ein bisschen klarer, aber nur weil ich die Fragen vergessen habe. Jedenfalls für den Moment.
Freitag, 16. März
Heute Abend kommt mein Vater nach Hause, weil Wochenende ist. Unter der Woche arbeitet er in Paris, und es ist zu weit, um jeden Abend heimzufahren, also nach Montargis. Trotzdem tun sich viele diese Gurkerei tagtäglich an, mit den ganzen Staus und Bahnstreiks, und dann geht dieser Tarifkonflikt wieder los, und im Fernsehen ist nur noch davon die Rede. Aber mein Vater arbeitet oft bis spät in die Nacht, wie die Leute im Showbusiness. Er würde dann erst kommen, wenn meine Mutter und ich schon längst im Bett wären, und könnte sich nur noch mutterseelenallein zwei Eier in die Pfanne hauen und die Spätnachrichten gucken, und das ist keine gute Idee, vor allem, wenn man leicht Albträume kriegt.
Mein Vater hat einen komischen Beruf, eher von der peinlichen Sorte, er ist Vertreter. Ja, ich weiß, das klingt mies. Er ist Klinkenputzer. Er besucht die Leute zuhause und verkauft ihnen Panzertüren, Alarmanlagen und Sicherheitssysteme. Und weil heutzutage alle völlig paranoid sind, ist sein Geschäft eine Goldgrube. Durch die Krise »wird sich das noch erhärten«, wie mein Vater gern sagt. Ich frage mich, ob es auch Zeiten gibt, in denen das erschlafft, und wenn ja, was genau. Mein Vater sieht schon kommen, dass es seinen Job nicht mehr lange gibt, weil die Leute keinen mehr reinlassen. Überall werden Türcodes und Gegensprechanlagen eingerichtet, überall Riegel vorgeschoben. Streng genommen darf er sich nicht beschweren, denn mit seiner Sicherheitsproduktpalette unterstützt er ja den Fimmel, sich bis ins Allerletzte zu verbarrikadieren. Es ist, als würde man den Strick verkaufen, mit dem man sich erhängt. Das ist Kamikaze, aber das stört ihn anscheinend nicht weiter. Die ganze Welt ist Kamikaze, das ist Trend, man nehme nur Drogenhandel, Abholzung, Überbevölkerung, Doping im Leistungssport, das zu Bauchspeicheldrüsenkrebs führt, und Pestizide im Brokkoli. Das ist jetzt ein ziemliches Durcheinander und ich habe bestimmt etwas vergessen, aber es ist ja klar, was ich meine. Und vielleicht ist es auch heldenhaft, in vollem Tempo auf die Wand zuzurasen. Letztes Jahr habe ich einen Film gesehen, da kamen Samurais vor, so eine Art japanische Ritter, die Selbstmord begehen, wenn sie ihre Ehre verlieren. Die Menschheit muss irgendwie entehrt sein, das würde alles erklären.
Eins ist jedenfalls klar, Typen, die wie mein Vater Klinken putzen, sind Helden. Helden ohne Superkräfte, total verkannt und vor allem ziemlich schlecht angesehen. Wenn wir zu Beginn des Schuljahrs den Beruf unserer Eltern auf die Auskunftsbögen schreiben müssen, ist mir das V-Wort jedes Mal peinlich. Die reinste Demütigung. Ich passe immer auf, dass meine Nachbarn nicht mitlesen können. Vor meinem inneren Auge sehe ich, wie der Lehrer sich einen Schnurrbartträger mit altmodischer Krawatte vorstellt, sympathisch, aber nicht gerade clever, der an jeder Tür klingelt und dann augenrollend abgewimmelt wird. So was von uncool. Ich würde gern »Arzt« auf das Blatt schreiben, »Anwalt« oder »Französischlehrer«, einen echten Beruf, würdevoll und ehrenhaft, nicht so einen Abzocker-Job, so einen Schmarotzer, der dir irgendeinen Schrott andreht. Dabei leben wir von diesem Schrott, ich auch. Und laut meinem Vater ist der Direktverkauf an den Endkunden ja die krasseste Herausforderung überhaupt. Man landet ungefragt bei Leuten, die nichts brauchen, und am Ende haben sie einen Riesenscheck unterschrieben, für ein Produkt, das sie nie kaufen wollten. Und wenn du es gut eingefädelt hast, sind sie auch noch zufrieden. Das Geheimnis ist: Ein Verkäufer verkauft nicht. Jedenfalls darf es nicht so wirken. Er interessiert sich für die Menschen. Er redet mit ihnen. Er wird ihr Freund. Und dann macht er ihnen ein einmaliges Angebot. Das ist eine Kunst. Nur ist die nicht gerade hoch angesehen, anders als Dichtkunst, Musik, Schauspielerei. Dafür gibt es keinen Adelsbrief und wird es nie einen geben. Weil dieser Beruf vorher ausstirbt.
Mein Vater bekommt nur Provision. In den Wochen, in denen er wenig verkauft, ist er nicht ganz so gut gelaunt. Er sagt zwar nichts, aber ich merke es sofort, er lacht weniger. Er tut so, als wäre alles in Ordnung – das nehme ich ihm aber nicht ab. Er sagt, dass man in manchen Wochen viel verkauft und in anderen eben nicht, auf keinen Fall darf man sich verunsichern lassen, man muss unermüdlich weiter klingeln, weiter lächeln, weiter verführen, sich das Gezeter der Leute anhören und ihnen das Gefühl geben, sie seien wichtig und intelligent, selbst wenn sie den blödesten Quatsch erzählen. Und man muss es wirklich ernst meinen, sonst funktioniert es nicht. Keine Ahnung, wie er das schafft, wahrscheinlich ist er so eine Art Sophist. Wie diese Griechen, von denen Monsieur Merlet so gern redet, eigentlich soll er Französisch unterrichten, aber er macht immer Philosophie – er hat seinen Beruf verfehlt, nur knapp, das muss man ihm lassen. Mein Vater kann einen Standpunkt vertreten und anschließend das genaue Gegenteil, das stört ihn null, was ihn interessiert, ist der Austausch, die Dialektik, man solle sich nicht zu sehr an einer Meinung festbeißen, eine sei so gut wie die andere, jedenfalls sagt er das so, und das ist die Grundlage, um mit wem auch immer einig zu werden, die Grundlage für einen gelungenen Verkauf. Sein Leitspruch lautet: »Überall Leute, die im Nebel stochern und behaupten, die Welt sei grau.« Was beweist, dass Vertreter und Philosoph quasi dasselbe ist. Aber das darf man keinem Philosophen erzählen. Und erst recht keinem Vertreter. Dabei sind die Leute heutzutage alle Vertreter, das würden sie nie eingestehen, aber wenn man ihnen nicht abkauft, was sie einem andrehen wollen, sind sie traurig und enttäuscht. Man braucht nur den Fernseher anzuschalten, um das zu kapieren. Mein Vater tut wenigstens nicht so, als wäre er etwas Besseres. Auch wenn mir das meistens ganz lieb wäre. Aber da ist sie wieder, diese Widersprüchlichkeit in der Welt, von der ich schon gesprochen habe.
Jedenfalls erkenne ich sofort, was er beim Nachhausekommen für eine Laune hat. Man weiß nie, auf welchem Fuß man ihn erwischt, mal ist er richtig lieb, mal tobt er vor Wut. Mein Vater redet laut, lacht laut, brüllt laut, und wenn er zuschlägt, knallt’s. Er ist insgesamt ein lauter Typ. Und ein bisschen gefährlich. Was ihn aber von allen anderen Vätern unterscheidet und mich manchmal mit ihm versöhnt, sind einzelne Momente. Wenn wir im Auto an der Ampel stehen, macht er das Lenkrad zur Trommel und stimmt afrikanische Gesänge an, keine Ahnung, wo er die herhat, er muss sie auf Radio Antilles gehört haben, mitten in der Nacht, auf der Heimfahrt von einem Kunden (übrigens ist mein Vater null rassistisch, bitte nicht falsch verstehen, ist nicht als Angeberei gemeint). Er singt aus vollem Hals, bis uns die Ohren wegfliegen, aber mit so einem breiten Grinsen, dass er sogar den weltgrößten Miesepeter aufheitern würde. Beim Tanzen genauso. Ich brauche sonntags nur eine CD einzulegen, diese bescheuerten Chansons, die meine Eltern so lieben und die einem unter die Haut gehen, ohne dass man genau weiß warum – lieber würde man sich von Bach oder Mozart rühren lassen, stattdessen wird man von Michel Sardou oder Alain Souchon zum Heulen gebracht, oder fast –, ich muss nur so ein Lied abspielen, schon rennt mein Vater zu meiner Mutter und fordert sie mitten im Wohnzimmer zum Tanz auf – als wir noch ein Wohnzimmer hatten. Meine Mutter ziert sich, sie sagt so was wie »Ach Bernard« oder »Ich muss mich ums Essen kümmern«, aber er legt sich so richtig ins Zeug, und dann gibt sie doch nach. Das mögen die Frauen anscheinend, dass man sich so richtig ins Zeug legt.
Und dann tanzen sie, ganz langsam, Wange an Wange, mit mir als einzigem Zuschauer, peinlich berührt, aber irgendwie auch froh über diese Annäherung. Keine Ahnung, ob sie sich wirklich lieben, ob sie je ineinander verliebt waren, so ganz klar ist mir das nicht. Ich sehe ja, dass irgendeine Kraft sie zusammenhält, ein Elektromagnet mit ultrastarker Anziehung, und ich glaube, sie werden sich niemals trennen. Aber Liebe, zum Beispiel wie ich sie für Pauline empfinde, sieht anders aus. Wenn zwei Menschen sich lieben, ist es vielleicht wie beim Wein: Es gibt einen langen Reifeprozess, und man weiß erst am Ende, ob dabei Essig herauskommt oder ein besonders edler Tropfen. Und bei meinen Eltern ist anscheinend nie klar, worauf es hinausläuft.
Dienstag, 20. März
Im Freizeitraum steht ein Fernseher. Heute lief Tennis, mega, mein Lieblingssport. Und dann war es wie Weihnachten, nur dass ich Weihnachten hasse, sagen wir mal so, es war, als hätten die Götter meine Gebete erhört: Pauline kam rein und setzte sich zwei Stühle weiter, um sich das Match anzuschauen. Unfassbar. Aber so war’s. So ist das Leben: Wenn alles verloren scheint, lässt es auf einem Misthaufen Rosen blühen – noch so eine Theorie meines Vaters. Pauline ist erschienen, als hätte ich aus der Tiefe meines Inneren nach ihr gerufen und sie den Ruf endlich vernommen. Außerdem war sie vom Match ziemlich gebannt. Wenn man sich zu jemandem hingezogen fühlt, weiß man nie, wie man ein Gespräch anbahnen soll, man legt sich tausend Sätze zurecht, aber keiner passt, das ist wie mit dem Outfit für eine Party, auf der auch Mädchen eingeladen sind: nie kann ich mich entscheiden, dabei habe ich nicht mal tausend Outfits, höchstens zwei. Ich probiere eins an, betrachte mich im Spiegel und finde mich blass und unförmig, die Beine zu kurz, den Kopf zu groß, im Ernst, als stünde ich nicht vor dem Schrankspiegel, sondern vor einem dieser Zerrdinger auf dem Jahrmarkt. Echt deprimierend.
Aber jetzt konnte ich mit Pauline ganz selbstverständlich über Tennis reden, Vorhand, Rückhand, es hat einfach so angefangen. Ihr gefielen die schwedischen Spieler, sagte sie. Das war ein Schlag in die Magengrube, ich sehe nämlich kein bisschen schwedisch aus, aber ich bin ganz cool geblieben, eben wie die Schweden, die sich nie aus der Ruhe bringen lassen. Pauline war nett, lustig, sie konnte sich super ausdrücken, treffsicher, klar, wie ein gut gestimmtes Klavier. Sie sagte, dass der Schwede den zweiten Aufschlag nie hoch genug spielte und dass seine einhändige Rückhand ihn bei den schulterhohen Schlägen behinderte. Eine richtige Expertin. Ich war hin und weg. Als sie mir erklärte, dass der Amerikaner mehr ans Netz gehen und dabei in der Feldmitte mit der Rückhand einen Slice schlagen müsste, um keine Ecke freizugeben und die Passierbälle des Gegners zu verhindern, bin ich ihr völlig verfallen. Wobei, verfallen war ich ihr schon seit der Geschichte mit dem Tischtennisball. Ich bin ihr also rückverfallen. In diesem Moment wurde mir schlagartig klar, dass ich ihr bei jedem Wiedersehen erneut rückverfallen und in der Zwischenzeit nur auf die nächste Begegnung warten würde. Das wäre also mein Leben, und das Schlimmste, oder vielleicht das Beste daran war: Es gefiel mir, ich freute mich wie ein Schneekönig.
Dann schauten wir das Match weiter, jedenfalls den ersten Satz, der mit einem Tie-Break endete. Ich betete, dass es möglichst lange dauern würde. Schließlich fragte sie mich nach meiner Klasse, meinen Lehrern, fast schon persönliche Fragen, sie interessierte sich für mich, ehrlich. Auch wenn ich bei ihren Pupillen keinerlei Weitstellung beobachten konnte. Das ist der einzige Haken, zugegeben, so viel Ehrlichkeit muss sein. Dafür hat sie drei Mal gelächelt, von einem Ohr bis zum anderen, vor allem bei der Story über unsere Mathelehrerin, wir hatten nämlich festgestellt, dass wir dieselbe haben. Auf den zweiten Blick sieht diese Lehrerin richtig gut aus, zunächst war mir das nicht aufgefallen, weil sie für mich eigentlich zu alt ist, so um die 40 oder 50, aber mit Stil, so eine kühle Schönheit. Einmal trug sie eine schicke beige Flanellhose mit einem ziemlich langen Reißverschluss, der die ganze Unterrichtsstunde offen stand. Man konnte ihre Spitzenunterwäsche sehen, und sogar noch darunter, ein Transparenzeffekt, wie unser Kunstlehrer sagen würde. Kein Wunder, dass ich nicht mehr weiß, was sie uns an diesem Tag beigebracht hat, ob Funktionsgraphen oder Kurvendiskussion. Ich hatte andere Kurven im Kopf, ist ja klar.
Über diese Geschichte hat Pauline Tränen gelacht, damit konnte ich wohl punkten. Das hat mir echt gutgetan, weil sie richtig laut lacht, ich liebe das. Ich lache auch richtig laut. Nicht so laut wie mein Vater und mein Bruder, aber trotzdem sehr laut, das ist anscheinend erblich. Und plötzlich kam es mir so vor, als wäre sie eine von uns. Aber auch bildschön. Wenn man sich anguckt, wo ich herkomme, müsste sich das eigentlich ausschließen. Meine Familie hat nicht gerade Model-Charakter, aber darauf komme ich später zurück. Jedenfalls war das eben der beste Nachmittag meines Lebens, nur dass sie irgendwann losmusste und ich nicht wusste, ob wir je wieder miteinander reden würden. Ich schmiedete also alle möglichen Pläne, um ein Wiedersehen herbeizuführen, ich suchte nach einem Vorwand, ich könnte ihr zum Beispiel ein Buch ausleihen, dann müsste sie es mir zurückgeben, aber ich hatte nur das Biobuch in meinem Rucksack, nicht unbedingt der beste Köder. Ich überlegte fieberhaft, ob ich sie ins Kino oder zu Boris einladen sollte, in die Cafeteria unserer Schule, aber für ein erstes Treffen war das alles zu überstürzt. Also habe ich einfach weiter ferngesehen. Ihr Abgang rückte immer näher, das hatte ich im Gefühl, der Schwede hatte das Break für sich entschieden, er führte also schon mit einem Satz, und der zweite war laut Kommentator nur noch Formsache. So hält man die Zuschauer nicht bei der Stange. Und erst recht nicht die Frau meines Lebens.
Sie nahm ihre Jacke und sagte, sie heiße Pauline und es sei cool gewesen, sich mit mir zu unterhalten. Natürlich wäre ein Kuss auf die Wange zum Abschied echt super gewesen, aber irgendwie auch merkwürdig. Sie stand auf und rief mir im Gehen zu: »Bis bald«, trotzdem fühlte ich mich auf Anhieb einsam und verlassen. Ich dachte an diese Fernsehreportagen über Hunde, die am Anfang der Sommerferien auf Autobahnraststätten ausgesetzt werden, und an alte Leute, die im August bei Gluthitze allein zuhause herumsitzen, ich dachte an eine Doku über Waisenhäuser in Bulgarien, an Robinson Crusoe auf seiner Insel, na ja, jedenfalls hatte ich einen heftigen Durchhänger, als sie weg war.
Mittwoch, 21. März
Heute Morgen bin ich Pauline auf dem Schulflur begegnet, sie hat mir zugelächelt, nur von weitem, aber mir wurde sofort ganz heiß ums Herz, ich kann das kaum beschreiben, eine Welle aus Freude, die auf dich zukommt, dich mitreißt und glückselig zurücklässt. Sozusagen eine Antwort auf alles. Wahrscheinlich ist Liebe genau das: die Antwort auf alles. Das hatte ich schon mal irgendwo gelesen oder bei einem Pfarrer in der Christmette aufgeschnappt – in meiner Familie ist man nur am 24.12. gläubig, dann haben wir zwischen Hauptgang und Nachtisch was zu tun, sozusagen einen Verdauungsgottesdienst –, aber jetzt habe ich es das erste Mal selbst gespürt, mit Haut und Haar. Das ist der Unterschied zwischen dem, was man glaubt, und dem, was man erlebt. Bei der Liebe, und bei Gott vielleicht auch, da geht es um Erfahrung, nicht um Vorstellungskraft, Ahnung oder einen Hoffnungsschimmer nach dem Lesen des Horoskops. Mir kommt es immer vor, als wollte man uns den Glauben an Gott beibringen wie einem Tauben den Glauben an Mozart.
Wenn ich die French Open gewinnen würde, wäre ich garantiert nicht glücklicher, als wenn Pauline lächelt. Und sofort habe ich mich gefragt, was sie wohl für mich empfindet. Findet sie mich einfach nur sympathisch, oder vielleicht auch ein bisschen attraktiv? Vielleicht findet sie mich auch nur witzig. Kommt es vor, dass man jemandem gefällt, der einem auch selbst gefällt? Mir ist das noch nie passiert. Pauline ist keine Magazintraumfrau, sie ist nicht überirdisch schön, im Gegenteil, sie ist irdisch schön. Weil sie echt ist. Weil sie atmet, weil ihr Herz schlägt. Weil sie zittert, wenn ihr kalt ist. Weil ihre Augen so hell strahlen. Ich würde ihr eine glatte Eins geben. Aber sie? Kann sein, dass ich in ihren Augen eher eine Vier oder Drei bin. Mist. Vielleicht benotet sie auch richtig hart. Am Ende ist es eine Fünf.
Ich habe mein Rad aus der Fahrradgarage geholt und bin nach Hause gefahren, im Kopf schwirrten mir all diese Gedanken herum. Ich bin erst über den Radweg und dann rein in den Wald. Jeden Tag durchquere ich ihn ein Stück, weil meine Schule am Waldrand liegt. Oft fahre ich so schnell ich kann, ich trete mit Karacho in die Pedale, wie im Geschwindigkeitsrausch. Ich kenne jeden Stein auf dem Pfad, jede Wurzel, alle Gräben und Abhänge, ich weiß genau, wann man nach rechts ziehen muss, wann man am besten aus dem Sattel geht, Gas gibt und langsamer wird. Im Herbst liegt alles voller Laub, das oft feucht und glitschig ist, da ist es besser, man lässt das mit dem Bremsen ganz. Heute war ich langsam unterwegs, ich hatte es nicht eilig, ich war voller Hoffnung. Der Winter ging zu Ende, die Natur bereitete noch reglos, in Stille und Kälte, dem Frühling den Weg. Ich hörte das Rollen meines Fahrrads, ein leises Quietschen, das Krähen eines Raben, der aus dem Wipfel einer mächtigen Eiche stob.
Als ich zuhause ankam, wartete meine Mutter auf mich. Sie hatte mir Getreidekaffee gemacht und Brote, das ist mein Nachmittagssnack nach der Schule, mit vier Stückchen Schokolade – nie mehr als eine Rippe – oder mit Marmelade, das kommt auf den Tag an. Meine Mutter liebt Schokolade, deshalb isst sie sie manchmal auf, und dann bleibt nur die Marmelade. Wenn ich mich beschwere, kontert sie, dass sie es früher längst nicht so gut gehabt hätte, und beschreibt lang und breit ihre Kindheit, nicht ganz so schlimm wie bei Cosette aus Les Misérables, aber auch nicht gerade das Luxusprogramm, ohne Kühlschrank, mit einem kranken Eisenbahner zum Vater, einen neuen Mantel gab’s höchstens alle drei Jahre, nicht so wie heute, wo selbst arme Leute Nikes tragen, die ein Vermögen kosten, wie sie meint. Und: Ich biete dir ein viel besseres Leben, als ich es damals hatte, du solltest dankbar sein. Was soll man gegen so ein Totschlagargument noch sagen?
Als ich nach dem Snack mit meinen Hausaufgaben anfangen wollte, zog meine Mutter eine Schachtel mit dem Foto einer Blondine aus dem Schrank, eine Verpackung, die ich sogar im Schlaf erkennen würde, und erklärte, jetzt sei es Zeit zum Nachbleichen, weil man schon meinen Ansatz sehe. Einmal im Monat blondiert meine Mutter mir die Haare. Seit ich sieben bin, geht das so. Mehr als die Hälfte meines Lebens. Am Anfang hatte ich nichts dagegen, es war wie Fingernägel schneiden. Irgendwann wollte ich wissen, warum sie das tut. So uneinig meine Eltern sich meistens sind, hier herrscht Burgfrieden: So gefalle ich ihnen besser. Von Blondieren wollen sie gar nicht reden, man würde mich doch nur ein bisschen aufhellen. Ich selbst habe keine Ahnung, ob mir helle Haare besser stehen. Ich würde mich auch nie trauen, jemanden zu fragen, so peinlich ist mir das, und so lasse ich mir einmal im Monat die Haare bleichen. Auch wenn ich es nicht mag. Vor allem habe ich Schiss, dass es jemandem auffällt, wenn ich am Tag danach in die Schule komme. Als ich noch in der Grundschule war, wurden mir die Haare einmal in der Mittagspause blondiert, und nachmittags hatte ich dann wieder Unterricht. Da rief ein Mädchen: »Bist jetzt blond, Émile!«, und hat es ständig wiederholt, »Bist jetzt blond! Bist jetzt blond!«. Ich wäre am liebsten im Boden versunken.
Jahre später hat meine Mutter mir angeboten, damit aufzuhören: »Wenn du nicht mehr willst, lassen wir es eben sein, aber schade wäre es schon.« Ich habe hin und her überlegt. Und dann gesagt, dass wir ruhig weitermachen können. Ich wäre zwar lieber von Natur aus schön, aber das ist anscheinend nur wenigen Auserwählten vergönnt, und die anderen müssen ihre Schokoladenseite betonen. Da musste ich plötzlich an Pauline denken, ich hatte zwar keine große Lust, dass meine Mutter mir die Farbe auffrischte, aber vielleicht würde ich Pauline so besser gefallen. Ich war quasi ein unbeschriebenes Blatt, das in zwei Stücke gerissen wird. Meine Mutter hat mein Schwanken ausgenutzt – manchmal ist mein ganzes Leben ein einziges Hin- und Herschwanken. Außer wenn ich urplötzlich absaufe. Das kommt vor, so wie Regentage, sogar noch öfter als die, ich muss ohne jede Vorwarnung einstecken – mal eine Ohrfeige, mal einen Arschtritt, dann wieder eine öffentliche Demütigung, von wegen: wenn du deine Badeshorts nicht dabeihast, musst du eben in Unterhose schwimmen; diese ultrafiesen Bestrafungen, die sofort vollstreckt werden und einen fertigmachen. Es ist Land unter, das Wasser steht einem bis zum Hals, man sinkt ab und hat das Gefühl, noch tiefer sinken zu können.
Meine Mutter hat mir einen Stuhl hingeschoben, ein großes, sauberes Handtuch über meine Schultern gelegt und es im Nacken unter mein T-Shirt geklemmt, damit alles mehr oder weniger dicht bleibt. Sie hat das Zeug aus dem kleinen Fläschchen mit dem Zeug aus dem großen vermischt und kräftig geschüttelt, dann die durchsichtigen Plastikhandschuhe übergezogen und angefangen, das Zaubermittel aufzutragen. Sie massiert mir dabei immer die Kopfhaut, das ist das Gute daran, megaschön, das entspannt mich. Außerdem ist es unser Moment, und so was haben wir nicht oft. Nur sie und ich. Wenn das Fläschchen dann leer ist, oder fast, je nach Bedarf, guckt meine Mutter auf die Uhr und wir warten, ohne einen Finger zu rühren. Und ohne einen Mucks zu sagen. Das Zeug braucht Zeit zum Einwirken, und wenn man sich bewegt, verkleckert man es überall, man muss also völlig still halten, wie bei »Ochs am Berg«, diesem Spiel von früher.
Je länger die Einwirkzeit, umso heller die Haare, es kommt auf die Dosierung an. Einmal hatten wir nicht lange genug gewartet, und meine Mutter meinte, das hätten wir uns auch sparen können. Würden wir hingegen zu lange warten, wäre ich blond wie Stroh, das würde jedem auffallen, der reinste Horror. Ich bestehe also immer darauf, die Sache ein bisschen abzukürzen, man muss sich auch mal durchsetzen. Dann spült meine Mutter das Zeug mit warmem Wasser raus, das riecht etwas komisch, man muss gut lüften. Am Ende fönt sie mir die Haare, und wir begutachten das Ergebnis. Das ist der Moment der Wahrheit. Panisch nähere ich mich dem Spiegel, jedes Mal das Gleiche, ich habe eine Heidenangst, darin ein Monster zu entdecken. Oder einen goldblonden Schnulzensänger à la Claude François. Diesmal war es einigermaßen gutgegangen, jedenfalls keine Katastrophe. So eine Art aschblond.
Wenn ich mich manchmal bei meinem Vater beschwere, weil mir das Ganze so künstlich vorkommt, beteuert er, die helle Farbe wirke im Gegenteil ganz natürlich, wegen meiner hellen Haut. Außerdem sei er als Kind auch ein richtiger Blondschopf gewesen, man würde der Natur also nur ein wenig nachhelfen. Als wäre meine DNA unterwegs verloren gegangen und nur eine kleine Korrektur nötig, um meinem genetischen Erbe wieder zu seiner vollen Strahlkraft zu verhelfen. Mein Vater schwingt gern große Reden, er legt einfach los, manchmal weiß er gar nicht, was er sagen will, aber das macht ihm keine Angst, er stürzt sich da unerschrocken rein und fällt immer wieder auf die Füße, mehr oder weniger. Wahrscheinlich eine Berufskrankheit. Als Reaktion mische ich alle Argumente, das Für und das Wider, das Naheliegende und das rein Spekulative, das Gewisse und





























