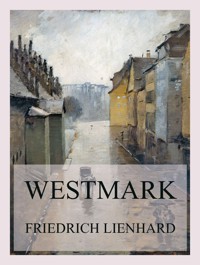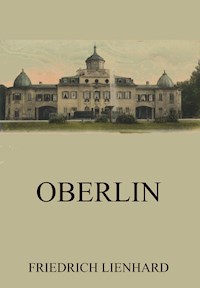1,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 1,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 1,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Booksell-Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
In "Der Spielmann: Roman aus der Gegenwart" entwirft Friedrich Lienhard ein eindringliches Porträt einer von Wandel und Unsicherheit geprägten Gesellschaft. Durch die Augen des Protagonisten, eines begabten Spielmanns, wird der Leser in eine Welt eingeführt, die sowohl von individueller als auch kollektiver Suche nach Identität geprägt ist. Der literarische Stil Lienhards verbindet poetische Sprachbilder mit einer klaren, erdenden Prosa, die eigene Reflexion und zeitgenössische soziale Themen kunstvoll einfängt und im Kontext der modernen Literatur einen bedeutenden Beitrag leistet. Friedrich Lienhard, ein ausgewiesener Kenner der kulturellen und sozialen Strömungen seiner Zeit, versteht es, komplexe menschliche Beziehungen und die Herausforderung der gesellschaftlichen Integration authentisch darzustellen. Geprägt von seinen Erfahrungen als Schriftsteller und Beobachter der Gegenwart, nutzt er seine Werke, um Fragen der Identität und Zugehörigkeit zu erforschen, wobei er häufig seinen eigenen Lebensweg als Inspiration heranzieht. Dieses Buch ist eine fesselnde Lektüre für alle, die an der Schnittstelle von Kunst und Gesellschaft interessiert sind. Lienhards meisterhafte Erzählung fordert den Leser heraus, über die eigene Rolle in einer sich ständig verändernden Welt nachzudenken und legt einen bleibenden Eindruck von der Komplexität menschlicher Erfahrungen. In dieser bereicherten Ausgabe haben wir mit großer Sorgfalt zusätzlichen Mehrwert für Ihr Leseerlebnis geschaffen: - Sorgfältig ausgewählte unvergessliche Zitate heben Momente literarischer Brillanz hervor. - Interaktive Fußnoten erklären ungewöhnliche Referenzen, historische Anspielungen und veraltete Ausdrücke für eine mühelose, besser informierte Lektüre.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Der Spielmann: Roman aus der Gegenwart
Inhaltsverzeichnis
Erster TeilIngos Irrfahrt
Erstes KapitelDer Wanderer
„Sehne dich und wandre!”
Heinrich von Stein
A uf einem hellgrünen Riviera-Hügel, zwischen feierlicher Zypresse und lustigem Kirschbaum, der mit halbreifen Früchten betupft war, saßen zwei liebliche junge Mädchen.
Es war Verwandtschaft in ihren rosigen Gesichtern und in ihrer geschmackvoll einfachen Kleidung mit dem weißen Matrosenkragen, aus dem dort und hier auf länglichem Halse ein dunkelbraunes Köpfchen wuchs.
Die Ältere, auf einem Feldstuhl sitzend und über eine Stickerei gebeugt, war von ganz besonders bestrickender Schönheit. Wenn sie die enzianblauen Augen unter schweren Wimpern langsam aufschlug, ging ein Leuchten über die Umgebung. Alle Dinge wurden in dieser Beleuchtung schöner, alle Menschen gütiger. Es waren große, schüchterne, vielleicht nicht sehr kluge Augen, vom weiten Bogen der bräunlichen Brauen madonnenhaft umrahmt. Das Mädchen war hoch und schlank. Und schön waren auch die Nüstern des feinen Näschens, die bei gedämpftem Lachen mitzulächeln schienen; schön das sanft gerundete Kinn; schön der schmale und doch volle, kirschrote, meist ein wenig geöffnete Mund. Sie glich in ihrer gesunden und natürlichen Jungfräulichkeit den Madonnen Raffaels und mochte Maler und Dichter entzücken. Denn ein Künstler spürte in diesem Mädchen zwar weder Gelehrsamkeit noch gesellschaftliche Gewandtheit, wohl aber das Lebensgeheimnis einer starken und sittsamen Weiblichkeit, gesunde Kinder zu schaffen fähig, keine Bücher.
Unfern von den jungen Damen lag eine kannelierte Marmorsäule zwischen zerstreuten Blöcken. Vermutlich hatte man dort bauen wollen; aber der Baumeister hatte sich in die entzückende Landschaft verliebt und das Bauen vergessen. Angesichts des blauen Meeres, zwischen Zypressen und Oliven, hätte sich ein weißer Tempel wirksam ausgenommen, der Sonne geweiht, der Schönheit heilig. Jedoch der Tempel war noch unsichtbar, der Sonnenanbeter desgleichen; und dem Baumeister drohte abermals Gefahr des Verliebens durch diese beiden ungewöhnlich schönen Mädchen.
Sie plauderten französisch. Aus ihrem Gespräch ging hervor, daß die Mutter der Älteren ihren Nachmittagsschlaf auszudehnen pflegte, so daß die beiden Schönheiten abseits von der gemieteten Villa auf diesem Aussichtsplatz verweilen konnten.
Der jüngere Backfisch lag ausgestreckt im weichen Grase, stützte die braunen Wangen in die Hände und las. Mädchenhüte flimmerten strohgelb aus grünem Rasen. Und es war anmutige Stille um die beiden Gestalten; selbst der Mittagswind spielte nur lässig in Gras und Laub. Von Zeit zu Zeit sprang die Kleine auf, griff in das Blätterwerk empor und suchte sich frühreife Kirschen heraus; oft auch hob sie lachend ihr spitzes Mäulchen an den freundlich herabgeneigten Baum und naschte die Früchte gleich vom Ast weg. Dann hängte sie sich ein Kirschenpaar über jede Ohrmuschel, kaute, spuckte Kerne an die Marmorsäule und las vergnüglich weiter.
Aus der Ferne funkelte in gleichmäßiger Ruhe das tiefblaue Mittelmeer.
Häufig lachte die Lesende hell hinaus und strampelte vor Vergnügen mit den gelben Schuhen.
„Sag' doch, Martha, kann es etwas Lustigeres geben als diese verrückten Briefe Mozarts?” rief sie. „Hör' einmal zu!”
Und sie las in geläufigem Deutsch flink herunter: „Allerliebstes Bäsle, Häsle! Ich habe dero mir so wertes Schreiben richtig erhalten — falten — und daraus ersehen — drehen — daß der Herr Vetter — Retter — und die Frau Bas — Has — und Sie — wie recht wohl auf sind — Rind; wir sind auch Gott sei Dank recht gesund — Hund” — — sie brach lachend ab.
„So geht's nun immerzu weiter!” fuhr sie französisch fort. „Jedem dritten Wort hängt er irgendeinen albernen Reim an, der gar keinen Sinn hat, nur aus Necklust. Oh, ich liebe Mozart schrecklich! Die Leute von damals waren lustiger, leichter, eleganter und amüsanter — verstehst du das, Martha? Sie schlugen Purzelbaum, sie tanzten Menuett, sie liebten, küßten sich und waren doch nicht gemein, denn sie hatten mehr Poesie im Leibe! Verstehst du das, Martha?”
Martha lächelte, stickte und schwieg.
„Mais allons donc!” zürnte die kleine Elsässerin. „Do sitzt se un sagt nix!”
Sie sprang auf, hob das spitze Näschen in die Luft und witterte die blühenden Riviera-Hügel hinunter, wo auf allen Hängen zwischen weißen Landhäusern steile, dunkle Zypressen, silbergraue Olivenbäume und spitzblättrige Gartenpalmen die Landschaft festlich stimmten. Ihre Augen leuchteten die Gegend ab.
Und plötzlich klatschte sie in die Hände.
„Da kommt er wieder!”
„Wahrhaftig!” bestätigte die stille Base Martha, ward ein wenig lebendiger und sandte ihre tiefblauen Augenstrahlen gleichfalls den Abhang hinunter. „Was tut er denn?”
„Er spielt auf einer Laute und summt vor sich hin! Hab' ich dir's nicht gleich gesagt? Das ist ein deutscher Musiker!”
„Er spricht übrigens auch gut Französisch. Und warum kann es nicht auch ein Maler sein? Er hatte ja neulich einen Malkasten mit!”
„Oder ein Dichter! Denn er hat uns ja ein Verschen gedichtet!”
„Oder ein reicher Privatmann, der alles treibt und nichts.”
„Möglich, denn Geld hat er gewiß! Und dabei so die Geste des Weltmannes! Und grundgelehrt! Er interessiert mich schrecklich. Aber ich bin gewiß, daß er deinetwegen kommt. Und dabei sitzt sie immer da wie ein Stockfisch! Ich kann die Unterhaltung im Gang halten — und in dich verlieben sie sich! Alle! Auch wenn du kein Wort sagst! Zu dumm! Ich hab's schrecklich schwer auf der Welt.”
Sie seufzte, klappte Mozarts Briefe heftig wieder auf und setzte sich mit sehr melancholischer Miene und schwermütig gestütztem Haupt neben das lächelnde, stickende und schweigende Bäschen. Aber es zuckte um ihre Mundwinkel; ihre Blicke schielten vom Buch hinweg nach dem Ankömmling, und mit einem Rippenstoß an Cousine Martha flüsterte sie, daß sie vor Lachen berste.
Der ankommende Herr war ein schmucker, mittelgroßer Mann von etwa dreißig Jahren. Er trug einen feinen Flanellanzug und einen Panamahut über kurzem dunkelblonden Haar.
Schon von fern schwang er den Hut und die bänderumflatterte Laute und rief in deutscher Sprache:
„Das ist ja ausgezeichnet, daß ich Sie wieder treffe! Bravissimo! Die Freundin Mozarts und die große Schweigerin! Kirschbaum und Zypresse! Guten Tag!”
Und trat heran, verbeugte sich und fuhr fort:
„Der Tempel ist noch unerbaut, aber die Priesterinnen warten. Seien Sie gegrüßt, allerholdeste Hüterinnen dieses heiligen Hains!”
Die beiden jungfräulichen Wesen nickten gemessen und kämpften mit dem Lachen; er aber nahm ohne Verzug auf der Säule Platz.
„Verzeihen Sie, meine Damen,” sprach er, „daß ich auch heute so unsalonmäßig bin, mich nicht in konventionellen Formen vorzustellen. Nehmen Sie an, ich sei irgendein Wanderer, der — nun, der seine Bestimmung sucht. Nehmen Sie an, ich sei ein Spielmann, ein Troubadour — mein Vorname ist übrigens Ingo, und das genügt —, und nehmen Sie an, Sie seien die zwei anmutigsten Schloßherrinnen der ganzen anmutigen Provence!”
„Sehr liebenswürdig!” lachte die Kleine. Die Sachlage war fremdartig, aber den Mädchen nicht mißfällig. Die Ältere richtete ihr großes Augenpaar schüchtern und fragend auf die Jüngere; und diese zappelte vor Vergnügen, im Lustspiel mitzutun.
„Sie haben recht,” sagte der Zappelkäfer, „es ist heutzutage viel weniger Poesie in der Welt als in den Zeiten Mozarts. Hab' ich das nicht eben gesagt, Martha?”
„Aha! Darum tragen Sie also beide diese zierlichen braunen Mozart-Zöpfe, nicht wahr?”
„Eben! Meine Cousine wollte nicht, aber sie muß!”
Martha lächelte und stickte; schaute dann die Base an, nicht den Fremden, und sprach mit ihrer leisen Stimme, um nur auch etwas zu sagen:
„Sie hat mir lustige Stellen aus Mozarts Briefen vorgelesen.”
„Wollen Sie's hören?” setzte sofort das Backfischchen ein. Und sie plapperte einiges herunter, bis sie vor Lachen aufhören mußte. Dann wurde sie gesetzter und bemerkte, es seien auch recht schmerzliche Briefe in dieser Sammlung, etwa über den Tod der Mutter oder jene unglaubliche Behandlung beim Erzbischof von Salzburg.
„Schändlich so etwas! Ganz abscheulich! Finden Sie nicht auch?”
„Niederträchtig!” bekräftigte der Fremde. „Aber das hat Mozarts Lebenslaune nicht gebrochen. Ein rechter Kerl zerbricht überhaupt nicht. Ein elastischer Geist ist aus beßrem Stoff als der beste parische Marmor. Übrigens, Sie anbetungswürdiges Mozart-Mägdlein, ich zerbreche mir schon drei Tage den Kopf, warum diese Marmorsäule so mutterseelenallein hier oben auf dem Hügel liegt — grade nur die einzige! Als ob eine einzige Säule irgend etwas in der Welt stützen könnte! Als ob nicht mit der Zweiheit überhaupt erst alles Leben begönne! Sind Sie nicht auch dieser Meinung, gnädiges Fräulein?”
„Parfaitement!” bestätigte die Kleine und gab der Älteren einen Rippenstoß.
Martha lächelte und stickte.
„Sehen Sie, wir zwei verstehen uns ausgezeichnet!” rief der junge Mann. „Deshalb haben Sie sich auch, als Symbol der Zweiheit, je ein Paar Edelsteine an die Ohren gehängt, Mademoiselle!”
Die Kleine hatte ganz vergessen, die hellroten Kirschen zu entfernen, pflückte sie jetzt mit umständlichen Gebärden aus Haar und Ohrmuschel heraus und begann sie aufzuessen. Der Fremde streckte zum Fangen die Hände aus; sie lachte und warf ihm das zweite Paar der unreifen Früchte zu.
„Dafür spielen Sie uns aber auch etwas vor!” rief sie. „Denn Sie sind doch offenbar ein Musiker?”
„Offenbar!” erwiderte der Spielmann ernsthaft und griff Akkorde aus Mozarts Figaro, womit er das folgende Geplauder scherzend begleitete. „Aber ich male auch bisweilen; ich singe auch ein wenig; ich komponiere mitunter. Und da zum Singen Worte gehören, so dicht' ich auch.”
„Ein Universalgenie!” rief der Backfisch entzückt.
„Und wenn Sie hinzunehmen, daß ich Dingen, die mich interessieren, auch wissenschaftlich nachspüre und sogar ein paar Bücher geschrieben habe — —”
„Oh, oh, oh, Martha, was sagst du nur dazu?!”
„So werden Sie begreifen, daß ich mich vor allem andren nach etwas ganz Bestimmtem sehne — nach der Zweiheit, mit der ich zusammen eine Einheit bilden könnte, fest, geschlossen, gesammelt — ein Kunstwerk, ein Tempel, eine Gralsburg!”
Die Mädchen schauten einander verwundert an.
„Schrecklich gelehrt!” sagte die Jüngere. „Erzählten Sie nicht gestern, daß Sie an einem Duett komponieren?”
„Auch das! Zwei Mädchenstimmen! Die eine von stiller Schönheit, edel und einfach — Frieden ausstrahlend wie eine Madonna oder ein Engel von Fra Angelico. Die andre ein Kobold, der in allen Tonlagen herumgaukelt, ganz voll Koloraturen, eine Nixe, eine Wasserfee. Soll ich Sie mal spielen, Fräulein Nixe?”
Er spielte närrische Akkorde und sang zu den Kapriolen ein Necklied.
„Reizend! Von Mozart?”
„Von mir, holder Schmetterling!”
„Mais c'est charmant! Das müssen Sie mir aufschreiben! Aber nun sollen Sie auch meine Cousine komponieren!”
Er ließ sich, nachdem er sich so lange nur mit der Jüngeren abgegeben hatte, im Grase nieder, zu den Füßen der verlegenen Stickerin; aber er griff nur einige ernst-schöne Akkorde und sprach dann mit zarter Höflichkeit:
„Sie heißen Martha, mein stilles, fleißiges Fräulein. Mehr weiß ich nicht, will es auch vorerst gar nicht wissen. Aber gesehen habe ich Sie schon irgendwo und habe Ihr Gesicht behalten. Nur weiß ich nicht mehr: war es jenseits dieses Sternes, ehe unsre Seelen auf die Erde flogen, oder war es irgendwo in Europa? Denn ich wandre viel. Ihnen möcht' ich nichts Neckisches, sondern etwas sehr Liebes und Ernstes sagen oder singen. Denn Sie verdienen es, Sie sind so gut, wie Sie schön sind.”
Und ihre Hand ergreifend, an der noch der Fingerhut steckte, küßte er plötzlich die schlanken Finger der überraschten Schönen.
Dann aber besann er sich, sprang auf und packte Hut und Laute.
„Auf Wiedersehen! A rivederci!”
Und sprang mit großen Schritten den Hügel hinunter.
** *
Weitab von diesem Riviera-Hügel, vor einem der alten fränkisch-thüringischen Herrensitze mitten in Deutschland, steht eine mächtige Tanne. Ein Vorfahre Ingos hatte sie gepflanzt, als er in den Türkenkrieg zog. „Ihr sollt euch”, schrieb er, „bei ihrem Anblick erinnern, daß der Mann sein Erbe verlassen und sein Lebensziel erobern muß.” Als aber sein Verwalter während des Freiherrn Fernfahrt einen Schloßteich in Ackerland verwandelte, schrieb derselbe Türkenkrieger folgenden Brief: „So wir nicht alles im alten Stand finden, schießen wir dir bei unsrer Heimkehr eine Kugel durch den Kopf, denn der Mann soll sein Erbe achten. Im übrigen bleiben wir dir in Gnaden gewogen.”
Noch andre Ahnen Ingos hatten die abenteuerliche Ferne aufgesucht und sich doch zuletzt, gebräunt von Lebens-Erfahrung, auf den geliebten heimischen Boden zurückgefunden.
Der Enkel dieser freiheitlich-konservativen Männer, die aus Fernfahrt und Einkehr ihr Leben auferbauten, der Troubadour Ingo, der am Rande der Mittelmeerkultur die Leuchtkraft der Olivenhänge in sich einsog, war ein jüngerer Sohn. Bei ihm hatte sich der Adelsstolz ins Geistige umgesetzt. Und während sein älterer Bruder Hochwild schoß, sann er selbst im Gebirg' und auf dem Weltmeer dem erhabenen Problem nach, wie sich germanischer Ernst und griechische Schönheitsfreude und christliche Innerlichkeit in einem heiter-ernsten Naturell vereinigen könnten ...
Als Ingo jenen Hügel hinabschritt, sang und pulsierte sein Blut.
Und das Blut sang und sprach zu dem leichtfüßig dahineilenden Spielmann:
„Einst hat dein Ahnherr Friedrich die schöne Elsässerin Octavie von Birkheim in den harten, kräftigen Herbst eurer Thüringer Waldung heimgeführt. Greif zu, Spielmann! Trage die Schönheit unter die Parkwipfel der arbeitsamen Stille! Denn deine Munterkeit ist Maske, dein Herz ist reif und traubenschwer von Heimweh nach Tempel und Hütte mitten in Deutschland. Noch braucht dich Deutschland nicht; noch spielst du das Leid deiner Verbannung mit Melodien hinweg. Doch halt aus! Vollende dich wandernd! Wandre, wandre! Es wandert der blühende Lenz und verwandelt sich wandernd in goldenen Herbst. Es wandert das Licht, den Tag verwandelnd in Nacht und die Nacht in Frührot. Es wandert und wächst der Mensch und verwandelt sich wandernd aus Kindergestalt in die Reife des ruhigen Greises. Und so wandern Geburt und Tod. So wandert die Zeit, so wandern die Sonnen des Weltalls — und alles Lebendigen Wesen ist Wandel und Wandrung. Wandre, mein Freund — nur wandre zu Ende!”
So sang das Blut.
So sang es in einem schön gewachsenen, durch besonnenen Sport kräftig und ebenmäßig ausgebildeten Körper.
Und so schritt er hinab, voll Spannkraft und Lebensmut, griff in die Saiten und spielte sich ein Wanderlied.
Plötzlich unterbrach er dieses Reigenspiel seiner Gedanken, strich über die Stirn, sah um sich und sagte gelassen:
„Bursche, du bist verliebt! Mach', daß du in dein Hotel kommst, damit dir Friedel den Text liest!”
Zweites KapitelTitanic
„Ich komme vom Gebirge her, Es dampft das Tal, es braust das Meer ... Wo bist du, mein geliebtes Land? Gesucht, geahnt und nie gekannt? O Land, wo bist du?” ...
Schmidt von Lübeck
N acht hatte sich der Landschaft bemächtigt.
Ein Gewitter krachte über der Palmenküste. In wuchtigen Massen troff der Regen.
Im Hotel vernahm man das nahe Rauschen und Drohen des gewaltig tosenden Meeres, dessen großer Ton sich mit den Stimmen der Gewitternacht verband.
Doch in den glänzenden Luxusräumen, die von Goldornamenten und Kristallen strotzten, wurde die Sprache der Natur nicht wichtig genommen. Ein internationales Sprachengemisch, ein feinblauer Zigarettendampf, Schaumperlen der Sektgläser stiegen empor und schufen eine besondre Stimmung.
Der kleine Kommerzienrat Otto S. Marx feierte Geburtstag. Es war ein reichlich Dutzend seiner vielen guten Bekannten zu einem Souper eingeladen. Seine Laune war vorzüglich, denn der Vormittag hatte ihm in den Spielsälen eine beträchtliche Summe in die Tasche geschoben. Und nun neckte er seinen stattlichen germanischen Freund, den Großkaufmann Schaller aus Barcelona, der eine Handvoll Goldstücke verloren hatte — für Firma Schaller & Co. zwar eine Kleinigkeit, aber immerhin des Verdrusses wert; denn die bereits gewonnenen Tausende waren dem leidenschaftlichen deutschen Spieler wieder durch die Finger getropft, da er nicht die Besonnenheit hatte, beizeiten abzubrechen, wie der immer kluge und immer nüchterne Otto S. Marx.
Unter den Gästen stachen hervor, durch helle und einnehmende Gesichtszüge, das deutsche Ehepaar Trotzendorff mit dem befreundeten thüringischen Freiherrn Ingo von Stein-Waldeck. Der blonde englische Maler Wallace und sein angenehmer, nach allen Seiten stets gleich liebenswürdiger französischer Freund Leroux hatten sich mit diesen drei Deutschen angefreundet; und es störte sie nicht, daß der männliche Major von Trotzendorff gelegentlich seinen nationalen Standpunkt im Gegensatz zu andren anwesenden Deutschen unverschwommen betonte; denn seine leuchtend schöne Frau Friederike, genannt Friedel, glich alles wieder aus.
Um diese lebenswarmen Menschen her saßen allerlei belanglose Damen und Herren, die sich durch Reichtum und Brillanten von der arbeitenden Menschheit absonderten, nicht durch Seele. Da war ein jovialer Theaterdirektor, der ebenso wie sein Nachbar, ein blasierter Gesandtschafts-Attaché, für lüsterne Anekdoten empfänglich war und manchmal aus einem wiehernden Lachen gar nicht mehr herauskam; da war eine sehr dekolletierte, sehr parfümierte, sehr geschminkte Dame aus österreichischen Adelskreisen, die täglich mit kühlster Geschäftsmiene am Spieltisch saß. Und so Gesicht an Gesicht, fahl, geisterhaft in den Rauch eingezeichnet, umblitzt von den Zieraten des Salons, umdröhnt von Meer und Gewitter.
Man sprach vom Untergang der „Titanic”.
Dieser englische Riesendampfer, das größte Passagierschiff, das je auf einem Ozean geschwommen, war auf seiner ersten Fahrt von England nach Amerika an einem Eisberg zerschellt. Das ungeheure Fahrzeug war mit mehr als tausendsechshundert Menschen in die Tiefe gesunken.
Ein Aufschrei scholl durch die Menschheit.
„Wie kann denn eine solche schwimmende Luxusstadt überhaupt untergehen?! Es waren ja Restaurants an Bord, Konzertsäle, Tennisplätze, Blumenläden — ganze Straßen! Es fuhren ja Millionäre und Milliardäre mit!”
„Der alte Atlantik kümmert sich den Teufel um alle Milliardäre der Welt!”
„Der Ozean ist dort dreihundertmal so tief als der Tiefgang der Titanic!”
„Der Eisberg, an dem das Schiff zerkrachte, ist schwerer als alle Eisenflotten der Welt!” ...
In einer eiskalten Aprilnacht war es — zwei Stöße — und das Riesenschiff stand fest! Von Tür zu Tür läuft das Wort: Auf! ein Unglück! Was, wo, wie? Menschen, mehr neugierig als erschrocken, huschen im Schlafrock durch die Korridore — was, wo, wie? Und abermals ein Befehl: Stecke jeder ein Dokument zu sich! Jetzt summt es heraus aus allen Kabinen, jetzt füllt es tosend Verdeck und Gänge, staut sich, fragt, ruft, schreit, kämpft — und um die verängstete Menschenmasse eisige Nacht und das Plätschern, Nagen, Zähneblecken des wartenden Ozeans! Da rufen Geistliche die volle Wahrheit: In wenigen Minuten stehen wir alle vor Gottes Antlitz, wer seine Seele erleichtern will, der mag es tun! Und die Schiffskapelle, die im Salon bis zuletzt mit lustigen Weisen getäuscht hat, bricht ab und geht über in den Choral: „Näher, mein Gott, zu dir!” Furchtbare Panik! Das todgeweihte Gewühl drängt, stößt, beißt sich zu den Booten, über zertretene Kinderleichen hinüber, und alle Kommandorufe ersticken im mörderischen Gebrüll. Einzelne überladene Boote kämpfen sich los vom Überandrang, um sie her tropfen Menschen ins Wasser wie Körner von einem übervollen Gefäß — und dann richtet sich der Schiffsrumpf in seiner ganzen Länge jäh empor, in Kirchturmhöhe aus den Wassern starrend, und schüttelt die wild aufschreiende Menschenmasse ab, um dann selber in den schwarzen Strudel zu versinken ... Einige Hundert haben sich auf allzu spärlichen Booten gerettet und schwimmen nun in Nußschalen, die Füße im Eiswasser, durch die kalte Nacht, Land suchend, Überbleibsel einer Sintflut ... Titanen wollten den Himmel stürmen; Götter schoben ihnen lächelnd mit dem kleinen Finger einen Eisblock entgegen — und die Titanen stürzten ...
Diese Schilderung wurde ausgesponnen und mit erschütternden Einzelheiten umrankt. Gemüter und Nerven erzitterten.
Aber sehr bald flutete neuer Unterhaltungsstoff über den Eindruck hinweg. Man sprach von Schiffsunfällen, von Lebensversicherung, von Maßregeln, die eine Katastrophe solcher Art künftig verhüten würden; man verurteilte die Schnellfahrten über den Ozean, man stritt über den Wert solcher Riesenschiffe. Bald war man mitten in Zahlen und Maßen der Dreadnoughts. Und hier wurden einige Herren hitzig, darunter der fachmännisch beschlagene Major von Trotzendorff, als der Kaiserliche Jachtklub, der Meteorjachtklub von Deutschland und der Deutsche Motorbootklub nicht reinlich auseinandergehalten wurden. Von da sprang das Gespräch auf den Kaiserlichen Aeroklub und den Berliner Verein für Luftschiffahrt über. Man hatte vor wenigen Tagen einer Wettfahrt von Motorbooten beigewohnt: mit aufgebäumtem Kiel, in fabelhafter Raserei, umschäumt von zurückspritzenden Wellen, waren die Boote am Felsen von Monte Carlo vorübergesprüht. Und im Hafen erhob sich, nach Anlauf auf dem Wasser, eines dieser surrenden Wunderwerke jählings in die Luft und flog mit seinen zwei Insassen in großem Bogen kühn hinaus übers Meer und wieder genau zurück und herab an die Abfahrtstelle ... Welche Eroberungen des Wassers und der Luft! Welche Überwindungen der Schwere! Sie stürmen den Himmel, diese Titanen!
Das Gespräch flatterte in Gruppen auseinander; die Titanic schien vergessen. Diese modernen Menschen waren berauscht von den unvergleichlichen technischen Errungenschaften der Gegenwart ...
Ingo von Stein saß in tiefen Gedanken versunken. Er hatte sich im Geiste mehr und mehr abgesondert vom Gespräche seiner Zeitgenossen. Plötzlich, als eine Pause sein Eingreifen möglich machte, sprach er in seiner ernst-liebenswürdigen Weise mit vollklingender Mannesstimme:
„Gestatten Sie mir eine Frage, meine Damen und Herren! Ist niemandem von Ihnen bei diesen Gesprächen über den Untergang der Titanic etwas aufgefallen?”
„Wieso? Was denn?”
„Verzeihen Sie, es ist unmodern, davon zu reden! Nehmen Sie an, daß es ein philosophisch gestimmter Mensch sei, den diese Frage beschäftigt! Als diese sechzehnhundert Menschen untergingen, fuhr ebenso ein Entsetzen durch die Welt wie beim sizilischen Erdbeben. Aber — binnen kurzem ist alles wieder vergessen! Die Jagd saust weiter. Neue Eindrücke stürmen über die alten hinweg; es kommt nicht zu seelischer Verarbeitung. Hat wohl eine Frage nach Sinn und Wesen des Todes die materialistische Menschheit durchschauert? Hat man ein Polarschiff ausgesandt in das unbekannte Land jenseits des Todes? Hat man sich auf Sinn und Wert des Lebens und Sterbens besonnen?”
„Herr Baron, das is Religion — und Religion is Privatsache!” rief Marx.
„Wer hat denn heute zu solchen Spekulationen Zeit?” setzte Schaller hinzu.
„Wir sind doch nicht mehr im Mittelalter mit Hölle und Himmel und solchen Popanzen!”
„Aber darüber kann ja jeder denken, wie er will! In Religionssachen bin ich für mein Part indifferent — und ich hoffe, mit mir jeder moderne Mensch!”
So ging es um den Tisch herum. Der Attaché stemmte den Kneifer ins Auge und betrachtete den Baron wie ein vorsintflutliches Megatherion.
„Sehen Sie! Sie bestätigen, was ich sage!” fuhr Stein fort. „Der Zusammenprall zwischen Titanic und Eisberg war umsonst. Niemand hat die gigantische Frage verstanden. Denn eine Frage ist in jener Aprilnacht über den Ozean geschwommen und hat der Titanic Halt geboten. Die moderne Titaniden-Menschheit hat die Frage nicht einmal gehört!”
Ein Teil der Gesellschaft versuchte ernst zu werden. Man vernahm draußen das Tosen des Gewitters; man vernahm das Donnern der nächtlichen See.
„Nehmen Sie einmal an,” fuhr der philosophische Sonderling fort, „wir alle, wie wir hier sitzen, ganz Europa, die ganze moderne Zivilisation, seien der Schiffskörper einer Titanic, umbraust von den Gefahren des Chaos! Nehmen Sie an, eine Katastrophe bedrohe uns, ein europäischer Krieg, mit Hungersnot, Seuchen und Revolution — was dann? Nehmen Sie einmal an, wir Zeitgenossen seien dem Untergang geweiht und schauen auf die letzten Jahrzehnte zurück, wie dort in den letzten Minuten die Todgeweihten der Titanic auf ihre Fahrt — was ist das Ergebnis? Können wir sagen, diese glänzende Anhäufung materieller Güter, diese fieberhafte Konkurrenz aller gegen alle, seien der wahre Sinn und Zweck und Wert des Daseins?”
Er hielt einen Augenblick inne, sah sich fragend um und schloß:
„Sie, meine Damen und Herren, sagen ja — ich sage nein! Das ist unhöflich, denn ich setze mich damit auf einen Nachen und fahre von der Titanic fort. Oder vielmehr: ich fahre gleich nicht mit. Ich lehne die Beteiligung an dieser rasenden Lebensfahrt dankend ab. Wenn mir aber jemand von Ihnen einen Amundsen oder Nansen namhaft zu machen weiß, der ausfährt, um den geistigen Pol, den ruhenden Pol in der Erscheinungen Flucht zu entdecken, jenseits der Sinnenwelt, jenseits des Todes — dieser Polarfahrt würd' ich mich sofort anschließen.”
Das war in liebenswürdigem Ton, lächelnd, aber energisch und bestimmt herausgesprochen.
Der Versammelten, die auf solche Gedankengänge nicht gestimmt waren, hatte sich eine erstaunte oder gar beklemmende Empfindung bemächtigt. Stein hatte eine Erörterung erwartet; aber man ging nicht darauf ein.
Es war Herr Otto S. Marx, Buchdruckereibesitzer großen Stils, der die sorglose Stimmung wieder herstellte. Er fuhr mit der Hand über Glatze, Stirn und leicht gebogene Nase zum modern gestutzten rötlichen Schnurrbart herunter, als wische er etwas hinweg, und rief mit Humor:
„Ein entschieden philosophischer Kopf, unser Herr Baron von Stein!”
Diese paar Worte waren mit so komischer, etwas nasaler und nüchterner Betonung gesagt, daß man allgemein in befreiendes Lachen ausbrach.
„Aber einstweilen sitzt er mit auf der Titanic und schlürft Sekt!” trumpfte der derber gestimmte Schaller und erhob mit schallendem Lachen sein kräftig unterbautes Kinnbacken-Gesicht mit dem scharfen Monokel und dem Durchzieher auf der linken Wange. Man konnte ihn für einen Typus des deutschen Korpsstudenten nehmen; seine ansehnliche Statur mit dem ganz kurzen Blondhaar stach wirksam ab vom salopp hingelagerten Marx, der mit den Händen in den Hosentaschen im Plüschfauteuil lehnte und spöttisch-überlegen den Baron anblinzelte.
„Lieber Baron,” fuhr Schaller fort, „Marx und ich liegen uns zwar immer in den Haaren, obwohl er meinen Rat in Bankpapieren schätzt; aber in einem modernen Glaubensartikel sind wir einig: erst die Million — dann die Seele!”
Erneutes Gelächter stimmte diesem massiven Grundsatz bei. Auch der gutartige Stein lächelte mit; Trotzendorff mochte gleichfalls kein Spielverderber sein; doch seine Frau sah betreten und bedauernd zu Ingo hinüber. Nur der Engländer Wallace trank seine Limonade und rang sich kein Lächeln ab.
Als das Gespräch dann wieder im Gang war und weitersummte, beugte sich Frau von Trotzendorff zu ihrem Liebling hinüber.
„Ingo,” raunte sie, die Hand am Munde, „denk' an das Gleichnis von den Perlen!”
„Stimmt, Friedel!” kam es zurück. „Aber ich sollte charaktervoll sein und selber nicht unter den Säuen sitzen!”
„Unsinn! Willst du wohl —?! Bist schon Einsiedler genug!”
Er zuckte die Achseln, schüttelte den Kopf und lehnte sich wieder zurück.
Und nun ließ er sein Auge wandern über diese Fräcke und Toiletten. Was für eine Gesellschaft war denn dies hier am Rande Europas, unter die er da geraten war? Wo leuchtet denn hier, aus diesen Gesichtern mit der Tücke des modernen Menschen, der seine Mitmenschen zu überlisten trachtet, aus diesen scharfen oder verlebten Zügen — wo leuchtet jenes freimütig-unbefangene deutsche Gemüt? Jenes Edelgemüt, das die große Musik, Philosophie und Mystik geboren hat? ... Verstand, Pfiffigkeit, Lüsternheit, Tatkraft, Nervosität — diese Eigenschaften prägten sich zwar deutlich in den Mienen aus. Aber Seele? Wo ist denn die deutsche Seele? Er nahm nur Frau Friedels schöne und phantasievolle Züge aus neben Trotzendorffs offener Männlichkeit; der Engländer neben ihm war sachlich, der hübsche Franzose kokett. Aber diese beiden jungen Leute waren ihm noch weitaus die angenehmsten unter der unangenehmen Gesellschaft. Unangenehm? Sind es nicht deine deutschen Landsleute? Bist du nicht in Gefahr, deinem Vaterlande fremd zu werden? ... Vaterland! ...
Die Empfindung ließ ihn nicht mehr los, daß er sich auf einem gefährdeten Schiffe befand, selber in Gefahr und nur durch dünne Wände getrennt von den Wassern der Vernichtung.
Der junge Engländer an seiner Seite unterbrach plötzlich seine düstren Gedankengespinste und fragte den Baron, ob er wisse, daß Mr. Stead, der Vorkämpfer des Spiritismus und der Friedensbewegung, mit der Titanic untergegangen sei? Ingo, der gut Englisch verstand und sprach, verneinte. Und sachte ging Mr. Wallace auf ein Gebiet über, das abseits lag von diesem Kreise und von Ingos künstlerischen Lebenspfaden, das ihn aber rasch fesselte. Der kaltblütige Engländer, der für die Alkoholstimmung dieses deutschen Kreises unempfänglich schien, sprach von einer spiritualistisch-religiösen Bewegung der Neuzeit. Er war Maler aus Liebhaberei, Sprachlehrer aus Beruf; und auf seiner Visitenkarte, die er im Laufe des Gespräches mit dem Baron tauschte, stand ein M. A.: „Master of Arts”, sein Universitätsgrad. Er hatte seine Jugend in Indien verbracht. Und es war für den Deutschen eine Wohltat, in dem flackrigen Rhythmus dieser Abendgesellschaft solche gelassene Ruhe zu vernehmen, wie sie aus diesem etwas kühlen, aber sehr unterrichteten Manne zu ihm herüberschwang. Es war ein Ton aus einer weiteren Welt; und daß es ein Ausländer war, von dem dieser Ton kam, machte den Deutschen beschämt und nachdenksam.
„Sie haben übrigens”, sprach Wallace, „in Deutschland einen Mann, der auf diesem Gebiete sehr bedeutend ist.”
Und er nannte einen Namen, den Ingo nie vernommen hatte.
Doch das beruhigende Zwischenspiel wurde durchbrochen. Stein, mitunter zum Aufbrausen geneigt, schnaubte plötzlich empor und rief einem Lebemann am Ende der Tafel kampflustig zu:
„Wer verunglimpft da unten Schiller?! Lassen Sie unsren Schiller in Ruhe! Hätten wir nur etwas von seiner Männlichkeit!”
„Aber Sie haben mich wohl nicht ganz verstanden, mein verehrtester Herr Baron”, erwiderte Herr von Jedermann und Überall. „Ich habe nur ganz einfach festgestellt: Damals war der Wallenstein modern — heute der Rosenkavalier; damals die Iphigenie — heute die Salome. Na, und warum soll ich das nicht sagen?”
Stein lachte und rief mit Schärfe zurück:
„Sagen Sie das, Edler! Und fügen Sie hinzu: Damals war das weimarische Hoftheater modern — heute das Kino!”
Er warf sich wieder in seinen Sessel und machte eine segnende Handbewegung gegen den Ritter des Geistes, der den linken Daumen unter die linke Achselhöhle eingeklemmt, die rechte Hand gespreizt hatte und mit der Zigarette im Mundwinkel wiederholte: „Na, warum nicht?”
Da war nichts zu widerlegen.
Jetzt tauschte Schaller seinen Platz mit Mr. Wallace und ließ sich neben dem thüringischen Freiherrn nieder.
„Herr Baron, nichts für ungut, aber Sie philosophieren zu viel! Sie müssen mich in Barcelona besuchen! In allem Ernst! Ich habe Ihnen nachher auch etwas Amüsantes zu erzählen. Unter uns: ein Restchen deutsches Gemüt in mir beneidet Sie. Verstehen Sie? Nein? So will ich's Ihnen erklären. Gestern warfen Sie gesprächsweise die Bemerkung hin: als Sie die Wahl hatten zwischen Staatskarriere und geistiger Vertiefung, haben Sie unbedingt das letztere vorgezogen. Universalbildung im Sinne Wilhelm von Humboldts — sagten Sie; moderne Fortsetzung des klassischen Idealismus — sagten Sie. Sie sehen, ich hab' mir's gemerkt, bin also gar kein so feister Materialist, wie es allerdings aussieht. Und darum sag' ich: ein Rest in mir beneidet Sie um dieser freien Wahl willen, die Sie getroffen haben. Hol's der Teufel! Etwas wie Sentimentalität sitzt immer in uns Deutschen.”
„Das Deutschland von heute hat sich für Ihren Weg entschieden, mein lieber Herr Schaller”, erwiderte Ingo gelassen. „Erst die Million — dann die Seele! Beneiden Sie mich vielleicht um das Martyrium der Heimatlosigkeit?”
„Ach was, Unsinn! Sie sind jung, nicht älter als ich! Schaffen Sie sich eine Heimat, bauen Sie sich ein Schloß! In der Calle Muntaner zu Barcelona steht meine Burg; kommen Sie einmal hin, sehen Sie sich an, was deutsche Energie im Ausland fertigbringt! Bis dahin hab' ich ein hübsches junges Weib im Hause. Schaffen auch Sie sich eine Frau an, Herr Baron, das bewahrt vor philosophischen Hühnerleitern! Und kommen Sie! Ich bin manchmal hungrig nach Geist — ausgehungert! Und à propos, wissen Sie, was ich Ihnen jetzt Amüsantes zu verzapfen habe, Sennor? Wissen Sie, daß Sie entdeckt sind?”
„Wieso entdeckt?”
„Als ein Troubadour namens Ingo, der meinen zwei jungen Nichten den Hof macht!”
„Potztausend noch einmal!” fuhr Ingo auf und hätte vor Verblüffung fast sein Sektglas fallen lassen. „Die zwei jungen Mädchen da oben auf dem Hügel sind Ihre Nichten?!”
„Sind meine Nichten, ich kann nichts dafür!” bestätigte der lachende Kaufmann. „Niedliche Lärvchen, was? Beide haben's nicht von mir, denn wir sind nicht blutsverwandt; die Mutter der Älteren, eine Witwe aus Straßburg, ist die Schwester meiner Stiefmutter; so sind wir in eine Art Onkelschaft geraten, und ich versteh' mich mit den Mädels ganz famos. Die Jüngste ist ja entzückt von Ihnen, einfach aus dem Häuschen!”
„Aber sagen Sie mir doch — wie hat sich denn das herausgestellt? Aus Straßburg? Jetzt begreif' ich! Dort war's, dort hab' ich das Mädchen gesehen, in der Vogesenstraße, als ich im Herbst ein paar Wochen dort wohnte! Aber wie hat man denn mich entdeckt?”
„Nichts einfacher als das! Durch Ihr Buch ‚Heroismus’, das Sie mir geliehen haben! Da steht Ihr Name, Ingo von Stein. Dies Ingo hat sie verraten. Ich habe das Buch meinen Nichten hinaufgebracht, wir blättern drin, der kleine Grashüpfer schwatzt immerzu von dem Besuch des reizenden Unbekannten, der Ingo heiße. Ingo? Ingo heißt euer romantischer Anbeter? Wie sieht er denn aus? So und so! Famos, da haben wir ihn ja! Voilà! Ecco!”
Er lachte herzhaft. Stein lachte mit.
Aber in seinem Herzen schloß sich doch etwas zu; ein musikalischer Zauber, ein poetischer Duft drohte zu entfliegen, der Reiz des Magischen und Fremdartigen. Denn jene Welt Mozarts, jenes reine Eiland der Schönheit, wurde überflutet von der breiten Alltagswelt dieser knochigen Millionenmacher, dieser Geldmagnaten, dieses modernen Amerikanismus.
Daher ging Ingo recht bald und mit leichtem Scherz über die Sache hinweg, zumal Frau Friederike, zur Eifersucht geneigt, gespannt herüberfragte, von welchen reizenden jungen Mädchen denn hier so angelegentlich die Rede sei. Nur eines merkte er sich: die jungen Damen waren im Begriff, mit Frau Frank-Dubois, Marthas Mutter, nach Barcelona zu reisen, um dort einige Wochen bei Onkel Schaller zu wohnen.
„Eine Reise nach Barcelona”, warf Ingo hin, „steht übrigens bei mir schon längst auf dem Programm. Denn dort in der Nähe ist der berühmte Montserrat, der Gralsberg, der Montsalvat der Sage.”
„Kenn' ich natürlich genau! Famoser Berg! Großartige Aussicht! Also kommen Sie! In meinem Hause finden Sie etwas, was Ihnen so leicht kein Privatmann bietet: zwei echte Velasquez! Heh, was meinen Sie dazu? Raus aus dem Beamten- und Spießbürgernest Deutschland! Nur der Mittelmäßige kommt dort vorwärts! Für geniale Köpfe ist kein Platz mehr im Reich. Großzügige Naturen treiben sich im Ausland herum oder ersticken im deutschen Winkel.”
Die Damen und einige Herren zogen sich zurück.
Trotzendorff trat zu Stein heran, der sich gleichfalls erhoben hatte.
„Weißt du das Neueste, Ingo?”
„Nun was denn, Richard?”
„Meine Berufung ist Tatsache! Hoheit hat's bestätigt!”
„Also von jetzt ab Hofmann, lieber Richard? Na, mein herzliches Beileid!”
„Danke für den Glückwunsch! Das wird auch für dich entscheidend, alter Flüchtling! Ich habe meinen Plan. Und du weißt, ich bin in solchen Dingen zäh. Auf dem Weg über Seine Hoheit komm' ich an den Kaiser heran, mache Majestät mit deinen Gedanken bekannt, verschaffe dir eine persönliche Vorstellung, und du wirst an den Platz gestellt, wo du wirken kannst!”
Ingo legte den Arm um die Schulter des Freundes.
„Du bist doch ein unverbesserlicher Utopist!”
„Abwarten, Junge!” erwiderte der straffe Soldat und strich seinen dicken grauen Schnurrbart. „Wenn du erst einmal mit dem deutschen Kaiser auf der Wartburg ein richtiges Kaisergespräch geführt hast, dann sprechen wir weiter!”
Frau Friederike war herangekommen. Es war heute abend in ihrem Wesen etwas wie nervöses Fieber.
„Richard hat recht”, sagte sie hastig. „Wir müssen dich unter Aufsicht nehmen, lieber Ingo, wir müssen dich mit Gewalt an die rechte Stelle schieben. Die Sache wird gemacht! Du kennst meinen Alten, der läßt nicht locker, wenn er etwas im Kopf hat!”
„Hier steh' ich nun wie Buridans Esel zwischen den zwei bekannten Heubündeln”, lächelte Stein. „Die Lockung dort heißt Barcelona — die Lockung hier heißt Wartburg. Wohin?”
„Nach Deutschland, Ingo! An deine deutsche Aufgabe!”
„Hat mich nicht gerade Friedel aus Deutschlands Enge herausgeschmeichelt?”
Doch Frau Friederike schob ihren Arm unter den seinen und entführte ihn samt ihrem Gatten aus der Riviera-Gesellschaft.
Aber sie konnte sich oben, als sie einander Gute Nacht sagten, nicht enthalten, noch einmal nach den hübschen jungen Mädchen zu fragen, die ihn so lebhaft entflammt hatten. Er warf lachend einige beschwichtigende Worte hin; doch ihr entging nicht, daß er errötet war, und sie schied mit langen, schweren Blicken ...