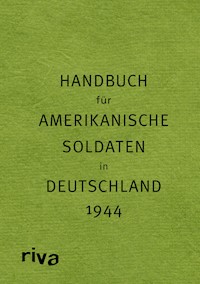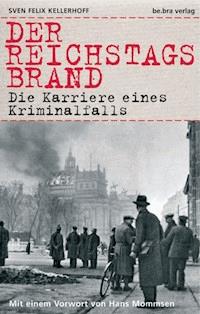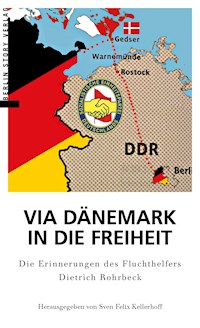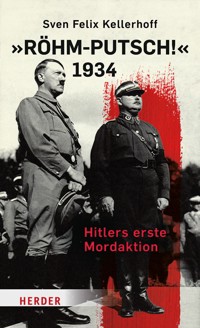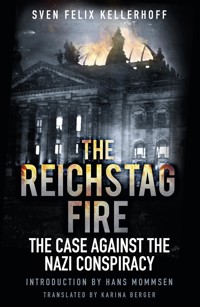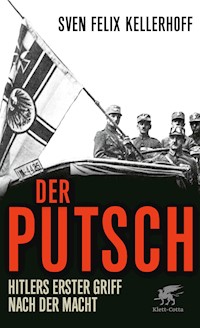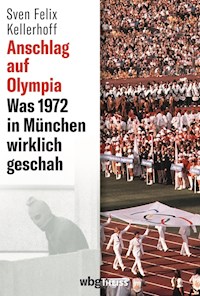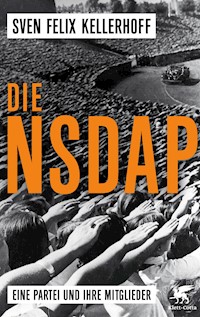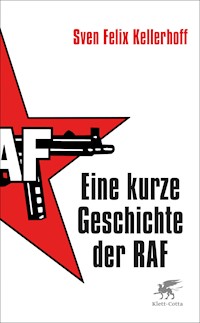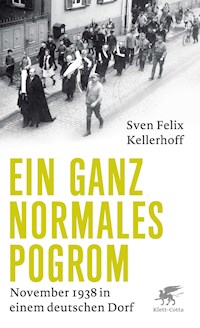18,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Konrad Theiss Verlag GmbH
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
»Stammheim« ist seit dem Prozess gegen die erste Führungsgeneration der RAF zum Mythos geworden. Die Wahlverteidiger der Angeklagten taten alles, um das Strafverfahren zum Schauprozess zu machen. So drang fast nur die einseitige Interpretation der RAF-Anwälte in die deutsche Öffentlichkeit – und wirkt bis heute fort. Sie lässt das Verfahren als »systematische Zerstörung aller rechtsstaatlichen Garantien« (Otto Schily) erscheinen. Dabei ist das Gegenteil richtig: Die Richter gewährleisteten ein ordentliches Strafverfahren. Ein halbes Jahrhundert später ist es an der Zeit, dem Verfahren und damit dem Rechtsstaat Gerechtigkeit widerfahren zu lassen – auf Grundlage vielfältigster Quellen. Der Bogen spannt sich von der Ankunft der RAF-Führung in der Untersuchungshaft 1972 bis zum Selbstmord von Andreas Baader, Gudrun Ensslin und Jan-Carl Raspe am 18. Oktober 1977. Gezeigt wird, was beim Jahrhundertprozess wirklich geschah. Er ist ein Vorbild für den Umgang des Rechtsstaat mit Terror.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Buchvorderseite
Festung: Kinder fahren 1974 am Zaun der JVA Stuttgart-Stammheim entlang. Das »Mehrzweckgebäude« für die Gerichtsverhandlung ist im Bau.
Titelseite
Sven Felix Kellerhoff
DER STAMMHEIM PROZESS
Die RAF und das Baader-Meinhof-Verfahren 1975 bis 1977
Impressum
wbg Theiss ist ein Imprint der Verlag Herder GmbH
© Verlag Herder GmbH, Freiburg im Breisgau 2025Alle Rechte vorbehaltenwww.herder.de
Umschlaggestaltung: Pittner-Design, Haiming, unter Verwendung von Fotos von Jan-Carl Raspe, Gudrun Ensslin und Andreas Baader (Public domain)
E-Book-Konvertierung: Daniel Förster
ISBN Print: 978-3-534-61063-1ISBN E-Book (E-Pub) 978-3-534-61140-9ISBN E-Book (PDF): 978-3-534-61132-4
Inhalt
Urteil
Der Vorsitzende Richter ließ sich Zeit. Zweidreiviertel Stunden mussten Staatsanwälte, Verteidiger und Justizbeamte sowie 178 Zuschauer und 49 akkreditierte Vertreter der Presse auf harten Plastikstühlen im Verhandlungssaal auf die entscheidenden Sätze warten; manch einer nickte sogar ein.1 Denn erst ganz am Ende der mündlichen Urteilsbegründung am 28. April 1977 kam Eberhard Foth auf die Hauptsache zu sprechen. Anders als bei gewöhnlichen Strafprozessen handelte es sich weder um den Schuldspruch an sich noch um das Strafmaß, denn beides hatte der Vorsitzende Richter des 2. Strafsenates des Oberlandesgerichts (OLG) Stuttgart bereits zu Beginn verkündet, und beides konnte niemanden überraschen: Alle drei Angeklagten, Andreas Baader, Gudrun Ensslin und Jan-Carl Raspe, waren schuldig und wurden zur Höchststrafe verurteilt.2
Foth wusste jedoch, dass etwas anderes im Mittelpunkt des Interesses stehen würde: »Manche werden fragen – wo bleibt die Politik?«, formulierte er die Erwartung, auf die er eine einleuchtende Antwort geben musste. Nach einer kurzen Atempause und einem Blick über die dicht besetzten Reihen vor der Richterbank erhob der 46-jährige Jurist seine Stimme: »Dort, wo sie hingehört – nämlich draußen vor der Tür des Gerichtssaals.« Wer einen politischen Prozess oder politische Verteidigung fordere, der sage »sich los von dem rechtsstaatlichen Strafverfahren«.3
Diese Sätze richteten sich an die deutsche wie die internationale Öffentlichkeit, die dem Prozess fast zwei Jahre lang teils gespannt, teils irritiert gefolgt war. Jene, die immer wieder das Gegenteil gefordert hatten, hörten Foths Bescheid gar nicht erst: Die Plätze der Angeklagten und ihrer Wahlanwälte blieben an diesem Donnerstagvormittag leer; nur fünf vom Gericht bestimmte Pflichtverteidiger nahmen am letzten Prozesstag teil.4
»Jedem Vernünftigen« sei klar, fuhr der Vorsitzende fort, dass der Vietnamkrieg, selbst wenn man darin einen Völkermord sehe, nicht als Rechtfertigung für einen »auf eigene Faust« geführten Krieg in Deutschland dienen könne: »Die Angeklagten wussten das – und sie wollten dagegen verstoßen.« Wer mit dem »angeblichen Zweck, den US-Imperialismus zu treffen«, Bombenanschläge in der Bundesrepublik verübe, treffe damit Menschen, die »nicht das Geringste« mit den Kämpfen in Südostasien zu tun hatten: »Drucker, Korrektoren, Hausfrauen, eine Reisegruppe, ein Roller fahrendes Kind«.5
Seit 9.02 Uhr hatte Eberhard Foth, unterbrochen von einer 25-minütigen Pause, die Gründe für das verhängte Strafmaß – für jeden der Angeklagten dreimal lebenslänglich sowie zusätzlich 15 Jahre Freiheitsentzug – vorgetragen. Im Mittelpunkt standen vier Morde und mindestens 54 Mordversuche, verübt durch Sprengstoffanschläge, für die das Führungstrio der anarchistischen Terrorgruppe Rote Armee Fraktion (RAF) nach Überzeugung des 2. Strafsenates gemeinschaftlich die Verantwortung trug. Um weitere Straftaten wie Banküberfälle, Autodiebstähle, Schießereien sowie Urkundenfälschung ging es nur am Rande: Sie konnten nicht mehr zu einer Erhöhung des Strafmaßes führen und bleiben daher unberücksichtigt.6
Nach seinen Worten über den eben nicht »politischen« Charakter des Verfahrens schloss Foth die Sitzung um 11.47 Uhr. Damit endete im »Mehrzweckbau« der Justizvollzugsanstalt Stammheim im Norden der Landeshauptstadt von Baden-Württemberg der 192. und letzte Verhandlungstag im bis dahin aufwendigsten Strafprozess der deutschen Rechtsgeschichte: 23 Monate Dauer, fast 40 000 Asservate, 997 geladene Zeugen und 80 Sachverständige, ein 13 939 Seiten starkes Wortprotokoll und weitere etwa 50 000 Blatt Prozessakten.7 Das Urteil erlegte den drei Angeklagten auf, die Kosten des Verfahrens zu tragen, doch weil sie alle mittellos waren und angesichts der verhängten Strafen sicher nie wieder nennenswert verdienen würden, musste die Staatskasse dafür aufkommen – also der Steuerzahler.
Bei den Zeitgenossen löste das Urteil von Stammheim überwiegend Zustimmung aus. Die Parteien im Bundestag demonstrierten ungewohnte Einigkeit: Herbert Wehner, der Vorsitzende der SPD-Fraktion, zeigte sich zufrieden, »dass gefasste Terroristen für ihre erwiesenen Verbrechen mit angemessenen Strafen zu rechnen haben, trotz der Versuche der Angeklagten, das Verfahren zu torpedieren«. Der Partner der regierenden Koalition, die FDP, lobte »die souveräne Entscheidung der unabhängigen dritten Gewalt im Staat«, die beweise, »dass der Staat auf die Herausforderung des Terrorismus zu reagieren weiß«. Helmut Kohl, als Oppositionsführer und CDU-Vorsitzender sonst naturgemäß fast immer anderer Ansicht als die Regierungsparteien, ließ sich zitieren, die Angeklagten seien »ihrer gerechten Strafe zugeführt« worden: »Das Urteil stellt ein für alle Mal klar, dass die Verurteilten nicht irregeleitete Weltverbesserer sind, sondern Kriminelle.«8
Proteste gegen das Urteil blieben hinter den Erwartungen der Behörden zurück. Zwar wurden Prominente der westdeutschen Gesellschaft schon seit Wochen wellenweise mit kritischen Briefen überhäuft, unter anderen von 128 US-Anwälten, rund hundert französischen und belgischen Juristen, 23 britischen Verteidigern und Dutzenden deutschen wie internationalen Theologen. Auch sandte die Zentrale von Amnesty International Telegramme an die Bundesregierung und die Landesregierung in Stuttgart, um auf die angeblich unmenschlichen Haftbedingungen der Verurteilten aufmerksam zu machen. Doch die meisten der Empfänger waren derlei längst gewohnt und nahmen die immer gleichen Vorwürfe nicht mehr zur Kenntnis. Absehbar empört äußerten sich die Wahlverteidiger der Angeklagten, die der Urteilsbegründung ferngeblieben waren, ihre Plädoyers lieber auf einer Pressekonferenz im Stuttgarter Parkhotel gehalten hatten – und trotzdem in den folgenden Tagen Revision einlegten. Über die Szene der RAF-Unterstützer hinaus blieb Kritik eher verhalten; noch wirkte offenbar das Erschrecken über den Dreifachmord, den am 7. April 1977 Baader-Anhänger an Generalbundesanwalt Siegfried Buback und zwei Begleitern verübt hatten.
Bedeutsamer als Beschwerden aus linken und linksextremen Kreisen war das Echo der Medien. Hinsichtlich des Schuldspruchs und des Strafmaßes fiel es praktisch einhellig aus, doch darüber hinaus gab es Differenzen. Die linksliberale Hamburger Wochenzeitung Die Zeit befand: »Zwar zweifelt niemand daran, dass die lebenslange Freiheitsstrafe wegen Mordes für die drei Hauptakteure des Terrorismus rechtens ist.« Doch zugleich kritisierte das Blatt: »So hat das Gericht in Stammheim immer gewusst, über welche Taten, aber zu keiner Zeit, über welche Menschen es verhandelte. Daraus resultierten die Schwächen des Verfahrens. Daraus auch folgt das Gefühl mangelnder Befriedung und Befriedigung, trotz des rechtlich unanfechtbaren Ergebnisses.«9
Die konservative Frankfurter Allgemeine kam zu einem düsteren Schluss: »Die schiere Endlosigkeit des Stammheimer Prozesses hat auf das Prozessieren selbst zurückgeschlagen.« Zwar lobte der Kommentator das Gericht, dem die Angeklagten und ihre Wahlverteidiger mit einer »Dauerorgie« an Schmähungen gegenübergetreten waren: »Mit den Fäkal-Vokabeln, die sie dabei benutzten, könnte man eine Kiesgrube füllen.« Gleichwohl zog der Leitartikel unter der Zeile »Geschwächt und gedemütigt« eine negative Bilanz: »Wer sich das alles vor Augen hält, dem müssen Prunkworte wie das vom Rechtsstaat, der sich bewährt und behauptet habe, im Halse stecken bleiben.«10
Entgegengesetzt zur Konkurrenz aus Frankfurt am Main kommentierte die bürgerliche Hauptstadtzeitung Die Welt: »Am Stammheimer Prozess musste sich erweisen, ob der Rechtstaat den Terror mit seinen gesetzlichen Mitteln überzeugend bewältigen kann. Nun ist das Urteil gesprochen und die Antwort kann gegeben werden: Ja, diese exemplarische Aufgabe hat der Rechtsstaat gemeistert.« Was der Zeit und der Frankfurter Allgemeine negativ erschien, lobte die Welt: »Dies war kein Prozess der flammenden Abrechnung mit Polit-Mördern, sondern ein Verfahren quälender Mühsal. Aber am Ende steht ein Urteil, das von der großen Mehrheit der Bürger als angemessen und gerecht gewürdigt werden kann.«11
Mit dem Blick von außen nahm die Neue Zürcher Zeitung die Kritiker des Verfahrens aufs Korn: »Die Bundesrepublik Deutschland, die sich in den bald drei Jahrzehnten ihres Bestehens erfolgreich bemüht hat, auf den Trümmern einer autoritären Diktatur eine neue demokratische Ordnung aufzurichten, wird diffamiert, als sei sie ein Unrechtsstaat par excellence.« Der Zweck dieser Kampagne sei klar, meinte die Schweizer Zeitung: »Sie zielt darauf ab, die bestehende staatliche Ordnung der Bundesrepublik in Verruf zu bringen und damit die anarchistischen und terroristischen Ziele der Angeklagten zu unterstützen.«12
Während also das Verfahren von Stammheim 1977 positiv oder doch zumindest differenziert beurteilt wurde, hat sich die Wahrnehmung ein halbes Jahrhundert später vollkommen verschoben: Der Stammheim-Prozess gilt als unfair, als »Schauprozess«, als das »deprimierendste Strafverfahren in der Geschichte der Bundesrepublik« oder gleich als der »wohl berüchtigtste politische Strafprozess der bundesrepublikanischen Geschichte«.13 Dabei muss man nicht einmal auf jene Publizisten schauen, die den mörderischen Amoklauf der RAF gegen die Gesellschaft als »große deutsche Passionsgeschichte« verklären oder mit der zweideutigen Kalenderweisheit »Gewalt gebiert Gewalt« verharmlosen.14 Das Hamburger Magazin Der Spiegel überschrieb eine Bildergalerie über den Stammheim-Prozess mit den Worten »Beispiellose Blamage für den Rechtsstaat«.15 Auch anerkannte Wissenschaftler wie der Strafrechtler Florian Jeßberger, der selbst die Protokolle des Verfahrens ediert hat, bewerten das Verfahren negativ: »Die Bemühungen um die ›Entpolitisierung‹ des Prozesses« hätten, so der Berliner Juraprofessor, »die Bedeutung und die Dimension des Verfahrens« verkürzt.16
Oft liest man, für diesen Prozess seien »Sondergesetze« erlassen worden, um den Verteidigern die Verteidigung zu erschweren – doch in Wirklichkeit ging es darum, den Missbrauch von Privilegien zu beenden, die ordentliche Verfahren unmöglich gemacht hätten, und diese Gesetze gelten seit 1975 für alle Strafprozesse. Die unzutreffende Formulierung »Sondergesetze« soll wohl den Eindruck erwecken, im Stammheimer Verfahren sei es rechtlich nicht korrekt zugegangen. Bei einem so betont linken Hochschullehrer wie Uwe Wesel konnte derlei 2006 nicht wirklich erstaunen, doch auch die ihrem Auftrag nach zu inhaltlicher Neutralität verpflichtete Nachrichtenagentur dpa übernahm 2017 diese Formulierung.17
Wie ist es zu dieser Verschiebung gekommen? Während der Staat mit dem Urteil das Verfahren als abgeschlossen betrachtete, sahen es RAF-Sympathisanten sowie die meisten Anwälte entgegengesetzt – und führten ihre Kampagnen fort. Bezeichnend für den Umgang mit dem RAF-Terror allgemein war der Episodenfilm Deutschland im Herbst, in dem elf Regisseure, von Rainer Werner Fassbinder bis Volker Schlöndorff, das irreführende Bild einer angeblich dystopischen Bundesrepublik im Jahr 1977 zeichneten. Der Kampf der Anarchisten gegen den vermeintlich präfaschistischen Staat erschien darin auf Hochglanz poliert; unübersehbar etwa, wenn man die verwendeten Bilder von der Trauerfeier für den ermordeten Arbeitgeberpräsidenten Hanns Martin Schleyer vergleicht mit jenen der Beerdigung der im Stammheimer Prozess verurteilten Baader, Ensslin und Raspe nach ihren Suiziden. Die Produktion, beim Publikum nur mäßig erfolgreich, erhielt beim Deutschen Filmpreis 1978 eine Auszeichnung in Gold.
Speziell auf den Prozess bezog sich Reinhard Hauffs kammerspielartiger Film Stammheim von 1985. Rückblickend sagte der Regisseur über seine eigene Arbeit: »Es hätte niemand so intelligente Dialoge schreiben können zu dem Thema wie die, die die Angeklagten zum größten Teil selbst und spontan nicht verfasst, sondern ausgesprochen haben.«18 Doch im Film gibt es keinerlei »intelligente Dialoge«, sondern Verbalattacken der Angeklagten auf die Richter, durchsetzt mit Hass. Der Gegensatz zwischen dem zügellosen Auftreten Andreas Baaders (Ulrich Tukur) und dem sichtlich um Selbstbeherrschung bemühten Vorsitzenden Richter (Ulrich Pleitgen) verzeichnet die reale Situation.
Der niederländische Linksextremist Pieter Bakker Schut, der als Anwalt einen in Utrecht wegen Polizistenmordes verhafteten RAF-Terroristen verteidigte, veröffentlichte 1986 ein Buch über Stammheim, dessen Untertitel die »notwendige Korrektur der herrschenden Meinung« einforderte – ein überflüssiges Begehren, denn in der Öffentlichkeit dominierte bereits das Verdikt über Stammheim.19 Kaum jemand störte, dass der Spiegel über die »eingeschüchterte Nach-Stammheim-Republik« fabulierte.20
Daran hat sich seither wenig geändert. In zahlreichen TV-Dokumentationen über den Linksterrorismus treten immer wieder entlassene Terroristen, Wahlverteidiger und RAF-Sympathisanten als Gewährsleute auf, als könnten sie zur Aufklärung beitragen – aber sie verbreiten immer nur ähnliche Behauptungen wie während des Prozesses.21 Auch wenn Historiker sich mit dem Stammheimer Prozess beschäftigen, erstaunt die Äquidistanz, mit der sie rechtskräftig wegen Unterstützung der RAF verurteilten Terroranwälten wie Richtern gegenübertreten.22 Sicher käme niemand auf die Idee, bei Unterstützern von NS-Verbrechern und ihren Verteidigern ähnlich zu verfahren.
Angesichts dessen scheint es überfällig, den Stammheimer Prozess gegen Andreas Baader, Gudrun Ensslin, Ulrike Meinhof und Jan-Carl Raspe einer historischen Revision zu unterziehen. Die Voraussetzungen dafür sind kurz vor dem fünfzigsten Jahrestag der Eröffnung am 21. Mai 1975 günstig, denn seit kurzem liegen entscheidend wichtige Quellen entweder erstmals in gut nutzbarer Form oder sogar überhaupt vor.
Seit Anfang 2022 ist das 13 939 Seiten lange, weitgehend vollständige Wortprotokoll der 192 Verhandlungstage digital verfügbar – es ist die mit Abstand wichtigste Grundlage für jede Auseinandersetzung mit dem Stammheimer Verfahren, weil daran der Alltag dieses Strafprozesses fast Wort für Wort nachvollzogen werden kann. Von Reinhard Hauffs angeblich »intelligenten Dialogen« findet man darin nichts; dafür verstören die Beschimpfungen, mit denen nicht nur die Angeklagten, sondern ebenso viele ihrer Wahlverteidiger das Gericht bedachten. Das Protokoll war schon seit längerer Zeit im Bundesarchiv und im Staatsarchiv Ludwigsburg zugänglich, allerdings stets mit archivrechtlich bedingten Einschränkungen. Im Rahmen der kommentierten Edition von Florian Jeßberger ist es jetzt ohne nennenswerte Schwärzungen aus Gründen des Datenschutzes benutzbar.
Eine wesentliche Ergänzung zu diesem Protokoll sind die bereits seit 2007 bekannten, rund zwölf Stunden langen Tonbandaufzeichnungen aus dem Gerichtssaal. Es handelt sich um zufällig erhalten gebliebene Reste der Mitschnitte, die für das Wortprotokoll angefertigt worden waren.23 Sie lenken den Blick auf Aspekte, die auch das präziseste Wortprotokoll nie vermitteln kann – etwa Intonation, Lautstärke und Tempo der Sprecher. Erstaunlich ist, dass die Erwartungen, die man nach dem Wortlaut des Protokolls wie nach den zeitgenössischen Berichten der Prozessbeobachter hat, oft nicht zutreffen. Baader schrie jedenfalls nicht regelmäßig, sondern stieß noch übelste Beschimpfungen ruhig, fast sachlich heraus; zwar erhob er die Stimme und erregte sich, aber das war den erhaltenen Aufzeichnungen zufolge eher nicht der Normalfall.24 Ensslin schwäbelte leicht – auch als sie in erschreckend nüchternen Worten die Verantwortung der Angeklagten für die Anschlagsserie im Mai 1972 gestand.25 Dagegen schrien die Wahlverteidiger regelmäßig, störten mit Zwischenrufen und pöbelten herum.26 Im Protokoll war die Tonlage nur ausnahmsweise vermerkt; daher ergänzen die Mitschnitte die Quellenlage entscheidend, obwohl nur ein Bruchteil überliefert ist.27
Erstmals für dieses Buch ausgewertet werden konnten Akten der auf Seiten der Anklage federführenden Bundesanwaltschaft im Bundesarchiv Koblenz, die jetzt freigegeben und digitalisiert wurden.28 Gleichfalls tausende Blatt umfassen die Unterlagen, die hauptsächlich die Hauptabteilung XXII des Ost-Berliner Ministeriums für Staatssicherheit (MfS), zuständig für Terrorismus im Allgemeinen und die Kontakte der SED-Diktatur zur RAF im Besonderen, gesammelt hat; viel von dem Material dürfte der RAF-Verteidiger Klaus Croissant, der sich spätestens 1981 als Inoffizieller Mitarbeiter verpflichtete, an das MfS weitergegeben haben.29 Das Bundesamt für Verfassungsschutz hat das Protokoll zur Verfügung gestellt, das den Besuch von Jean-Paul Sartre bei Andreas Baader im Dezember 1974 dokumentiert – bisher waren nur Auszüge der Öffentlichkeit bekannt, wiewohl das Papier selbst schon 2013 freigegeben worden war.30
Erstmals umfassend genutzt wurde für dieses Buch eine mit Anlagen 112 Seiten starke Ausarbeitung, in der Theodor Prinzing über seine zweieinhalb Jahre als Vorsitzender Richter des 2. Strafsenates reflektierte und auf die Rolle der »Stammheimer Journalisten« einging, jenes knappe halbe Dutzend Prozessbeobachter, die schon während des Verfahrens, vor allem aber in den Jahren nach dem Urteil seine Umwertung vorantrieben.31 Das Material ergänzt weitere Äußerungen Prinzings in Interviews mit verschiedenen Medien um wesentliche Zusammenhänge und ermöglicht eine Perspektive auf das Verfahren unabhängig von der zeitgenössischen und späteren Medienberichterstattung.
Zwei weitere der insgesamt sechs Berufsrichter, die in Stammheim urteilten, haben sich in jüngerer Zeit ausführlich über ihre Erfahrungen geäußert. Prinzings Nachfolger als Vorsitzender Eberhard Foth verfasste mehrere Beiträge in Fachzeitschriften und veröffentlichte 2015 Bemerkungen zu den RAF-Verfahren in Stuttgart-Stammheim; Kurt Breucker, einer der beisitzenden Richter, äußerte sich in Vorträgen und Medienbeiträgen.32 Beide gaben zudem ausführliche Zeitzeugeninterviews.33
Von großer Bedeutung sind die schon länger zugänglichen Unterlagen aus dem Umfeld der Wahlverteidiger im Archiv des Hamburger Instituts für Sozialforschung.34 Weitere bedeutsame Quellen sind an eher unerwarteter Stelle zugänglich geworden: Bettina Röhl, eine der beiden Töchter von Ulrike Meinhof, druckt in ihrer wütenden Abrechnung mit der eigenen Mutter unter dem Titel Die RAF hat Euch lieb seitenweise Passagen aus der vertraulichen Korrespondenz zwischen Meinhof und ihrem Vertrauensanwalt Heinrich Hannover ab – Material, das anders wohl nie die Öffentlichkeit erreicht hätte.35
Da die Justiz in der Bundesrepublik im Prinzip Ländersache ist, genau wie Polizeiangelegenheiten, sind baden-württembergische Archive für die Beschäftigung mit dem Stammheimer Verfahren besonders wichtig. Aus dem Prozess gegen den Terrorhelfer Croissant haben sich im Staatsarchiv Ludwigsburg umfangreiche Ermittlungsakten erhalten, die Einblick in die Methoden der Wahlverteidiger gewähren, bisher aber unbeachtet geblieben sind. Im Hauptstaatsarchiv Stuttgart liegen im Bestand des baden-württembergischen Innenministeriums Unterlagen zum Schutz des Verfahrens sowie in den Akten des Stammheim-Untersuchungsausschusses von 1977/78 Material über den Selbstmord Baaders, Ensslins und Raspes.
Die nun verfügbaren Quellen erlauben es, das tatsächliche Verhalten der Angeklagten, ihrer Wahlverteidiger und der weiteren Verfahrensbeteiligten nachzuvollziehen, namentlich der beiden Vorsitzenden Richter Prinzing und Foth. Die Analyse zeigt, dass die heute vorherrschende negative Wahrnehmung des Stammheimer Prozesses an der Realität vorbeigeht. Die Angeklagten und ihre Wahlverteidiger, die sich über alle Maßen mit ihren Mandanten identifizierten und ein vermeintlich legaler Arm der RAF waren, wollten den Prozess um jeden Preis zu einem Fall »politischer Justiz« umdeuten. Ihr Ziel war es, die Unfähigkeit des Staates zu beweisen, sich an seine eigenen Maßstäbe zu halten. So sollte die angeblich präfaschistische Natur der Bundesrepublik enthüllt werden, deren demokratischer Charakter nur scheinbar sei. Dazu machten sie sich das Strafprozessrecht zu Nutze, das sie oft missbrauchten. Trotz einiger weniger Grenzüberschreitungen der Behörden, von denen die schlimmste das Verfahren beinahe in den letzten Wochen zum Platzen gebracht hätte, gelang das den Angeklagten und ihren Wahlverteidigern nicht.
Im positiven Sinne erinnerungswürdig am Stammheimer Verfahren ist die schier übermenschliche Gelassenheit, mit der es die Richter schafften, die fortwährenden Attacken der Verteidiger zu ertragen und ein ordentliches Strafverfahren zu gewährleisten. »Große Schwierigkeiten waren vorhersehbar«, sagte Theodor Prinzing rückblickend: »Ich hatte bis dahin in meiner Laufbahn als Strafrichter nie irgendwelche Probleme – nicht mit Verteidigern, nicht mit Angeklagten, auch nicht mit den schwierigsten Leuten. Dass es so schlimm werden würde, das hätte niemand gedacht.«36
Indizienkette: 156 Ordner mit rund 50 000 Seiten stehen hinter dem Richtertisch. Es handelt sich um die »wesentlichen Ermittlungsergebnisse« des BKA.
Auftakt
Auftritt
Der Knall war unüberhörbar: Kurz nach Mitternacht vom 2. auf den 3. April 1968 machte ein Kaufhof-Mitarbeiter seinen Kontrollgang durch die Bettenabteilung im 4. Stock des modernen Warenhauses an der Einkaufsstraße Zeil in Frankfurt am Main, als hinter ihm etwas explodierte. Keine zehn Meter entfernt loderte schlagartig eine Feuerwand; Rauchschwaden wälzten sich auf den Mann zu, der Qualm drang in seine Augen und die Nase. Als er losrannte, um sich in Sicherheit zu bringen, nahm er aus dem Augenwinkel wahr, dass es auch in der Spielwarenabteilung brannte; Teddybären, Puppen und Carrera-Bahnen aus Kunststoff standen in Flammen. Um 0.06 Uhr löste die Sprinkleranlage automatisch aus, und weil die Alarmierung der nächsten Feuerwache gut funktionierte, waren keine 60 Sekunden später mehrere Löschzüge auf dem Weg zum Kaufhof vis-à-vis der Hauptwache sowie zum etwa 200 Meter weiter östlich gelegenen kleineren Kaufhaus Schneider, in dem ebenfalls Flammen wüteten.1 Bald darauf klingelte in der Frankfurter Redaktion der dpa das Telefon, und eine Frau sagte: »Gleich brennt’s bei Schneider und im Kaufhof. Es ist ein politischer Racheakt!«2
Die doppelte Brandstiftung mit Zeitzündern war die erste schwere Gewalttat, die Andreas Baader und Gudrun Ensslin begingen, zusammen mit zwei Mittätern, die Randfiguren blieben. Baader, knapp 25 Jahre alt, stammte aus einem bildungsbürgerlichen Münchner Elternhaus, war aber ohne seinen 1945 verschollenen Vater aufgewachsen.3 Er galt als begabt, jedoch faul und aufsässig. Das Gymnasium verließ er ohne Abschluss, für eine Berufsausbildung interessierte er sich nicht. Stattdessen beteiligte er sich 1962 im Alter von 19 Jahren an Jugendkrawallen in Schwabing; er war ein »Aktionstyp«, wie ihn Ulrike Meinhof später gegenüber dem Journalisten Joachim Fest charakterisierte.4 Anschließend ging Baader nach West-Berlin, um sich der Wehrpflicht zu entziehen; 1967 kam er in Kontakt mit der linksradikalen Berliner Kommune 1 um Dieter Kunzelmann, schaffte es aber nicht in ihren inneren Kreis.
Allerdings lernte er hier Gudrun Ensslin kennen, eine drei Jahre ältere Doktorandin. Sie war das mittlere von sieben Kindern eines schwäbischen Pfarrerehepaars, hatte nach dem Abitur zunächst Pädagogik studiert und sich als Volksschullehrerin qualifiziert. Anschließend wollte sie mit einem Stipendium der Studienstiftung des deutschen Volkes eine germanistische Doktorarbeit verfassen.5 Anfang 1967 gehörte sie zur linksradikalen Studentenszene in West-Berlin; im Mai desselben Jahres bekam sie ihren Sohn Felix, dessen Vater sie im Februar 1968 für Andreas Baader verließ.
Im Gefolge der Kommune 1 beteiligten sich Baader und Ensslin an mehreren Provokationen, etwa anlässlich des Staatsaktes für den verstorbenen Paul Löbe, den langjährigen Reichstagspräsidenten der Weimarer Republik. Am 22. März 1968 wurden Fritz Teufel und Rainer Langhans, bekannte Mitglieder der Kommune 1, von dem Vorwurf der Anstiftung zu Brandanschlägen freigesprochen – ihren Aufruf mit der eindeutigen Überschrift »Burn, warehouse, burn« wertete der Richter als »Satire«. Jedoch fügte er hinzu: »Insgesamt gesehen sind die Flugblätter durchaus geeignet, von bestimmten Leuten ernst genommen und als Aufforderung zur Brandstiftung aufgefasst zu werden.«6 Wenige Tage später fuhren Baader und Ensslin nach Frankfurt am Main, um in der Nacht zum 3. April Brandsätze in den beiden Kaufhäusern zu zünden. Der Schaden war enorm, doch die Täter konnten noch am selben Tag festgenommen werden, weil sie im Bekanntenkreis mit ihrer Tat geprahlt hatten.7
Das anschließende Strafverfahren gegen sie in Frankfurt am Main wurde zu einer Art »Happening«.8 Die vier Angeklagten beschimpften das Gericht nach Kräften, obwohl sie betont milde behandelt wurden. In sehr weiter Auslegung der einschlägigen Vorschriften durften sich Baader und Ensslin mehrfach besuchen, obwohl beide nicht verheiratet waren – der zuständige Richter entsprach ihrem Wunsch, weil sie verlobt seien. Vertreten wurden die vier Angeklagten von neun Verteidigern und einem Referendar, unter ihnen die West-Berliner Juristen Horst Mahler und Otto Schily.
Horst Mahler, geboren 1936 als Sohn eines Zahnarztes, hatte seit 1955 mit einem Stipendium der Studienstiftung des deutschen Volkes Jura studiert.9 Nach Abschluss seines Studiums übernahm er im Sommer 1964 die Kanzlei eines verstorbenen Kollegen einschließlich dessen Mandantschaft und profilierte sich als Experte für Wirtschaftsstrafsachen in West-Berlin. Doch er vertrat auch einen KZ-Wächter, der später wegen mindestens zweifachen Mordes eine lebenslange Freiheitsstrafe erhielt.10 Ende 1966 gehörte Mahler zum Umfeld des Sozialistischen Deutschen Studentenbundes (SDS). Nach dem gewaltsamen Tod des Demonstranten Benno Ohnesorg durch eine Kugel des West-Berliner Polizisten und Stasispitzels Karl-Heinz Kurras am 2. Juni 1967 kümmerte sich Mahler fast nur noch um linksradikale Mandanten.11 Dabei beschränkte er sich nicht mehr auf die Tätigkeit als Anwalt, sondern wurde Teil der Szene: Nach dem Attentat auf den Studentenführer Rudi Dutschke im April 1968 führte Mahler die Demonstranten an, die das Gebäude des Springer-Verlages in Kreuzberg zu stürmen versuchten, in dem sie ihren Hauptfeind sahen.12 Dabei kam es zu hohem Sachschaden, doch Menschen wurden nicht getötet oder schwer verletzt.
So weit ging Otto Schily nicht. 1932 geboren, stammte er aus großbürgerlichen Verhältnissen und studierte mit zunächst begrenztem Engagement Jura – erst im zweiten Anlauf bestand er 1962 das erste Staatsexamen. Danach stieß er zu einer eingeführten Kanzlei und beschäftigte sich vorwiegend mit Zivilrecht. 1967 jedoch schwenkte er hart nach links; um diese Zeit freundete er sich mit Mahler an und trat als Hauptmieter einer Wohnung auf, in der die linksradikale Wielandkommune lebte.13 Persönlich gab Schily zwar stets den Bohemien, doch inhaltlich positionierte er sich eindeutig antibürgerlich.
»Fast ein politischer Appell« sei sein Plädoyer für die Angeklagte Ensslin im Kaufhausbrandstifter-Prozess, schrieb ein Beobachter. Deren Versuche, den Widerspruch zwischen den bürgerlichen Idealen und der Realität zu entlarven, hätten laut Schily zu einer »Kette von Frustrationen« geführt. Das »Schlüsselerlebnis Vietnam« habe bei ihr wie bei vielen tausenden anderen Jugendlichen zu »einer fast zur Wut gesteigerten Ohnmacht« geführt. Die Tat sei nicht zu rechtfertigen, räumte der Anwalt ein, relativierte jedoch gleich, die Brandstiftungen seien »wohl aber zu verstehen«. In Vietnam geschähen Verbrechen, die »vielleicht schlimmer als die der Nazis« seien; dagegen hätten die Angeklagten ein Fanal setzen wollen. In einer gewagten Volte bestritt Schily dann den Tatbestand der Brandstiftung; es liege nur vorsätzliche Sachbeschädigung vor, deren Verfolgung an einen Strafantrag durch den Geschädigten gebunden sei. Weil ein solcher Antrag nicht vorliege, müsse das Gericht auf Freispruch erkennen. Zum Plädoyer der Ankläger, die 72 Monate Haft gefordert hatten, erklärte Schily: »In der kapitalistischen Wirtschaft gehört die Vernichtung von Gütern aller Art aus Gründen des Profits zur Tagesordnung. Wie man da sechs Jahre Zuchthaus für einen angebrannten Schrank fordern kann, ist mir unbegreiflich.«14
Während der Verkündung des Urteils gegen die vier Brandstifter kam es zu Tumulten: Im Gerichtssaal protestierten Gesinnungsgenossen und warfen Rauchbomben, und während eines wilden Handgemenges zwischen Justizbeamten, Demonstranten und den Angeklagten versuchten Baader und Ensslin zu flüchten – allerdings ohne Erfolg. Trotzdem wurden alle Angeklagten zu moderaten Haftstrafen von je drei Jahren verurteilt. Der Vorsitzende Richter nahm zu ihren Gunsten an, sie hätten »die Öffentlichkeit aufschrecken« wollen. Gewalt sei jedoch kein Mittel der Auseinandersetzung, mahnte er, zumal Unschuldige hätten geschädigt werden können. Die Kammer wertete die Tatsache, dass die Angeklagten keine kriminelle Vorgeschichte hatten, strafmildernd: »Ideelle Motive« seien ihnen nicht ganz abzusprechen.15
Während des Prozesses hatte die bekannte Journalistin Ulrike Meinhof die Angeklagten in der Haft besucht; Baader faszinierte sie sofort. Meinhof war im Herbst 1934 in ein nationalsozialistisches Elternhaus hineingeboren worden.16 1940 starb ihr Vater, neun Jahre später ihre Mutter; deren Freundin Renate Riemeck wurde Ulrikes wichtigste Bezugsperson und Vormund. Riemeck trat nun als linke Friedensaktivistin auf, verschwieg aber, dass sie 1941 noch vor ihrem 21. Geburtstag der NSDAP beigetreten war – Frauen mussten besonderen Einsatz zeigen, um überhaupt in die zu neun Zehnteln männliche NS-Bewegung aufgenommen zu werden. Unter Riemecks Einfluss radikalisierte sich die noch nicht volljährige Ulrike Meinhof Anfang der 1950er-Jahre und profilierte sich in der aus der DDR gesteuerten Protestbewegung »Kampf dem Atomtod«. Ihr Studium mit Unterstützung der Studienstiftung wollte sie mit einer Dissertation beenden, die sie aber Ende 1960 abbrach.17 Da war sie bereits seit zwei Jahren Mitglied der illegalen KPD, einer westdeutschen Untergrundorganisation der SED, und schrieb in linken Blättern.
Meinhofs Karrieresprungbrett bildete die Zeitschrift Konkret, die der Kommunist Klaus Rainer Röhl in Hamburg herausgab – zunächst mit finanzieller Unterstützung der SED und der Stasi.18 Schnell stieg sie zur Chefredakteurin auf und wurde bald darauf Kolumnistin: bekannteste Stimme des Blattes, jedoch ohne praktische Verpflichtungen. In dieser Zeit lernte Joachim Fest sie kennen und registrierte fasziniert wie irritiert die »drastische Sicherheit ihres Urteils«. Auf ihn wirkten Meinhofs Kolumnen wie »ein plötzlicher, vom leeren Blatt erzeugter Rauschzustand, der ein selbstergriffenes Schweben über aller Erdenschwere zur Folge« hatte.19 Inzwischen warf Konkret, gewandelt zu einer Mischung aus Politblatt und Sexpostille, viel Geld ab, so dass Röhl und Meinhof als Ehepaar mit ihren Zwillingstöchtern luxuriös in Hamburg-Blankenese lebten. Doch sie radikalisierte sich immer stärker und geriet in Konflikt mit ihrem Mann wie der Konkret-Redaktion.
Wegen des bundesweit registrierten Auftretens als Ensslin-Verteidiger musste Schily aus seiner bisherigen Kanzlei ausscheiden. Nun selbstständig, vertrat er immer öfter linksradikale Mandanten, zum Beispiel seinen Freund Horst Mahler und, allerdings nur relativ kurze Zeit, Ulrike Meinhof als »Scheidungsanwalt«.20 Sie hatte sich von Röhl getrennt und war mit ihren Töchtern nach West-Berlin gezogen. Gleichzeitig stieg sie zu einer Art Medienstar auf, trat als Gast in Talkshows auf und schrieb für den Südwestfunk das Drehbuch eines Film über die Erziehung von Heimkindern.21
Die vier verurteilten Frankfurter Brandstifter blieben nur bis Mitte Juni 1969 inhaftiert – dann kamen sie vorläufig frei. Weil bei Ersttätern eine verhängte Strafe ohnehin nach zwei Dritteln zur Bewährung ausgesetzt werde und bereits 14 Monate verbüßt waren, stünden nur noch zehn Monate aus. Das lasse »nicht mehr auf eine Fluchtgefahr schließen«, befand das zuständige Gericht.22 Als Anfang November 1969 der Bundesgerichtshof die von ihren Anwälten beantragte Revision des Urteils verwarf, tauchten Baader, Ensslin und einer der Mittäter ab, unter anderem in Paris und Rom; der vierte Verurteilte hingegen stellte sich.
Ungefähr zur gleichen Zeit begann in West-Berlin das Strafverfahren wegen des Angriffs auf den Springer-Verlag gegen Horst Mahler. Als Verteidiger trat neben Schily der Hamburger Kurt Groenewold auf. Der 1937 geborene Millionenerbe, Spross einer Familie mit großem Immobilienbesitz in der Hansestadt und Berlin, praktizierte seit 1965. Erstmals Aufsehen erregt hatte er 1968 als Verteidiger eines SDS-Aktivisten; bald darauf wurde er bekannt als der Anwalt, »der in Hamburg für die Linke ficht«.23 Groenewold vertrat ebenfalls Ulrike Meinhof in ihrem Scheidungsverfahren.24
Mahler reiste Ende 1969, während des Prozesses wegen der erwartbaren Strafe von maximal zwei Jahren Haft auf Bewährung und trotz der bereits erfolgten zivilrechtlichen Verpflichtung zu einer hohen Schadensersatzzahlung auf freiem Fuß, nach Rom. Dort traf er sich mit den flüchtigen Brandstiftern Baader und Ensslin, denen er 10.000 Mark gab – angeblich Spenden wohlhabender Gesinnungsgenossen. Anschließend überlegten die drei, wie man künftig gegen den Staat kämpfen solle: »Dann haben wir die ganze Nacht diskutiert und haben gesagt, a) wir wollen etwas machen, b) was können wir zusammen machen?« Mahlers Darstellung zufolge wurde man sich einig: »Dann haben wir uns verständigt, ob das reicht, was wir an Konsens hatten. Wir stellten fest, das reicht, und da wurde beschlossen, dass sie nach Berlin kommen und ich in Berlin die Vorbereitungen treffen musste, damit sie hier irgendwo als Illegale leben können.«25
Im Februar 1970 kehrten Baader und Ensslin nach West-Berlin zurück; ihr erstes Quartier nahmen sie in der großzügigen Wohnung von Ulrike Meinhof. Deren achtjährige Zwillingstöchter erfuhren, dass die Polizei nach den Besuchern suchte, weshalb sie nur die Decknamen der beiden Gäste benutzen durften: »Hans« und »Grete«. Der Strafprozess gegen Mahler lief weiter. Dessen Verteidiger versuchten, den Geschädigten Axel Springer zum Täter zu machen; Schily entwickelte sich durch die Vernehmung des in linken Kreisen verhassten Unternehmers zu einer Art Star.26 Jenseits der Szene fand er jedoch keinen Zuspruch: Er wiederhole »in ermüdender Zusammenfassung alle jene Dinge, die die linksorientierten Kreise in Deutschland seit Jahren dem Verleger vorwerfen«, schrieb selbst das linksliberale West-Berliner Boulevardblatt Der Abend, ein scharfer Konkurrent der Springer-Zeitungen, und fügte sarkastisch hinzu: »Eigentlich ist es nur die Mondlandung der Amerikaner, für die man Herrn Springer nicht verantwortlich macht.«27
Schilys Plädoyer im Fall Mahler zeigte, dass er wie im Frankfurter Kaufhausbrandstifter-Prozess 1968 die Sphären von Strafrecht und Politik zu verwischen trachtete. Wenn sein Mandant nicht freigesprochen würde, sagte Schily, müssten sich die Richter im Klaren sein, »dass sie zugleich Tausende von kritischen Studenten« verurteilen, die Gegner des Springer-Verlages seien. Eine Bestrafung Mahlers wegen Aufruhrs und Landfriedensbruchs sei schon deshalb nicht möglich, weil die Demonstranten »rechtmäßig gehandelt« hätten.28 Angesichts des hohen Sachschadens beim gescheiterten Sturm eine bemerkenswerte Ansicht. Nicht einmal mit vereinten Kräften konnten Schily und Groenewold verhindern, dass Mahler am 18. März 1970 wegen Landfriedensbruchs und schweren Aufruhrs verurteilt wurde; jedoch fiel die Strafe mit zehn Monaten Haft auf Bewährung abermals milde aus. Trotzdem verursachten wütende Mahler-Anhänger bei Ausschreitungen weitere Sachschäden in Höhe von 300.000 Mark.29
Am 4. April 1970 ging der untergetauchte Baader, möglicherweise durch den Tipp eines V-Mannes, der West-Berliner Polizei ins Netz und kam ins Gefängnis Plötzensee, um seine 22-monatige Reststrafe abzusitzen. Doch daraus wurden nur fünf Wochen: Horst Mahler, der trotz seiner Verurteilung weiter als Anwalt praktizieren durfte und umgehend nach Baaders Festnahme dessen Vertretung übernommen hatte, erreichte einen begleiteten Ausgang in ein Forschungsinstitut. Wider besseres Wissen gab der Gefängnisdirektor Mahlers Drängen nach, obwohl er dem Strafgefangenen Baader schon vorher weit entgegengekommen war, etwa durch ungewöhnlich häufig genehmigte Besuche. So durfte dreimal in einer Woche eine vermeintliche Lektorin des linken Wagenbach-Verlages zu ihm ins Gefängnis kommen; in Wirklichkeit handelte es sich um Gudrun Ensslin. Insgesamt bekam Baader in 38 Tagen 25-mal Besuch, also deutlich öfter als üblich.
Am 14. Mai 1970 begleiteten zwei Justizbeamte Baader nach Berlin-Dahlem, wo er angeblich mit Ulrike Meinhof Fachliteratur für ein gemeinsames Buchprojekt im Auftrag des Wagenbach-Verlages recherchieren wollte. Nach gut einer Stunde stürmten Gudrun Ensslin, zwei junge Frauen und ein maskierter Mann das kleine Institut. Sie überwältigten die Justizbeamten, ermöglichten Baader die Flucht und verletzten dabei einen Mitarbeiter mit einem Bauchschuss, der für den Rest seines Lebens ein Pflegefall blieb. Auch Meinhof sprang mit aus dem Fenster der Bibliothek.
Fahndung
Die Programmänderung konnte nicht überraschen. Eigentlich hätte am 24. Mai 1970 der Film »Bambule« im ersten TV-Programm ausgestrahlt werden sollen, zur besten Sendezeit am Sonntagabend um 20.15 Uhr. Ulrike Meinhof hatte das Drehbuch geschrieben – doch dann war sie mit Andreas Baader untergetaucht. Der Südwestfunk in Baden-Baden zog den Film am 16. Mai zurück und teilte mit: »Meinhof wird einer Tat beschuldigt, die sich mit verbrecherischen Mitteln gegen unsere Rechtsordnung und Verfassung richtet. Normen also, die Grundlagen einer öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalt sind.«1 Drei Tage später klebten an allen Litfaßsäulen West-Berlins Steckbriefe mit ihrem Porträt; die Belohnung für sachdienliche Hinweise betrug bis zu 10.000 Mark.2
Die West-Berliner Polizei suchte mit Hochdruck nach Baader und Meinhof, nach Gudrun Ensslin und Horst Mahler. Der Anwalt hatte zwar während der Gefangenenbefreiung einen Termin bei Gericht wahrgenommen, aber war unmittelbar danach abgetaucht. Angeblich sei er auf »Urlaub«, wanden sich seine Kanzleipartner vor laufender Kamera.3 Zusammen bildeten Baader, Meinhof, Ensslin und Mahler das »sogenannte Führungsgremium der Gruppe«, wie ein untergeordnetes Mitglied beim Verhör durch die DDR-Staatssicherheit angab.4 Verständigt hatten sich die vier darauf, zunächst die freien Sektoren der geteilten Stadt mit Terror zu überziehen; vorgesehen waren Anschläge auf das US-Hauptquartier in Dahlem und auf ein Büro der Fluggesellschaft PanAm, das eine Filiale der CIA sei. Der Innensenator sollte entführt werden, um »die Freilassung politischer Gefangener zu erzwingen«. Schließlich nahmen sich die Köpfe der Gruppe vor, den Springer-Verlag anzugreifen.
Um dem zunehmenden Fahndungsdruck auszuweichen, reisten im Juni 1970 knapp anderthalb Dutzend junge Deutsche zwischen 19 und 35 Jahren mit schlecht gefälschten arabischen Pässen über Ost-Berlin nach Jordanien. Hier wollten sie in einem Ausbildungslager der palästinensischen Terrororganisation PLO den Umgang mit Waffen und Sprengstoff lernen; geplant war eine »etwa achtwöchige Ausbildung als Einzelkämpfer«, wie ein Stasioffizier die Aussage eines Teilnehmers festhielt.5 Doch weil Baader sich weigerte, die Erwartungen der Gastgeber an Disziplin einzuhalten, endete die Unterweisung schon Anfang August vorzeitig. Zehn Tage später waren die Anarchisten zurück in West-Berlin.
Nicht alle Anhänger der Gruppe waren mit in den Nahen Osten geflogen; einige blieben in Deutschland, darunter der 28-jährige Holger Meins. Der Sohn eines Hamburger Kaufmanns hatte nach dem Abitur den Wehrdienst verweigert und war anerkannt worden. Er begann Kunst zu studieren und spezialisierte sich auf Filme. 1966 geriet er in West-Berlin in Kontakt mit linksextremen Kreisen und radikalisierte sich. Spätestens Anfang 1968 war er gewaltbereit – er drehte einen kurzen Lehrfilm »Wie baue ich einen Molotow-Cocktail?«. Vom Studium relegiert, klagte er sich erfolgreich zurück. Seit Mai 1970 gehörte er zu den aktiven Unterstützern des untergetauchten Baader, aber statt nach Jordanien mitzufliegen, half er bei einem Bombenanschlag auf ein Auto der West-Berliner Polizei, wofür er im August und September gut vier Wochen lang in Untersuchungshaft saß, dann aber wegen mangelnder Beweise freigelassen werden musste. Nun tauchte er unter.6
Auch der fast 26-jährige Jan-Carl Raspe war in Deutschland geblieben. Er stammte aus wohlhabendem Elternhaus, hatte seinen Vater aber nie kennengelernt. In Ost-Berlin aufgewachsen, siedelte er als 16-Jähriger kurz vor dem Mauerbau in den freien Teil der Stadt über, wo er schon länger ein Gymnasium besucht hatte. Er studierte Soziologie und schloss mit der Gesamtnote »gut« ab. Zu diesem Zeitpunkt gehörte er bereits zum radikalen Teil der West-Berliner Studentenschaft und lebte in der antibürgerlichen, pädophilen Kommune 2. Wohl im Spätsommer 1970 schloss sich Raspe Baader an und ging im November in den Untergrund. Wegen seines Basteltalents galt er als der »Techniker« der Anarchisten.7
Die inzwischen etwa 20 Mitglieder starke Gruppe begann, Autos zu stehlen und auf dem Schwarzmarkt Waffen zu kaufen. Nach drei fast gleichzeitigen Banküberfällen in West-Berlin am 29. September intensivierte die Polizei die Fahndung noch einmal. Die Gesamtbeute betrug mehr als 217.000 Mark, obwohl Ulrike Meinhof in einer Bank versehentlich rund 97.000 Mark hatte liegen lassen und mit nur 8115 Mark in einer Tüte verschwunden war. Das geraubte Geld reichte trotzdem, um längere Zeit in der Illegalität zu leben. Der Großteil der Gruppe wich dem Fahndungsdruck über die Transitstrecken aus West-Berlin in die Bundesrepublik aus, wobei die DDR-Staatssicherheit an den Kontrollstellen offenbar nachsichtig war.8 In Westdeutschland stahlen sie weiter Autos und begannen, in abgelegenen Ämtern einzubrechen und Blankopapiere zu entwenden.