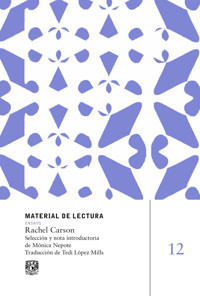12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: C. H. Beck
- Kategorie: Lebensstil
- Sprache: Deutsch
Der stumme Frühling» erschien erstmals 1963. Der Titel bezieht sich auf das Märchen von der blühenden Stadt, in der sich eine seltsame, schleichende Seuche ausbreitet. Das spannend geschriebene Sachbuch wirkte bei seinem Erscheinen wie ein Alarmsignal und avancierte rasch zur Bibel der damals entstehenden Ökologie-Bewegung.
Zum ersten Mal wurde hier in eindringlichem Appell die Fragwürdigkeit des chemischen Pflanzenschutzes dargelegt. An einer Fülle von Tatsachen machte Rachel Carson seine schädlichen Auswirkungen auf die Natur und die Menschen deutlich. Ihre Warnungen haben seither nichts von ihrer Aktualität verloren.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Rachel Carson
DER STUMME FRÜHLING
Aus dem Amerikanischen vonMargaret Auer
Mit einem Vorwort von Jill Lepore
C.H.Beck
Zum Buch
Der stumme Frühling erschien erstmals 1962. Der Titel bezieht sich auf das Märchen von der blühenden Stadt, in der sich eine seltsame schleichende Seuche ausbreitet. Das spannend geschriebene Buch wirkte bei seinem Erscheinen wie ein Alarmsignal und avancierte rasch zur Bibel der damals entstehenden Ökologie-Bewegung.
Zum ersten Mal wurde hier in einem eindringlichen Appell die Fragwürdigkeit des chemischen Pflanzenschutzes aufgezeigt. An einer Fülle von Tatsachen machte Rachel Carson seine schädlichen Auswirkungen auf die Natur und die Menschen deutlich. Ihre Warnungen und ihr ökologisches Denken haben seither nichts von ihrer Aktualität verloren.
Über die Autoren
Rachel Carson (1907–1964) erlangte als Meeresbiologin und Schriftstellerin weltweite Anerkennung durch ihre Bücher Geheimnisse des Meeres, Am Saum der Gezeiten sowie vor allem durch Der stumme Frühling.
Jill Lepore (*1966) ist Professorin für Amerikanische Geschichte an der Harvard University und schreibt seit 2005 regelmäßig für The New Yorker. Ihr jüngstes Buch Diese Wahrheiten. Eine Geschichte der Vereinigten Staaten erscheint im Herbst 2019 bei C.H.Beck.
Inhalt
Der WatvogelDas Vermächtnis von Rachel Carson
Vorwort von Jill Lepore
1. KAPITEL: Ein Zukunftsmärchen
2. KAPITEL: Die Pflicht zu erdulden
3. KAPITEL: Elixiere des Todes
4. KAPITEL: Oberflächengewässer und unterirdische Fluten
5. KAPITEL: Das Erdreich
6. KAPITEL: Das grüne Kleid der Erde
7. KAPITEL: Unnötige Verwüstung
8. KAPITEL: Und keine Vögel singen
9. KAPITEL: Der Tod zieht in die Flüsse ein
10. KAPITEL: Gifte regnen vom Himmel
11. KAPITEL: Das übertrifft die kühnsten Träume der Borgias
12. KAPITEL: Der Preis, den der Mensch zu bezahlen hat
13. KAPITEL: Durch ein schmales Fenster
14. KAPITEL: Jeder vierte …
15. KAPITEL: Die Natur wehrt sich
16. KAPITEL: Das erste Grollen einer Lawine
17. KAPITEL: Der andere Weg
Dank
Literaturverzeichnis
2. Kapitel: Die Pflicht zu erdulden
3. Kapitel: Elixiere des Todes
4. Kapitel: Oberflächengewässer und unterirdische Fluten
5. Kapitel: Das Erdreich
6. Kapitel: Das grüne Kleid der Erde
7. Kapitel: Unnötige Verwüstung
8. Kapitel: Und keine Vögel singen
9. Kapitel: Der Tod zieht in die Flüsse ein
10. Kapitel: Gifte regnen vom Himmel
11. Kapitel: Das übertrifft die kühnsten Träume der Borgias
12. Kapitel: Der Preis, den der Mensch zu bezahlen hat
13. Kapitel: Durch ein schmales Fenster
14. Kapitel: Jeder vierte …
15. Kapitel: Die Natur wehrt sich
16. Kapitel: Das erste Grollen einer Lawine
17. Kapitel: Der andere Weg
Namen- und Sachregister
Fußnoten
Für Albert Schweitzer
«Der Mensch hat die Fähigkeit, vorauszublicken und vorzusorgen, verloren. Er wird am Ende die Erde zerstören.»
Albert Schweitzer
Ich wollte den Text nicht mit Fußnoten belasten, aber ich weiß, dass sich viele meiner Leser sicherlich näher mit den erörterten Themen befassen möchten. Daher habe ich eine Liste meiner wichtigsten Quellen, nach Kapiteln und Seitenzahl geordnet, in einem Anhang am Schluss des Buches angeführt.
R. C.
Der WatvogelDas Vermächtnis von Rachel Carson
Vorwort von Jill Lepore
Das Haus, auf einer Insel in Maine, sitzt auf einer Felskante über dem Meer wie ein Adlerhorst. Unter der Veranda mit der weißen Brüstung führt die rutschige Klippe hinunter zum Watt, das mit klumpigem Seegras und Blasentang gesprenkelt ist, glitschig wie ein Haufen Schlangen. Strandschnecken klammern sich an Felsen; Muscheln klemmen sich zusammen wie kleine Geldbörsen. Eine Seemöwe landet auf einem zottelig bewachsenen Felsen, plustert sich auf und kauert sich dann in den beißenden Wind, der über das Wasser pfeift, während oben auf der Klippe moosbewachsene Bäume – Fichten und Tannen und Birken – seufzen und stöhnen wie alte Männer an einem feucht-kalten Morgen.
«Die Meeresküste ist eine alte Welt», schrieb Rachel Carson in jenem Haus an einem Kiefernschreibtisch, der in der Ecke eines Raumes stand, wo die Verandatür in jedem Windhauch erzitterte, als bettele sie darum, man möge sie entriegeln. Carson war eine gefeierte Autorin, lange bevor sie ihr letztes Buch Silent Spring (Der stumme Frühling) im Jahr 1962 veröffentlichte: die Wissenschaftspoetin des Meeres.
Ihr Aufsatz «Undersea», mit dem sie ihren Durchbruch feierte, erschien 1937 in der Zeitschrift The Atlantic. Darin fragte sie: «Wer kennt den Ozean? Weder Sie noch ich, mit unseren erdgebundenen Sinnen kennen wir nicht den Schaum und Sog der Gezeiten, die über die Krabben in ihrem mit Seetang getarnten Heim im Gezeitentümpel hinwegziehen; oder das langsame Auf und Ab der Hochsee, wo wandernde Fischschwärme nach Beute suchen und selbst zur Beute werden und wo Delfine ihre Atemluft aus der Atmosphäre über der Wasseroberfläche holen.» Der Leser wird von der Strömung ihrer Sprache mitgerissen, hingerissen, einem wässrigen Sprachbild aus Mollusken und Kiemenatmern und Rollwürmern und Krabben, Plankton und Lippfischen, mit Salzwasser durchtränkt, von Felsen umgeben, festgewachsen, fächerförmig, unermesslich tief, mit Rückenstacheln oder Strahlen bewehrt, kieselig und phosphoreszierend, während hier und da «ein Hummer sich mit geschickter Vorsicht durch das ewige Zwielicht tastet».
Die Landratte Der stumme Frühling ist ein folgenreiches Buch: Es begründete die Umweltbewegung und gab den Anstoß für mehrere wichtige Umweltgesetze, die zwischen 1963 und 1972 in den USA verabschiedet wurden; und es führte im Jahr 1970 zur Gründung der US-Umweltbehörde, der Environmental Protection Agency. Die Anzahl der Bücher, die so viel Gutes in der Welt bewirkt haben, kann man an den Armen eines Seesterns abzählen. Doch in ihren meisten anderen Büchern und Aufsätzen schrieb Carson über das Meer. Als junge Frau wäre sie überrascht gewesen, dass man sich später an sie vor allem als Autorin eines Buches über die Gefahren von Gartenpestiziden wie DDT erinnern würde. Damals arbeitete sie als Meeresbiologin für das US Bureau of Fisheries, die US-Fischereibehörde, schrieb Memos über Maifische und über die neugierigen Schnauzen der Wale. Ihr Spezialgebiet während des Studiums war der Amerikanische Aal gewesen.
Rachel Carson war sehr stolz auf Der stumme Frühling. Dennoch ist es erschütternd, dass eine neue Sammlung ihrer Schriften, die Sandra Steingraber unter dem Titel Silent Spring and Other Writings on the Environment herausbrachte, keinen einzigen ihrer Texte über die See enthält. Steingraber schließt diese Texte mit dem Hinweis aus, dass «Carsons Bücher über die See zwar gelegentlich auf Umweltbedrohungen hinweisen, aber nicht explizit zum Handeln auffordern». Bei Prosatexten, deren Stärke in Erkenntnissen und Staunen liegen, ist die politische Überzeugungskraft ein eigenartiges Wertmaß. In ihrem ersten Buch Under the Sea-Wind (1941, auf Deutsch als Unter dem Meerwind 1947 erschienen) schrieb Carson: «An der Meeresküste zu stehen – das Strömen von Ebbe und Flut zu spüren – den Hauch des Nebels zu atmen, der über eine weite Salzmarsch streift – dem Flug der Ufervögel zu folgen, die seit vielen Tausenden von Jahren über die Brandungslinien der Kontinente steigen – den Zug der alten Aale und der jungen Alse zu erleben, wenn sie ins Meer zurückkehren –, bedeutet solches Wissen nicht Wissen um Dinge, die ebenso ewig sind wie irgendein anderes Leben unserer Erde?»
Sie hätte Der stumme Frühling nicht schreiben können, wenn sie vorher nicht jahrzehntelang mit hochgerollten Hosenbeinen über Felsen geklettert, durch Gezeitentümpel gewatet wäre und dabei darüber sinniert hätte, wie sich Dinge gegenseitig beeinflussen und wie «das Salz der Kontinente im Lauf der Zeitalter das Wasser der See bitter werden ließ». Am liebsten zog sie bei Dunkelheit mit einer Taschenlampe los in die pechschwarze Nacht.
Alles Leben kommt aus dem Meer, betont Carson immer wieder und nennt es «die große Mutter allen Lebens». Auch wir Landsäugetiere, mit unseren kalkgehärteten Skeletten und unserem salzigen Blut, entstehen im Ozean einer Gebärmutter. Carson selbst konnte nicht schwimmen. Sie mochte keine Boote. In ihrer Kindheit hatte sie den Ozean noch nicht einmal von Ferne gerochen. Sie träumte von ihm: «Ich habe mir als Kind vorgestellt, wie das Meer wohl aussah, wie sich die Wellen anhörten.»
Rachel Carson wurde im Jahr 1907 im westlichen Pennsylvania in der Nähe des Flusses Allegheny geboren. Die Familie lebte in einem zweistöckigen, mit Schindeln verkleideten Haus auf einer 26 Hektar großen Farm mit einer Obstwiese voller Apfel- und Birnbäume, einem Hof mit einem Schwein, einem Pferd sowie ein paar Hühnern und Schafen. In den Anfangszeilen von Der stumme Frühling beschreibt sie einen ganz ähnlichen Ort:
Es war einmal eine Stadt im Herzen Amerikas, in der alle Geschöpfe in Harmonie mit ihrer Umwelt zu leben schienen. Die Stadt lag inmitten blühender Farmen mit Kornfeldern, deren Gevierte an ein Schachbrett erinnerten, und mit Obstgärten an den Hängen der Hügel, wo im Frühling Wolken weißer Blüten über die grünen Felder trieben. Im Herbst entfalteten Eiche, Ahorn und Birke eine glühende Farbenpracht, die vor dem Hintergrund aus Nadelbäumen wie flackerndes Feuer leuchtete. Damals kläfften Füchse im Hügelland, und lautlos, halb verhüllt von den Nebeln der Herbstmorgen, zog Rotwild über die Äcker.
Sie war das jüngste von drei Kindern und verbrachte ihre Kindheit auf den Feldern und in den Hügeln, wo ihre Mutter ihr Pflanzennamen und Tierrufe beibrachte. Sie las die Bücher von Beatrix Potter und Der Wind in den Weiden. Mit acht Jahren schrieb sie eine eigene Geschichte über zwei Zaunkönige auf der Suche nach einem Zuhause. «Ich kann mich an keine Zeit erinnern, auch nicht in frühester Kindheit, als ich nicht davon ausging, dass ich Schriftstellerin werden würde», sagte sie. «Ich weiß nicht, warum.» In Geschichten, die sie als Teenager schrieb, beschreibt sie ihre Entdeckungen: «Das Nest der Virginiawachtel, voll mit Eiern, die luftige Kinderstube des Trupials, das Zweiggerüst, das der Kuckuck als Nest bezeichnet, und das mit Flechten bedeckte Zuhause des Kolibris.»
Doch dann verkaufte Carsons Vater, der, außer mit seinem Rosengarten, mit kaum etwas Erfolg hatte, Teile der Farm. Auf den Wiesen wurden Häuser gebaut und Geschäfte eröffnet. Der kohlenschwarze Pesthauch drang aus dem verrauchten Pittsburgh letztendlich auch in Carsons Kindheit vor. Dieser Verlust ermöglichte es ihr später mit solcher Klarheit in den Eröffnungssätzen von Der stumme Frühling das Schicksal einer imaginären amerikanischen Kleinstadt zu beschreiben, die mit DDT besprüht wird:
Dann tauchte überall in der Gegend eine seltsame schleichende Seuche auf, und unter ihrem Pesthauch begann sich alles zu verwandeln. Irgendein böser Zauberbann war über die Siedlung verhängt worden: Rätselhafte Krankheiten rafften die Kükenscharen dahin; Rinder und Schafe wurden siech und verendeten. Über allem lag der Schatten des Todes. Die Farmer erzählten von vielen Krankheitsfällen in ihren Familien. In der Stadt standen die Ärzte immer ratloser den neuartigen Leiden gegenüber, die unter ihren Patienten auftraten. Einige Menschen waren plötzlich und unerklärlicherweise gestorben, nicht nur Erwachsene, sondern sogar Kinder, die mitten im Spiel jäh von Übelkeit befallen wurden und binnen weniger Stunden starben.
Rachel Carson verließ ihr Zuhause, um am Pennsylvania College for Women Englisch zu studieren. Sie schickte Gedichte an verschiedene Zeitschriften – Poetry, The Atlantic, Good Housekeeping, The Saturday Evening Post – und legte dann eine Sammlung von Ablehnungsschreiben an, seltsam wie Schmetterlinge. Ihre Mutter verkaufte Äpfel, Hühner und das Familienporzellan, um die Studiengebühren zu bezahlen, und fuhr jede Woche von der Farm zum College, um die Arbeiten ihrer Tochter zu tippen (und später auch Carsons Bücher). Ein Grund war wohl, dass sie sich, wie so viele Mütter, selbst nach Bildung sehnte.
Im Jahr 1928 nahm Carson, die von ihren Freunden Ray genannt wurde, an einem Abschlussball am College teil, zeigte aber nie das geringste romantische Interesse an Männern. Allerdings schwärmte sie leidenschaftlich für ihre Biologiedozentin, Mary Scott Skinker. Carson wechselte daraufhin das Hauptfach und folgte Skinker für ein Forschungsprojekt im Sommer nach Woods Hole, wo sie zum ersten Mal das Meer sah. Tagsüber suchte sie stundenlang die Küste ab, verlor sich in dieser neuen Welt, fasziniert von jedem Lebewesen, das sie fand. Nachts beobachtete sie im Wasser jenseits der Hafenanlage Borstenwürmer, deren Borsten im Mondlicht glitzerten, bei der Paarung.
Carson machte ihren Master-Abschluss in Zoologie an der Johns Hopkins University und begann 1932 mit ihrer Doktorarbeit. Ihre ganze Familie zog zu ihr nach Baltimore: ihre Mutter, ihr kränkelnder Vater, ihre geschiedene Schwester und ihre beiden kleinen Nichten. Sie war die einzige Erwerbstätige in ihrer Familie, arbeitete als Laborassistentin und unterrichtete Biologie und Zoologie an der Johns Hopkins University und an der Universität von Maryland. Auf dem Höhepunkt der Wirtschaftskrise lebte die Familie eine Zeitlang nur von Äpfeln. Schließlich verließ Carson die Universität, nahm einen besser bezahlten Job bei der US-Fischereibehörde an und verdiente noch ein wenig extra Geld mit Artikeln, die sie an die Baltimore Sun verkaufte. Ihre Biografin Linda Lear schrieb, in einem dieser Artikel sei es um Austernzucht gegangen, «in drei weiteren setzte sie ihre Untersuchungen zur misslichen Lage der Maifische fort».
Im Jahr 1935 starb Carsons Vater und zwei Jahre später auch ihre ältere Schwester. Danach musste sich Carson allein um ihre Mutter und ihre beiden elf und zwölf Jahre alten Nichten kümmern. Später adoptierte sie noch ihren Großneffen, der mit vier Jahren zur Waise geworden war. Diese Verpflichtungen frustrierten Carson zeitweise, aber noch viel mehr frustrierten sie ihre Biografen. Für Linda Lear, die Autorin von Rachel Carson: Witness for Nature (1997), die auch die exzellente Anthologie Lost Woods: The Discovered Writing of Rachel Carson (1998) herausgab, waren Carsons familiäre Verpflichtungen – und insbesondere die Kinder – nur eine Last, die «ihr ihre Privatsphäre nahm und ihr körperliche und emotionale Energie raubte». Lear meint das nicht böse, mehr als Begründung, warum Carson nicht mehr schrieb und warum sie, abgesehen von ihren Artikeln für die Sun, kein einziges Manuskript rechtzeitig abgab. Aber man gewinnt eine eigene Weisheit, wenn man sich um andere Menschen kümmert. Carson lernte, die Welt als wunderbaren, wilden, kreatürlichen und verletzlichen Ort zu sehen, dessen Einzelteile alle miteinander verbunden sind. Diesen Blick lernte sie nicht nur durch ihre umfangreichen wissenschaftlichen Forschungen, sondern auch durch ein Leben voller Sorge um andere, in dem sie alte Menschen und kleine Kinder pflegte, die Stirn eines sterbenden Mannes kühlte, verwaiste Mädchen zu Bett brachte und für einen einsamen kleinen Jungen Abendessen kochte. Das Häusliche durchdringt Carsons Sicht auf die Natur. «Die Wildnis verschwindet, weil ihr Zuhause zerstört wird, so wird gesagt», schrieb sie 1938. «Aber das Zuhause der Wildnis ist auch unser Zuhause.» Ihre Bindungen prägten ihre Sicht auf die Welt.
Kurz nach ihrer Einstellung bei der Fischereibehörde entwarf Rachel Carson einen elfseitigen Artikel über das Leben im Meer mit dem Titel «The World of Waters». Ihr Vorgesetzter fand ihn zu gut für eine Behördenbroschüre und schlug ihr vor, den Text bei The Atlantic einzureichen. Dort wurde der Artikel tatsächlich veröffentlicht, unter dem Titel «Undersea». Danach begann Carson mit der Arbeit an ihrem ersten Buch, auch dank der Großzügigkeit der Wirtschafts- und Sozialreformen von Präsident Roosevelt, denn sie schrieb ihre Notizen auf Papier der National Recovery Administration, einer für die Durchführung der Reformen zuständigen Behörde. Gleichzeitig arbeitete sie für den im Jahr 1939 umbenannten US Fish and Wildlife Service. Under the Sea-Wind erschien wenige Wochen bevor die Japaner Pearl Harbor bombardierten – und ging unter wie ein Schlachtschiff.
Während des Krieges brachte Carson Hausfrauen bei, wie man wenig bekannte Fischsorten statt des rationierten Fleischs auf den Tisch bringen konnte. Doch das reichte ihr nicht. Gleichzeitig reichte sie bei Reader’s Digest einen Text über DDT ein. In Kriegszeiten hatten Chemiefirmen Pestizide an das Militär verkauft, um Läuse zu bekämpfen und so die Ausbreitung von Typhus zu verhindern. Nach dem Krieg verkauften die Firmen DDT und andere Pestizide auf dem freien Markt für den Einsatz auf Äckern und in Gärten. Carson las staatliche Berichte über den Fisch- und anderen Tierbestand und war beunruhigt: DDT war nie für den zivilen Einsatz getestet worden, und offenbar starben an dem Gift nicht nur Insekten, sondern auch viele andere Lebewesen. Daher reichte sie einen Artikel über Pestizide ein, in dem es darum ging, «ob [das Gift] möglicherweise das empfindliche Gleichgewicht der Natur stört, wenn man es unklug einsetzt». Aber Reader’s Digest war nicht interessiert.
Überwiegend nachts schrieb Carson an einem weiteren Buch, in dem sie Lesern die neuen Erkenntnisse über eine Revolution der Meeresbiologie und Tiefseeforschung nahebringen wollte, indem sie eine Ökologie des Ozeans beschrieb. «Die Meeresoberfläche ist in Zonen eingeteilt, auch wenn sie für uns bar jeglicher Markierungen und weglos erscheint», erklärte sie. «Fische und Plankton, Wale und Oktopusse, Vögel und Meeresschildkröten, sie alle sind untrennbar mit bestimmten Arten von Wasser verbunden.» Doch der Stand der Forschung ließ noch manche Fragen offen: «Wale tauchen plötzlich vor den Küsten auf, wo es von krabbenartigem Krill wimmelt. Keiner weiß, woher oder über welche Wege.»
Carson hatte sich ein derart ausgreifendes Thema und Forschungsfeld ausgesucht, dass sie ihrem neuen Buch die Arbeitstitel «Out of My Depth» (Bedeutung etwa: «Bin überfordert») oder «Carson at Sea» («Carson ratlos») gab. Außerdem hatte sie eine düstere Vorahnung. Im Jahr 1946 hatte sie sich eine Zyste aus der linken Brust entfernen lassen. Zwei Jahre später entdeckte ihr Arzt eine weitere Zyste. Nach weiteren Operationen ging sie an die Küste, nach Nags Head in North Carolina. «Habe Spuren eines Küstenvogels gefunden, wahrscheinlich ein Sandläufer, und folgte ihnen ein wenig, bis sie ins Wasser abbogen und von den Wellen bald ausgelöscht wurden», schrieb sie in ihr spiralförmig gebundenes Notizbuch. «Wie viel das Meer doch wegwäscht und macht, als wäre es nie gewesen.»
Nach der Fertigstellung des Buches lehnte The Atlantic es allerdings ab, einen Auszug zu veröffentlichen, mit der Begründung, der Text sei zu poetisch. William Shawn, der Chefredakteur von The New Yorker, teilte diese Vorbehalte nicht. The Sea Around us (Geheimnisse des Meeres) erschien in Shawns Zeitschrift 1951 als dreiteiliges Profil der See und war damit das erste Profil im New Yorker, das etwas anderes als eine Person beschrieb. Die Redaktion wurde mit Leserbriefen überschwemmt: «Am Anfang dachte ich ‹O Mann, was soll das denn›, doch dann war ich verzaubert», schrieb ein Leser – und viele erklärten den Text zum Unvergesslichsten, das je in der Zeitschrift veröffentlicht worden war, und, nach John Herseys «Hiroshima», zum Zweitbesten.
Geheimnisse des Meeres gewann den National Book Award und hielt sich über rekordverdächtige 86 Wochen auf der Bestsellerliste der New York Times. Daraufhin wurde Unter dem Meerwind neu aufgelegt und jetzt ebenfalls zum Bestseller. «Wer ist die Autorin?», wollten die Leser wissen. Carsons kraftvoll geschriebenes Werk ließ männliche Kritiker mutmaßen, die Autorin müsse halb Mann sein. Ein Reporter des Boston Globe schrieb: «Eine Frau, die über die sieben Meere und ihre Wunder geschrieben hat, stellen sich viele wahrscheinlich als einen kräftigen, sportlichen Typ vor. Aber so ist Miss Carson nicht. Sie ist klein und schlank, mit kastanienbraunem Haar und Augen, deren Farbe an das Grün und Blau von Meerwasser erinnert. Sie ist schlank und feminin, trägt zartrosa Nagellack und verwendet Lippenstift und Puder gekonnt, aber sparsam.»
Carson ließ sich davon nicht beirren. Sie kündigte ihren Job bei der Fischereibehörde und begann, die Politik der US-Bundesregierung infrage zu stellen. Als Eisenhowers neuer Innenminister, ein Geschäftsmann aus Oregon, Wissenschaftler in der Abteilung durch politische Funktionäre ersetzte, schrieb Carson einen Brief an die Washington Post: «Hier zeigt sich deutlich ein bedenkliches Muster, nach dem die Regierung kompetente Fachleute mit langjähriger Erfahrung durch Parteigänger ersetzt.»
Aber die größte Veränderung, die Carsons Erfolg mit sich brachte, war das winzige Stückchen Land auf einer Klippe in Maine, das Carson mit den Einnahmen aus ihrer Meeresbiografie kaufte und auf das sie ein kleines Häuschen baute, ein Walden am Meer. Tauchen ging Carson nur ein einziges Mal. Sie trug dabei einen 38 Kilogramm schweren Tauchhelm und verbrachte 15 Minuten in zweieinhalb Metern Tiefe. Ihre wahre Liebe galt der Küste: «Ich kann mir keinen aufregenderen Ort vorstellen, als unten in der Gezeitenzone, wenn die Ebbe am frühen Morgen einsetzt und die Welt mit Salzgeruch, Wassergeräuschen und weichem Nebel erfüllt ist.» Die Tiefen des Meeres ergründete sie in Büchern; die Wände ihres Hauses in Maine stehen voll mit ihnen, zwischen Körben und Auslagen voller Meerglas und Muscheln und vom Meer geglätteten Steinen. Von diesem Aussichtspunkt aus schrieb sie einen Teil ihres nächsten Buches, The Edge of the Sea (Am Saum der Gezeiten).
Sie schrieb: «An fast allen Küstenbüchern für Amateure stört mich, dass sie dem Leser viele kleine, unabhängige Informationsbröckchen zu verschiedenen Lebewesen liefern, die aber nicht in ihre Lebensumwelt eingeordnet werden.» Carsons Buch über die Küste war anders, sie beschrieb den Küstenbereich als System, als Ökosystem, ein Wort, das die meisten Leser noch nie zuvor gehört hatten und das Carson selbst selten benutzte, sondern als eine Welle von Bewegung und Geschichte heraufbeschwor:
Sosehr sich diese Küsten in ihrer Natur und in den Bewohnern, denen sie eine Heimat bieten, unterscheiden, in meinen Gedanken verschmelzen sie durch die allen gemeinsame Berührung mit der See zu einer Einheit. Denn was sie jetzt, zu meiner Zeit, meinem Empfinden nach trennt, sind nur die Unterschiede eines flüchtigen Augenblicks im Strom der Zeit und in den weitschwingenden Rhythmen des Meeres. Einst war dieses Felsufer zu meinen Füßen eine Sandebene; dann siegte der Ozean und schuf eine neue Küstenlinie. Und in einer schattenhaft fernen Zukunft wird die Brandung diese Felsen zu Sand zermahlen und das Steilufer wieder in seinen früheren Zustand verwandeln. So vereinen und überblenden sich vor meinem geistigen Auge diese Uferformen. Sie ziehen wie in einem Kaleidoskop in ihrer wechselnden Gestalt vorüber, bei der es keinen endgültigen, letzten und unveränderlichen Zustand gibt – die Züge im Antlitz der Erde sind wie die See selbst ewig im Fluss.
Paul Brooks, Carsons Lektor bei Houghton Mifflin, sagte einmal, sie sei als Schriftstellerin wie «der Steinmetz, der die Kathedrale nie aus den Augen verliert». Sie ging bei der Überarbeitung ihrer Texte ebenso akribisch vor wie er. «Saß am Kapitel ‹Sandküste› mit dem Bleistift zwischen den Zähnen», schrieb er ihr. Aber sie mochte es nicht, korrigiert zu werden, und warnte Brooks: «Ich neige dazu, scheinbar seltsame Umkehrungen von Wörtern oder Sätzen zu verwenden» – ihre salzgetränkten Sprachbilder –, «aber sie sind überwiegend charakteristisch für meinen Stil, und ich will nicht, dass sie geändert werden.»
Beim Schreiben am Meeresufer verliebte sich Rachel Carson. Sie lernte Dorothy Freeman 1953 auf der Insel in Maine kennen, wo Carson ihr Ferienhaus hatte und die Freemans seit Jahren ihre Sommer verbrachten. Carson war 46 Jahre alt, Freeman 55. Freeman war verheiratet und hatte einen erwachsenen Sohn. Wenn die beiden Frauen nicht zusammen waren, schrieben sie sich atemlose, leidenschaftliche Briefe. «Warum behalte ich deine Briefe?», schrieb Carson in jenem Winter an Freeman. «Warum? Weil ich dich liebe!» Carson bewahrte ihre Lieblingsbriefe unter dem Kopfkissen auf. «Ich liebe dich mehr, als ich sagen kann», schrieb Freeman an Carson. «Meine Liebe ist grenzenlos wie das Meer.»
Beide Frauen machten sich Sorgen darüber, wem ihre Briefe in die Hände fallen konnten. Oft schickten sie im selben Umschlag zwei verschiedene Briefe, einen für die Familie (Carson für ihre Mutter, Freeman für ihren Mann), einen für die private Lektüre, der wahrscheinlich am Ende im «Schließfach» landete – ihrem Codewort für Briefe, die vernichtet werden sollten. «Hast du sie ins Schließfach gelegt?», fragte Carson Freeman. «Falls nicht, dann mache es bitte.» Später, als Carson ihre Papiere zusammenstellte, die sie der Yale-Universität versprochen hatte, las Freeman, dass Papiere der Schriftstellerin Dorothy Thompson, die kürzlich geöffnet worden waren, Hinweise auf ihre Beziehungen zu Frauen enthielten. Freeman schrieb an Carson: «Liebes, bitte benutze schnell das Schließfach.» Sie warnte Carson, dass ihre Briefe «für Menschen, die nach Ideen suchen, bedeutsam sein könnten». (Sie haben nicht alle zerstört: Freemans Enkelin gab die Briefe, die überdauert hatten, heraus und veröffentlichte sie 1995.)
Nach der Veröffentlichung von The Edge of the Sea im Jahr 1955, einem weiteren Bestseller, der ebenfalls im New Yorker in Fortsetzungen veröffentlicht wurde, wollte Shawn, dass Carson ein neues Buch schrieb, und zwar über nichts Geringeres als «das Universum». Unter anderen Umständen hätte sie das Projekt vielleicht sogar in Angriff genommen. Aber dann starb ihre Nichte Marjorie an Lungenentzündung, und Carson adoptierte Marjories vierjährigen Sohn Roger, der laut Carson «so viel Energie hat wie siebzehn Grillen». Sie stellte längere Schreibprojekte zurück, bis sie, etwas widerwillig, mit der Arbeit an einer Studie begann, deren Arbeitstitel lange Zeit «Menschheit gegen Erde» lautete.
Im Januar 1958 überschwemmten Mitglieder eines Bürgerkomitees gegen Massenvergiftungen Zeitungen im Nordosten der Vereinigten Staaten mit Leserbriefen, in denen sie auf die schrecklichen Folgen lokaler und landesweiter Massenausbringung von Insektiziden durch Sprühflugzeuge aufmerksam machten: Alles starb, außer den Insekten. Die Hausfrau und Vogelbeobachterin aus Massachusetts Olga Owens Huckins bezeichnete die Programme als «unmenschlich, undemokratisch und wahrscheinlich verfassungswidrig» und schrieb einen Brief an Carson. Der Ausschuss hatte in New York Klage eingereicht, und Huckins schlug vor, Carson solle über die Angelegenheit berichten.
Rachel Carson hatte seit der Bombardierung Hiroshimas und dem ersten zivilen Einsatz von DDT im Jahr 1945 über die Zerstörung der Umwelt schreiben wollen. Doch sie konnte unmöglich Roger und seine kranke Mutter wegen eines Prozesses in New York allein lassen. Im Februar schrieb sie an E. B. White: «Ich hoffe, dass Sie über diese Gerichtsverhandlungen im New Yorker berichten werden.» White zögerte – später gestand er Carson, er habe damals «chlorierte Kohlenwasserstoffe nicht von einer Randwanze unterscheiden» können –, sagte, sie solle selbst über die Geschichte schreiben, und leitete Carsons Brief an seinen Chefredakteur William Shawn weiter. Im Juni fuhr Carson nach New York und schlug Shawn die Story vor. «Wir stellen uns normalerweise nicht vor, dass der New Yorker die Welt verändern kann», sagte er ihr, «aber dieses Mal könnte er es tun.»
Freeman befürchtete, in weiser Voraussicht, dass die Chemieunternehmen Carson unerbittlich und brutal verfolgen würden. Carson versicherte ihr, dass ihr das bewusst sei, aber dass sie «dennoch nie wieder Frieden finden würde, wenn ich schweige». Marjorie Spock, die Schwester des berühmten Kinderarztes Benjamin Spock, berichtete Rachel Carson über den Prozess, während Carson ihre Recherchen von zu Hause aus durchführte, häufig mit Roger an ihrer Seite. Sie ackerte sich durch riesige Mengen wissenschaftlicher Literatur mehrerer Fachbereiche, einschließlich Medizin, Chemie, Physiologie und Biologie, und fasste sie zu einer klar verständlichen Erklärung zusammen. Freeman schrieb Carson, sie sei «wie die Möwenmutter, die das Käse-Sandwich für ihre Jungen vorkaut». Carson antwortete: «Vielleicht könnten wir ‹Menschheit gegen Erde› mit dem Untertitel ‹Was die Möwenmutter heraufwürgte› veröffentlichen.»
Im Herbst 1958 erlitt Carsons Mutter einen Schlaganfall. Carson pflegte sie zu Hause. Die Mutter hatte ihrer Tochter Vogelrufe beigebracht; bei ihrem ersten gemeinsamen Aufenthalt in Maine hatte Carson eine Bestandsaufnahme gemacht: «Und dann waren da noch die Rufe anderer, kleinerer Vögel – der rasselnde Ruf des Eisvogels, der zwischen seinen Jagdzügen nach Fisch auf den Pfeilern im Hafen saß; der Ruf des Phoebetyranns, der unter dem Dachvorsprung des Hauses nistete; die Rotschwänzchen, die in den Birken auf dem Hügel hinter dem Haus auf Futtersuche gehen und sich, zumindest in meinen Ohren, ewig nach dem Weg nach Wiscasset fragen. Ihre Rufe klangen sehr ähnlich wie: ‹Which is Wiscasset? Which is Wiscasset?›»
Gegen Ende des Herbstes, in dem Carsons Mutter erkrankte, schickte Spock ihr eine Schallplatte mit Vogelrufen. Carson hörte sie sich mit Roger an und brachte ihm jeden Ruf bei. «Er hat ein sehr süßes Gespür für alles, was lebt, und er mag es sehr, mit mir draußen unterwegs zu sein und all den Lebewesen zu lauschen», schrieb sie Spock. Carsons Mutter starb im Dezember desselben Jahres im Alter von 89 Jahren. Der Frühling 1959 war Carsons erster ohne ihre Mutter. «Wenn der Frühling naht, wird er nun in den Vereinigten Staaten in immer größeren Gebieten nicht mehr von seinen Vorboten, den zurückkehrenden Vögeln, angekündigt. Wo einst am frühen Morgen der herrliche Gesang der Vögel erschallte, ist es merkwürdig still geworden», schrieb Carson. Paul Brooks kam auf die Idee, den Titel des Kapitels über Vögel als Buchtitel zu verwenden: Der stumme Frühling. Eine Zeit der Trauer.
Carson aber befürchtete, dass sie selbst zum Schweigen gebracht werden könnte. Sie wurde krank; sie und Freeman erzählten es kaum jemandem, nicht einmal Brooks. Anfang des Jahres 1960 beschäftigte sich Carson mit immer umfangreicherer wissenschaftlicher Literatur über die Folgen «des endlosen Stroms an Chemikalien, zu denen Pestizide gehören, die heute in der Welt, in der wir leben, allgegenwärtig sind und, direkt und indirekt, individuell und kollektiv auf uns einwirken», als wären wir alle Fische, die in einem vergifteten Meer schwimmen. In dieser Zeit entdeckte sie neue Läsionen auf ihrer linken Brust.
Am 4. April 1960 unterzog sich Carson einer vollständigen Mastektomie. Ihr Arzt gab ihr keinerlei Informationen über die Tumore oder das Gewebe, das er entfernt hatte, und empfahl keinerlei Nachbehandlung; als sie ihm Fragen stellte, log er sie an, wie es damals üblich war, vor allem bei weiblichen Patienten. Die Operation war brutal gewesen, und Carson erholte sich nur langsam davon. «Ich glaube, ich habe das lästige Problem mit dem Krebs-Kapitel gelöst», schrieb sie im September aus Maine an Brooks. Aber im November fand sie erneut Knoten, dieses Mal auf den Rippen. Sie konsultierte einen anderen Arzt und bekam erste Bestrahlungen. Im Dezember vertraute sie sich schließlich Brooks an.
Rachel Carson hielt ihre Krebserkrankung geheim, weil sie nicht gern über Privates sprach, aber auch, weil sie nicht wollte, dass die Chemiefirmen diese Information nutzten, um ihre Arbeit als durch die Krankheit motiviert abzutun, und vielleicht auch, weil sie nicht wollte, dass die Firmen sich in verbaler Zurückhaltung übten, wenn das Buch denn erscheinen würde; je härter sie gegen Carson vorgingen, umso schlechter würden sie später dastehen. Das erforderte enormen Gleichmut. Ab Anfang 1961 saß sie immer wieder im Rollstuhl. Eine Behandlung folgte der nächsten: weitere Operationen, Injektionen (ein Arzt empfahl die Injektion von Gold). Eine Krankheit folgte der nächsten: Grippe, Staphylokokkeninfektionen, rheumatoide Arthritis, Augeninfektionen. «So eine Liste an Krankheiten!», schrieb sie an Freeman. «Wäre ich abergläubisch, dann würde ich womöglich einen bösartigen Einfluss bei der Arbeit vermuten, der entschlossen ist, die Fertigstellung des Buches irgendwie zu verhindern.»
Schon kurz nach Behandlungsbeginn wurde Carson gesagt, sie habe «nur noch Monate». Sie fürchtete sich vor dem Tod und hatte panische Angst zu sterben, bevor das Buch fertig war. Freeman glaubte, die Arbeit bringe Carson um oder erschwere zumindest ihren Kampf gegen den Krebs, und drängte sie, das Buchprojekt aufzugeben und stattdessen einen kürzeren Text zu verfassen und das Ganze abzuschließen. «Ein kürzerer Text ist besser als gar nichts», dachte sich Carson und erwog, die bereits fertigen Seiten in etwas «stark Reduziertes» und «vielleicht Philosophischeres» umzuwandeln. Sie entschied sich dagegen und legte dem New Yorker im Januar 1962 einen fast vollständigen Entwurf des Buches vor.
Shawn rief sie zu Hause an, um ihr zu sagen, dass er es gelesen hatte und für «brillant» hielt. Er sagte: «Sie haben daraus Literatur gemacht, voller Schönheit und Anmut und tiefer Gefühle.» Carson, die gezweifelt hatte, ob sie lange genug überleben würde, um das Buch zu beenden, war zum ersten Mal überzeugt, dass das Buch in der Welt das bewirken würde, was ihre Absicht war. Sie legte den Telefonhörer auf, brachte Roger ins Bett, nahm ihre Katze auf den Arm und brach vor Erleichterung in Tränen aus.
Silent Spring erschien im New Yorker im Juni 1962 in drei Teilen und im September desselben Jahres als Buch bei Houghton Mifflin. Carson zeigte darin, dass alles mit allem anderen verbunden ist.
Wir vergiften die Köcherfliegen in einem Bach, und die Lachszüge schwinden dahin. Wir vergiften die Mücken in einem See, und das Gift wandert von einem Glied der Futterkette zum nächsten, und bald fallen ihm die Vögel am Ufer des Sees zum Opfer. Wir sprühen unsere Ulmen, und im nächsten Frühling ist der Gesang der Wanderdrosseln verstummt; nicht weil wir die Wanderdrosseln selbst mit einem Sprühmittel töteten, sondern weil das Gift Schritt für Schritt in dem uns nun schon vertrauten Kreislauf vom Ulmenblatt zum Regenwurm und zur Wanderdrossel gelangte. Dies sind verbürgte Vorkommnisse, die sich beobachten lassen und einen Teil der sichtbaren Welt bilden, die uns umgibt. Sie spiegeln das Gefüge des Lebens – oder des Todes – wider, das die Wissenschaftler als Ökologie bezeichnen.
Das Buch schlug sofort ein. Leser schrieben ihre eigenen Geschichten. «Ich kann hier in jede Samenhandlung hineinspazieren und, ohne Begründung, genug Gift kaufen, um alle Einwohner von Oregon zu töten», schrieb ein Gärtner. Erste Leser riefen Kongressabgeordnete an. E. B. White beschrieb die drei Teile der Buchveröffentlichung im New Yorker in einem Brief an Carson als «die wertvollsten Artikel, die je in dieser Zeitschrift veröffentlicht wurden». Bei einer Pressekonferenz im Weißen Haus am 29. August fragte ein Reporter Präsident Kennedy, ob seine Regierung eine Untersuchung zu den Langzeitwirkungen von DDT und anderen Pestiziden einleiten werde. «Ja», antwortete der Präsident. «Diese Untersuchungen sind geplant, vor allem, natürlich, seit Miss Carsons Buch.»
«Ihr Buch hat landesweit Diskussionen ausgelöst», hieß es in einer einstündigen Sondersendung von CBS, in der Statements von Carson und von Sprechern aus Regierung und Industrie einander gegenübergestellt wurden, so dass sie de facto miteinander debattierten. (Carson lehnte alle weiteren Fernsehauftritte ab.) Sie saß auf der Veranda ihres Hauses in Maine und trug Rock und Strickjacke; der Wortführer der Insektizidhersteller, Robert White-Stevens von American Cyanamid, trug eine Brille mit dickem schwarzem Gestell und einen weißen Kittel und stand in einem Chemielabor inmitten von Messbechern und Bunsenbrennern.
White-Stevens stellt die Fachkompetenz von Carson infrage: «Miss Rachel Carson verzerrt in ihrem Buch Der stumme Frühling die Fakten aufs Gröbste und stützt ihre Behauptungen mit völlig haltlosen wissenschaftlichen Experimenten und allgemeinen praktischen Erfahrungen in diesem Bereich.»
Carson gibt sich verblüfft: «Kann irgendjemand glauben, dass man die Erdoberfläche mit Giften bombardieren kann, ohne sie für alles Leben unbrauchbar zu machen?»
White-Stevens reagiert wütend: «Miss Carson behauptet nach wie vor, das natürliche Gleichgewicht sei entscheidend für das Überleben der Menschen, obwohl Chemiker, Biologen und Wissenschaftler heute davon ausgehen, dass der Mensch dauerhaft die Kontrolle über die Natur gewinnt.»
Carson erwidert: «Für diese Menschen wurde offensichtlich das natürliche Gleichgewicht außer Kraft gesetzt, als der Mensch auf der Bildfläche erschien. Genauso gut könne man glauben, man könnte das Gesetz der Schwerkraft außer Kraft setzen.»
Trotz seines Laborkittels wirkt White Stevens im Vergleich zu Carsons Gelassenheit wie ein griesgrämiger Grantler. Doch Carson war weniger gelassen als erschöpft. Sie war 55 Jahre alt, sah aber 20 Jahre älter aus. (Sie fühle sich wie 90, sagte sie Freeman.) Sie bat Freeman inständig, niemandem von ihrer Krebserkrankung zu erzählen: «Es gibt keinen Grund, auch nur zu sagen, dass es mir nicht gut ging. Wenn du irgendetwas Negatives berichten willst oder zu müssen glaubst, dann sage, ich habe an einer Augenentzündung gelitten, die aber gut abgeheilt sei. Und sage, dass ich nie besser ausgesehen habe. Bitte sage das.» Doch es war leicht zu erkennen, selbst wenn es niemand wusste. Bei dem CBS-Interview trug Carson eine schwere Perücke; ihr waren alle Haare ausgefallen. Stehen fiel ihr schwer, da der Krebs nun auch die Wirbelsäule befallen hatte, die zu zerbrechen drohte, daher sah man sie nur sitzend. Nach seinem Interview mit Carson riet der CBS-Reporter Eric Sevareid seinem Produzenten Jay McMullen, der Sender solle die Aufnahmen so schnell wie möglich ausstrahlen. «Jay, wir haben hier eine tote Hauptakteurin», sagte er.
Im Dezember brach Carson bei der Suche nach einem Weihnachtsgeschenk für Roger – einem Plattenspieler – vor Schmerzen und Schwäche zusammen. Die Tumore breiteten sich immer weiter aus. CBS strahlte «The Silent Spring of Rachel Carson» im April 1963 aus. Einen Monat später sagte Carson vor dem US-Kongress aus.
Im Herbst hatte der Krebs ihren Hüftknochen erfasst. «Ich stöhne innerlich», schrieb sie, «und wache mitten in der Nacht auf und sehne mich nach Maine.» Bei ihrer letzten öffentlichen Rede mit dem Titel «Die Menschheit gegen sich selbst» humpelte sie mit einem Gehstock auf die Bühne. Eine Lokalzeitung beschrieb sie als eine «von Arthritis verkrüppelte alte Jungfer». An Freeman schrieb sie, eine Rückkehr nach Maine sei «nur ein Traum – ein lieblicher Traum».
Rachel Carson sah das Meer nicht wieder. Auch in Erinnerung blieb sie nicht für ihre Texte über das Meer, seine Küsten und die Tiefsee. «Das gute alte Geheimnisse des Meeres wurde vom Thron gestoßen», schrieb Freeman sorgenvoll. «Die Leute werden sich an dich als ‹Oh ja, die Autorin von Der stumme Frühling› erinnern. Wahrscheinlich gibt es Menschen, die von Geheimnisse des Meeres nie gehört haben.»
Am frühen Morgen des 14. April 1964 fragte Freeman schriftlich, wie Carson schlafe und wünschte ihr die Schönheit des Frühlings: «Ich weiß, dass du zum Gesang der Vögel erwachst.» Carson starb noch vor Sonnenuntergang. Drei Wochen später schüttete Freeman Carsons Asche von ihrer Insel in Maine ins Meer. «Jedes Lebewesen im Ozean, ob nun Pflanze oder Tier, gibt am Ende seiner Lebensdauer dem Wasser die Stoffe zurück, die sich für einige Zeit verbunden haben, um seinen Körper zu bilden», schrieb Carson einst. Freeman saß auf einem Felsen und sah zu, wie die Ebbe einsetzte.
Bevor Carson krank wurde, und auch danach noch, als sie noch hoffte, wieder gesund zu werden, plante sie für ihr nächstes Buch ein Thema, das sie faszinierte. «Wir leben in einer Zeit steigender Meeresspiegel», schrieb sie. «Wir werden in unserer Lebenszeit Zeugen eines bestürzenden Klimawandels.» Sie starb, bevor sie mit diesem Buch beginnen konnte, und dachte bis zuletzt über die ansteigenden Meere nach.
Im vergangenen Frühjahr wurde im Nordatlantik kein einziger neugeborener Glattwal gesichtet. Das Wasser ist offenbar zu warm, so dass die Walweibchen keine Kälber zur Welt brachten. Das Meer umgibt uns. Es ist unsere Heimat. Und das letzte Kalb ist unsere – untröstliche – Niederlage.
Aus dem Englischen von Sigrid Schmid
1. KAPITEL
Ein Zukunftsmärchen
Es war einmal eine Stadt im Herzen Amerikas, in der alle Geschöpfe in Harmonie mit ihrer Umwelt zu leben schienen. Die Stadt lag inmitten blühender Farmen mit Kornfeldern, deren Gevierte an ein Schachbrett erinnerten, und mit Obstgärten an den Hängen der Hügel, wo im Frühling Wolken weißer Blüten über die grünen Felder trieben. Im Herbst entfalteten Eiche, Ahorn und Birke eine glühende Farbenpracht, die vor dem Hintergrund aus Nadelbäumen wie flackerndes Feuer leuchtete. Damals kläfften Füchse im Hügelland, und lautlos, halb verhüllt von den Nebeln der Herbstmorgen, zog Rotwild über die Äcker.
Den Großteil des Jahres entzückten entlang den Straßen Schneeballsträucher, Lorbeerrosen und Erlen, hohe Farne und Wildblumen das Auge des Reisenden. Selbst im Winter waren die Plätze am Wegesrand von eigenartiger Schönheit. Zahllose Vögel kamen dorthin, um sich Beeren als Futter zu holen und aus den vertrockneten Blütenköpfchen der Kräuter, die aus dem Schnee ragten, die Samen zu picken. Die Gegend war geradezu berühmt wegen ihrer an Zahl und Arten so reichen Vogelwelt, und wenn im Frühling und Herbst Schwärme von Zugvögeln auf der Durchreise einfielen, kamen die Leute von weither, um sie zu beobachten. Andere kamen, um in den Bächen und Flüssen zu fischen, die klar und kühl aus dem Hügelland strömten und da und dort schattige Tümpel bildeten, in denen Forellen standen. So war es gewesen, seit vor vielen Jahren die ersten Siedler ihre Häuser bauten, Brunnen gruben und Scheunen errichteten.
Dann tauchte überall in der Gegend eine seltsame schleichende Seuche auf, und unter ihrem Pesthauch begann sich alles zu verwandeln. Irgendein böser Zauberbann war über die Siedlung verhängt worden: Rätselhafte Krankheiten rafften die Kükenscharen dahin; Rinder und Schafe wurden siech und verendeten. Über allem lag der Schatten des Todes. Die Farmer erzählten von vielen Krankheitsfällen in ihren Familien. In der Stadt standen die Ärzte immer ratloser den neuartigen Leiden gegenüber, die unter ihren Patienten auftraten. Einige Menschen waren plötzlich und unerklärlicherweise gestorben, nicht nur Erwachsene, sondern sogar Kinder, die mitten im Spiel jäh von Übelkeit befallen wurden und binnen weniger Stunden starben.
Es herrschte eine ungewöhnliche Stille. Wohin waren die Vögel verschwunden? Viele Menschen fragten es sich, sie sprachen darüber und waren beunruhigt. Die Futterstellen im Garten hinter dem Haus blieben leer. Die wenigen Vögel, die sich noch irgendwo blicken ließen, waren dem Tode nah; sie zitterten heftig und konnten nicht mehr fliegen. Es war ein Frühling ohne Stimmen. Einst hatte in der frühen Morgendämmerung die Luft widergehallt vom Chor der Wander- und Katzendrosseln, der Tauben, Häher, Zaunkönige und unzähliger anderer Vogelstimmen, jetzt hörte man keinen Laut mehr; Schweigen lag über Feldern, Sumpf und Wald.
Auf den Farmen brüteten die Hennen, aber keine Küken schlüpften aus. Die Farmer klagten, sie seien nicht mehr imstande, Schweine aufzuziehen. Jeder Wurf umfasste nur wenige Junge, und sie lebten höchstens ein paar Tage. Die Apfelbäume entfalteten ihre Blüten, aber keine Bienen summten zwischen ihnen umher, und da sie nicht bestäubt wurden, konnten sich keine Früchte entwickeln.
Die einst so anziehenden Landstraßen waren nun von braun und welk gewordenen Pflanzen eingesäumt, als wäre ein Feuer über sie hinweggegangen. Auch hier war alles totenstill, von Lebewesen verlassen. Selbst in den Flüssen regte sich kein Leben mehr. Keine Angler suchten sie auf, denn alle Fische waren zugrunde gegangen.
In den Rinnsteinen, unter den Traufen und zwischen den Schindeln der Dächer zeigten sich noch ein paar Fleckchen eines weißen körnigen Pulvers; es war vor einigen Wochen wie Schnee auf die Dächer und Rasen, auf die Felder und Flüsse gerieselt.
Kein böser Zauber, kein feindlicher Überfall hatte in dieser verwüsteten Welt die Wiedergeburt neuen Lebens im Keim erstickt. Das hatten die Menschen selbst getan.
Diese Stadt gibt es in Wirklichkeit nicht, aber ihr Ebenbild könnte sich an tausend Orten in Amerika oder anderswo in der Welt finden. Ich kenne keine Gemeinde, der all das Missgeschick, das ich beschrieben habe, widerfahren ist. Doch jedes einzelne dieser unheilvollen Geschehnisse hat sich tatsächlich irgendwo zugetragen, und viele wirklich bestehende Gemeinden haben bereits eine Reihe solcher Unglücksfälle erlitten. Fast unbemerkt ist ein Schreckgespenst unter uns aufgetaucht, und diese Tragödie, vorerst nur ein Phantasiegebilde, könnte leicht rauhe Wirklichkeit werden, die wir alle erleben.
Was geht hier vor, was hat bereits in zahllosen Städten Amerikas die Stimmen des Frühlings zum Schweigen gebracht? Dieses Buch will versuchen, es zu erklären.
2. KAPITEL
Die Pflicht zu erdulden
Die Geschichte des Lebens auf der Erde ist stets eine Geschichte der Wechselwirkung zwischen den Geschöpfen und ihrer Umgebung gewesen. Gestalt und Lebensweise der Pflanzen wie der Tiere der Erde wurden von der Umwelt geprägt. Berücksichtigt man das Gesamtalter der Erde, so war die entgegengesetzte Wirkung, kraft der lebende Organismen ihre Umwelt tatsächlich umformten, von verhältnismäßig geringer Bedeutung. Nur innerhalb des kurzen Augenblicks, den das jetzige Jahrhundert darstellt, hat eine Spezies – der Mensch – erhebliche Macht erlangt, die Natur ihrer Welt zu verändern.
Während des vergangenen Vierteljahrhunderts ist diese Macht nicht nur gewachsen und hat ein beängstigend großes Ausmaß erreicht, sie hat auch andere Formen angenommen. Der unheimlichste aller Angriffe des Menschen auf die Umwelt ist die Verunreinigung von Luft, Erde, Flüssen und Meer mit gefährlichen, ja sogar tödlichen Stoffen. Dieser Schaden lässt sich größtenteils nicht wiedergutmachen. Nicht nur in der Welt, die alle Lebewesen ernähren muss, sondern auch im lebenden Gewebe löst die Verunreinigung eine Kette schlimmer Reaktionen aus, die nicht mehr umkehrbar sind. In dieser alles umfassenden Verunreinigung der Umwelt sind Chemikalien die unheimlichen und kaum erkannten Helfershelfer der Strahlung; auch sie tragen unmittelbar dazu bei, die ursprüngliche Natur der Welt – die ursprüngliche Natur ihrer Geschöpfe – zu verändern. Strontium 90, das durch Kernexplosionen in die Luft abgegeben wird, fällt mit dem Regen zur Erde oder schwebt als radioaktiver Niederschlag herab, setzt sich im Boden fest, gelangt in das Gras, den Mais oder den Weizen, die dort angepflanzt werden, und lagert sich mit der Zeit in den Knochen eines menschlichen Wesens ab, um dort bis zu dessen Tode zu verbleiben. In ähnlicher Weise liegen chemische Mittel, die über Ackerland, Wälder oder Gärten gesprüht werden, lange im Boden und werden in lebende Organismen aufgenommen; von Vergiftung und Tod begleitet, gehen sie in der Nahrungskette von einem zum anderen über. Oder sie wandern geheimnisvoll in unterirdischen Wasserläufen, bis sie wieder zutage treten und durch die Alchemie von Luft und Sonnenlicht neue Verbindungen bilden, die den Pflanzenwuchs vernichten, das Vieh krank machen und unbekannten Schaden bei denen anrichten, die aus den einst reinen Quellen trinken. Wie Albert Schweitzer sagt: «Der Mensch kann die Teufel, die er selbst geschaffen hat, nicht einmal mehr wiedererkennen.»
Es dauerte Hunderte von Millionen Jahren, die Lebewesen hervorzubringen, die jetzt die Erde bewohnen – Äonen, in denen dieses Leben sich entfaltete, weiterentwickelte und die verschiedensten Formen annahm, bis es einen Zustand erreichte, in dem es der Umgebung angepasst und mit ihr im Gleichgewicht war. Die Umwelt, die das Leben, das sie unterhielt, unerbittlich gestaltete und beeinflusste, barg feindliche wie fördernde Elemente. Von bestimmten Gesteinen ging eine gefährliche Strahlung aus; sogar das Sonnenlicht enthielt kurzwellige Strahlen, die schädigend wirken konnten. Gewährt man dem Leben Zeit – nicht Jahre, sondern Jahrtausende –, passt es sich an, und so hat sich schließlich ein Gleichgewicht eingestellt. Denn dazu braucht es vor allem Zeit; an Zeit jedoch fehlt es in der heutigen Welt.
Der schnelle Wandel und die Geschwindigkeit, mit der immer neue Situationen geschaffen werden, richten sich mehr nach dem ungestümen und achtlosen Hasten des Menschen als nach dem bedächtigen Gang der Natur. Bei der Strahlung handelt es sich nicht mehr allein um die Strahlung, die im Hintergrund wirkt und aus dem Gestein stammt, um den Beschuss durch kosmische Strahlen oder um das ultraviolette Licht der Sonne; sie waren vorhanden, ehe es Leben auf der Erde gab. Jetzt ist Strahlung die unnatürliche Schöpfung des Menschen, der tolpatschig mit dem Atom experimentiert. Und bei den Chemikalien, an die Lebewesen ihren Stoffwechsel anzupassen haben, handelt es sich nicht mehr nur um Kalzium, Kieselerde, Kupfer und all die übrigen Minerale, die aus dem Gestein ausgewaschen und von Flüssen ins Meer befördert werden; jetzt geht es um synthetische Erzeugnisse des erfinderischen Menschengeists, die in Laboratorien zusammengebraut werden und kein Gegenstück in der Natur haben.
Sich an diese Chemikalien anzupassen würde Zeit in einem Maßstab erfordern, wie er der Natur eigen ist; dafür wären nicht nur die Jahre eines Menschenlebens, sondern die von Generationen nötig. Doch selbst wenn dies durch ein Wunder möglich würde, wäre damit nichts geholfen, denn die neuen Chemikalien kommen in einem endlosen Strom aus unseren Laboratorien; nahezu fünfhundert finden allein in den Vereinigten Staaten jährlich den Weg zum Verbraucher. Die Zahl ist niederschmetternd, und die Folgerungen, die sich daraus ergeben, lassen sich schwer ermessen – fünfhundert neue chemische Verbindungen, an die sich der Körper des Menschen und der Tiere jedes Jahr irgendwie anpassen soll, alles Substanzen, die völlig außerhalb des biologischen Erfahrungsbereichs liegen.
Darunter befinden sich viele, die im Kampf des Menschen gegen die Natur verwendet werden. Ungefähr seit dem Jahre 1945 sind über zweihundert neue chemische Ausgangsstoffe hergestellt worden; sie dienen dazu, Insekten, Unkraut, Nagetiere und andere Organismen zu vernichten, die in der modernen Sprache als «Schädlinge» bezeichnet werden; und diese Chemikalien werden unter ein paar tausend verschiedenen Handelsbezeichnungen verkauft.
Diese Spritz- und Sprühmittel, Pulver und sogenannten Aerosole – feinst verteilte Schwebstoffe als Rauch oder flüssig als Nebel – werden jetzt fast allgemein für Farmen, Gärten, Wälder und Wohnungen gebraucht. Es sind Chemikalien, die ohne Unterschied oder, wie man sagt, nicht selektiv wirken. Ihre Macht ist groß: Sie töten jedes Insekt, die «guten» wie die «schlechten», sie lassen den Gesang der Vögel verstummen und lähmen die munteren Sprünge der Fische in den Flüssen. Sie überziehen die Blätter mit einem tödlichen Belag und halten sich lange im Erdreich – all dies, obwohl das Ziel, das sie treffen sollen, vielleicht nur in ein wenig Unkraut oder ein paar Insekten besteht. Kann irgendjemand wirklich glauben, es wäre möglich, die Oberfläche der Erde einem solchen Sperrfeuer von Giften auszusetzen, ohne sie für alles Leben unbrauchbar zu machen? Man sollte die Stoffe nicht Insektizide, Insektenvertilgungsmittel, sondern «Biozide», Töter allen Lebens, nennen.
Das ganze Spritzverfahren scheint in einer endlosen Spirale gefangen zu sein. Seit DDT für den zivilen Gebrauch freigegeben wurde, mussten in einer stufenweisen Weiterentwicklung immer noch tödlichere Stoffe gefunden werden. Dies geschah, weil Insekten – in einer glänzenden Bestätigung des Darwinschen Satzes vom Überleben der Tauglichsten – Superrassen entwickelten, die gegen das in ihrem Fall angewandte Insektizid immun waren. Man musste daher ein tödlicher wirkendes – und dann ein noch stärkeres – entwickeln. Dazu kam es aber auch, weil aus Gründen, die später geschildert werden sollen, schädliche Insekten nach dem Spritzen oft plötzlich in größerer Zahl als vorher wieder auftauchten oder sich ausbreiteten. So ist der chemische Krieg niemals gewonnen, und in seinem heftigen Kreuzfeuer bleibt alles Leben auf der Strecke.
Neben der Möglichkeit, die Menschheit in einem Atomkrieg auszurotten, ist das Kernproblem unseres Zeitalters daher die Verunreinigung der gesamten Umwelt des Menschen geworden; sie erfolgt mit Substanzen, denen eine unglaubliche und heimtückische Macht innewohnt, Schaden anzurichten: Diese Stoffe reichern sich in den Geweben von Pflanzen und Tieren an, sie dringen selbst in die Keimzellen ein und zerstören oder verändern das Erbgut, von dem die Gestaltung der Zukunft abhängt.
Einige Leute, die sich gerne als Baumeister unserer Zukunft ausgeben, sehnen eine Zeit herbei, in der es möglich sein wird, das menschliche Keimplasma planmäßig zu verändern. Dabei kann es durchaus sein, dass wir dies durch Unachtsamkeit jetzt bereits vollbringen, denn viele chemische Stoffe führen, ebenso wie Strahlung, Genmutationen herbei. Es ist eine Ironie, wenn man bedenkt, dass der Mensch durch etwas anscheinend so Alltägliches wie die Wahl eines Spritzmittels gegen Insekten vielleicht seine eigene Zukunft bestimmt.
Auf all diese Wagnisse hat man sich eingelassen – und wofür? Künftige Historiker dürften sich mit Recht über unsere verschrobenen Vorstellungen von richtigen Größenverhältnissen sehr wundern. Wie nur konnte ein intelligentes Wesen ein paar unerwünschte Arten von Geschöpfen mit einer Methode zu bekämpfen suchen, die auch die gesamte Umwelt vergiftete und selbst die eigenen Artgenossen mit Krankheit und Tod bedrohte?
Doch genau das haben wir getan. Wir haben es überdies aus Gründen getan, die hinfällig werden, sobald wir sie genau überprüfen. Man macht uns weis, dass der gewaltige und immer ausgedehntere Gebrauch von Schädlingsbekämpfungsmitteln nötig sei, um die Produktion der Landwirtschaft zu heben. Doch ist unser eigentliches Problem nicht die Überproduktion? Man hat zu der Maßnahme gegriffen, Ackerland brachliegen zu lassen und die Farmer zu bezahlen, damit sie es nicht bebauen, und trotzdem haben unsere Farmer einen so schwindelerregenden Ernteüberschuss, dass der amerikanische Steuerzahler im Jahre 1962 über eine Milliarde Dollar an jährlichen Gesamtverwaltungskosten für das Programm der Einlagerung überschüssiger Nahrungsmittel ausgab. Wird die Lage vielleicht gebessert, wenn eine Abteilung des Landwirtschaftsministeriums sich bemüht, die Produktion zu drosseln, während eine andere Abteilung, wie es im Jahre 1958 geschah, feststellt: «Man nimmt allgemein an, dass die Verkleinerung der Anbaufläche für Feldfrüchte gemäß den Bestimmungen der Bodenkreditbank das Interesse an der Verwendung chemischer Mittel wecken wird, um auf dem weiterhin bebauten Land ein Höchstmaß an Erträgen zu erzielen.»
All das soll nicht heißen, dass es kein Insektenproblem gibt und es nicht notwendig ist, Schädlinge unter Kontrolle zu halten. Ich will vielmehr damit sagen, dass diese Kontrolle genau auf gegebene Tatsachen, nicht aber auf erdichtete Situationen abgestimmt sein muss und nur solche Bekämpfungsmethoden angewandt werden dürfen, die nicht zugleich mit den Insekten uns selbst vernichten.
Das Problem, um dessen Lösung man sich unter so vielen unheilvollen Folgen bemüht, ist eine Begleiterscheinung unserer modernen Lebensweise. Lange vor dem Zeitalter des Menschen haben die Insekten als eine Gruppe außerordentlich mannigfaltiger und anpassungsfähiger Geschöpfe die Erde bewohnt. Seit dem Auftreten des Menschen hat ein kleiner Prozentsatz der über eine halbe Million Insektenarten sein Wohlergehen beeinträchtigt; das geschah hauptsächlich auf zweierlei Weise: als Nebenbuhler im Kampf um die Nahrung und als Überträger menschlicher Krankheiten.
Von Bedeutung sind Insekten, die Krankheiten übertragen, überall dort, wo menschliche Wesen sich in Massen zusammendrängen, besonders unter hygienisch ungünstigen Verhältnissen, wie sie in Kriegszeiten, bei Naturkatastrophen oder bei äußerster Armut herrschen. Dann wird eine Bekämpfung notwendig. Wie wir gleich sehen werden, ist es jedoch eine ernüchternde Tatsache, dass die Methode, chemische Mittel in großen Mengen einzusetzen, nur beschränkten Erfolg hatte und zudem gerade die Zustände, die sie beheben soll, nur zu verschlimmern droht.
Als der Farmer den Acker noch unter primitiven Bedingungen bestellte, hatte er mit Insekten wenig Schwierigkeiten. Probleme tauchten erst auf, als die Landwirtschaft intensiver betrieben wurde und man unendlich große Ländereien dem Anbau einer einzelnen Feldfrucht widmete. Ein solches System bildete den richtigen Rahmen für eine ungestüme, geradezu explosionsartige Zunahme der Populationen bestimmter Insekten (unter einer Population versteht man den gesamten Bestand einer Tierart in einem Gebiet). Wird nur eine einzelne Getreidesorte angepflanzt, macht sich der Farmer nicht die Grundregeln zunutze, nach denen die Natur arbeitet; es ist eine Landwirtschaft, die sich ein Ingenieur ausgedacht haben könnte. Die Natur hat für große Mannigfaltigkeit der Landschaft gesorgt, der Mensch jedoch hatte immer eine besondere Leidenschaft dafür, sie einheitlich zu gestalten. Auf diese Weise hebt er die hemmenden, das Gleichgewicht regulierenden Kräfte auf, durch die in der Natur die Arten in Schranken gehalten werden. Ein wichtiges natürliches Hindernis für eine bestimmte Art ist eine Begrenzung des geeigneten Lebensraumes. Ernährt sich ein Insekt von Weizen, kann es, wie einleuchtet, auf einer Farm, wo ausschließlich Weizen wächst, seinen Bestand weit stärker vermehren als auf Land, wo Weizen mit Feldfrüchten abwechselt, an die das Insekt nicht angepasst ist.
Das Gleiche ereignet sich bei anderen Gelegenheiten. Vor einer Generation oder noch früher wurden in den Städten ausgedehnter Gebiete der Vereinigten Staaten die Straßen mit der stattlichen Ulme eingesäumt. Jetzt ist diese schöne Zierde, die man damit zu schaffen hoffte, von völliger Vernichtung bedroht, weil unter den Ulmen eine Krankheit wütet. Sie wird von einem Käfer übertragen, der nur begrenzte Möglichkeit hätte, sich in großen Populationen anzusammeln und sich von Baum zu Baum weiterzuverbreiten, wenn die Ulmen nur vereinzelt in einem abwechslungsreichen Pflanzenbestand aufträten.
Noch ein anderer wesentlicher Umstand spielt beim heutigen Insektenproblem eine Rolle, und man muss bei ihm die geologische und menschliche Geschichte berücksichtigen, die den Hintergrund bildet: Tausende von verschiedenartigen Organismen haben sich ausgebreitet und sind von ihrer ursprünglichen Heimat in neue Landstriche vorgedrungen. Diese weltweite Wanderung ist von dem Ökologen Charles Elton studiert und in seinem jüngst erschienenen Buch ‹The Ecology of Invasions› anschaulich geschildert worden. Vor einigen hundert Millionen Jahren, in der Kreidezeit, wurden viele Landbrücken zwischen Kontinenten vom Meer überflutet, und Lebewesen fanden sich nun in Räumen eingeschlossen, die Elton als «riesige getrennte Naturreservate» bezeichnet. Dort entwickelten sie, von anderen Vertretern ihrer Gattung abgeschnitten, viele neue Arten. Als manche der Landmassen sich vor ungefähr fünfzehn Millionen Jahren wieder vereinten, begannen diese Arten in neue Gegenden umzusiedeln – eine Wanderung, die nicht nur noch im Gange ist, sondern jetzt auch vom Menschen weitgehend gefördert wird.
An der heutigen Verbreitung der Arten ist vor allem die Einfuhr von Pflanzen wesentlich beteiligt; denn fast stets sind mit den Pflanzen auch Tiere eingeschleppt worden, zumal man eine Quarantäne erst vor verhältnismäßig kurzer Zeit zu verhängen begann und sie keine radikale Wirkung hat. Die Einfuhrbehörde für Pflanzen in den Vereinigten Staaten hat allein zweihunderttausend Arten und Spielarten von Gewächsen aus aller Welt ins Land gebracht. Nahezu die Hälfte der rund hundertachtzig bedeutenderen Pflanzenfeinde unter den Insekten sind zufällig vom Ausland in die Vereinigten Staaten importiert worden, meist als «Mitreisende» auf Pflanzen.
In einer neuen Umwelt, dem Zugriff der natürlichen Feinde entzogen, die in ihrem Heimatland ihre Zahl niedrig hielten, können eine Pflanze oder ein Tier, die in ein Gebiet einfallen, ungeheuer überhandnehmen. Es ist daher kein Zufall, dass unsere lästigsten Insekten eingeschleppte Arten sind.
Wahrscheinlich werden diese unerwünschten Gäste, ob sie nun auf natürlichem Wege oder mit Beistand des Menschen kamen, unbegrenzt weiter einwandern. Quarantäne und Feldzüge mit einem Masseneinsatz von Chemikalien sind nur äußerst kostspielige Möglichkeiten, Zeit zu gewinnen. Nach Dr. Elton ist es für uns eine Existenzfrage, mit der wir uns auseinandersetzen müssen; es ist notwendig, nicht nur neue technische Mittel zu finden, um diese Pflanze oder jenes Tier niederzuhalten; wir müssen vielmehr grundlegend Bescheid wissen über Tierpopulationen und ihre Beziehungen zur Umwelt, «um ein stetiges Gleichgewicht begünstigen und die explosive Gewalt dämpfen zu können, mit der Schädlinge zur Landplage werden und neue Gebiete überfallen».
Viele dieser Kenntnisse stehen jetzt zur Verfügung, aber wir wenden sie nicht an. Wir bilden auf unseren Universitäten Ökologen aus und stellen sie sogar in unseren Regierungsbehörden an, aber wir folgen selten ihrem Rat. So lassen wir zu, dass der chemische Todesregen niedergeht, als gäbe es keine andere Wahl, während in Wirklichkeit sehr viele Möglichkeiten bestehen und der erfinderische Geist des Menschen bald noch weit mehr entdecken könnte, wenn man ihm Gelegenheit dazu verschaffte.
Sind wir in einen hypnotischen Zustand verfallen, der uns das Minderwertige und Schädliche als unausweichlich hinnehmen lässt, so als hätten wir den Willen oder den Blick dafür verloren, das Gute zu fordern? Wenn wir so denken, erheben wir, um es mit den Worten des Ökologen Paul Shepard auszudrücken, «ein Leben zum Ideal, das gerade noch den Kopf über Wasser hält, nur zollbreit über der Grenze des Erträglichen, bis zu der die eigene Umwelt verdorben ist … Warum sollten wir alles geduldig ertragen: schwache Gifte als tägliche Nahrung, ein Heim in farbloser Umgebung, einen Kreis von Bekannten, die nicht unsere ausgesprochenen Feinde sind, den Lärm von Motoren, den wir eben noch so weit mildern, dass wir nicht wahnsinnig werden? Wer wollte in einer Welt leben, die just noch nicht ganz tödlich ist?»
Dennoch wird uns eine solche Welt aufgedrängt. Der Kreuzzug mit dem Ziel, eine chemisch entseuchte, von Insekten freie Welt zu schaffen, scheint bei vielen Spezialisten und den meisten sogenannten Bekämpfungsstellen einen fanatischen Eifer ausgelöst zu haben. Überall sind Beweise dafür zur Hand, dass Leute, die sich mit den Sprühmaßnahmen beschäftigen, rücksichtslos durchgreifen. «Die Entomologen, die diese Arbeiten beaufsichtigen … übernehmen die Funktion des Anklägers, Richters und der Geschworenen, sie benehmen sich, als könnten sie Steuern auferlegen und einkassieren und als Sheriff ihre eigenen Anordnungen mit Gewalt durchsetzen», sagte der Entomologe Neely Turner aus Connecticut. Bei Bekämpfungsstellen der Staaten wie des Bundes wird selbst dem empörendsten Missbrauch nicht Einhalt geboten.
Ich trete nicht etwa dafür ein, dass chemische Insektizide niemals verwendet werden dürfen. Ich behaupte aber, dass wir giftige und biologisch stark wirksame Chemikalien wahllos in die Hände von Personen geben, die weitgehend oder völlig ahnungslos sind, welches Unheil sie anrichten können. Wir haben eine ungemein große Anzahl von Menschen ohne ihre Zustimmung und oft ohne ihr Wissen in enge Berührung mit diesen Giften gebracht. Wenn die Bill of Rights keine Garantie dafür enthält, dass ein Bürger gegen todbringende Gifte, die von Privatleuten oder öffentlichen Beamten verbreitet werden, geschützt sein soll, so kommt das sicherlich nur daher, dass unsere Vorväter trotz ihrer beachtlichen Weisheit und Voraussicht sich ein solches Problem nicht vorstellen konnten.
Ich behaupte ferner, dass wir den Gebrauch dieser chemischen Stoffe gestattet haben, obwohl vorher nur wenig oder überhaupt nicht untersucht worden ist, wie sie auf den Boden und das Wasser, auf die Geschöpfe der Wildnis und den Menschen selbst wirken. Künftige Generationen werden uns den Mangel an kluger Sorge um die Unversehrtheit der natürlichen Welt, die alles Leben unterhält, wahrscheinlich nicht verzeihen.
Immer noch erkennt man nur in sehr beschränktem Maße die wahre Natur der Bedrohung. Wir leben in einem Zeitalter von Spezialisten, von denen jeder nur sein eigenes Problem sieht und den größeren Rahmen, in den es sich einfügt, entweder nicht erkennt oder nicht wahrhaben will. Es ist aber auch ein Zeitalter, das von der Industrie beherrscht wird, in dem das Recht, um jeden Preis Geld zu verdienen, selten angefochten wird. Wenn die Öffentlichkeit protestiert, weil sie auf irgendeinen offenkundigen Beweis für die gefährlichen Folgen der Anwendung von Schädlingsbekämpfungsmitteln stößt, speist man sie mit kleinen Beruhigungspillen, mit Halbwahrheiten ab. Wir haben es dringend nötig, Schluss zu machen mit diesen falschen Versicherungen, die uns bittere Pillen durch einen Zuckerguss schmackhaft machen wollen. Schließlich verlangt man ja von der Allgemeinheit, dass sie die Risiken auf sich nimmt, die von den Leuten, die Insekten bekämpfen, berechnet werden. Das Volk muss entscheiden, ob es auf dem eingeschlagenen Wege weiterzugehen wünscht, und das kann es nur, wenn es alle Fakten genau kennt. Mit den Worten von Jean Rostand ausgedrückt: «Die Pflicht zu erdulden gibt uns das Recht zu wissen.»
3. KAPITEL