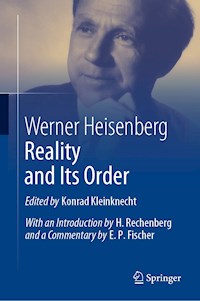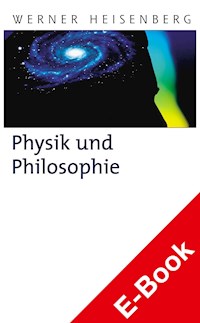10,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Piper ebooks in Piper Verlag
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Der Physiker und Nobelpreisträger Werner Heisenberg (1901–1976) zeichnet in diesen autobiografischen Gesprächen die Stationen seines wechselvollen Lebens nach. Vor dem Hintergrund der Münchner Räterepublik, der nationalsozialistischen Zeit und des Neuanfangs nach 1945 werden seine Beziehungen zu wichtigen Forscherpersönlichkeiten wie Albert Einstein, Max Planck und Carl Friedrich von Weizsäcker lebendig.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2013
Ähnliche
Mehr über unsere Autoren und Bücher:
www.piper.de
Vollständige E-Book-Ausgabe der im Piper Verlag erschienenen Buchausgabe
9. Auflage 2012
ISBN 978-3-492-96360-2
© 1969 Piper Verlag GmbH, München Umschlaggestaltung: semper smile, München nach einem Entwurf von Büro Hamburg Umschlagmotiv: Karoly Forgacs, Ullstein Datenkonvertierung: CPI – Clausen & Bosse, Leck
Vorwort
Was nun die Reden betrifft, die … gehalten worden sind, so war es mir als Ohrenzeugen … unmöglich, den genauen Wortlaut des Gesagten im Gedächtnis zu behalten. Daher habe ich die einzelnen Redner so sprechen lassen, wie sie nach meinem Vermuten den jeweiligen Umständen am ehesten gerecht geworden sein dürften, indem ich mich dabei so eng wie möglich an den Gedankengang des wirklich Gesprochenen hielt.
Thukydides
Wissenschaft wird von Menschen gemacht. Dieser an sich selbstverständliche Sachverhalt gerät leicht in Vergessenheit, und es mag zur Verringerung der oft beklagten Kluft zwischen den beiden Kulturen, der geisteswissenschaftlich-künstlerischen und der technisch-naturwissenschaftlichen, beitragen, wenn man ihn wieder ins Gedächtnis zurückruft. Das vorliegende Buch handelt von der Entwicklung der Atomphysik in den letzten 50Jahren, so wie der Verfasser sie erlebt hat. Naturwissenschaft beruht auf Experimenten, sie gelangt zu ihren Ergebnissen durch die Gespräche der in ihr Tätigen, die miteinander über die Deutung der Experimente beraten. Solche Gespräche bilden den Hauptinhalt des Buches. An ihnen soll deutlich gemacht werden, daß Wissenschaft im Gespräch entsteht. Dabei versteht es sich von selbst, daß Gespräche nach mehreren Jahrzehnten nicht mehr wörtlich wiedergegeben werden können. Nur Briefstellen sind, wo sie zitiert werden, im Wortlaut angeführt. Es soll sich auch nicht eigentlich um Lebenserinnerungen handeln. Daher hat der Verfasser sich erlaubt, immer wieder zusammenzuziehen, zu straffen und auf historische Genauigkeit zu verzichten; nur in den wesentlichen Zügen sollte das Bild korrekt sein. In den Gesprächen spielt die Atomphysik keineswegs immer die wichtigste Rolle. Vielmehr geht es ebensooft um menschliche, philosophische oder politische Probleme, und der Verfasser hofft, daß gerade daran deutlich wird, wie wenig sich die Naturwissenschaft von diesen allgemeineren Fragen trennen läßt.
Viele der beteiligten Personen sind im Text mit dem Vornamen eingeführt; teils weil sie später nicht weiter an die Öffentlichkeit getreten sind, teils weil die Beziehung des Verfassers zu ihnen durch die Verwendung des Vornamens besser dargestellt wird. Auch läßt sich so leichter der Eindruck vermeiden, als handle es sich um eine historisch in allen Einzelheiten getreue Wiedergabe der verschiedenen Begebenheiten. Aus diesem Grund wurde auch darauf verzichtet, ein genaueres Bild dieser Persönlichkeiten zu zeichnen; sie werden gewissermaßen nur an der Art, wie sie sprechen, erkennbar. Großer Wert wurde jedoch gelegt auf die korrekte und lebendige Schilderung der Atmosphäre, in der die Gespräche stattgefunden haben. Denn in ihr wird der Entstehungsprozeß der Wissenschaft deutlich, an ihr kann am besten verstanden werden, wie das Zusammenwirken sehr verschiedener Menschen schließlich zu wissenschaftlichen Ergebnissen von großer Tragweite führen kann. Es war die Absicht des Verfassers, auch dem der modernen Atomphysik Fernstehenden einen Eindruck von den Denkbewegungen zu vermitteln, die die Entstehungsgeschichte dieser Wissenschaft begleitet haben. Dabei mußte in Kauf genommen werden, daß im Hintergrund der Gespräche manchmal sehr abstrakte und schwierige mathematische Zusammenhänge sichtbar werden, die nicht ohne ein eingehendes Studium verstanden werden können.
Endlich hat der Verfasser mit der Aufzeichnung der Gespräche noch ein weiteres Ziel verfolgt. Die moderne Atomphysik hat grundlegende philosophische, ethische und politische Probleme neu zur Diskussion gestellt, und an dieser Diskussion sollte ein möglichst großer Kreis von Menschen teilnehmen. Vielleicht kann das vorliegende Buch auch dazu beitragen, die Grundlage dafür zu schaffen.
1
Erste Begegnung mit der Atomlehre (1919-1920)
Es mag etwa im Frühjahr 1920 gewesen sein. Der Ausgang des Ersten Weltkrieges hatte die Jugend unseres Landes in Unruhe und Bewegung versetzt. Die Zügel waren den Händen der zutiefst enttäuschten älteren Generation entglitten, und die jungen Menschen sammelten sich in Gruppen, kleineren und größeren Gemeinschaften, um sich einen neuen eigenen Weg zu suchen oder wenigstens einen neuen Kompaß zu finden, nach dem man sich richten konnte, da der alte zerbrochen schien. So war ich an einem hellen Frühlingstag mit einer Gruppe von vielleicht zehn oder zwanzig Kameraden unterwegs, die meisten von ihnen jünger als ich selbst, und die Wanderung führte, wenn ich mich recht erinnere, durch das Hügelland am Westufer des Starnberger Sees, der, wenn eine Lücke im leuchtenden Buchengrün den Blick freigab, links unter uns lag und beinahe bis zu den dahinter sichtbaren Bergen zu reichen schien. Auf diesem Weg ist es merkwürdigerweise zu jenem ersten Gespräch über die Welt der Atome gekommen, das mir in meiner späteren wissenschaftlichen Entwicklung viel bedeutet hat. Um verständlich zu machen, daß in einer Gruppe fröhlicher, unbekümmerter junger Menschen, die der Schönheit der blühenden Natur weit geöffnet waren, solche Gespräche geführt werden konnten, muß vielleicht daran erinnert werden, daß der Schutz durch Elternhaus und Schule, der in friedlichen Epochen die Jugend umgibt, durch die Wirren der Zeit weitgehend verlorengegangen und daß, gewissermaßen als Ersatz, eine Unabhängigkeit der Meinung in ihr entstanden war, die sich ein eigenes Urteil auch dort zutraute, wo dafür die Grundlagen noch fehlen mußten.
Einige Schritte vor mir ging ein blonder, schön gewachsener Bursch, dessen Eltern mir früher einmal die Unterstützung seiner Schularbeiten aufgetragen hatten. Noch im Jahr vorher hatte er als Fünfzehnjähriger im Straßenkampf die Munitionskästen geschleppt, als sein Vater mit einem Maschinengewehr hinter dem Wittelsbacher Brunnen in Stellung lag und an den Kämpfen um die Räterepublik München teilnahm. Andere, darunter ich selbst, hatten vor zwei Jahren noch als Knechte auf Bauerngütern im Bayerischen Oberland gearbeitet. So war uns der rauhe Wind nicht mehr fremd, und wir hatten keine Angst, uns auch über die schwierigsten Probleme unsere eigenen Gedanken zu machen.
Der äußere Anlaß des Gesprächs war wohl der Umstand, daß ich mich auf das im Sommer bevorstehende Abiturexamen vorzubereiten hatte und mich über naturwissenschaftliche Gegenstände gern mit meinem Freunde Kurt unterhielt, der meine Interessen teilte und später einmal Ingenieur werden wollte. Kurt stammte aus einer protestantischen Offiziersfamilie, er war ein guter Sportsmann und zuverlässiger Kamerad. Im Jahr vorher, als München von den Regierungstruppen eingeschlossen und in unseren Familien das letzte Stück Brot längst aufgezehrt war, hatten er, mein Bruder und ich einmal eine gemeinsame Fahrt nach Garching, durch die Linien der Kämpfenden hindurch, unternommen, und wir waren mit einem Rucksack voll Lebensmitteln, Brot, Butter und Speck, zurückgekommen. Solche gemeinsamen Erlebnisse schaffen eine gute Grundlage für rückhaltloses Vertrauen und fröhliches Einverständnis. Hier ging es aber jetzt um die gemeinsame Beschäftigung mit naturwissenschaftlichen Fragen. Ich berichtete Kurt, daß ich in meinem Physiklehrbuch auf eine Abbildung gestoßen sei, die mir völlig unsinnig vorkäme. Es handelte sich um jenen Grundvorgang der Chemie, bei dem zwei einheitliche Stoffe sich zu einem neuen ebenfalls einheitlichen Stoff, einer chemischen Verbindung, zusammenschließen. Aus Kohlenstoff und Sauerstoff etwa kann sich Kohlensäure bilden. Die bei solchen Vorgängen beobachteten Gesetzmäßigkeiten könne man, so lehrte das Buch, am besten verständlich machen, indem man annehme, daß die kleinsten Teile, die Atome, des einen Elements und die des anderen sich zu kleinen Atomgruppen, den sogenannten Molekülen, zusammenschließen. So bestehe etwa das Kohlensäuremolekül aus einem Atom Kohlenstoff und zwei Atomen Sauerstoff. Zur Veranschaulichung waren solche Atomgruppen im Buch abgebildet. Um nun weiter zu erklären, warum gerade je ein Atom Kohlenstoff und zwei Atome Sauerstoff ein Kohlensäuremolekül bilden, hatte der Zeichner die Atome mit Haken und Ösen versehen, mit denen sie im Molekül zusammengehängt waren. Dies kam mir ganz unsinnig vor. Denn Haken und Ösen sind, wie mir schien, recht willkürliche Gebilde, denen man je nach der technischen Zweckmäßigkeit die verschiedensten Formen geben kann. Die Atome aber sollten doch eine Folge der Naturgesetze sein und durch die Naturgesetze veranlaßt werden, sich zu Molekülen zusammenzuschließen. Dabei kann es, so glaubte ich, keinerlei Willkür, also auch keine so willkürlichen Formen wie Haken und Ösen geben.
Kurt erwiderte: »Wenn du die Haken und Ösen nicht glauben willst – und mir kommen sie ja auch recht verdächtig vor –, so mußt du wohl vor allem wissen, welche Erfahrungen den Zeichner veranlaßt haben, sie im Bild anzubringen. Denn die heutige Naturwissenschaft geht von Erfahrungen aus, nicht von irgendwelchen philosophischen Spekulationen, und mit der Erfahrung muß man sich abfinden, wenn man sie zuverlässig, das heißt mit hinreichender Sorgfalt gewonnen hat. Soviel ich weiß, stellen die Chemiker zunächst fest, daß die elementaren Bestandteile in einer chemischen Verbindung immer in ganz bestimmten Gewichtsverhältnissen auftreten. Das ist merkwürdig genug. Denn selbst wenn man an die Existenz der Atome, das heißt charakteristischer kleinster Teilchen für jedes chemische Element glaubt, so würden doch Kräfte von der Art, wie man sie sonst in der Natur kennt, kaum ausreichen, um verständlich zu machen, daß ein Kohlenstoffatom immer nur zwei Sauerstoffatome anziehen und an sich binden kann. Wenn es eine Anziehungskraft zwischen den beiden Atomarten gibt, warum sollen dann nicht auch gelegentlich drei Sauerstoffatome gebunden werden können?«
»Vielleicht haben die Atome des Kohlenstoffs oder des Sauerstoffs eine solche Form, daß eine Bindung von dreien eben schon aus Gründen der räumlichen Anordnung unmöglich wird.«
»Wenn du das annimmst, und das klingt ja nicht unplausibel, dann bist du schon fast wieder bei den Haken und Ösen des Lehrbuchs angelangt. Wahrscheinlich hat der Zeichner nur eben dies ausdrücken wollen, was du gesagt hast, da er die genaue Form der Atome ja gar nicht wissen kann. Er hat Haken und Ösen gezeichnet, um möglichst drastisch darzutun, daß es Formen gibt, die zur Bindung von zwei, aber nicht von drei Sauerstoffatomen an das Kohlenstoffatom führen können.«
»Schön, also die Haken und Ösen sind Unsinn. Aber du sagst, die Atome werden auf Grund der Naturgesetze, die für ihre Existenz verantwortlich sind, auch eine Form haben, die für die richtige Bindung sorgt. Nur wissen wir beide die Form einstweilen nicht, und auch der Zeichner des Bildes hat sie offenbar nicht gekannt. Das einzige, was wir bisher von dieser Form zu wissen glauben, ist eben, daß sie dafür sorgen muß, daß ein Kohlenstoffatom nur zwei, aber nicht drei Sauerstoffatome an sich binden kann. Die Chemiker haben, das wird im Buch erwähnt, an dieser Stelle den Begriff ›chemische Valenz‹ erfunden. Aber ob das nur ein Wort oder schon ein brauchbarer Begriff ist, müßte man erst herausbringen.«
»Es ist wahrscheinlich doch etwas mehr als nur ein Wort; denn beim Kohlenstoffatom sollen die vier Valenzen, die ihm zugeschrieben werden – und von denen je zwei die zwei Valenzen je eines Sauerstoffatoms absättigen sollen –, etwas mit einer tetraederförmigen Gestalt des Atoms zu tun haben. Es steckt also offenbar ein etwas bestimmteres empirisches Wissen über die Formen dahinter, als uns jetzt zugänglich ist.«
An dieser Stelle mischte sich Robert ins Gespräch, der bisher schweigend neben uns hergegangen war, aber offenbar zugehört hatte. Robert hatte ein schmales, aber kräftiges Gesicht, das von ganz dunklem vollem Haar umrahmt war und im ersten Augenblick etwas verschlossen aussah. Er beteiligte sich nur selten an dem leichten Geplauder, das eine solche Wanderung zu begleiten pflegt; aber wenn abends im Zelt vorgelesen oder wenn vor der Mahlzeit ein Gedicht gesprochen werden sollte, so wandten wir uns an ihn, denn keiner wußte wie er in der deutschen Dichtung, ja sogar in der philosophischen Literatur Bescheid. Wenn er Gedichte vortrug, so geschah es ohne jedes Pathos, ohne jeden sprachlichen Aufwand, aber doch so, daß der Inhalt des Gedichtes auch den Nüchternsten unter uns erreichte. Die Art, wie er sprach, die gesammelte Ruhe, in der er formulierte, zwang zum Aufhorchen, und seine Worte hatten, so schien es, mehr Gewicht als die der anderen. Auch wußten wir, daß er sich neben der Schule mit philosophischen Büchern beschäftigte. Robert war mit unserem Gespräch unzufrieden.
»Ihr Naturwissenschaftsgläubigen«, meinte er, »beruft euch immer so leicht auf die Erfahrung, und ihr glaubt, daß ihr damit die Wahrheit sicher in den Händen haltet. Aber wenn man darüber nachdenkt, was bei der Erfahrung wirklich geschieht, scheint mir die Art, wie ihr das tut, sehr anfechtbar. Was ihr sprecht, kommt doch aus euren Gedanken, nur von ihnen habt ihr unmittelbar Kunde; aber die Gedanken sind ja nicht bei den Dingen. Wir können die Dinge nicht direkt wahrnehmen, wir müssen sie zuerst in Vorstellungen verwandeln und schließlich Begriffe von ihnen bilden. Was bei der sinnlichen Wahrnehmung auf uns von außen einströmt, ist ein ziemlich ungeordnetes Gemisch von sehr verschiedenartigen Eindrücken, denen die Formen oder Qualitäten, die wir nachher wahrnehmen, gar nicht direkt zukommen. Wenn wir etwa ein Quadrat auf einem Blatt Papier anschauen, so wird es weder auf der Netzhaut unseres Auges noch in den Nervenzellen des Gehirns irgend etwas von der Form eines Quadrats geben. Vielmehr müssen wir die sinnlichen Eindrücke unbewußt durch eine Vorstellung ordnen, ihre Gesamtheit gewissermaßen in eine Vorstellung, in ein zusammenhängendes, ›sinnvolles‹ Bild verwandeln. Erst mit dieser Verwandlung, mit dieser Zusammenordnung von Einzeleindrücken zu etwas ›Verständlichem‹ haben wir ›wahrgenommen‹. Daher müßte doch zuerst einmal geprüft werden, woher die Bilder für unsere Vorstellungen kommen, wie sie begrifflich gefaßt werden und in welcher Beziehung sie zu den Dingen stehen, bevor wir so sicher über Erfahrungen urteilen können. Denn die Vorstellungen sind doch offenbar vor der Erfahrung, sie sind die Voraussetzung für die Erfahrung.«
»Kommen denn die Vorstellungen, die du so scharf vom Objekt der Wahrnehmungen trennen willst, nicht selber doch wieder aus der Erfahrung? Vielleicht nicht so direkt, wie man es sich naiv denken möchte, aber doch indirekt etwa über die häufige Wiederholung ähnlicher Gruppen von Sinneseindrücken oder über die Beziehungen zwischen den Zeugnissen verschiedener Sinne?«
»Das scheint mir keineswegs sicher, nicht einmal besonders einleuchtend. Ich habe neulich in den Schriften des Philosophen Malebranche studiert, und da ist mir eine Stelle aufgefallen, die sich eben auf dieses Problem bezieht. Malebranche unterscheidet im wesentlichen drei Möglichkeiten für die Entstehung der Vorstellungen. Die eine, die du eben erwähnt hast: Die Gegenstände erzeugen über die Sinneseindrücke direkt die Vorstellung in der menschlichen Seele. Diese Ansicht lehnt Malebranche ab, da die sinnlichen Eindrücke ja qualitativ verschieden sind sowohl von den Dingen als auch von den ihnen zugeordneten Vorstellungen. Die zweite: Die menschliche Seele besitzt die Vorstellungen von Anfang an, oder sie besitzt wenigstens die Kraft, diese Vorstellungen selbst zu bilden. In diesem Fall wird sie durch die sinnlichen Eindrücke nur an die schon vorhandenen Vorstellungen erinnert, oder sie wird von den Sinneseindrücken dazu angeregt, die Vorstellungen selbst zu formen. Die dritte – und für diese entscheidet sich Malebranche: Die menschliche Seele nimmt teil an der göttlichen Vernunft. Sie ist mit Gott verbunden und daher ist ihr auch von Gott die Vorstellungskraft, sind ihr die Bilder oder Ideen gegeben, mit denen sie die Fülle der sinnlichen Eindrücke ordnen und begrifflich gliedern kann.«
Damit war nun wieder Kurt ganz unzufrieden: »Ihr Philosophen seid immer schnell bei der Hand mit der Theologie. Und wenn es schwierig wird, laßt ihr den großen Unbekannten auftreten, der alle Schwierigkeiten sozusagen von selbst löst. Aber damit lasse ich mich hier nicht abfinden. Wenn du nun einmal die Frage gestellt hast, so will ich wissen, wie die menschliche Seele zu ihren Vorstellungen kommt; und zwar in dieser Welt, nicht in einer jenseitigen. Denn die Seele und die Vorstellungen gibt es doch in dieser Welt. Wenn du nicht zugeben willst, daß die Vorstellungen einfach selbst aus der Erfahrung stammen, dann mußt du erklären, wieso sie der menschlichen Seele von Anfang an mitgegeben sein können. Sollen sie oder wenigstens die Fähigkeit zum Bilden der Vorstellungen – mit denen doch schon das Kind die Welt erfährt – etwa angeboren sein? Wenn du dies behaupten willst, dann liegt doch der Gedanke nahe, daß die Vorstellungen auf den Erfahrungen früherer Generationen beruhen, und ob es sich nun um unsere jetzigen Erfahrungen oder um die vergangener Generationen handelt, das soll mir nicht so wichtig sein.«
»Nein«, erwiderte Robert, »so meine ich es bestimmt nicht. Denn einerseits ist es äußerst zweifelhaft, ob sich Gelerntes, das heißt das Ergebnis von Erfahrungen, überhaupt vererben ließe. Andererseits kann das, was Malebranche meint, wohl auch ohne Theologie ausgedrückt werden, und dann paßt es besser in eure heutige Naturwissenschaft. Ich will’s versuchen. Malebranche könnte etwa sagen: Die gleichen ordnenden Tendenzen, die für die sichtbare Ordnung der Welt, für die Naturgesetze, die Entstehung der chemischen Elemente und ihre Eigenschaften, die Bildung der Kristalle, die Erzeugung des Lebens und alles andere verantwortlich sind, sie sind auch bei der Entstehung der menschlichen Seele und in dieser Seele wirksam. Sie lassen den Dingen die Vorstellungen entsprechen und bewirken die Möglichkeit begrifflicher Gliederung. Sie sind für jene wirklich existierenden Strukturen verantwortlich, die erst dann, wenn wir sie von unserem menschlichen Standpunkt aus betrachten, wenn sie in Gedanken fixiert werden, in ein Objektives – das Ding – und ein Subjektives – die Vorstellung – auseinanderzutreten scheinen. Mit der für eure Naturwissenschaft so plausiblen Auffassung, daß alle Vorstellung auf Erfahrung beruhe, hat diese These Malebranches gemein, daß die Fähigkeit zum Bilden von Vorstellungen in der Entwicklungsgeschichte durch die Beziehung der Organismen zur äußeren Welt zustande gekommen sein mag. Aber Malebranche betont doch gleichzeitig, daß es sich um Zusammenhänge handelt, die nicht einfach durch eine Kette kausal ablaufender Einzelvorgänge erklärt werden können. Daß hier also – wie bei der Entstehung der Kristalle oder der Lebewesen – übergeordnete Strukturen mehr morphologischen Charakters wirksam werden, die sich mit dem Begriffspaar Ursache und Wirkung nicht ausreichend erfassen lassen. Die Frage, ob die Erfahrung vor der Vorstellung gewesen sei, ist also wohl nicht vernünftiger, als die altbekannte Frage, ob die Henne früher gewesen sei als das Ei, oder umgekehrt.
Im übrigen wollte ich euer Gespräch über die Atome nicht stören. Ich wollte nur davor warnen, bei den Atomen so einfach von Erfahrung zu sprechen; denn es könnte immerhin sein, daß die Atome, die man ja gar nicht direkt beobachten kann, auch nicht einfach Dinge sind, sondern zu fundamentaleren Strukturen gehören, bei denen es keinen rechten Sinn mehr hätte, sie in Vorstellung und Ding auseinandertreten zu lassen. Natürlich kann man die Haken und Ösen in deinem Lehrbuch nicht ernst nehmen, ebenso wenig wohl auch alle Bilder von Atomen, die man hin und wieder in populären Schriften findet. Solche Bilder, die dem leichteren Verständnis dienen sollen, machen das Problem nur viel unverständlicher. Ich glaube, man sollte beim Begriff ›Form der Atome‹, den du vorher erwähnt hast, äußerst vorsichtig sein. Nur wenn man das Wort ›Form‹ sehr allgemein faßt, nicht nur räumlich, wenn es nicht viel anderes bedeutet als etwa das Wort ›Struktur‹, das ich eben benützt habe, könnte ich mich mit diesem Begriff halbwegs anfreunden.«
Durch diese Wendung des Gesprächs wurde ich ganz unvermittelt an eine Lektüre erinnert, die mich ein Jahr vorher beschäftigt und gefesselt hatte und die mir damals an wichtigen Stellen ganz unverständlich geblieben war. Es handelte sich um den Dialog ›Timaios‹ bei Plato, in dem ja auch über die kleinsten Teile der Materie philosophiert wird. Aus den Worten von Robert wurde mir zum ersten Mal, wenn auch zunächst noch in unklarer Weise, begreiflich, daß man überhaupt zu solchen merkwürdigen gedanklichen Konstruktionen über die kleinsten Teile kommen kann, wie ich sie in Platos ›Timaios‹ vorgefunden hatte. Nicht daß mir diese Konstruktionen, die ich zunächst für ganz absurd gehalten hatte, nun auf einmal plausibel erschienen wären; nur sah ich hier zum ersten Mal einen Weg vor mir, der wenigstens im Prinzip zu derartigen Konstruktionen führen konnte.
Um verständlich zu machen, daß mir die Erinnerung an das Studium des ›Timaios‹ in diesem Moment sehr viel bedeutete, muß wohl auch kurz über die merkwürdigen Umstände berichtet werden, unter denen diese Lektüre stattgefunden hatte. Im Frühjahr 1919 herrschten in München ziemlich chaotische Zustände. Auf den Straßen wurde geschossen, ohne daß man genau wußte, wer die Kämpfenden waren. Die Regierungsgewalt wechselte zwischen Personen und Institutionen, die man kaum dem Namen nach kannte. Plünderungen und Raub, von denen einer mich einmal selbst betroffen hatte, ließen den Ausdruck »Räterepublik« als Synonym für rechtlose Zustände erscheinen. Als sich dann schließlich außerhalb Münchens eine neue bayerische Regierung gebildet hatte, die ihre Truppen zur Eroberung von München einsetzte, hofften wir auf Wiederherstellung geordneter Verhältnisse. Der Vater des Freundes, dem ich früher bei den Schularbeiten geholfen hatte, übernahm die Führung einer Kompanie von Freiwilligen, die sich an der Eroberung der Stadt beteiligen wollten. Er forderte uns, das heißt die halberwachsenen Freunde seiner Söhne, auf, als stadtkundige Ordonnanzen bei den einrückenden Truppen zu helfen. So ergab es sich, daß wir einem Stab, genannt Kavallerieschützenkommando II, zugeteilt wurden, der sein Quartier in der Ludwigstraße im Gebäude des Priesterseminars gegenüber der Universität aufgeschlagen hatte. Hier tat ich also Dienst, oder richtiger, hier führten wir zusammen ein sehr ungebundenes Abenteurerleben; von der Schule waren wir befreit, wie schon so oft vorher, und wir wollten die Freiheit nutzen, um die Welt von neuen Seiten kennenzulernen. Der Freundeskreis, mit dem ich ein Jahr später über die Hügel am Starnberger See wanderte, hatte sich in seinem Grundstock eben hier zusammengefunden. Dieses abenteuerliche Leben dauerte aber nur einige Wochen. Als dann die Kämpfe abgeflaut waren und der Dienst eintönig wurde, geschah es öfters, daß ich nach einer in der Telephonzentrale durchwachten Nacht mit dem Sonnenaufgang aller Pflichten ledig war.
Um mich allmählich wieder auf die Schule vorzubereiten, zog ich mich dann mit unserer griechischen Schulausgabe der Platonischen Dialoge auf das Dach des Priesterseminars zurück. Dort konnte ich, in der Dachrinne liegend und von den ersten Sonnenstrahlen durchwärmt, in aller Ruhe meinen Studien nachgehen und zwischendurch das erwachende Leben auf der Ludwigstraße beobachten. An einem solchen Morgen, als das Licht der aufgehenden Sonne schon das Universitätsgebäude und den Brunnen davor überflutete, geriet ich an den Dialog ›Timaios‹, und zwar an jene Stelle, wo über die kleinsten Teile der Materie gesprochen wird. Vielleicht hat mich die Stelle zunächst nur deswegen gefesselt, weil sie schwer zu übersetzen war oder weil sie von mathematischen Dingen handelte, die mich immer schon interessiert hatten. Ich weiß nicht mehr, warum ich meine Arbeit gerade auf diesen Text besonders hartnäckig konzentrierte. Aber was ich dort las, kam mir völlig absurd vor. Da wurde behauptet, daß die kleinsten Teile der Materie aus rechtwinkligen Dreiecken gebildet seien, die, nachdem sie paarweise zu gleichseitigen Dreiecken oder Quadraten zusammengetreten waren, sich zu den regulären Körpern der Stereometrie Würfel, Tetraeder, Oktaeder und Ikosaeder zusammenfügten. Diese vier Körper seien dann die Grundeinheiten der vier Elemente Erde, Feuer, Luft und Wasser. Dabei blieb mir unklar, ob die regulären Körper nur als Symbole den Elementen zugeordnet waren, so etwa der Würfel dem Element Erde, um die Festigkeit, das Ruhende dieses Elements darzustellen, oder ob wirklich die kleinsten Teile des Elements Erde eben die Form des Würfels haben sollten. Solche Vorstellungen empfand ich als wilde Spekulationen, bestenfalls entschuldbar durch den Mangel an eingehenden empirischen Kenntnissen im alten Griechenland. Aber es beunruhigte mich tief, daß ein Philosoph, der so kritisch und scharf denken konnte wie Plato, doch auf derartige Spekulationen verfallen war. Ich versuchte, irgendwelche Denkansätze zu finden, von denen aus die Spekulationen Platos mir verständlicher werden könnten. Aber ich wußte nichts zu entdecken, was auch nur von ferne den Weg dahin gewiesen hätte. Dabei ging für mich von der Vorstellung, daß man bei den kleinsten Teilen der Materie schließlich auf mathematische Formen stoßen sollte, eine gewisse Faszination aus. Ein Verständnis des fast unentwirrbaren und unübersehbaren Gewebes der Naturerscheinungen war doch wohl nur möglich, wenn man mathematische Formen in ihm entdecken konnte. Aber mit welchem Recht Plato dabei gerade auf die regulären Körper der Stereometrie verfallen war, blieb mir völlig unverständlich. Sie schienen keinerlei Erklärungswert zu enthalten. So benützte ich den Dialog weiterhin nur, um meine Kenntnisse im Griechischen aufzufrischen. Aber die Beunruhigung blieb. Das wichtigste Ergebnis der Lektüre war vielleicht die Überzeugung, daß man, wenn man die materielle Welt verstehen wollte, etwas über ihre kleinsten Teile wissen mußte. Aus Schullehrbüchern und populären Schriften war mir bekannt, daß auch die moderne Wissenschaft Untersuchungen über die Atome anstellt. Vielleicht konnte ich später in meinem Studium selbst in diese Welt eindringen. Aber das war später.
Die Beunruhigung blieb und wurde für mich ein Teil jener allgemeinen Unruhe, die die Jugend in Deutschland ergriffen hatte. Wenn ein Philosoph vom Rang Platos Ordnungen im Naturgeschehen zu erkennen glaubte, die uns jetzt verlorengegangen oder unzugänglich sind, was bedeutet das Wort »Ordnung« überhaupt? Ist Ordnung und ihr Verständnis an eine Zeit gebunden? Wir waren in einer Welt aufgewachsen, die wohlgeordnet schien. Unsere Eltern hatten uns die bürgerlichen Tugenden gelehrt, die für die Aufrechterhaltung jener Ordnung die Voraussetzung bilden. Daß es zuzeiten auch notwendig sein kann, für ein solches geordnetes Staatswesen das eigene Leben zu opfern, das hatten schon Griechen und Römer gewußt, das war nichts Besonderes. Der Tod vieler Freunde und Verwandter hatte uns gezeigt, daß die Welt eben so ist; aber nun gab es viele, die sagten, der Krieg sei ein Verbrechen gewesen, und zwar ein Verbrechen eben jener Führungsschicht, die sich für die Aufrechterhaltung der alten europäischen Ordnung vor allem verantwortlich gefühlt hatte, die geglaubt hatte, ihr auch dort Geltung verschaffen zu müssen, wo sie mit anderen Bestrebungen in Konflikt geriet. Die alte Struktur Europas war jetzt durch die Niederlage zerbrochen. Auch das war nichts Besonderes. Wo es Kriege gibt, muß es Niederlagen geben. Aber war dadurch der Wert der alten Struktur grundsätzlich in Frage gestellt? Kam es nun nicht einfach darauf an, aus den Trümmern eine neue kräftigere Ordnung aufzubauen? Oder hatten jene recht, die auf den Straßen von München ihr Leben dafür opferten, die Rückkehr einer Ordnung alten Stils überhaupt zu verhindern und statt dessen eine zukünftige zu verkünden, die nicht mehr eine Nation, sondern die ganze Menschheit umfassen sollte – obwohl diese Menschheit außerhalb Deutschlands in ihrer Mehrheit vielleicht gar nicht daran dachte, eine solche Ordnung errichten zu wollen? In den Köpfen der jungen Menschen gingen diese Fragen wirr durcheinander, und auch die Älteren konnten uns keine Antworten mehr geben.
So fiel in die Zeit zwischen der Lektüre des ›Timaios‹ und der Wanderung auf den Höhen am Starnberger See noch ein weiteres Erlebnis, das erheblichen Einfluß auf mein späteres Denken gewonnen hat und über das berichtet werden muß, bevor das Gespräch über die Welt der Atome wieder aufgenommen werden kann. Einige Monate nach der Eroberung Münchens waren die Truppen wieder aus der Stadt ausgezogen. Wir besuchten die Schule wie vorher, ohne viel über den Wert unseres Tuns nachzudenken. Da geschah es eines Nachmittags, daß ich auf der Leopoldstraße von einem mir unbekannten Jungen angesprochen wurde: »Weißt du schon, daß sich in der nächsten Woche die Jugend auf Schloß Prunn versammelt? Wir wollen alle mitgehen, und du sollst auch kommen. Alle sollen kommen. Wir wollen uns jetzt selbst überlegen, wie alles weitergehen soll.« Seine Stimme hatte einen Klang, den ich bis dahin nicht gehört hatte. So beschloß ich, nach Schloß Prunn zu fahren, Kurt wollte mich begleiten.
Die Eisenbahn, die damals noch ganz unregelmäßig verkehrte, brachte uns erst in vielen Stunden ins untere Altmühltal. Es war wohl in früheren geologischen Zeiten einmal das Tal der Donau gewesen; die Altmühl hat sich dort in vielen Windungen den Weg durch den Fränkischen Jura gegraben, und das malerische Tal ist fast wie das Rheintal von alten Burgen bekränzt. Die letzten Kilometer zum Schloß Prunn mußten wir zu Fuß zurücklegen, und schon sahen wir von allen Seiten junge Menschen auf die hohe Burg zustreben, die kühn auf einem senkrecht abfallenden Felsen am Talrand errichtet ist. Im Schloßhof, in dessen Mitte ein alter Ziehbrunnen stand, waren schon größere Scharen versammelt. Die meisten waren noch Schüler, aber es gab auch Ältere darunter, die als Soldaten alle Schrecken des Krieges miterlebt hatten und in eine veränderte Welt zurückgekehrt waren. Viele Reden wurden gehalten, deren Pathos uns heute fremd anmuten würde: Ob das Schicksal unseres Volkes oder das der ganzen Menschheit für uns wichtiger wäre, ob der Opfertod der Gefallenen durch die Niederlage sinnlos geworden sei, ob die Jugend sich das Recht nehmen dürfe, ihr Leben selbst und nach eigenen Wertmaßstäben zu gestalten, ob die innere Wahrhaftigkeit wichtiger sei als die alten Formen, die für Jahrhunderte das Leben der Menschen geordnet hätten – über all dies wurde mit Leidenschaft gesprochen und gestritten.
Ich war viel zu unsicher, um mich an diesen Debatten zu beteiligen, aber ich hörte zu und dachte über den Begriff der Ordnung selbst nach. Die Verwirrung im Inhalt der Reden schien mir zu zeigen, daß auch echte Ordnungen miteinander in Widerstreit geraten können und daß dann durch diesen Kampf das Gegenteil von Ordnung bewirkt wird. Dies war, so schien mir, doch nur möglich, wenn es sich um Teilordnungen handelte, um Bruchstücke, die sich aus dem Verband der zentralen Ordnung gelöst hatten; die zwar ihre Gestaltungskraft noch nicht eingebüßt hatten, denen aber die Orientierung nach der Mitte verlorengegangen war. Das Fehlen dieser wirksamen Mitte wurde mir immer quälender bewußt, je länger ich zuhörte; ich litt fast physisch darunter, aber ich wäre selbst nicht imstande gewesen, aus dem Dickicht der widerstreitenden Meinungen einen Weg in den zentralen Bereich zurückzufinden. So vergingen Stunden, und es wurden Reden gehalten und Streitgespräche geführt. Die Schatten auf dem Burghof wurden länger, und schließlich folgte dem heißen Tag eine graublaue Dämmerung und eine mondhelle Nacht. Immer noch wurde gesprochen, aber dann erschien oben auf dem Balkon über dem Schloßhof ein junger Mensch mit einer Geige, und als es still geworden war, erklangen die ersten großen d-moll-Akkorde der Chaconne von Bach über uns. Da war die Verbindung zur Mitte auf einmal unbezweifelbar hergestellt. Das vom Mondlicht übergossene Altmühltal unter uns wäre Grund genug für eine romantische Verzauberung gewesen; aber das war es nicht. Die klaren Figuren der Chaconne waren wie ein kühler Wind, der den Nebel zerriß und die scharfen Strukturen dahinter sichtbar werden ließ. Man konnte also vom zentralen Bereich sprechen, das war zu allen Zeiten möglich gewesen, bei Plato und bei Bach, in der Sprache der Musik oder der Philosophie oder der Religion, also mußte es auch jetzt und in Zukunft möglich sein. Das war das Erlebnis.
Den Rest der Nacht verbrachten wir an Lagerfeuern und in Zelten auf einer Waldwiese oberhalb des Schlosses, und dort wurde auch Eichendorffscher Romantik Raum gegeben. Der junge Geiger, schon ein Student, setzte sich zu unserer Gruppe und spielte Menuette von Mozart und Beethoven, dazwischen alte Volkslieder, und ich versuchte, ihn auf meiner Gitarre zu begleiten. Er erwies sich übrigens als ein lustiger Kamerad, der sich nicht gern auf die Feierlichkeit seiner Darstellung der Chaconne von Bach anreden ließ. Als es doch geschah, fragte er zurück: »Weißt du, in welcher Tonart die Posaunen von Jericho geblasen haben?« – »Nein.« – »Natürlich auch in d-moll!« – »Wieso?« – »Weil sie die Mauern von Jericho d-moll-iert haben.« Unserer Empörung über den Kalauer konnte er sich nur durch schnelle Flucht entziehen.
Diese Nacht war nun wieder in das Halbdunkel der Erinnerung zurückgesunken, und wir wanderten über die Höhen am Starnberger See und sprachen über die Atome. Roberts Bemerkung über Malebranche hatte mir klar gemacht, daß Erfahrungen über die Atome nur recht indirekter Art sein können und daß die Atome wahrscheinlich keine Dinge sind. Dies hatte offenbar auch Plato im ›Timaios‹ gemeint, und nur so waren seine weiteren Spekulationen über die regulären Körper wenigstens halbwegs verständlich. Auch wenn die moderne Naturwissenschaft über die Formen der Atome spricht, so kann das Wort Form hier nur in seiner allgemeinsten Bedeutung verstanden werden, als Struktur in Raum und Zeit, als Symmetrie-Eigenschaft von Kräften, als Möglichkeit zur Bindung an andere Atome. Anschaulich würde man solche Strukturen wohl nie beschreiben können, schon weil sie gar nicht so eindeutig in die objektive Welt der Dinge gehörten. Aber einer mathematischen Betrachtung sollten sie vielleicht zugänglich sein.
Ich wollte also mehr über die philosophische Seite des Atomproblems wissen und erwähnte gegenüber Robert die Stelle im ›Timaios‹ bei Plato. Dann fragte ich ihn, ob er denn überhaupt mit der Meinung einverstanden sei, daß alle materiellen Dinge aus Atomen bestehen, daß es schließlich kleinste Teile gebe, eben die Atome, in die man alle Materie zerlegen könne. Ich hätte den Eindruck, daß er gegen diese ganze Begriffswelt der atomaren Struktur der Materie recht skeptisch eingestellt sei.
Er bestätigte mir dies. »Mir ist diese Fragestellung fremd, die so weit aus unserer unmittelbaren Erlebniswelt herausführt. Die Welt der Menschen oder die der Seen und Wälder liegt mir näher als die der Atome. Aber man kann natürlich fragen, was geschieht, wenn man die Materie immer weiter zu teilen sucht, ebenso wie man fragen kann, ob sehr entfernte Sterne und deren Planeten von lebendigen Wesen bewohnt sind. Mir sind solche Fragen nicht angenehm; vielleicht möchte ich die Antwort gar nicht wissen. Ich glaube, wir haben in unserer Welt wichtigere Aufgaben als die, solche Fragen zu stellen.«
Ich antwortete: »Ich will nicht mit dir über die Wichtigkeit der verschiedenen Aufgaben rechten. Mir ist die Naturwissenschaft immer interessant gewesen, und ich weiß, daß sich viele ernsthafte Menschen darum bemühen, mehr über die Natur und ihre Gesetze zu erfahren. Vielleicht ist der Erfolg ihrer Arbeit auch für die menschliche Gemeinschaft wichtig, aber darauf kommt es mir jetzt nicht an. Was mich beunruhigt, ist dies: Es sieht so aus, und Kurt hat das ja vorhin schon gesagt, als hätte die moderne Entwicklung von Naturwissenschaft und Technik recht dicht an die Stelle herangeführt, an der man die einzelnen Atome oder wenigstens ihre Wirkung unmittelbar sehen kann, an der man mit Atomen experimentieren kann. Wir wissen davon noch wenig, weil wir es nicht gelernt haben; aber wenn es so ist, wie verhält sich das zu deinen Ansichten? Was könntest du vom Standpunkt deines Philosophen Malebranche dazu sagen?«
»Ich würde jedenfalls erwarten, daß die Atome sich ganz anders verhalten als die Dinge der täglichen Erfahrung. Ich könnte mir wohl denken, daß man beim Versuch, immer weiter zu teilen, auf Unstetigkeiten stößt, aus denen man auf eine körnige Struktur der Materie schließen muß. Aber ich würde vermuten, daß sich die Gebilde, mit denen man dann zu tun bekommt, einer objektiven Fixierung in vorstellbaren Bildern weitgehend entziehen, daß sie eher eine Art abstrakter Ausdruck für die Naturgesetze sind, aber eben keine Dinge.«
»Wenn man sie aber direkt sehen kann?«
»Man wird sie nicht sehen können, sondern nur ihre Wirkung.«
»Das ist eine schlechte Ausrede. Denn das ist bei allen anderen Dingen doch genauso. Auch von einer Katze siehst du immer nur die Lichtstrahlen, die von ihrem Körper ausgehen, das heißt die Wirkungen der Katze, niemals die Katze selbst, und auch wenn du ihr Fell streichelst, ist es grundsätzlich nicht anders.«
»Doch! Da kann ich dir nicht recht geben. Die Katze kann ich direkt sehen, denn hier kann ich, ja muß ich die Sinneseindrücke in eine Vorstellung verwandeln. Von der Katze gibt es beides: die objektive und die subjektive Seite – die Katze als Ding und als Vorstellung. Aber beim Atom ist das anders. Da werden Vorstellung und Ding nicht mehr auseinandertreten, weil das Atom eigentlich beides nicht mehr ist.«
Hier mischte sich Kurt wieder ins Gespräch: »Mir wird euer Reden zu gelehrt. Ihr ergeht euch in philosophischen Spekulationen, wo man eben doch einfach die Erfahrung fragen sollte. Vielleicht führt uns unser Studium einmal später an die Aufgabe, über die Atome oder an den Atomen zu experimentieren; dann werden wir schon sehen, was die Atome sind. Wir werden wahrscheinlich lernen, daß sie genauso wirklich und real sind wie alle anderen Dinge, mit denen man experimentieren kann. Wenn es wahr ist, daß alle materiellen Dinge aus Atomen bestehen, so sind diese Atome eben auch genauso wirklich und real wie die materiellen Dinge.«
»Nein«, erwiderte Robert, »dieser Schluß scheint mir äußerst anfechtbar. Du könntest genausogut sagen: Weil alle lebendigen Wesen aus Atomen bestehen, so sind die Atome auch genauso lebendig wie diese Wesen. Das ist doch offenbar Unsinn. Erst die Zusammensetzung vieler Atome zu größeren Gebilden soll diesen Gebilden ja die Qualitäten, die Eigenschaften geben, die sie eben als solche Gebilde oder Dinge charakterisieren.«
»Also meinst du, die Atome seien nicht wirklich oder real?«
»Nun übertreibst du wieder! Vielleicht handelt es sich hier gar nicht um die Frage, was wir über die Atome wissen, sondern um die ganz andere Frage, was solche Worte wie ›wirklich‹ oder ›real‹ bedeuten sollen. Ihr habt vorhin die Stelle in Platos ›Timaios‹ erwähnt und berichtet, daß Plato die kleinsten Teile mit mathematischen Formen, den regulären Körpern, identifiziert. Wenn das auch unrichtig sein mag, denn Plato hatte keine Erfahrungen über die Atome, so kann man es doch einmal als möglich unterstellen. Würdest du solche mathematische Formen ›wirklich‹ und ›real‹ nennen? Wenn sie Ausdruck der Naturgesetze sind, also Ausdruck der zentralen Ordnung des materiellen Geschehens, so müßte man sie wohl wirklich nennen, denn es gehen Wirkungen von ihnen aus, aber man könnte sie nicht real nennen, weil sie eben keine ›res‹, keine Sache sind. Man weiß hier eben nicht mehr recht, wie man die Worte verwenden soll, und das ist kein Wunder, weil man sich so weit entfernt hat von dem Bereich unserer unmittelbaren Erfahrung, in dem sich unsere Sprache in vorgeschichtlicher Zeit gebildet hat.«
Kurt war mit dem Verlauf des Gesprächs noch nicht ganz zufrieden und meinte: »Auch die Entscheidung hierüber würde ich gern der Erfahrung überlassen. Ich kann mir nicht vorstellen, daß die menschliche Phantasie ausreicht, um die Verhältnisse bei den kleinsten Teilen der Materie zu erraten, wenn man sich nicht vorher durch eingehende Experimente mit der Welt dieser kleinsten Teile vertraut gemacht hat. Nur wenn dies sehr gewissenhaft und ohne alle vorgefaßten Meinungen geschieht, kann ein echtes Verständnis herauskommen. Daher bin ich skeptisch gegen allzu eingehende philosophische Diskussionen über einen so schwierigen Gegenstand. Denn dabei werden zu leicht gedankliche Vorurteile gebildet, die dann später das Verständnis erschweren, statt es zu erleichtern. Ich hoffe also, daß sich in Zukunft zuerst die Naturwissenschaftler und erst dann die Philosophen mit den Atomen befassen.«
Um diese Zeit war die Geduld der anderen Mitwanderer wohl erschöpft. »Wollt ihr nicht endlich mit eurem merkwürdigen Zeug aufhören, das doch kein Mensch versteht? Wenn ihr euch aufs Examen vorbereiten wollt, so tut es zu Hause. Wie wär’s mit einem Lied?« So wurde schnell angestimmt, und der helle Klang der jungen Stimmen, die Farben der blühenden Wiesen waren wirklicher als die Gedanken über die Atome, und sie verscheuchten den Traum, dem wir uns überlassen hatten.
2
Der Entschluß zum Physikstudium (1920)
Schulzeit und Universitätsstudium waren für mich durch einen tiefen Einschnitt getrennt. Nach einer dem Abitur folgenden Wanderung durchs Frankenland mit der gleichen Gruppe von Freunden, mit denen ich im Frühling am Starnberger See über die Atomlehre gesprochen hatte, erkrankte ich schwer, mußte mit hohem Fieber für viele Wochen das Bett hüten und war auch in der anschließenden Erholungszeit noch lange mit meinen Büchern allein. In diesen kritischen Monaten war mir ein Werk in die Hände geraten, dessen Inhalt mich faszinierte, obgleich ich es nur halb verstand. Der Mathematiker Hermann Weyl hatte unter dem Titel ›Raum–Zeit–Materie‹ eine mathematische Darstellung der Prinzipien der Einsteinschen Relativitätstheorie gegeben. Die Auseinandersetzung mit den hier entwickelten schwierigen mathematischen Methoden und dem dahinterliegenden abstrakten Gedankengebäude der Relativitätstheorie beschäftigte und beunruhigte mich. Sie bekräftigte meinen schon vorher gefaßten Entschluß, an der Universität München Mathematik studieren zu wollen.
In den ersten Tagen meines Studiums trat dann aber noch eine merkwürdige und auch für mich überraschende Wendung ein, die kurz berichtet werden muß. Mein Vater, der an der Universität München Mittel- und Neugriechische Sprache lehrte, hatte mir eine Unterredung mit dem Professor für Mathematik Lindemann verschafft, der durch die endgültige mathematische Entscheidung des uralten Problems von der Quadratur des Zirkels berühmt geworden war. Ich wollte Lindemann bitten, mich zu seinem Seminar zuzulassen; denn ich bildete mir ein, durch die Mathematikstudien, die ich während der Schulzeit nebenher getrieben hatte, für ein solches Seminar genügend vorbereitet zu sein. Ich besuchte Lindemann, der auch in der Hochschulverwaltung tätig war, im ersten Stock des Universitätsgebäudes in einem merkwürdig altmodisch ausgestatteten dunklen Raum, der in mir durch die Steifheit seiner Einrichtung etwas beklemmende Gefühle auslöste. Bevor ich noch mit dem Professor, der sich nur langsam erhob, gesprochen hatte, bemerkte ich auf dem Schreibtisch neben ihm kauernd ein kleines Hündchen mit schwarzem Fell, das mich in dieser Umgebung ganz unmittelbar an den Pudel in Fausts Studierstube erinnerte. Der dunkle Vierbeiner blickte mich feindselig an, er betrachtete mich offenbar als einen Eindringling, der die Ruhe seines Herrn stören wollte. Dadurch etwas verwirrt, brachte ich mein Anliegen nur stockend vor und bemerkte erst jetzt beim Sprechen, wie unbescheiden meine Bitte eigentlich war. Lindemann, ein alter Herr mit weißem Vollbart, der schon etwas müde aussah, empfand diese Unbescheidenheit offenbar auch, und die leichte Gereiztheit, die ihn ergriff, mag der Grund dafür gewesen sein, daß nun plötzlich das Hündchen auf dem Schreibtisch entsetzlich zu bellen anfing. Sein Herr versuchte vergeblich, es zu beruhigen. Das kleine Tier steigerte seinen Zorn über mich zu einem wütenden Kläffen, das in immer neuen Anfällen aus ihm hervorbrach, so daß die Verständigung immer schwieriger wurde. Lindemann fragte noch, welche Bücher ich denn in der letzten Zeit studiert hätte. Ich nannte das Werk von Weyl ›Raum–Zeit–Materie‹. Unter dem anhaltenden Toben des kleinen schwarzen Wächters schloß Lindemann darauf das Gespräch mit den Worten: »Dann sind Sie für die Mathematik sowieso schon verdorben.« Damit war ich entlassen.
Mit dem Studium der Mathematik war es also nichts. Eine enttäuschte Beratung mit meinem Vater führte zu dem Schluß, daß ich es ja auch mit dem Studium der mathematischen Physik versuchen könnte. So wurde ein Besuch bei Sommerfeld vereinbart, der damals das Fach der Theoretischen Physik an der Universität München vertrat und als einer der glänzendsten Lehrer der Hochschule und als ein Freund der Jugend galt. Sommerfeld empfing mich in einem hellen Zimmer, durch dessen Fenster man im Hof der Universität die Studenten auf den Bänken unter der großen Akazie sitzen sah. Der kleine, untersetzte Mann mit dem etwas martialisch anmutenden dunklen Schnurrbart machte zunächst einen strengen Eindruck. Aber schon aus den ersten Sätzen schien mir eine unmittelbare Güte zu sprechen, ein Wohlwollen für den jungen Menschen, der hier Führung und Rat suchte. Wieder kam die Rede auf meine neben der Schule betriebenen mathematischen Studien und auf das Buch von Weyl ›Raum–Zeit–Materie‹. Sommerfeld reagierte ganz anders als Lindemann:
»Sie sind viel zu anspruchsvoll«, meinte er, »Sie können doch nicht mit dem Schwierigsten anfangen und hoffen, daß Ihnen das Leichtere von selbst in den Schoß fällt. Ich verstehe, daß Sie von dem Problemkreis der Relativitätstheorie fasziniert sind, und die moderne Physik dringt auch noch an anderen Stellen in Bereiche vor, in denen philosophische Grundpositionen in Frage gestellt werden, in denen es sich also um Erkenntnisse der erregendsten Art handelt. Aber der Weg dahin ist weiter, als Sie sich jetzt vorstellen. Sie müssen mit bescheidener, sorgfältiger Arbeit im Bereich der traditionellen Physik anfangen. Wenn Sie Physik studieren wollen, so haben Sie übrigens zunächst die Wahl, ob Sie vor allem experimentieren oder theoretisch arbeiten wollen. Nach dem, was Sie erzählen, liegt Ihnen die Theorie vielleicht näher. Aber haben Sie sich in der Schulzeit nicht auch gelegentlich mit Apparaten und Experimenten beschäftigt?«
Ich bestätigte dies und berichtete, daß ich als Schuljunge gerne kleine Apparate, Motoren und Funkeninduktoren gebaut hätte. Aber im ganzen sei mir die Welt der Apparate doch eher fremd, und die Sorgfalt, die man bei genauen Messungen auch relativ unwichtiger Daten aufwenden müsse, fiele mir sicher außerordentlich schwer.
»Aber Sie müssen, auch wenn Sie Theorie treiben wollen, mit großer Sorgfalt kleine und Ihnen zunächst unwichtig scheinende Aufgaben bearbeiten. Wenn solche großen bis in die Philosophie reichenden Probleme zur Diskussion stehen wie die Einsteinsche Relativitätstheorie oder die Plancksche Quantentheorie, so gibt es auch für den, der über die Anfangsgründe hinaus ist, viele kleine Probleme, die gelöst werden müssen und die erst in ihrer Gesamtheit ein Bild des neu erschlossenen Gebiets vermitteln.«
»Aber mich interessieren die dahinterliegenden philosophischen Fragen vielleicht noch mehr als die einzelnen kleinen Aufgaben«, wandte ich schüchtern ein. Aber damit war Sommerfeld gar nicht zufrieden.
»Sie wissen doch, wie Schiller über Kant und seine Ausleger gesagt hat: ›Wenn die Könige baun, haben die Kärrner zu tun‹. Zunächst sind wir alle Kärrner! Aber Sie werden schon sehen, daß Ihnen auch das Freude macht, wenn Sie solche Arbeit sorgfältig und gewissenhaft tun und dabei auch, wie wir hoffen, etwas herausbringen.« Sommerfeld gab mir dann noch Anweisungen für die Anfänge meines Studiums und versprach, mir vielleicht schon sehr bald ein kleines Problem vorzulegen, das mit Fragen der neuesten Atomtheorie zu tun hätte und an dem ich meine Kräfte erproben könnte. Damit war über meine Zugehörigkeit zur Sommerfeldschen Schule für die nächsten Jahre entschieden.
Dieses erste Gespräch mit einem Gelehrten, der in der modernen Physik wirklich Bescheid wußte, der auf dem Gebiet zwischen Relativitätstheorie und Quantentheorie selbst wichtige Entdeckungen gemacht hatte, wirkte noch lange Zeit in mir nach. Die Forderung nach der Sorgfalt im Kleinen leuchtete mir ein, da ich sie in anderer Form auch von meinem Vater oft gehört hatte. Aber es bedrückte mich, noch so weit von dem Bereich entfernt zu sein, dem mein eigentliches Interesse galt. So fand diese erste Unterredung ihre Fortsetzung in manchen anderen Gesprächen mit meinen Freunden, und mir ist besonders eines in der Erinnerung geblieben, das die Stellung der modernen Physik in der kulturellen Entwicklung unserer Zeit betraf.
Mit dem Geiger, der in der Nacht von Schloß Prunn die Chaconne von Bach gespielt hatte, traf ich mich in jenem Herbst häufig im Haus unseres Freundes Walter, der ein guter Cellist war. Wir versuchten gemeinsam, uns in die klassische Trioliteratur einzuarbeiten, und hatten uns damals gerade vorgenommen, für eine Feier das berühmte Schuberttrio in B-Dur einzustudieren. Da Walters Vater früh verstorben war, lebte seine Mutter allein mit ihren beiden Söhnen in einer großen und sehr kultiviert eingerichteten Wohnung in der Elisabethstraße, nur wenige Minuten von meinem elterlichen Haus in der Hohenzollernstraße entfernt, und der schöne Bechsteinflügel im Wohnzimmer erhöhte für mich noch den Reiz, dort zu musizieren. Im Anschluß an die gemeinsame Musik saßen wir dann oft bis spät in die Nacht zusammen, in Gespräche vertieft. Bei dieser Gelegenheit kam die Rede auch auf meine Studienpläne. Walters Mutter fragte mich, warum ich mich nicht für das Studium der Musik entschieden hätte:
»Aus Ihrem Spiel und aus der Art, wie Sie über diese Musik sprechen, habe ich den Eindruck, daß die Kunst Ihrem Herzen näher liegt als Naturwissenschaft und Technik, daß Sie im Grunde den Inhalt solcher Musik schöner finden als den Geist, der sich in Apparaten und Formeln oder in raffinierten technischen Geräten ausdrückt. Wenn das so ist, warum wollen Sie sich für die Naturwissenschaft entscheiden? Der Weg der Welt wird doch schließlich bestimmt durch das, was die jungen Menschen wollen. Wenn die Jugend sich für das Schöne entscheidet, wird es mehr Schönes geben; wenn sie sich für das Nützliche entscheidet, wird es mehr Nützliches geben. Daher hat die Entscheidung eines jeden einzelnen ihr Gewicht nicht nur für ihn selbst, sondern auch für die menschliche Gesellschaft.«
Ich versuchte mich zu verteidigen: »Ich glaube eigentlich nicht, daß man vor eine so einfache Wahl gestellt wird. Denn auch abgesehen davon, daß ich wahrscheinlich kein besonders guter Musiker werden könnte, bleibt doch die Frage, in welchem Gebiet man heute am meisten ausrichten kann, und diese Frage zielt auf den Zustand des betreffenden Gebiets. In der Musik habe ich den Eindruck, daß die Kompositionen der letzten Jahre nicht mehr so überzeugend sind wie die der früheren Zeiten. Im 17.Jahrhundert war die Musik noch weitgehend von dem religiösen Kern des damaligen Lebens bestimmt, im 18.Jahrhundert ist der Übergang in die Gefühlswelt des Einzelnen vollzogen worden, und die romantische Musik des 19.Jahrhunderts ist bis in die innersten Tiefen der menschlichen Seele vorgedrungen. Aber in den letzten Jahren scheint die Musik in ein merkwürdig unruhiges und vielleicht etwas schwächliches Experimentierstadium zu geraten, in dem theoretische Überlegungen eine größere Rolle spielen als das sichere Bewußtsein eines Fortschritts auf vorbestimmter Bahn. In der Naturwissenschaft, und besonders in der Physik, ist das anders. Dort hat die Verfolgung des vorgezeichneten Weges – dessen Ziel damals, vor zwanzig Jahren, das Verständnis gewisser elektromagnetischer Erscheinungen sein mußte – von selbst zu Problemen geführt, in denen philosophische Grundpositionen, die Struktur von Raum und Zeit und die Gültigkeit des Kausalgesetzes, in Frage gestellt werden. Hier, glaube ich, eröffnet sich ein noch unübersehbares Neuland, und wahrscheinlich werden mehrere Generationen von Physikern zu tun haben, um die endgültigen Antworten zu finden. Es scheint mir eben sehr verlockend, dabei irgendwie mitzutun.«
Unser Freund Rolf, der Geiger, war damit nicht zufrieden. »Gilt das, was du von der modernen Physik sagst, nicht auch im gleichen Maße von unserer heutigen Musik? Auch hier scheint der Weg vorgezeichnet. Die alten Schranken der Tonalität werden überwunden, wir treten in ein Neuland ein, in dem wir hinsichtlich der Klänge und Rhythmen fast jede beliebige Freiheit haben. Können wir da nicht ebensoviel Reichtum erhoffen wie in deiner Naturwissenschaft?«
Walter aber hatte doch einige Bedenken bei diesem Vergleich. »Ich weiß nicht«, warf er ein, »ob Freiheit in der Wahl der Ausdrucksmittel und fruchtbares Neuland notwendig das gleiche sind. Es sieht zwar zunächst so aus, als ob eine größere Freiheit auch eine Bereicherung, eine Vermehrung der Möglichkeiten darstellen müsse. Aber das kann ich für die Kunst, die mir näher liegt als die Wissenschaft, eigentlich nicht zugeben. Der Fortschritt der Kunst vollzieht sich doch wohl in der Weise, daß zunächst ein langsamer historischer Prozeß, der das Leben der Menschen umgestaltet, ohne daß der Einzelne darauf viel Einfluß ausüben könnte, neue Inhalte hervorbringt. Einzelne begabte Künstler versuchen dann, diesen Inhalten sichtbare oder hörbare Gestalt zu geben, indem sie dem Material, mit dem ihre Kunst arbeitet, den Farben oder den Instrumenten, neue Ausdrucksmöglichkeiten abringen. Dieses Wechselspiel oder–wenn man so will – dieser Kampf zwischen dem Ausdrucksinhalt und der Beschränktheit der Ausdrucksmittel ist, so scheint mir, die unumgängliche Voraussetzung dafür, daß wirklich Kunst entsteht. Wenn die Beschränktheit der Ausdrucksmittel wegfällt, wenn man zum Beispiel in der Musik jeden beliebigen Klang hervorbringen kann, so gibt es diesen Kampf nicht mehr, so stößt die Anstrengung der Künstler gewissermaßen ins Leere. Daher bin ich gegen allzu große Freiheit skeptisch.«
»In der Naturwissenschaft«, fuhr Walter fort, »werden immer wieder neue Experimente durch neue Techniken ermöglicht und ausgeführt, neue Erfahrungen gesammelt, und dadurch werden wohl die neuen Inhalte hervorgebracht. Die Ausdrucksmittel sind hier die Begriffe, in denen die neuen Inhalte erfaßt und damit verstanden werden sollen. Zum Beispiel habe ich aus populären Schriften entnommen, daß die Relativitätstheorie, die dich so interessiert, auf gewissen Erfahrungen beruht, die so um die Jahrhundertwende gemacht wurden, als man versuchte, die Bewegung der Erde im Raum mit Hilfe der Interferenz von Lichtstrahlen nachzuweisen. Als dieser Nachweis mißlang, merkte man, daß die neuen Erfahrungen oder, was dasselbe ist, die neuen Inhalte eine Erweiterung der Ausdrucksmöglichkeiten, das heißt des Begriffssystems der Physik, nötig machten. Daß dann radikale Änderungen an so fundamentalen Begriffen wie Raum und Zeit notwendig würden, hatte wohl zu Anfang niemand vorausgesehen. Aber das war offenbar die große Entdeckung Einsteins, der als erster erkannte, daß an den Vorstellungen von Raum und Zeit etwas verändert werden kann und auch verändert werden muß.
Ich würde das, was du von deiner Physik schilderst, also eher mit der Entwicklung der Musik in der Mitte des 18.Jahrhunderts vergleichen. Damals war durch einen langsamen historischen Prozeß jene Gefühlswelt des einzelnen Menschen ins Bewußtsein der Zeit getreten, die wir aus Rousseau oder später aus Goethes Werther kennen, und es ist dann den großen Klassikern, Haydn, Mozart, Beethoven, Schubert, gelungen, durch Erweiterung der Ausdrucksmittel für diese Gefühlswelt eine angemessene Darstellung zu finden. In der heutigen Musik aber sind mir die neuen Inhalte zu wenig erkennbar oder zu unplausibel, und der Überfluß in den Ausdrucksmöglichkeiten macht mich eher besorgt. Der Weg der heutigen Musik scheint gewissermaßen nur im Negativen vorgezeichnet: man muß die alte Tonalität aufgeben, weil man glaubt, daß ihr Bereich erschöpft sei; nicht weil starke neue Inhalte vorhanden wären, die sich in ihr nicht mehr ausdrücken ließen. Wohin man aber gehen soll, nachdem man die Tonalität verlassen hat, darüber besteht bei den Musikern noch keine Klarheit, da gibt es nur tastende Versuche. In der modernen Naturwissenschaft sind die Fragestellungen gegeben, die Aufgabe besteht darin, die Antworten zu finden. In der modernen Kunst sind die Fragestellungen selbst unbestimmt. Aber du solltest noch etwas mehr von dem Neuland erzählen, das du in der Physik vor dir zu sehen glaubst und in dem du später auf Entdeckungsfahrten ausgehen willst.«
Ich versuchte, das wenige, was ich durch meine Krankheitslektüre und durch populäre Bücher über Atomphysik in Erfahrung gebracht hatte, den anderen verständlich zu machen.
»In der Relativitätstheorie«, so antwortete ich Walter, »haben die Experimente, die du genannt hast und die offenbar mit Experimenten anderer Art gut zusammenpassen, Einstein veranlaßt, den bisherigen Begriff der Gleichzeitigkeit aufzugeben. Das ist schon sehr aufregend. Denn zunächst glaubt ja jeder Mensch, daß er genau wisse, was das Wort ›gleichzeitig‹ bedeutet, auch wenn es sich auf Ereignisse bezieht, die sich in großem räumlichem Abstand abspielen. Aber offenbar weiß man es nicht genau. Wenn man nämlich fragt, wie man denn feststellen kann, ob zwei derartige Ereignisse gleichzeitig seien, und dann verschiedene Feststellungsmöglichkeiten auf ihre Ergebnisse hin untersucht, so erhält man von der Natur die Auskunft, daß die Antwort nicht eindeutig ist, daß sie vielmehr vom Bewegungszustand des Beobachters abhängt. Raum und Zeit sind also nicht so unabhängig voneinander, wie man bisher geglaubt hatte. Einstein hat in einer ziemlich einfachen und geschlossenen mathematischen Form diese neue Struktur von Raum und Zeit beschreiben können. In den Monaten meiner Krankheit habe ich versucht, in diese mathematische Welt etwas einzudringen. Dieser ganze Bereich ist aber, wie ich inzwischen von Sommerfeld gelernt habe, schon ziemlich weitgehend erschlossen und daher gar kein Neuland mehr.
Die interessantesten Probleme liegen jetzt in anderer Richtung, nämlich in der Atomtheorie. Dort handelt es sich um die Grundfrage, warum es in der materiellen Welt immer wiederkehrende Formen und Qualitäten gibt. Warum zum Beispiel die Flüssigkeit Wasser mit allen ihren charakteristischen Eigenschaften immer wieder neu gebildet wird, etwa beim Schmelzen des Eises oder beim Kondensieren von Wasserdampf oder beim Verbrennen von Wasserstoff. Das ist in der bisherigen Physik zwar immer vorausgesetzt, aber niemals verstanden worden. Wenn man sich die materiellen Körper, zum Beispiel das Wasser, als aus Atomen zusammengesetzt denkt und die Chemie macht ja von dieser Vorstellung erfolgreich Gebrauch –, so würden die Bewegungsgesetze, die wir als Newtonsche Mechanik in der Schule gelernt haben, niemals zu Bewegungen der kleinsten Teile von einem solchen Stabilitätsgrad führen können. An dieser Stelle müssen also Naturgesetze ganz anderer Art wirksam werden, die dafür sorgen, daß sich die Atome immer wieder in der gleichen Weise anordnen und bewegen, so daß immer wieder Stoffe mit den gleichen stabilen Eigenschaften entstehen. Die ersten Andeutungen für solche neuen Naturgesetze sind offenbar vor zwanzig Jahren von Planck in seiner Quantentheorie gefunden worden, und der dänische Physiker Bohr hat die Planckschen Ideen mit Vorstellungen über die Struktur des Atoms in Verbindung gebracht, die Rutherford in England entwickelt hatte. Er hat dabei zum ersten Mal Licht auf die merkwürdige Stabilität im atomaren Bereich werfen können, von der ich gerade gesprochen habe. Aber in diesem Gebiet ist man, wie Sommerfeld meint, von einem klaren Verständnis der Verhältnisse noch weit entfernt. Hier öffnet sich also ein riesiges Neuland, in dem man vielleicht noch für Jahrzehnte neue Zusammenhänge entdecken kann. So müßte man doch eigentlich die ganze Chemie auf die Physik der Atome zurückführen können, wenn man an dieser Stelle die Naturgesetze richtig formuliert hat. Es wird darauf ankommen, die richtigen neuen Begriffe zu finden, mit denen man sich in dem neuen Gebiet zurechtfinden kann. Ich glaube also, daß man heute in der Atomphysik wichtigeren Zusammenhängen, wichtigeren Strukturen auf die Spur kommen kann als in der Musik. Aber ich gebe gern zu, daß es vor 150Jahren gerade umgekehrt gewesen ist.«
»Du meinst also«, antwortete Walter, »daß der Einzelne, der an der geistigen Struktur seiner Zeit mitwirken will, auf die Möglichkeiten angewiesen ist, die ihm die historische Entwicklung eben für diese Zeit bereitstellt? Wenn Mozart in unserer Zeit geboren wäre, so könnte er auch nur atonale experimentierende Musik schreiben wie unsere heutigen Komponisten?«
»Ja, das vermute ich. Wenn Einstein im 12.Jahrhundert gelebt hätte, so hätte er sicher keine bedeutenden naturwissenschaftlichen Entdeckungen machen können.«
»Vielleicht ist es aber auch unerlaubt«, warf Walters Mutter ein, »immer gleich an die großen Gestalten wie Mozart oder Einstein zu denken. Der Einzelne hat meist nicht die Möglichkeit, an einer entscheidenden Stelle mitzuwirken. Er nimmt mehr im stillen, im kleinen Kreise teil, und da muß man sich eben doch überlegen, ob es nicht schöner ist, das B-Dur-Trio von Schubert zu spielen, als Apparate zu bauen oder mathematische Formeln zu schreiben.«
Ich bestätigte, daß mir gerade an dieser Stelle viele Skrupel gekommen wären, und ich berichtete auch über mein Gespräch mit Sommerfeld und darüber, daß mein zukünftiger Lehrer das Schillerwort zitiert hatte: »Wenn die Könige baun, haben die Kärrner zu tun.«
Rolf meinte dazu: »Darin geht es natürlich uns allen gleich. Als Musiker muß man zunächst unendlich viel Arbeit allein für die technische Beherrschung des Instruments aufwenden, und selbst dann kann man nur immer wieder Stücke spielen, die schon von hundert anderen Musikern noch besser interpretiert worden sind. Und du wirst, wenn du Physik studierst, zunächst in langer mühevoller Arbeit Apparate bauen müssen, die schon von anderen besser gebaut, oder wirst mathematischen Überlegungen nachgehen, die schon von anderen in aller Schärfe vorgedacht worden sind. Wenn dies alles geleistet ist, bleibt bei uns, sofern man eben zu den Kärrnern gehört, immerhin der ständige Umgang mit herrlicher Musik und gelegentlich die Freude daran, daß eine Interpretation besonders gut geraten ist. Bei euch wird es dann und wann gelingen, einen Zusammenhang noch etwas besser zu verstehen, als es vorher möglich war, oder einen Sachverhalt noch etwas genauer zu vermessen, als die Vorgänger es gekonnt haben. Darauf, daß man an noch Wichtigerem mitwirkt, daß man an entscheidender Stelle weiterkommen könnte, darf man nicht allzu bestimmt rechnen. Selbst dann nicht, wenn man an einem Gebiet mitarbeitet, in dem es noch viel Neuland zu erkunden gibt.«
Walters Mutter, die nachdenklich zugehört hatte, sprach nun mehr vor sich hin als zu uns gewandt, so als ob sich ihre Gedanken erst im Sprechen formten:
»Wahrscheinlich wird das Gleichnis von den Königen und den Kärrnern immer falsch gedeutet. Natürlich kommt es uns zunächst so vor, als gehe der ganze Glanz von der Tätigkeit der Könige aus und als sei die Arbeit der Kärrner nur nebensächliches Beiwerk. Aber vielleicht ist es gerade umgekehrt. Vielleicht beruht der Glanz der Könige im Grunde auf der Arbeit der Kärrner; er besteht überhaupt nur darin, daß die Kärrner für viele Jahre mühevolle Arbeit, aber damit auch die Freude und den Erfolg mühevoller Arbeit gewinnen können. Vielleicht erscheinen uns Gestalten wie Bach oder Mozart nur deshalb als Könige der Musik, weil sie für zwei Jahrhunderte so vielen kleineren Musikern die Möglichkeit gegeben haben, in größter Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit ihre Gedanken nachzuvollziehen, neu zu interpretieren und damit den Zuhörern verständlich zu machen. Und selbst die Zuhörer nehmen noch an dieser Arbeit des sorgfältigen Nachvollziehens und Interpretierens teil, und dabei werden ihnen jene Inhalte gegenwärtig, die von den großen Musikern dargestellt worden sind. Wenn man die historische Entwicklung ansieht – und das scheint mir für die Künste und die Wissenschaften in gleicher Weise zuzutreffen –, so muß es in jeder Disziplin lange Zeiten der Ruhe oder einer nur langsamen Entwicklung geben. Auch in diesen Zeiten kommt es auf die gewissenhafte, bis in alle Einzelheiten genaue Arbeit an. Alles, was nicht mit vollem Einsatz gemacht ist, wird sowieso vergessen und verdient nicht, auch nur erwähnt zu werden. Aber dann bringt dieser langsame Prozeß, in dem sich mit dem Wandel der Zeiten auch der Inhalt der betreffenden Disziplin verändert, plötzlich und manchmal ganz unerwartet neue Möglichkeiten, neue Inhalte hervor. Große Begabungen werden von diesem Vorgang, von den Wachstumskräften, die hier spürbar werden, gewissermaßen magisch angezogen, und so kommt es, daß innerhalb weniger Jahrzehnte auf einem engen Raum die bedeutendsten Kunstwerke geschaffen oder wissenschaftliche Entdeckungen größter Wichtigkeit gemacht werden. So ist in der zweiten Hälfte des 18.Jahrhunderts die klassische Musik in Wien entstanden, so im 15. und 16.Jahrhundert die Malerei in den Niederlanden. Die großen Begabungen geben den neuen geistigen Inhalten zwar ihre äußere Darstellung, sie schaffen die gültigen Formen, in denen sich die weitere Entwicklung vollzieht; aber sie bringen die neuen Inhalte doch nicht eigentlich selbst hervor.
Ende der Leseprobe