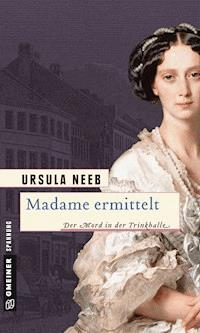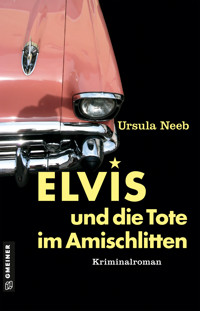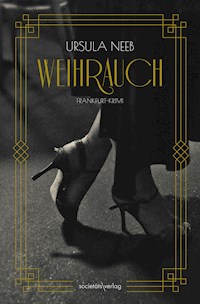14,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Ullstein Ebooks in Ullstein Buchverlage
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Im Jahre 1581 bricht der Gelehrte Martin Molitor zu einer Reise nach Trier auf. Seine Schwester Sybille ist voller Sorge. Es ist kein Geheimnis, dass ein Serienmörder an der Mosel sein Unwesen treibt und viele Wanderer nicht zurückkehren. Als ihre schlimmsten Befürchtungen wahr werden und Martin verschollen bleibt, bricht Sybille gegen die Widerstände ihrer Familie auf und will die Wahrheit ergründen. Sie trifft auf den Schriftenhändler Sebastian Wildgruber und verliebt sich unsterblich in ihn. Gemeinsam mit Sebastian beginnt Sybille, das grausame Rätsel um den Teufel vom Hunsrück zu entwirren.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Das Buch
Der Hunsrück, 1581: Eine rätselhafte Mordserie versetzt die Bewohner des Rheinlandes in Angst und Schrecken. Immer wieder verschwinden Wanderer in der Gegend um den Fraßberg bei Bernkastel an der Mosel auf unerklärliche Weise und tauchen nie mehr auf. Die Bevölkerung ist sich sicher: Es kann sich nur um das Werk des Teufels handeln.
Allen Geschehnissen zum Trotz nimmt der Gelehrte Martin Molitor auf seiner Reise nach Trier die Route über den Hunsrück. Als er nicht zurückkehrt, bricht seine Schwester Sibylle gegen die Widerstände ihrer Familie auf, um die Wahrheit über das Verschwinden ihres Bruders zu ergründen. Nur ein einziger Mensch hilft ihr: der Schriftenhändler Sebastian Wildgruber. Gemeinsam mit Sebastian beginnt Sibylle, das grausame Rätsel um den Teufel vom Hunsrück zu entwirren und kommt so dem berüchtigtsten Serienmörder jener Zeit auf die Spur.
Die Autorin
Ursula Neeb hat Geschichte studiert. Aus der eigentlich geplanten Doktorarbeit entstand später ihr erster Roman »Die Siechenmagd«. Sie arbeitete beim Deutschen Filmmuseum und bei der FAZ. Heute lebt sie als Autorin mit ihren beiden Hunden in Seelenberg im Taunus. Die Geschichte des deutschen Serienmörders Christman Gniperdoliga, dem mehrere Hundert Opfer zugeschrieben werden, inspirierte sie dazu, den Historienroman »Der Teufel vom Hunsrück« zu schreiben.
Von Ursula Neeb sind außerdem in unserem Hause erschienen:
Das Geheimnis der TotenmagdDie HurenköniginDie Hurenkönigin und der VenusordenDie Rache der Hurenkönigin
Ursula Neeb
Der Teufelvom Hunsrück
Roman
Ullstein
Besuchen Sie uns im Internet:www.ullstein-buchverlage.de
Wir wählen unsere Bücher sorgfältig aus, lektorieren sie gründlich mit Autoren und Übersetzern und produzieren sie in bester Qualität.
Hinweis zu Urheberrechten
Sämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten.Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken, deshalb ist die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Widergabe ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.
ISBN 978-3-8437-1202-6
© Ullstein Buchverlage GmbH, Berlin 2016Umschlaggestaltung: ZERO Werbeagentur, MünchenTitelabbildung: © Getty Images / DEA / G. Dagli Orti. (Stillleben im Vordergrund);© FinePic®, München (rote Hintergrundstruktur)
E-Book: Pinkuin Satz und Datentechnik, Berlin
Alle Rechte vorbehalten
»Den Teufel spürt das Völkchen nie, auch wenn er sie beim Kragen hätte.« (Johann Wolfgang von Goethe, Faust. Der Tragödie erster Teil, Tübingen 1808)
Für Mocho, in Liebe.
Prolog
Die Strahlen der hochstehenden Mittagssonne tauchten den Berghang in goldenes Licht. Die junge Frau, die das steilste Stück bereits hinter sich gelassen und fast schon den breiten Wiesengürtel erreicht hatte, der bis hinunter zum Höhenweg führte, hielt inne und sog tief den intensiven Blütenduft ein. Es war Ende Mai, das Gras stand in Saft und Kraft, und alles strotzte vor Leben. Für einen flüchtigen Moment ließ die Frau mit den verhärmten Gesichtszügen ihre Blicke über die blühenden Wiesenkräuter schweifen, um die sich Bienen und Schmetterlinge tummelten, und hinauf zu den Blütenkronen der Obstbäume, wo sie sich in der endlosen Weite des azurblauen Himmels verloren. Sie hatte ganz vergessen, wie schön das Leben sein konnte! Es mochte eine Ewigkeit her sein, seit sie zum letzten Mal den Frühling erlebt hatte. Genau sieben Jahre, wurde es ihr bewusst, und ihr Gesicht verdüsterte sich, als habe sich eine dunkle Wolke vor die Sonne geschoben. Wie gehetzt hastete die Frau mit der fragilen Statur weiter, als wäre der Leibhaftige hinter ihr her – und irgendwie war er das ja auch, zumindest in ihren Gedanken. Denn eines war ihr unterwegs klargeworden: Bei jedem einzelnen Schritt, der sie hinausführte aus der Hölle, war ihr Peiniger stets bei ihr. Er saß ihr im Nacken wie ein Alb, beherrschte ihre Gedanken und hielt ihr Herz mit eisernem Griff umklammert. Es war der reinste Hohn, dass sie ihm hatte schwören müssen, nicht zu flüchten und alles genau so zu tun, wie er es befahl, denn der Mut zum Aufbegehren war ihr längst abhandengekommen. Er hatte ihr die Seele geraubt und nur noch eine leere Hülle zurückgelassen.
Vor Jahren hatte er ihr einmal einen Spiegel geschenkt, und was sie darin erblickt hatte, hatte sie kaum wiedererkannt. Ihre Haare, die früher geglänzt hatten wie Gold und bis zu den Hüften reichten, waren grau und strähnig geworden, die einst so strahlenden Augen leer und erloschen, die vollen Lippen zu einem schmalen Strich verkniffen, ihr ehemals so liebreizendes Gesicht war bleich und hohlwangig und gemahnte sie an ein Gespenst. Und das war sie auch – ein Gespenst in einer grausigen Schattenwelt, das die Gewänder von Toten trug.
Als sie unversehens die junge Frau und ihren Begleiter auf der Wiese erblickte, schreckte sie zusammen wie vom Schlag getroffen. Sie war so menschenscheu geworden in ihrer Einöde. Die beiden jungen Leute, die sie aus großen Augen anschauten, schienen aus einer Welt zu kommen, der sie schon lange nicht mehr angehörte.
»Kann ich Euch vielleicht helfen?«, richtete die junge Frau das Wort an sie und lächelte ihr freundlich zu. Für wenige Sekunden wurde ihr ganz warm ums Herz, und sie hätte der arglosen Fremden am liebsten entgegengeschrien, sie solle auf der Hut sein. Doch die übermächtige Angst, die ihr Gemüt verdüsterte, ließ sie schweigen. Das ansprechende Gesicht der Frau erinnerte sie an ihre geliebte Schwester, und ein unbändiger Schmerz schnürte ihr die Kehle zu. Die Bilder aus jener fernen, längst vergangenen Zeit, in der sie noch voller Zuversicht ins Leben geblickt hatte, waren im Laufe der Jahre immer blasser geworden.
Jäh wandte sie sich ab und flüchtete, die eindringlichen Rufe des Paares nicht beachtend, in wilder Hast den Berg hinauf. Obgleich sie das Beten schon lange verlernt hatte, sandte sie inständige Bitten zum Himmel, die beiden möchten ihr bloß nicht folgen. Die Schritte dicht hinter ihr verrieten jedoch, dass sie es taten. Sie hatte das Gefühl, keine Luft mehr zu bekommen, und geriet ins Straucheln. Mit letzter Kraft stützte sie sich auf dem steinigen Geröll ab und kam mühsam wieder auf die Beine. In ihrer Faust hielt sie noch einen Stein. Sie zitterte am ganzen Körper, als sie ihn hastig in die Innentasche ihres Mieders schob und weiterrannte. Sie vernahm keuchende Atemzüge kaum einen Steinwurf von ihr entfernt, die ihr unaufhaltsam und beharrlich folgten – in den sicheren Tod.
1. TEIL – Das böse Handwerk
(Der Satan zu Beelzebub): »Besser ist’s, der Hölle Herr zu sein als des Himmels Sklave.«
(John Milton, Das verlorene Paradies, I.262, London 1674)
1
In der Umgebung von Kerpen, 29. Oktober 1566
An jenem regnerischen Herbstabend wollte sich Christman gerade auf sein Zimmer zurückziehen, um vor dem Schlafen noch ein wenig seine Studien zu betreiben, als der Vater ihn an der Treppe zurückhielt.
»Du musst noch die drei Feldhasen zur ›Mühlenschenke‹ bringen«, sagte der stattliche Mann im grünen Försterrock barsch.
Der Sechzehnjährige verzog ärgerlich das Gesicht. »Hat das nicht Zeit bis morgen?«, murrte er. »Ich bin doch schon in aller Herrgottsfrühe auf die Jagd gegangen und bin müde.«
»Dann hättest du sie früher hinbringen müssen. Der Wirt rechnet zum Wochenende damit, und jetzt haben wir schon Freitagabend. Die müssen ja auch noch abgezogen und ausgeweidet werden, oder willst du das machen?« Der Förster musterte seinen Sohn missmutig. »Wenn wir sie die Nacht über hier liegen lassen, können wir sie morgen früh an die Hunde verfüttern.«
Der hochgewachsene junge Mann mit den kurzgeschorenen hellen Haaren seufzte resigniert. »Na gut, ich geh ja schon!«, grummelte er und nahm seinen Lodenumhang vom Kleiderhaken.
»Von den zehn Groschen, die dir der Wirt zu geben hat, kannst du meinethalben drei Kreuzer behalten«, rief ihm der Vater hinterher.
Drei Kreuzer dafür, dass ich bei diesem Sauwetter den Laufburschen für dich mache! Da gibst du ja am Sonntag bei der Kollekte mehr in den Almosenbeutel, du Geizhals, fluchte Christman im Stillen und schlug erbittert die Tür hinter sich zu. Wie so oft sehnte er sich danach, alles zurückzulassen und endlich ein Leben zu führen, das seiner wahren Bestimmung entsprach.
Als ihn draußen die Nacht umfing und ein feiner Nieselregen sein Gesicht benetzte, stieß er zwischen den Zähnen hervor: »Lass diesen Tag nicht mehr fern sein!«
Der junge Förstersohn eilte zum Stall, sattelte den Rappen und befestigte die Feldhasen am Sattel. Dann entzündete er an der Hoflaterne eine Teerfackel, denn es war Neumond und stockfinstere Nacht, stieg auf sein Pferd und ritt durch das Hoftor in den angrenzenden Wald hinein. Kaum hatte er das Forsthaus hinter sich gelassen, gab er dem Rappen die Sporen und stürmte in wildem Galopp den Waldweg entlang. Je schneller er ritt, desto mehr verflüchtigte sich sein Unmut, und bald genoss er es, durch den dunklen Wald zu reiten. Er liebte die Finsternis und fühlte sich in ihr geborgen. Sie war zweifellos sein Element. Wie gerne hätte er auf die Fackel verzichtet und wäre durch die Dunkelheit geschnellt wie eine Eule in lautlosem Flug. Schon als Knaben hatten ihn in der Natur jene geheimnisvollen Geschöpfe fasziniert, die es durch geschickte Tarnung verstanden, sich unsichtbar zu machen. Obgleich er sich früh in sich selbst zurückgezogen hatte und zum Einzelgänger und Sonderling geworden war, lag ihm doch nie daran, sich von der Masse abzuheben. Im Gegenteil, ihn beherrschte eher der Wunsch, in ihr zu verschwinden. Daher widerstrebte es ihm auch, durch das Licht aufzufallen. Zwar kannte er den Wald gut genug, um sich blind orientieren zu können, nicht aber die Flussauen, in denen sich die »Mühlenschenke« befand, was die Fackel leider unabdingbar machte.
Im Nu hatte Christman den Tannenwald durchquert und näherte sich dem Erfttal mit seinen Obstwiesen und Viehweiden, das sich zwischen Kerpen und der kleinen Ortschaft Blatzheim erstreckte. Feine Nebelschwaden hingen über dem Gras, und ein Stück weit entfernt konnte Christman die Lichter des Wirtshauses ausmachen. Der Regen war stärker geworden, und er freute sich schon auf seine warme Stube im Forsthaus. Er würde nur rasch die Hasen abgeben und sich gleich wieder auf den Heimweg machen.
Als er wenig später die Schenke erreicht hatte und sein Pferd festmachte, vernahm er aus der Gaststube laute Stimmen. Ungesellig und menschenscheu, wie er war, widerstrebte es ihm zutiefst, sich unter die Leute zu mischen. Am liebsten hätte er die Hasen einfach vor die Tür gelegt und sich still und heimlich davongeschlichen, aber das konnte er natürlich nicht machen. Mit fahriger Hand wischte er sich den Schweiß und den Regen von der Stirn, packte die Hasen an den Schnüren und trat mit zusammengepressten Lippen in den Schankraum. Bei dem schlechten Wetter hatten sich gerade einmal eine Handvoll Gäste in die »Mühlenschenke« verirrt, die dem unauffälligen jungen Mann im Lodenumhang glücklicherweise kaum Beachtung schenkten. Lediglich der Wirt kam grüßend hinter dem Schanktresen hervor und nahm sogleich das Wildbret in Empfang.
»Setz dich an den Ofen, Junge, und wärm dich erst mal auf«, bot er Christman an und hieß seine Frau, dem Sohn des Försters ein Bier zu bringen. Christman blickte sich verdrossen um. Die Einladung behagte ihm wenig, doch er mochte den Wirt nicht vor den Kopf stoßen, und so nahm er das Angebot an und ließ sich an einem freien Tisch am Rande der Gaststube nieder. Als ihm die Wirtin das Bier brachte und ihm freundlich zuzwinkerte, bedankte er sich einsilbig. Er machte sich nicht viel aus Weibsbildern und konnte es auch nicht nachvollziehen, dass die meisten Männer sich so nach ihnen verzehrten. In ihm schwelte ein ganz anderes Feuer. Er nahm einen Schluck und ließ seine Blicke verstohlen über die Schankgäste schweifen. An einem großen Tisch am Kachelofen saßen vier Männer und unterhielten sich angeregt. Ihren Stimmen nach waren sie bereits ziemlich angetrunken. Einer von ihnen, ein feister, stiernackiger Bursche mit gerötetem Gesicht, führte das Wort. Christman kannte ihn vom Sehen. Es war ein Pferdehändler aus dem Nachbarort Blatzheim. Seine großspurige Art missfiel Christman, und er vermied es daher, ihn direkt anzuschauen, damit der Kerl nicht noch das Wort an ihn richtete. Stattdessen lenkte er seine Aufmerksamkeit auf den Fremden am Nachbartisch, dem ebenso wenig der Sinn nach Ansprache zu stehen schien wie ihm, und taxierte ihn unauffällig. Der Mann hatte pechschwarzes, schulterlanges Haar und einen schwarzen Oberlippenbart. In seiner zerschlissenen Uniformjacke sah er wild und verwegen aus. Das markante, wettergegerbte Gesicht mit den slawischen Zügen war von Narben und Schrammen übersät, was sein abenteuerliches Aussehen noch verstärkte. Die schräg geschnittenen Augen über den hohen Wangenknochen muteten fremdländisch an. Er war womöglich von tatarischer Herkunft. Christman, der seinen Mitmenschen überwiegend gleichgültig, nicht selten auch feindselig gesonnen war, fand den Fremden interessant. Den Mann umgab eine Unnahbarkeit, die selbst das Großmaul vom benachbarten Stammtisch nicht zu durchbrechen wagte, er trank in kleinen Schlucken seinen Branntwein und bedeutete der Wirtin mit herrischer Geste, ihm noch einmal nachzufüllen, ohne sich auf irgendeine Weise zu bedanken. Er nahm von seiner Umwelt nicht die geringste Notiz und schien ganz in seine Gedanken versunken.
Das laute Stimmengewirr vom Stammtisch ging Christman zunehmend auf die Nerven, und er trank hastig sein Bier aus, um endlich wieder gehen zu können. Der Pferdehändler prahlte mit seinen guten Geschäften mit den einfältigen Bauerntölpeln, denen er für ein paar alte Schindmähren das Geld aus der Tasche gezogen habe, und orderte beim Wirt eine Lokalrunde. Als ihm die Wirtin gleich darauf ein Bier auf den Tisch stellte und der Pferdehändler gönnerhaft allen zuprostete, hätte Christman den Bierkrug am liebsten gar nicht angerührt. Um jedoch nicht den Unmut des Spenders auf sich zu ziehen, prostete er verhalten zurück. Aus den Augenwinkeln beobachtete er, dass sein Tischnachbar es ihm gleichtat.
»Wollt ihr zwei euch nicht zu uns setzen, an unserem Tisch ist doch noch Platz genug, da muss keiner alleine saufen!«, tönte mit einem Mal die Stimme des Pferdehändlers durch den Schankraum, und Christman schreckte unwillkürlich zusammen.
»Sehr freundlich von Euch, aber ich muss mich gleich auf den Weg machen!«, erwiderte sein Tischnachbar mit fremdländischem Tonfall und verlangte auch sogleich beim Wirt die Rechnung.
Als sich darauf die Blicke des Pferdehändlers und seiner Trinkkumpane auf Christman richteten, erklärte dieser hastig, dass auch er in Bälde aufbrechen müsse.
»Wo müsst Ihr denn hin?«, fragte der Pferdehändler den Mann im Uniformrock.
»Nach Kerpen«, entgegnete dieser kurz angebunden und zählte dem Wirt die Münzen auf den Tisch.
»Das ist aber schade, ich muss in die andere Richtung, nach Blatzheim«, meinte der Pferdehändler bedauernd. »In diesen schlimmen Zeiten ist es nämlich besser, nicht alleine unterwegs zu sein!«, verkündete er mit unheilvoller Miene.
»Das ist wohl wahr!«, stimmte ihm der Wirt, der immer noch mit der Kerze am Tisch des Fremden stand, um ihm das Wechselgeld herauszugeben, mit finsterem Blick zu. Als der Mann im Soldatenrock unbeeindruckt blieb und auch nicht nachfragte, was genau gemeint sei, schlug der Pferdehändler fassungslos die Hände zusammen.
»Sagt bloß, Ihr wisst gar nichts von den schrecklichen Morden, die uns hier im Rheinland seit einiger Zeit heimsuchen!«, rief der Mann aus Blatzheim entrüstet, der vor Mitteilungsdrang und Sensationsgier förmlich zu platzen schien.
Auch wenn der Fremde nur mäßig interessiert mit den Achseln zuckte, ließ es sich der Pferdehändler nun freilich nicht nehmen, die Hintergründe haarklein vor ihm auszubreiten.
»In der Gegend um Dellbrück wurden in den letzten Wochen insgesamt acht Männer mit durchgeschnittener Kehle aufgefunden!«, deklamierte der Pferdehändler im pathetischen Tonfall eines Moritatensängers. »Und damit nicht genug, gehörten in jüngster Zeit auch zwei schwangere Frauen zu den Opfern. Mit aufgeschnittenen Leibern lagen sie in ihrem eigenen Blute, ihrer Leibesfrucht beraubt!« Er hielt kurz inne und wischte sich eine Träne aus den Augenwinkeln, ehe er mit Grabesstimme fortfuhr: »Der böse Feind hat die abscheulichen Morde begangen! In der Nähe der Leichen hat man einen schwarzen Ziegenbock gesehen!«
Der korpulente Mann bekreuzigte sich. Der Wirt und die anderen Schankgäste taten es ihm gleich. Auf ihren Gesichtern spiegelten sich Angst und Entsetzen. Auch Christman, der schon von den Gräueltaten gehört hatte, schlug hastig ein Kreuz, obgleich ihm der Sermon des Pferdehändlers auf die Nerven ging. Aber er mochte nicht aus der Reihe tanzen. Aus den Augenwinkeln sah er, wie der Mann mit dem Narbengesicht ebenfalls mit der Hand ein Kreuz andeutete, was Christman jedoch seltsam anmutete. Nicht nur, weil er die linke Hand verwendete, sondern auch, weil er den kleinen Finger und den Zeigefinger merkwürdig abspreizte. Christman wusste, was es mit diesem Zeichen auf sich hatte, und ihm sträubten sich die Nackenhaare. Als der Mann im Soldatenrock gleich darauf die Münzen vom Tisch klaubte, fiel Christman auf, dass er offensichtlich Linkshänder war und der Ring- und Mittelfinger der linken Hand steif und verkrümmt abstanden, was natürlich die eigenartige Handhaltung beim Bekreuzigen erklärte. Dennoch war Christmans Interesse an seinem Tischnachbarn längst entflammt, und er fühlte sich auf seltsame Weise zu ihm hingezogen. Als der Schwarzhaarige schließlich aufstand und grüßend die Hand hob, konnte Christman im Kerzenschein auf den Pulsadern des Mannes einen eintätowierten schwarzen Federkiel ausmachen, um den ein schwarzer Kreis gezogen war. Die Erkenntnis traf ihn wie ein Blitz, und ihm stockte der Atem. Der Fremde nahm seinen fadenscheinigen Umhang vom Kleiderhaken, stülpte sich eine speckige Soldatenmütze auf den Kopf und wandte sich noch einmal zu dem Pferdehändler um.
»Gott zum Gruße!«, verabschiedete er sich mit dem eigentümlichen rollenden »R« und deutete eine Verbeugung an. »Und gebt fein acht, dass Euch auf Eurem Nachhauseweg der böse Feind nicht holt!«, sagte er mit spöttischem Grinsen und eilte zur Tür hinaus.
»Was für ein unverschämter Tropf!«, entrüstete sich der Pferdehändler und ließ seinem Unmut freien Lauf.
Christman, dessen Mund trotz des reichlich genossenen Biers staubtrocken geworden war, hörte ihm gar nicht mehr zu. Wie ein Schlafwandler erhob er sich vom Stuhl und ging zum Tresen.
»Könnt … könnt Ihr mir bitte … das Geld für die Hasen geben?«, stotterte er und blickte durch den Wirt hindurch wie durch einen Geist.
»Ist dir nicht wohl, Junge, du siehst so blass aus?«, fragte ihn der Wirt besorgt.
»Doch, doch …«, beeilte sich Christman zu erwidern, nahm die zehn Groschen entgegen und verabschiedete sich von den Wirtsleuten mit einem ungelenken Gruß.
Als er aus der Schenke trat, umfingen ihn nur Regen und Dunkelheit. Von dem Fremden war weit und breit nichts zu sehen. Christman lauschte angespannt in die Nacht. Seine Nasenlöcher vibrierten, wie bei einem Jagdhund, der Witterung aufnahm. Er hörte Pferdegetrappel, das sich in linker Richtung entfernte. Seltsam – hatte der Mann nicht gesagt, dass er nach Kerpen wolle? Das lag aber auf der anderen Seite, der linke Trampelpfad führte nach Blatzheim. Verwundert kniff Christman die Augen zusammen und spähte über den finsteren Feldweg entlang den Flussauen, von wo die Geräusche zu ihm drangen.
Tatsächlich konnte er in der Ferne das tänzelnde Licht einer Fackel ausmachen. Ohne nachzudenken, schwang sich Christman aufs Pferd und galoppierte los. Der Drang, dem Fremden zu folgen, war stärker als jedes Abwägen. Er hätte nicht genau sagen können, warum er es tat oder was er sich davon versprach. Ganz entgegen seiner sonst so kühl kalkulierenden, vorausschauenden Art war Christman in diesem Augenblick ein blind Getriebener. Unversehens fiel ihm die wundersame Geschichte des Rattenfängers von Hameln ein, der mit seinem betörenden Flötenspiel die Kinder aus der Stadt lockte, woraufhin sie auf Nimmerwiedersehen verschwanden, und er musste grinsen. Ihn schreckte diese Vorstellung nicht, nein, sie faszinierte ihn vielmehr.
Während er dem Fremden folgte, achtete der erfahrene Jäger und Fährtenleser darauf, unauffällig zu bleiben. Er wollte nicht entdeckt werden, sondern selbst bestimmen, wann und wie er sich ihm zu erkennen geben würde. Zunächst würde er sich an ihn heranpirschen und ihn eine Weile ausspähen, wie er es auf der Jagd zu tun pflegte. Peinlich darauf bedacht, den angemessenen Abstand zu dem Mann mit dem Narbengesicht zu wahren, ließ er den Rappen in einen gemäßigten Trab fallen. Nachdem er so eine ganze Weile geritten war, ohne die Silhouette des Reiters auch nur einen Moment lang aus den Augen zu lassen, machte der Fremde jäh halt. Rasch brachte Christman sein Pferd hinter einem Busch zum Stehen und beobachtete mit angehaltenem Atem, was der Mann tat. Der Fremde stieg vom Pferd und band das Tier am Rand des Feldwegs an einen Ast. Dann leuchtete er mit der Fackel nach oben in die Baumkrone. Was hat er nur vor, dachte Christman verwundert, der sich zunächst keinen Reim auf das merkwürdige Gebaren des Mannes machen konnte. Als der Fremde gar die Fackel löschte und mit einem Schlag undurchdringliche Dunkelheit herrschte, so dass Christman nichts mehr sehen konnte, war er vollends irritiert. Verstört fragte er sich, ob der andere seinen Verfolger womöglich bemerkt hatte und ihm nun seinerseits auflauerte, um ihn zu stellen. Unwillkürlich ging er in Habtachtstellung, denn der Mann im Soldatenrock war mit Sicherheit kampferprobt und wehrhaft. Sein narbenüberzogenes, verwegenes Gesicht, das Christman zuvor in der Schenke gemustert hatte, wirkte gefährlich.
Lautlos ließ sich Christman vom Sattel gleiten, umfasste den Schaft seines Jagdmessers und kauerte sich ins regennasse Gras. Sein Körper war gespannt wie eine Bogensehne. Als der Angriff jedoch ausblieb, beruhigte er sich allmählich wieder. Der Mann konnte ihn unmöglich wahrgenommen haben, so verhalten, wie er ihm gefolgt war. Er würde reglos hier ausharren und abwarten. Als Jäger hatte er gelernt, sich in Geduld zu üben.
Plötzlich hörte er aus der Richtung, wo der Mann sein Pferd angebunden hatte, das Knacken von Zweigen. Es kam jedoch nicht aus dem Unterholz, sondern aus der Baumkrone. Christman hielt den Atem an. Auch er war bei der Verfolgung eines Wildes zuweilen schon auf einen Baum geklettert, um besseren Überblick zu haben. Aber bei Neumond und so schlechten Sichtverhältnissen ging doch niemand auf die Jagd. Nur Räuber und Wegelagerer machten sich die Finsternis zunutze. Mit einem Mal ahnte Christman, was der Mann vorhatte, und das Herz schlug ihm bis zum Hals. Der betrunkene Pferdehändler, der sich vorhin in der Schenke damit gebrüstet hatte, was er heute für ein gutes Geschäft gemacht habe und der überdies noch lautstark verkündet hatte, dass er nach Blatzheim müsse …! Warum war er nicht gleich darauf gekommen? Der Mann mit dem Narbengesicht musste ein Räuber sein, der seine Opfer in Schenken ausspähte, um ihnen dann im Schutz der Dunkelheit aufzulauern und sie auszurauben.
Christman hatte Mühe, seinen hektischen Atem im Zaum zu halten. Um ihn herrschte absolute Stille, von dem Mann war nichts mehr zu hören. Lediglich der durchdringende Schrei eines Käuzchens hallte von Zeit zu Zeit durch die Nacht, und Christman erschauerte, was nicht alleine an der nasskalten Witterung lag. Nach und nach legte sich jedoch seine Aufregung, er verschmolz mit seiner Umgebung, verlor jegliches Zeitgefühl und gab sich ganz seinen Gedanken hin. Im Nachhinein war ihm, als habe ihn ein ungeheurer Sog erfasst und hierherverschlagen, so stark und mächtig, dass er ihm überallhin gefolgt wäre – und hätte er ihn direkt in die Hölle geführt.
Lautes Pferdegetrappel riss Christman aus seiner Versenkung. Er hätte nicht sagen können, wie viel Zeit inzwischen vergangen war. Der Reiter mit der Fackel in der Hand galoppierte unaufhaltsam auf ihn zu. Als er an ihm vorbeipreschte, gewahrte er das feiste Gesicht des Pferdehändlers, und beim Gedanken, was diesem gleich widerfahren würde, empfand er eine gewisse Häme. Da hörte er auch schon ein Knacken der Äste, dem ein dumpfer Aufprall folgte, und einen lauten, verzweifelten Schrei. Dann trat Stille ein. Christman reckte den Oberkörper und sah den korpulenten Pferdehändler rücklings auf dem Boden liegen. Im Licht der Fackel, die dem Reiter beim Sturz entglitten war, gewahrte er seine weit klaffende Kehle, aus der wie aus einem rot sprudelnden Quell in einer pulsierenden Fontäne das Blut strömte. Der Geruch des Blutes war so intensiv, dass ihn Christman selbst in seinem Versteck noch wahrnahm. Der Mann im Soldatenrock stand über sein Opfer gebeugt und hielt den blutigen Dolch in der Linken. Er murmelte etwas, das Christman nicht verstehen konnte. Es klang bösartig. Christman war vom Anblick des Todes und dem Blutgeruch derart erregt, dass sich ihm ein kehliges Stöhnen entrang. Blitzartig drehte sich der Mörder um und stürzte auch schon mit gezücktem Messer auf Christman zu. Dieser fiel vor ihm auf die Knie und reckte beschwörend die Arme hoch.
»Bitte, Meister, lasst Gnade walten!«, flehte er unterwürfig. »Ich bin Euer ergebener Diener und Bewunderer! Auch ich habe einen Pakt mit dem Satan geschlossen …!« Mit bebenden Händen riss er sein Wams auf, entblößte seine unbehaarte Brust und wies auf den eintätowierten schwarzen Federkiel auf der linken Seite. »Ich bin Euch gefolgt, weil ich Euch angehören möchte! Bitte nehmt mich als Euren Schüler auf!«
Der Fremde verzog den Mund zu einem höhnischen Grinsen. In seinen Raubtieraugen flackerte ungezügelte Mordlust.
»Der Teufel ist mein Mitkonsort, einen anderen brauch ich nicht!«, knurrte er und hielt Christman das Messer an die Kehle. »Außerdem, was sollte ich dir denn schon beibringen, du Grünschnabel? Das Töten ist das Einzige, auf das ich mich verstehe!«
»Und genau das möchte ich von Euch lernen!«, bat Christman stammelnd, und obgleich ihm vor Furcht die Glieder schlotterten, blickte er den Mann mit den blutverschmierten Händen offen an.
»Schneid hast du ja schon, dass du mir mit so einem Ansinnen kommst und dir nicht vor Angst in die Hose scheißt«, spie ihm der Mörder ins Gesicht, wobei er den Druck der Dolchspitze verstärkte. Christman spürte einen stechenden Schmerz und nahm wahr, dass ihm das Blut den Hals herunterlief. Der Fremde grinste ihn tückisch an.
»Dann tötet mich doch, das ist mir einerlei!«, schrie Christman außer sich. »Ich fürchte weder Tod noch Teufel und bin von der gleichen Art wie Ihr!«
Der Mann spuckte verächtlich auf den Boden. »Was weißt du denn schon von meiner Art, du Rotzlöffel! Aber einen wie dich zu töten macht fürwahr keinen Spaß. Du winselst ja noch nicht mal um dein Leben.« Der Mann im Soldatenrock richtete zwar noch weiterhin das Messer auf Christmans Hals, die wilde Grausamkeit in seinem Blick war jedoch einer gewissen Ernüchterung gewichen. Er schien zu überlegen.
»Und was zahlst du mir, wenn ich dich zum Gesellen nehme?«, fragte er nach einer Weile und musterte Christman lauernd.
»Ich kann Euch kein Lehrgeld zahlen, wenn Ihr das meint«, erwiderte der Junge. »Aber ich kann Euch etwas beibringen, das ohnegleichen ist!«
»Was kann denn das schon sein?«, blaffte der Mörder abfällig.
»Ich kann Euch lehren, wie man sich unsichtbar macht!«
Der Mann im Soldatenrock zuckte unmerklich zusammen. Für einen flüchtigen Moment spiegelte sich in seinem Blick ein Anflug von Interesse.
»Deine Kunst sehe ich, du Wurm!«, versuchte er seine Neugier mit grobem Spott zu kaschieren. »Du kriechst vor mir im Dreck und stiehlst mir nur meine Zeit!«
»Ihr seht mich, weil der Satan es so gefügt hat. Er wollte, dass wir uns begegnen!«, trumpfte der Förstersohn auf. »Ich bin Euch von der Schenke gefolgt und habe Euch die ganze Zeit beobachtet, und Ihr habt mich nicht bemerkt, obwohl ich nur einen Steinwurf von Euch entfernt war!«
Der Mörder verzog ärgerlich das Gesicht. »Das ist der Dunkelheit geschuldet«, schnappte er.
»Nicht alleine!«, widersprach Christman unbeirrt. »Schon als Knabe habe ich mich darin geübt, und durch die Jagd und die Schwarze Kunst habe ich meine Fähigkeit noch beträchtlich verfeinert …«
»Dass du einen grünen Jägerrock trägst, das sehe ich«, bemerkte der Mörder. »Aber kannst du auch schießen?«
Über Christmans unscheinbare Züge glitt ein stolzes Lächeln. »Obwohl ich erst sechzehn bin, gelte ich als der beste Armbrustschütze weit und breit. Das kann ich Euch bei Gelegenheit gerne unter Beweis stellen. Meinen ersten Rehbock habe ich schon mit zehn Jahren erlegt.«
»Dann verstehst du dich ja schon aufs Töten«, sagte der Mann mit dem Narbengesicht. »Was soll ich dir denn dann noch beibringen?«
Christman schüttelte entschieden den Kopf. »Ich weiß, wie man Tiere tötet, aber im Töten von Menschen fehlt mir jegliche Erfahrung.«
»Da ist kein großer Unterschied«, erwiderte der Mörder trocken, »lass dir das von einem alten Kriegsmann gesagt sein.«
»Aber das Töten von Tieren reicht mir nicht mehr!«, brach es mit jäher Heftigkeit aus Christman heraus. »Ich sehne mich unsagbar danach, Menschen zu töten! Schon seit Jahren beherrscht mich dieser Gedanke, und ich bin wie besessen davon!« In die Augen des jungen Mannes war ein kalter Glanz getreten.
Mit einem rauen Auflachen ließ der Mörder langsam das Messer sinken. »Mir scheint, wir haben doch etwas gemeinsam, Grünschnabel«, knurrte er und tätschelte derb Christmans Wange. »Dann lass uns unseren Pakt mit Blut besiegeln!«, schlug er vor und wischte den blutigen Dolch sorgsam am nassen Gras ab. Ehe Christman sichs versah, packte er ihn am Handgelenk und ritzte ihm die Haut über den Pulsadern auf. Dann fügte er sich an der gleichen Stelle einen Schnitt zu und presste ihrer beider Handgelenke zusammen.
»Schwör mir beim Fürsten der Finsternis absoluten Gehorsam und dass du mich niemals verraten wirst!«, stieß er zwischen den Zähnen hervor.
»Das schwöre ich bei Satan!«, erwiderte Christman feierlich und hob die Hand zum Schwur.
»Dann werde ich aus dir einen Menschenjäger machen und dich das böse Handwerk lehren!«, raunte der Mörder Christman zu, drückte ihn an sich und gab ihm den Bruderkuss.
2
Frankfurt am Main, 29. April 1581
Sibylle Molitor saß am offenen Fenster ihres Zimmers und blickte nachdenklich auf die verliebten Paare und ausgelassenen jungen Leute, die frohgemut scherzend durch die Braubachgasse zogen. Nach den Schrecken der Pest, die erst wenige Jahre zurücklag und Tausende von Menschen das Leben gekostet hatte, genossen sie den Frühling in vollen Zügen – die »sterbenden Läufe« mit ihrem unsäglichen Leid würden noch früh genug zurückkehren. Wie recht sie haben, dachte die Patriziertochter versonnen und mühte sich, gleichermaßen guten Mutes zu sein und nicht länger ihren trübsinnigen Gedanken nachzuhängen. Entschlossen klappte sie das Buch auf, das in ihrem Schoß lag, um sich ihrem größten Vergnügen zu widmen: eine gelehrte Abhandlung ihres Bruders zu lesen – an der sie, wie immer, nicht ganz unbeteiligt gewesen war. Während Sibylle zärtlich über die aufgeschlagene Buchseite strich, glitt ein stolzes Lächeln über ihr feingeschnittenes Gesicht mit der hohen, vergeistigten Stirn. Mein schlaues Schwesterlein, pflegte Martin zu sagen, wenn sie ihn nach stundenlangem Debattieren schließlich doch davon überzeugt hatte, in einem bestimmten Kapitel Änderungen vorzunehmen oder Begriffe noch genauer zu erläutern. Denn seit ihrer frühen Jugend war Sibylle ihrem älteren Bruder Martin, der bereits mit zweiundzwanzig Jahren einen Doktorhut in Philosophie erworben hatte, beim Verfassen seiner Schriften behilflich. Inzwischen war sie zu seiner rechten Hand geworden, und es erfüllte sie mit Stolz und Freude, den geliebten Bruder bei seiner Arbeit zu unterstützen. Auch wenn sie deswegen in den Frankfurter Patrizierkreisen längst ihren Ruf als Blaustrumpf hatte – obschon ihr ansprechendes Äußeres diesem Klischee keineswegs entsprach. Böse Zungen behaupteten gar, sie sei auf dem besten Wege, eine alte Jungfer zu werden, und die zahlreichen Aspiranten, denen sie ungerührt die kalte Schulter zeigte, munkelten hinter vorgehaltener Hand sogar Schlimmeres. Von sonderbarer Geschwisterliebe war die Rede, und dass es schwere Sünde sei, wenn Bruder und Schwester sich so nahestünden. Zumal auch Martin das heiratsfähige Alter längst überschritten hatte, was indessen, im Gegensatz zu Sibylle, mit einer gewissen Nachsicht betrachtet wurde.
»Er ist halt mit der Wissenschaft verheiratet!«, pflegte ihr Vater achselzuckend zu erwidern, wenn er von Geschäftskollegen und Vätern heiratsfähiger Töchter wieder einmal darauf angesprochen wurde. Wenngleich er es mit gutartigem Spott kaschierte und Martin deswegen nie einen offenen Vorwurf machte, so wusste Sibylle doch nur zu gut, wie sehr es den Patriarchen eines alten Handelsgeschlechtes schmerzte, dass sein einziger Sohn es vorzog, sich in den schönen Künsten zu verlustieren, anstatt als rechtschaffener Kaufmann das Familienvermögen zu mehren.
Als Sibylle feststellen musste, dass sie den Satz über die Seele bei Platon nun schon zum dritten Mal gelesen hatte, ohne ihn wirklich zu erfassen, weil sie mit ihren Gedanken ganz woanders war, klappte sie verdrossen das Buch zu und trat ans Fenster, um angespannt über die Gasse zu spähen. Es wollte ihr einfach nicht mehr gelingen sich abzulenken. Sie war ganz krank vor Sorge um Martin, der vor vierzehn Tagen nach Trier aufgebrochen war, um an der Philosophischen Fakultät einen Vortrag zu halten. Inzwischen war er bereits vier Tage überfällig, und es fehlte noch immer jede Nachricht von ihm. Eigentlich hatte sie ihn ja begleiten wollen, aber sie mochte den Vater nicht alleine lassen, der über den Tod der Mutter und der beiden älteren Töchter, die vor zwei Jahren an der Pest gestorben waren, nicht hinwegkam. Hatte er es anfangs noch damit abgetan, dass Martin in Trier womöglich der Frau seines Lebens begegnet sei – auch wenn das an einem Jesuitenkolleg eher unwahrscheinlich war –, so war der bejahrte Kaufmann mittlerweile doch gleichfalls höchst besorgt. Vor drei Tagen hatte er einen reitenden Boten nach Trier entsandt, dessen Rückkehr sehnlichst erwartet wurde.
Es fing schon an zu dämmern, woraufhin Sibylle das Fenster schloss und ihr Zimmer verließ, um dem Vater unten in der Wohnstube ein wenig Gesellschaft zu leisten. Sie war auf der Treppe, als die lauten Schläge des Türklopfers sie vor Schreck zusammenfahren ließen. Hals über Kopf stürmte sie die Treppe hinunter und wäre in der Halle fast mit der Hausmagd zusammengeprallt, die herbeigeeilt war, um die Tür zu öffnen. Doch die Tochter des Hauses kam ihr zuvor und riss mit bebenden Händen den Türflügel auf. Draußen stand der Bote und neigte höflich den Kopf vor der Patriziertochter. Auf seiner Stirn glitzerten Schweißperlen, und er war von dem schnellen Ritt noch ganz außer Atem.
»Kommt doch herein und setzt Euch erst mal hin«, hörte Sibylle die Stimme ihres Vaters aus dem Hintergrund. Der junge Mann nahm das Angebot dankbar an und trat in die Halle, wo der Hausherr ihm einen Stuhl anbot und die Magd hieß, dem Mann einen Becher Wasser und eine kleine Stärkung zu bringen. Während sich die Dienerin entfernte, standen Sibylle und ihr Vater beklommen im Eingangsbereich und warteten darauf, dass sich die Atemzüge des Boten ein wenig beruhigten. Sibylle trat von einem Bein aufs andere und platzte schier vor Anspannung. Die ernste Miene des Reiters verhieß jedoch nichts Gutes – was sich gleich darauf bestätigte.
»Ich … ich muss Euch leider mitteilen«, stieß der Bote atemlos hervor, »dass Euer Sohn in der Philosophischen Fakultät in Trier gar nicht eingetroffen ist! Die Jesuiten waren darüber ziemlich befremdet und ließen mich wissen, dass sie den Vortrag des jungen Herrn Doktor kurzfristig absagen mussten. Sie bedauerten das sehr, und ich soll Euch von Ihnen bestellen, sie würden den jungen Herrn Doktor in ihre Gebete einschließen und ließen Euch bitten, ihnen doch Bescheid zu geben, wenn sich … die Angelegenheit aufgeklärt hat …«
Sibylle war kreidebleich geworden und stöhnte entsetzt auf.
»Ach Gott, ach Gott, hoffentlich ist dem Jungen nichts passiert!«, rief der alte Herr und geriet leicht ins Wanken. Obgleich Sibylle von der Hiobsbotschaft selber so erschüttert war, dass der Boden unter ihren Füßen nachzugeben schien, stützte sie den Vater fürsorglich und führte ihn zu einem Stuhl.
»Wir wollen doch nicht gleich das Schlimmste annehmen«, suchte sie ihn zu beruhigen, während sie ihm mit zittrigen Fingern einen Becher Wasser einschenkte. Sie spürte selbst einen Kloß im Hals, und bange Ahnungen spukten ihr wie entfesselte Dämonen im Kopf herum.
»Oh Gott, lass es bitte nicht wahr sein!«, murmelte sie mit brüchiger Stimme und konnte mit einem Mal ihre Tränen nicht länger zurückhalten. Nun war es der Vater, der sie tröstete.
»Das wird sich bestimmt bald alles aufklären«, krächzte er kurzatmig und wischte sich den Schweiß von der Stirn. »Vielleicht ist er unterwegs krank geworden oder hat sich sonst irgendetwas getan, das kann auf einer Reise immer mal vorkommen. Kuriert sich wahrscheinlich irgendwo aus und wenn es ihm bessergeht, wird er schon zurückkommen.«
Sibylle schüttelte energisch den Kopf. »Niemals!«, erwiderte sie nachdrücklich. »So gewissenhaft und zuverlässig, wie Martin ist, hätte er doch in einem solchen Fall sofort die Fakultät benachrichtigt und auch uns eine Nachricht zukommen lassen, damit wir Bescheid wissen und uns keine Sorgen machen.« Sie musterte den Boten nachdenklich. »Ist er denn sonst vielleicht irgendwo gesehen worden? In einer Fremdenherberge oder einem Gasthaus, das auf der Strecke lag …?«
»Ich hatte keine Gelegenheit, mich eingehender nach seinem Verbleib zu erkundigen«, erklärte der Bote bedauernd. »Ich bin die ganzen Tage in scharfem Galopp durchgeritten, um Euch so schnell wie möglich zu unterrichten. Anders kann man auch eine solche Strecke nicht in drei Tagen bewältigen«, fügte er mit leichtem Vorwurf hinzu.
»Das ist wohl wahr«, entgegnete die Patriziertochter verständnisvoll und bedankte sich bei dem Herold für die rasche Übermittlung.
Auch der Vater dankte dem jungen Mann, der sich inzwischen etwas erholt hatte, und entlohnte ihn großzügig. Nachdem der Bote gegangen war, erhob sich der alte Herr ächzend aus seinem Stuhl.
»Auf den Schrecken brauch ich jetzt einen Schnaps, und dann überlegen wir weiter, was wir tun können«, sagte er.
Bedrückt folgte Sibylle ihrem Vater in die weitläufige, behaglich eingerichtete Wohnstube und ließ sich von ihm auch einen Schluck Branntwein einschenken. Sie hatte zwar Martins wegen schon seit Tagen ein ungutes Gefühl gehabt, aber die verhängnisvollen Neuigkeiten verstörten sie zutiefst. Die schreckliche Ungewissheit, was ihm unterwegs zugestoßen sein mochte, raubte ihr fast den Verstand. Sie leerte den Branntweinbecher mit einem Zug und lief unruhig im Zimmer umher wie ein Raubtier im Käfig.
»Jetzt setz dich gefälligst hin, du machst einen ja ganz verrückt!«, fuhr Karl Molitor seine Tochter an. Die Adern an seinen Schläfen waren angeschwollen, und das faltige Gesicht war aschfahl geworden. Er sah alt und hinfällig aus. Wenn dem Martin was passiert ist … das verkraftet er nicht, dachte Sibylle bestürzt. Und ich auch nicht! Sie presste sich die Hand vor den Mund, um nicht laut aufzuschreien, und es kostete sie unglaubliche Kraft, nicht in haltloses Weinen auszubrechen. Das würde den Vater nur noch mehr aufregen, zudem galt es, einen kühlen Kopf zu bewahren, um planvoll und bedacht vorzugehen – auch wenn ihr das in ihrer jetzigen Verfassung äußerst schwerfiel. Sibylle holte tief Luft, ließ sich folgsam auf einem Stuhl nieder und lächelte den Vater tapfer an.
»Das wird sich bestimmt bald alles aufklären, Vater«, sagte sie und tätschelte aufmunternd seine Schulter. Der alte Herr ergriff ihre Hand und drückte sie bekümmert. Ihm war deutlich anzumerken, was er dachte, auch wenn er sich hütete es auszusprechen. Als Kaufmann war er oft genug unterwegs gewesen, um zu wissen, wie gefährlich das Reisen war. Räuber und Wegelagerer warteten nur darauf, einen unbedarften Reisenden zu überfallen und auszurauben. Daher war er auf seinen ausgedehnten Handelsreisen stets im Verband mit anderen Kaufleuten geritten, der überdies von einer bewaffneten Eskorte begleitet wurde. Er hatte auch seinem Sohn immer geraten, nicht ohne Begleitschutz zu reisen. Doch Martin hatte seine Ermahnungen damit abgetan, dass es bei ihm doch nichts zu holen gebe außer Schriftstücken und Büchern. Der eigenwillige Freigeist hatte alle Warnungen in den Wind geschlagen – und jetzt haben wir das Malheur, grübelte der Familienvorstand erbittert.
»Ich werde gleich morgen einen Suchtrupp nach ihm ausschicken«, erklärte er bestimmt. »Der alte Gottfried mag mit ihnen reiten, damit sie ihre Arbeit auch ordentlich machen.«
Noch während er sprach, war Sibylle eine Idee gekommen, und ihre grauen Augen leuchteten auf. »Da habe ich einen besseren Vorschlag!«, brach es aus ihr heraus, und sie blickte den Vater eindringlich an. Karl Molitor, der wusste, wie kapriziös seine jüngste Tochter sein konnte, runzelte in banger Erwartung die Stirn.
»Ich werde mitkommen!«, verkündete Sibylle mit wilder Entschlossenheit. »Dann kannst du dir auch sicher sein, dass gründlich nach Martin gesucht wird. Jeden Grashalm werde ich umdrehen, bis ich ihn gefunden habe!«
In Sibylles Worten lagen eine solche Inbrunst und Leidenschaft, dass dem alten Herrn unwillkürlich die Tränen in die Augen stiegen.
»Das kommt ja überhaupt nicht in Frage!«, rief er empört und wischte sich mit zittriger Hand über die Augenwinkel. »Soll ich das einzige Kind, das mir geblieben ist, auch noch verlieren?«, brachte er heraus, ehe ihm die Stimme versagte und er schluchzend sein Gesicht in den Händen barg.
Sibylle blinzelte bewegt und legte tröstend die Arme um ihn. »Du musst dir um mich keine Sorgen machen, Vater«, raunte sie beschwörend. »Ich nehme mir eine bewaffnete Garde mit, dann wird mir schon nichts passieren. Bitte, erlaube es mir! Du willst doch auch wissen, was mit Martin passiert ist …«
Der bejahrte Patrizier entwand sich brüsk ihrer Umarmung. Er wollte sich auf keinen Fall von Sibylle um den Finger wickeln lassen, wie so oft. Seinem Nesthäkchen konnte er nur schwer etwas versagen.
»Natürlich will ich das!«, erwiderte er barsch. »Deswegen schicke ich ja auch morgen früh den Suchtrupp los – und wir zwei bleiben hier und halten solange die Stellung.« Er streichelte Sibylle begütigend über die Wange. Als er die Enttäuschung in ihrem Gesicht gewahrte, murmelte er versöhnlich: »Du kannst doch einen alten Zausel wie mich nicht alleine lassen, dann habe ich ja überhaupt niemanden mehr!«
Sibylle stieß vernehmlich die Luft aus. Bei dem Gedanken daran blutete ihr das Herz. Was ganz im Sinne ihres Vaters war, denn der gewiefte alte Kaufmann wusste sehr wohl, dass er seiner widerspenstigen Tochter den Wind aus den Segeln nehmen konnte, indem er ihr ein schlechtes Gewissen machte. Doch so schnell mochte Sibylle nicht klein beigeben.
»Ach Papa, ich bin doch nicht lange weg! Höchstens ein bis zwei Wochen. Und dann komme ich wieder zurück und habe Martin im Schlepptau! Die kurze Zeit kannst du doch mal alleine bleiben. Du gehst tagsüber in dein Kontor, und abends lässt du dich von Traudel versorgen oder triffst dich mit der Kaufmannsgilde in eurer Trinkstube im Hause Limpurg …«, sprudelte es aus ihr heraus.
»Du brauchst gar nicht weiter zu versuchen, mich zu überreden!«, schnitt ihr der Vater das Wort ab. »Du bleibst zu Hause, und damit Schluss!«, erklärte er nachdrücklich und schlug vor, noch einen Schlummertrunk zu sich zu nehmen und dann ins Bett zu gehen.
Die junge Frau war schon drauf und dran, auf den Schlummertrunk zu verzichten und sich grollend auf ihr Zimmer zurückzuziehen, doch sie besann sich schließlich eines Besseren.
»Ist recht, Vater«, seufzte sie ergeben.
Während der alte Herr die Dienerin beauftragte, ihnen eine heiße Schokolade zu bereiten, umspielte ein listiges Lächeln Sibylles Lippen. Sie war entschlossener denn je, die Reise anzutreten, und musste den alten Starrkopf unbedingt davon überzeugen, dass er sie ziehen ließ. Die Vorstellung, untätig zu Hause zu sitzen, während Martin vielleicht irgendwo in arge Bedrängnis geraten war, trieb sie schon jetzt an den Rand des Wahnsinns. Einzig indem sie nach ihm suchte, konnte sie etwas für ihn tun, und das mochte sie keinem anderen überlassen. Niemand kannte die Schrullen und Gewohnheiten ihres Bruders besser als sie, nur sie konnte sich ganz in ihn hineinversetzen. Sie würde ihn finden, und wenn er im entlegensten Winkel der Welt war. Genau das musste sie ihrem Vater verständlich machen – was gewiss kein leichtes Unterfangen werden würde. Es bedurfte einer Engelsgeduld, gepaart mit erheblichem Fingerspitzengefühl, die beide nicht gerade zu ihren Stärken zählten.
3
In der Umgebung von Kerpen, 29. 10. 1566
»Genug geschwallt, jetzt wird gearbeitet!«, raunzte der Mann mit dem Narbengesicht herrisch und wies mit der Hand, in der er noch immer den Dolch hielt, auf den toten Pferdehändler, der ein Stück weit entfernt auf dem Trampelpfad lag. »Filz den Dreckskerl nach allem, was irgendwie von Wert ist. Ich setz mich solange hier hin und guck zu, ob du das auch richtig machst!«
Der Raubmörder ließ sich unweit des Toten auf einem Baumstumpf nieder und verschränkte die Arme.
Christman beugte sich über den Pferdehändler, hob das Wams an und schnitt mit der scharfen Klinge seines Jagdmessers die prall gefüllte lederne Geldkatze ab, die um den dicken Leib geschnallt war. Dann durchsuchte er die Manteltaschen, in denen sich eine Handvoll Kupfermünzen befand, fuhr in die obere Innentasche und zog eine versilberte Taschenflasche hervor, die er schüttelte und neben die Geldkatze auf den Boden legte.
»Da ist sogar noch was drin«, bemerkte er und setzte seine Suche fort. Doch außer den Seitentaschen des wollenen Wamses, die mit Hafer- und Getreidekörnern gefüllt waren, fanden sich keine weiteren Behältnisse. Christman hielt kurz inne, dann öffnete er die Gürtelschnalle aus Messing und zog dem Pferdehändler den Ledergürtel ab, an dem ein Schlüsselbund und ein kleiner Lederbeutel befestigt waren. Er schnürte den Beutel auf und blickte hinein.
»Da ist ein Rosenkranz drin«, rief er seinem Lehrmeister über die Schulter zu.
»Und – taugt er was?«, fragte der Mann im Soldatenrock.
»Billiger Tand, die Perlen und das Kreuz sind nur aus Holz«, erwiderte Christman abfällig.
»Dann wirf ihn ins Gebüsch«, befahl ihm der Raubmörder.
Der Förstersohn schleuderte den Rosenkranz in hohem Bogen ins Unterholz. Dann packte er sein Messer und trennte die drei silbernen Knöpfe vom Wams des Toten ab.
»Die Mantelknöpfe sind aus Hirschhorn, wollt Ihr sie haben?«, fragte er seinen Lehrmeister.
»Immer her damit!«, krähte dieser.
»Das war’s auch schon. Was ist mit der Kleidung und den Schuhen? Soll ich sie ihm ausziehen?«
»Sehe ich vielleicht aus wie ein Lumpenkrämer?«, knurrte der Mann im Soldatenrock grimmig. »Ich hab nur Verwendung für Pelze und teures Tuch. Auf die verschwitzten Klamotten von dem Fettwanst kann ich verzichten, und auf dem seine Stinkstiefel erst recht! Die kannst du dir nehmen, wenn du willst …« Er gab ein höhnisches Wiehern von sich.
Christman ging darauf mit keiner Silbe ein. »Was soll ich damit machen?«, fragte er sachlich und wies auf das Diebesgut.
»Pack die Sore in meine Satteltaschen, und dann werfen wir den Kerl ins Gebüsch«, befahl ihm sein Lehrmeister.
»Sore – das hört sich irgendwie fremdländisch an. Ist das ein Wort aus Eurer Sprache?«, erkundigte sich der Förstersohn interessiert.
Der Mörder lachte kehlig. »Da sieht man mal wieder, was du für ein Grünschnabel bist!«, prustete er verächtlich. »Aber was kann man von einer Grünratt schon anderes erwarten! Dass so einer die Gaunersprache nicht kennt, braucht einen nicht zu wundern«, murmelte er kopfschüttelnd. »›Sore‹ heißt nichts anderes als Diebesgut, und einen wie dich nennt man unter Fahrenden und Gaunern halt ›Grünratt‹, das sind die Waldaufseher und Förster, die unsereinem das Leben schwermachen. So, und jetzt mach hin, damit wir endlich von hier fortkommen!«
Christman nahm den rauen Tonfall seines Lehrmeisters widerspruchslos hin. Ihm war klar, dass er von dem wilden, grausamen Gesellen keine Flötentöne zu erwarten hatte – und im Grunde genommen mochte er seine schroffe, zynische Art sogar. Gehorsam packte er die Sachen zusammen. Als sie wenig später die Leiche des Pferdehändlers an Armen und Beinen griffen und ins Gebüsch warfen, gerieten sie gehörig ins Schwitzen.
»Ganz schön schwer, der Fettsack!«, fluchte der Mann mit dem Narbengesicht zwischen den Zähnen und wischte sich den Schweiß von der Stirn. »Wo hast du den Schnaps hin?«, fragte er atemlos.
»In Eure Satteltaschen getan, wie Ihr es befohlen habt«, antwortete Christman und eilte zum Pferd seines Lehrmeisters. Kurz darauf hielt er dem Mann die Taschenflasche hin, der sie ihm grob aus der Hand riss und gierig daraus trank. Dann reichte er die Flasche seinem Gehilfen, der gleichfalls einen tiefen Zug nahm.
»Wie ist dein Name, Grünschnabel, damit ich weiß, wie ich dich in Zukunft ansprechen kann?«, fragte ihn der Mann mit dem Narbengesicht nun etwas umgänglicher.
»Ich heiße Christman Gniperdoliga«, erwiderte der junge Mann und neigte höflich den Kopf.
»Was ist denn das für ein Name!«, mokierte sich sein Lehrmeister. »Dein Vorname gefällt mir nicht, und dein Nachname ist der reinste Zungenbrecher! Ich werde dir einen neuen Namen geben, der besser zu dir passt.«
Der Mann im Soldatenrock musterte seinen Gehilfen nachdenklich. »Du hast kalte Fischaugen, Jüngelchen, und wenn man dich rau anpackt, zuckst du nicht mal mit der Wimper. Du lässt dich nicht so leicht aus der Reserve locken, und dein Mienenspiel verrät nicht, was du gerade denkst. Du bist ein eiskalter Hund, das imponiert mir und ist in unserem Gewerbe von Vorteil.« Sein schmallippiger Mund verzog sich zu einem breiten Grinsen. »Aber als du dir vorhin den Toten betrachtet und seine blutige, durchgeschnittene Kehle gesehen hast, konntest du den Blick kaum abwenden von seinem Blut, so trunken und betört warst du. Du hast Freude am Töten, und in deinem Innern schlummert eine Bestie, an der nichts Menschliches ist.« Er tätschelte Christmans Schulter. »Ich werde sie zum Leben erwecken, so wahr ich Peter Nirsch heiße! Mir fällt nur kein passender Name für dich ein. Du hast keine auffälligen Merkmale, und deine Visage ist so nichtssagend …« Der Mann mit dem Narbengesicht nahm noch einen Schluck aus der Flasche und musterte Christman unwillig.
Der junge Mann lächelte. Ihm schmeichelte die Bemerkung seines Lehrmeisters. »Genau das ist vielleicht mein Merkmal – dass ich so unauffällig und nichtssagend bin. Ich bin wie eine Groppe, die sich ihrer Umgebung so gut anpassen kann, dass sie unsichtbar wird. Auf steinigem Untergrund kann man sie kaum noch erkennen«, murmelte Christman versonnen.
»Nie gehört! Was soll das denn sein, eine Groppe?«, raunzte Peter Nirsch.
»Eine Groppe ist ein hiesiger Süßwasserfisch. In der Erft gibt es viele Groppen«, erklärte Christman und deutete in Richtung Fluss.
Der Mann mit dem Narbengesicht lachte auf. »Na, das passt ja, wo du so ein Fischblut bist!«, feixte er. »Meinethalben, dann nennen wir dich halt … Groperunge aus Kerpen!«
Der Förstersohn verbeugte sich ehrfürchtig. »Es wird mir eine Ehre sein, diesen Namen zu tragen, Meister!«
»Schluss mit dem ewigen ›Meister‹!«, fuhr ihn der Mann mit dem Narbengesicht an. »Du redest mich gefälligst mit Herr Kapitän an, wie sich das für den Burschen eines Hauptmanns geziemt.« Peter Nirsch strich stolz über seine speckige Uniformjacke. »Wie du siehst, bin ich ein alter Kriegsmann – und als Landsknecht habe ich das böse Handwerk von der Pike auf gelernt!«
Peter Nirsch verstaute die Flasche in seiner Rocktasche, ergriff die Fackel, die im Boden steckte, und stieg auf sein Pferd. »Wir reiten jetzt zu meinem Unterschlupf«, ließ er seinen Gehilfen wissen und wartete, bis Groperunge ebenfalls im Sattel saß und zu ihm aufgeschlossen hatte.
»Wo befindet sich denn Euer Unterschlupf?«, fragte der Förstersohn neugierig.
»Stell nicht so viele Fragen«, knurrte Peter Nirsch, gab seinem Pferd die Sporen und schlug den Weg in Richtung Kerpen ein. Groperunge hielt sich dicht hinter ihm. Es war schon weit nach Mitternacht und stockfinster. Sie ritten an der »Mühlenschenke« vorbei, die längst geschlossen hatte. Die Fenster waren alle dunkel und die Wirtsleute zu Bett gegangen. Groperunge blickte kurz zum Waldrand mit seinen dunklen Tannenwipfeln, von wo er in den Abendstunden gekommen war. Beim Gedanken an sein Elternhaus empfand er keinerlei Wehmut, im Gegenteil, ihn überkam ein mächtiges Hochgefühl, dass er endlich seinem Meister begegnet war. Ich danke dir, Satan, dass du mein Flehen erhört hast, dachte er mit Inbrunst, und wie schon so oft in dieser wundersamen Nacht fühlte er eine tiefe Verbundenheit mit seinem Lehrmeister – wie er sie noch nie zuvor für einen Menschen empfunden hatte.
»Ich danke Euch, Herr Kapitän, dass Ihr mich aufgenommen habt!«, brach es auf einmal, ganz entgegen seiner verschlossenen Art, aus ihm heraus.
Peter Nirsch wandte sich ruckartig zu ihm um und bleckte höhnisch die Zähne. »Freu dich nicht zu früh, Bürschchen, ich werde dich nämlich ordentlich striezen, darauf kannst du einen lassen!«
Nachdem sie das schlafende Kerpen in weitem Bogen umritten hatten und ihnen in den Flussauen keine Menschenseele begegnet war, schlug Peter Nirsch plötzlich den Weg zur Erft ein. Als sie sich dem Flussufer näherten, gewahrte Groperunge im Fackelschein die Umrisse einer Hütte, die von dichtem Weidengeflecht umrankt war. Peter Nirsch stieg vom Sattel, führte sein Pferd unter das Weidendach, wo er es anband, und bedeutete seinem Gehilfen, es ihm gleichzutun. Als sie wenig später in die windschiefe Hütte traten, fiel Groperunge auf, dass sie sauber gefegt und aufgeräumt war. Ein paar alte Fischernetze, die auf den groben Holzdielen ordentlich übereinandergelegt waren, dienten offensichtlich als Schlafplatz. Neben einer kleinen Feuerstelle mit Rauchfang waren zerkleinerte Äste und Zweige gestapelt. Nachdem Nirsch noch einige Talgkerzen entzündet hatte, wirkte der bescheidene Raum fast heimelig.
Der Kapitän zog seinen regennassen Uniformrock aus, legte sich eine Wolldecke um die Schultern und befahl seinem Gehilfen, ein Feuer zu entfachen. Ohne Murren machte sich Groperunge ans Werk, bald knisterten die Flammen und verbreiteten eine behagliche Wärme. Erst jetzt streifte der hagere junge Mann seinen klammen Umhang ab und ließ sich zögerlich neben der Feuerstelle nieder. Sein Lehrmeister war damit beschäftigt, die Münzen aus der Geldkatze des Pferdehändlers zu zählen. Groperunge beobachtete ihn verstohlen. Er sah, wie Peter Nirsch beim Zählen die Lippen bewegte und seine Miene immer zufriedener wurde.
»Hat sich gelohnt, mit dem Fettsack – wusst ich’s doch!«, knarzte er launig und griff nach der Schnapspulle, die neben ihm auf dem Boden stand. Im Lichtschein fiel Groperunge auf, dass dem Mann mit dem Narbengesicht ein kleiner Lederbeutel aus dem Halsausschnitt seines Wamses gerutscht war. Als Peter Nirsch den Blick seines Gehilfen bemerkte, schob er ihn hastig wieder unters Wams.
»Glotz nicht so blöd!«, schnaubte er unwillig. »Das geht dich nichts an!«
Obgleich Groperunges Neugier nun erst richtig angestachelt war, sparte er sich jegliche Nachfragen.
»Eine schöne Unterkunft habt Ihr Euch ausgesucht, Herr Kapitän«, bemerkte er anerkennend. »Auf den ersten Blick sieht man die Hütte gar nicht, wegen dem dichten Weidengeflecht ringsherum.«
Peter Nirsch warf ihm einen durchdringenden Blick zu. »Da hab ich auch lange suchen müssen, bis ich diese Bruchbude hier gefunden habe. Das ist das Erste, was ich mach, wenn ich irgendwo ein Ding drehen will: mich nach einem geeigneten Unterschlupf umzuschauen. Denn wenn du keine gute Kawure hast, wo du dich verstecken kannst und in Sicherheit bist, dann lass lieber die Finger von der Sache. Merk dir das, Bürschchen, das ist in unserem Gewerbe von größter Wichtigkeit!« Sein vernarbtes Gesicht war unversehens ernst geworden. »Erst recht, wenn du ein einsamer Wolf bist wie ich, der sich nicht mit anderen Gaunern zusammentut. Denn unter denen, die sich mit krummen Touren durchschlagen – und da sind Mordbrenner und Halsabschneider darunter, die auch mal einen kaltmachen –, gibt es einen festen Zusammenhalt. Sie haben nicht nur ihre eigene Sprache, das Rotwelsch, sondern sie verständigen sich auch durch bestimmte Zeichen, die sie auf Gebetsstöcken, Wegweisern und Scheunen in der Umgebung von Ortschaften hinterlassen, damit ihre Kumpane wissen, wo sie eine gute Platte finden. Genau so warnen sie auch, wenn von irgendwoher Gefahr droht. Sei es vor bissigen Hunden, die ein bestimmtes Gehöft bewachen, oder vor besonders scharfen Dackeln und Grünratten – Dackel, so nennt man unter gemeinen Verbrechern die Polizisten, mein Jungchen!«, stieß er mit kehligem Lachen hervor, als er Groperunges fragenden Gesichtsausdruck gewahrte. »Nicht dass ich diese Mahnungen nicht zu schätzen wüsste«, fuhr er fort. »Keiner, der auf krummen Touren reist, kann sich erlauben, sie einfach in den Wind zu schießen, denn du kannst gar nicht vorsichtig genug sein, wenn du nicht am Galgen baumeln willst.« Er musterte seinen Gehilfen eindringlich. »Trau keiner Seele – das ist seit jeher meine Losung! Und ich wär nicht so lange im Geschäft, wenn ich damit nicht richtigliegen würde. Deswegen gibt es bei mir auch keine Kumpanei und Verbrüderung. Auch nicht mit anderen Mordbuben. Das ist der Grund, warum ich mir meine Platten selber suche und mich nicht auf die Empfehlungen anderer Gauner verlasse. Mir steht halt nicht der Sinn nach Gesellschaft. Das habe ich dir aber gleich gesagt.«
Peter Nirsch nahm noch einen Schluck aus der Pulle, ehe er sie unwillig an seinen Gehilfen weiterreichte. »Und jetzt hab ich dich am Hals. Du säufst mir meinen Schnaps weg, frisst mein Brot und willst alles von mir wissen.« Er seufzte resigniert.
Groperunge vermied es, von der Flasche zu trinken, und schob sie mit unterwürfiger Geste seinem Meister hin. Er wirkte bedrückt und traute sich kaum, etwas zu sagen.
»Ihr braucht nicht für mich zu sorgen, Herr Kapitän. Ich kann mir mein Brot selber verdienen«, stieß er schließlich hervor und senkte betreten den Blick. »Es soll nicht Euer Schaden sein, dass Ihr mich aufgenommen habt. Ich kann jagen und Fische fangen und Euch in all Eurem Tagwerk unterstützen. Sagt mir, was ich zu tun habe, und ich werde es machen. Ich habe Euch absoluten Gehorsam geschworen – und damit ist es mir auch sehr ernst …«
»Hör auf rumzuschwallen«, unterbrach ihn der Kapitän gereizt und musterte Groperunge tückisch. »Verrate mir lieber, wie ein Milchbart wie du, der keinen Schimmer von der rauen Wirklichkeit hat, zum Teufelsanbeter geworden ist?«, fragte er höhnisch. »Denn deine braven Förstereltern haben dir doch so was bestimmt nicht beigebracht.«
Möchten Sie gerne weiterlesen? Dann laden Sie jetzt das E-Book.