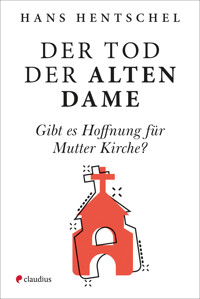
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Claudius
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Sprache: Deutsch
Die Kirche ist in die Jahre gekommen. Ob in der evangelischen oder in der katholischen Variante: Es steht nicht gut um sie. Manche halten sie für nicht mehr überlebensfähig. Hans Hentschel will das nicht einfach so hinnehmen und kontert mit Humor. Er beschreibt die Geschichte der alten Dame Kirche, schildert ihre Krankheit und liefert eine Diagnose. Es werden Behandlungsmöglichkeiten bedacht, Medikamente vorgeschlagen und eine Reha angedeutet. Ein ebenso spitzzüngiges wie liebenswertes Buch, das den Debatten mehr Leichtigkeit gibt und neben bittere Pillen immer auch die Ermutigung setzt.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 139
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
HANS HENTSCHEL
DER TOD DER ALTEN DAME
Gibt es Hoffnung für Mutter Kirche?
INHALT
Cover
Titel
Ein persönliches Vorwort
TEIL EINSWie geht’s denn? – Ach …
„Der Rost macht erst die Münze wert“
„Wahrhaftig, der Schrank hat keine Rückwand!“
„Niemand hört es gern, dass man ihn Greis nennt“
„Alte Kirchen haben trübe Augen“
„Wes Brot ich ess, des Lied ich sing“
Nostalgie ist eine charmante Lügnerin
„Hoppe, hoppe Reiter“
„Früher war mehr Lametta“
„Allen Leuten recht getan …“
„Außen hui und innen pfui“
„Gold und Silber lieb ich sehr“
TEIL ZWEIWo fehlt’s denn? – Lange Geschichte …
Kirche – was ist das?
Das Einmalvier der Kirche
Von der Glaubwürdigkeit und vom Glauben
Wer Ohren hat, der höre
Dabei sein … ist eben nicht alles
Hätten Sie’s gewusst? Die vier Säulen des Glaubens
„Wir“ gewinnt
In diesem Zeichen wirst du siegen
TEIL DREIGute Besserung! – Ich habe Hoffnung …
Die Wende vom Ende
Das Evangelium ist keine Einbahnstraße
Theotainment: Lass dich überraschen …
Ein Alphabet der Medikationen
Anmerkungen
Impressum
Ein persönliches Vorwort
Seit 44 Jahren lebe ich mit einer Geliebten neben meiner Ehefrau.
Diesen provokativen Satz könnte ich auch noch auf einen sehr viel längeren Zeitraum beziehen. Diese Geliebte teilt nämlich tatsächlich die wesentlichen Zeiten meines bewussten Lebens. Solange ich mich zurückerinnern kann, ist sie da. Sie ist im Grunde immer da gewesen.
Meine Eltern haben dafür Sorge getragen, dass die Liebe zu ihr gewachsen ist. Immer mehr Menschen kamen dazu, die mir zeigten, dass diese Liebe sich lohnt und dass ein Leben ohne diese Geliebte ärmer wäre.
Auch wenn ich mit meiner Frau zu zweit war, war die Geliebte dabei. Wir sprachen über sie, wir verteidigten sie gegen ihre Verächter, wir kritisierten sie, wo es uns nervte, wie sie sich danebenbenahm, und sie mischte in der Erziehung unserer Kinder kräftig mit.
Diese Geliebte ist … die Kirche.
Die Liebe meines Lebens gehört der Kirche. Sie ist die Geliebte, die an meinen Alltagen morgens schon am Frühstückstisch saß und abends den Schreibtisch mit mir teilte. Und sonntags war Besuchstag.
In den Armen der Kirche fühle ich mich bis heute geborgen und der Raum, den sie in meinem Leben einnimmt, ist riesengroß.
Wenn ich allerdings heute auf sie schaue, sehe ich eine alt gewordene Dame, der sich historische Irrtümer, moderne Quengeleien, universale Fehlleistungen aus Vergangenheit und Gegenwart und die schrecklichen Vorwürfe und Tatsachen der sexuellen Übergriffe ins Gesicht gegraben haben.
Der Ruf meiner Geliebten ist zweifelhaft geworden.
Das ist umso trauriger, als es ihr eigentlich immer um Glaubwürdigkeit gegangen ist. Um die Würde des christlichen Glaubens, für den sie einsteht und in ungezählten Dörfern und Städten einfach dasteht.
Wenn ich auf meine Geliebte sehe, Lebensbegleiterin durch gute und durch böse Tage, dann wird der Blick von einem durchdringenden Ton überlagert. Es ist das Tatütata des Rettungswagens, mit dem die Kirche nach traditionsgetragenen Jahrhunderten, nach Stein gewordenen Zeiten, nach selbstverständlichem Da- und Dabeisein in allen Menschentagen auf die Intensivstation des ‚Moderne-Welt-Hauses‘ gebracht wird, wo sich neben erschrockenen Funktionär*innen und umtriebigem Verwaltungspersonal auch manche Betroffene wie ich Sorgen um die Geliebte machen.
Da liegt die alt gewordene Dame und die einen geben sie auf, weil man auch einer Hundertjährigen keine neue Hüfte mehr einbaut oder ihr einen Herzschrittmacher einsetzt, andere halten in Treue ihre Hände, von denen sie sich lebenslang begleitet fühlten, und wieder andere – eine erschreckend größer werdende Zahl – wenden sich ab und lassen die alte Dame ohne weitere Anteilnahme sterben … wann, das weiß man nicht. Und wenden sich dem Leben zu.
Und während diese vielen frisch, fit, frei die Geräusche und Genüsse des Lebens mit allerlei anderen Geliebten teilen, werden auf der Intensivstation all die Register der lebenserhaltenden Instrumente gezogen.
Ob der Tod der alten Dame tatsächlich nah ist oder ob sie Auferstehung aus dem Bett der Intensivstation feiern kann, vermag ich nicht zu sagen.
Ich jedenfalls bin noch nicht bereit, die alte Dame, die Geliebte meines Lebens, aufzugeben.
Was im Folgenden erzählt wird, ist die Geschichte der alten Dame, die Schilderung ihrer Krankheit und einer Diagnose. Es werden Behandlungsmöglichkeiten bedacht, Medikamente vorgeschlagen und eine Reha angedeutet.
Der Tod der alten Dame soll nicht widerspruchslos und ohne den hoffnungsvoll geführten Kampf ums Überleben hingenommen werden.
Wie geht’s denn? – Ach …
„Der Rost macht erst die Münze wert“
Ehrlich – der Rost macht erst die Münze wert? Dieses Zitat aus Goethes Faust ist einerseits eine unsinnige Behauptung in der modernen Konsumwelt und von daher unter dem Gesichtspunkt zeitgenössischer Geldwirtschaft eine Unwahrheit. Andererseits kann der Satz für die Hobbygemeinschaft all jener, die leidenschaftlich Münzen sammeln, durchaus wahr sein. Antike Münzen zwar werden in ihrem Wert nicht allein vom Rost bestimmt, aber je älter, je mehr aus der Zeit gefallen eine Münze ist, desto eher kann man davon ausgehen, dass ihr ein gewisser, nicht zu vernachlässigender Wert zukommt. Manche der alten Münzen werden mit großer Sorgfalt und Sachkenntnis erst vom Rost der Jahrhunderte oder Jahrtausende zu befreien sein, um den tatsächlichen Wert zu ermitteln. Und wenn es kein wirklicher ‚Kaufwert‘ ist, dann ist es der Wert der Wertschätzung.
Nicht wenige argumentieren bei den Alterserscheinungen der Kirche – römisch oder lutherisch ist dabei egal –, dass der Rost den Wert der Kirche ausmache. Die so Argumentierenden haben dabei die Tradition und das Jahrhunderte währende Wesen der Kirche im Auge. Ausgedrückt wird das gern mit den Worten: „Was schon vor Hunderten von Jahren gut, hilfreich und segensreich gewesen ist, kann nicht plötzlich schlecht sein und dem Modernismus oder einer lässigen À-la-mode-Haltung geopfert werden.“
Diejenigen in der Kirche, die unbedingt und gegen die Zeit an den wunderbaren Traditionen festhalten wollen, haben durchaus nicht die Absicht, der Kirche zu schaden, selbst wenn sie diese dem eigenen Geschmack unterwerfen. Stark wollen diese Anwälte der ‚ewig gleichen Kirche‘ das Schwache oder das immer schwächer Werdende schützen und behaupten die Würde und die jahrtausendealte Kraft einer für sie zeitlosen Institution des lieben Gottes höchstselbst. Was dabei freilich übersehen oder überhört wird, ist die Tatsache, dass für eine beständig zunehmende Zahl von Menschen der Rost der Kirche nur ausweist, dass sie ihren einstigen Glanz verloren hat. Relevanz? Fehlanzeige.
Selbst wenn es immer noch eine große Zahl an Antiquitätenliebhaber*innen in der Gesellschaft gibt und selbst wenn viele von diesen Sammler*innen des Alten und Ehrwürdigen ihre Wohnung gern damit schmücken und dabei überhaupt nicht auf Praktikabilität achten, bezieht sich die Liebe zur Antiquität zwar auf Möbel, Bilder und Haushaltsgegenstände, vielleicht auch noch auf Bücher, nicht aber auf die Kirche, die im Antiquitätenladen der Gesellschaft des 21. Jahrhunderts einen Raum einnimmt, den kaum noch Kunden betreten wollen.
Theodor S., *2002 – Zugbegleiter
„Meine Oma sagt mir, dass der Name Theodor so etwas heißt wie ‚Gottes Geschenk‘, und dann meint sie, dass sie mir davon erzählen muss, dass Gott der große Zampano in der Welt ist. Von mir aus soll der bloß in seiner Kirche bleiben. Ich brauche den nicht und diesen ganzen Kram mit Papst und verkleideten Männern und Kerzen und so auch nicht. Klar, Theodor hat vom Namen her wohl was mit Gott zu tun, aber ich als Person nicht. Aus der Kirche bin ich ausgetreten, sobald ich mein erstes Geld verdient habe. Der Laden ist doch voll antiquiert!“
Dass dieser ‚Laden‘ von immer weniger Menschen betreten wird, kann auch daran liegen, dass das Türschild, auf dem eigentlich steht: „Du bist willkommen“, entweder so verblasst ist, dass es kaum noch zu lesen ist, oder dass es in einer Schrift geschrieben wurde, die wie die Sütterlin-Schrift der Großeltern von der nächsten und übernächsten Generation nicht mehr gelesen werden kann, oder dass es sogar in einer unverständlichen Sprache der Kirchengeschichte geschrieben wurde.
Die Kirche steht für viele Menschen – sei es als rostig gewordene Institution oder als zwar ehrwürdige, aber leider nicht mehr zeitgemäße Antiquität – in einem anderen Land als dem Land, in dem sie leben.
„Wahrhaftig, der Schrank hat keine Rückwand!“
In der fantastischen Literatur müssen die Hauptfiguren häufig eine Grenze überschreiten, um von der realen in die fantastische Welt zu gelangen: In der Harry-Potter-Reihe von Joanne K. Rowling ist es der Bahnsteig neundreiviertel am Bahnhof King’s Cross, der den Schüler*innen der Zauberschule Hogwarts den Zugang zum Hogwarts-Express ermöglicht. Muggel – also Menschen ohne die Vorstellungskraft einer parallelen Welt voller Magie – können diesen Zugang nicht nutzen. In Erich Kästners 1932 erstmals erschienenem Kinderbuch „Der 35. Mai“ müssen Konrad und sein Onkel, der Apotheker Ringelhuth, gemeinsam mit dem Pferd Negro Kaballo einen Schrank aus dem 15. Jahrhundert durchschreiten, um ihre fantastische Reise in die Südsee antreten zu können. Und auch in C. S. Lewis’ wenige Jahre nach Kästners Kinderbuch entstandenen „Chroniken von Narnia“ ist es ein Kleiderschrank, der den Übergang in eine andere Welt ermöglicht.
In ähnlicher Weise wird auch von jenen, die der Kirche angehören wollen, ein Grenzübertritt gefordert. Ein Grenzübertritt in ein Land mit vielen vergessenen Orten. Für den Grenzübertritt ist – wie in den genannten Büchern – die Bereitschaft nötig, sich überhaupt erst einmal auf eine andere Welt bzw. eine andere Weltsicht einzulassen. Da geht es nicht allein um den Glauben an Jesus Christus als Gottes Sohn, der in der Kirche sein unabdingbares Zuhause hat, sondern es geht auch darum, sich sowohl auf die oft exklusive Sprache der Kirche einzulassen wie auch auf den zuweilen geheimnisvollen Habitus.
Christian K., *2000 – Jurastudent
„Ich komme aus Chemnitz. Ich war tatsächlich zum ersten Mal in meinem Leben in so einem Sonntagsgottesdienst, weil meine Freundin mich mitgenommen hat. Das war echt krass. Wenn du dich hinsetzen willst, darfst du dich nicht gleich hinsetzen, weil man erst ein bisschen stehen muss, und dann musst du im Gottesdienst auch immer aufstehen und dich hinsetzen. Das Prinzip ist dabei undurchschaubar. Die Lieder kannste vergessen und wenn der Pope vorne was sagt, musst du auswendig wissen, was er jetzt von dir hören will. Ich fand es super anstrengend …“
Für erhebliche Teile der gesellschaftlich aktiven oder der heranwachsenden Generation bedeutet der Weg zur Kirche oder in die Kirche tatsächlich so etwas wie entweder durch den Kleiderschrank in Kästners „Der 35. Mai“ oder über den Bahnsteig neundreiviertel in Rowlings „Harry Potter“ zu gehen. Für die große Zahl der die Gesellschaft vor allem bestimmenden Generation der 35- bis 65-Jährigen mögen die kirchentypische Sprache und ihre Gepflogenheiten zwar Erinnerungen an vergangene Kindheitstage wecken, trotzdem ist durch Entfremdung, die über den Jahren des kirchenlosen Heranwachsens und des ebenso kirchenlosen Erwachsenenlebens einsetzte, der Gang in oder zur Kirche Grenzübertritt. Verstärkt wird das durch die noch weiter entfremdende Unsicherheit, dass man nicht mehr weiß, wie man sich benehmen muss oder mit welchen Worten im liturgischen Automatismus mitzuspielen ist.
Es ist wie eine Erinnerung an die Urlaube der Kindheit, die mit den Eltern im Harz, auf einer der Nordseeinseln oder in Österreich verbracht wurden und an die man sich tatsächlich gern erinnert, allerdings auch mit einem lächelnden nostalgischen Gefühl. Von diesem Damals der Ferientage in Familienpensionen, auf dem Campingplatz oder in Ferienheimen, die von öffentlichen Trägern geführt wurden – wie z.B. auch der Kirche –, bleibt gute Erinnerung, aber heute fliegt man lieber nach Mallorca oder in die Vereinigten Staaten. Verfängt der alte Zauber noch, die Atmosphäre ‚des ganz Anderen‘? Während „die Kirche im Dorf bleiben soll“, wie ein bekannter Spruch sagt, der geradezu sprichwörtlich für Beharrung steht, hat sich die Welt ringsum auch in den Dörfern schon längst globalisiert. In den Dörfern und erst recht in den Städten stehen zwar noch die alten Gebäude, in denen sich manche Kindheitserinnerung angesammelt hat, aber sie spielen keine Rolle mehr im Leben. Es sind mindestens zwei sehr unterschiedliche Gruppen, deren Entfremdung zur Kirche oder der Kirche gegenüber zu beobachten sind. Auf der einen Seite die bürgerliche Klientel. Auf der anderen Seite die in früheren Zeiten dem Arbeitermilieu zuzurechnenden Menschen, die sich mit einer Kirche schon immer schwerer taten, die mit ihrer Botschaft und mit ihren Traditionen eher das gepflegte Bürgertum angesprochen hat.
Die Kirchen bedienen bei sehr vielen Menschen keine vitalen Bedürfnisse mehr. Der Glaube verlässt im Wesentlichen nicht mehr die von ihm selbst gebauten oder angemieteten Räume und findet sich nicht mehr ‚auf Straßen und Gassen‘. Zwar gibt es immer wieder bei kirchlichen Hochzeiten, bei Beerdigungen oder bei Taufen die ‚Urlaubsfahrt‘ in das Land der Kindheit und diese familiären Urlaubsfahrten mögen sogar gute Erinnerungen und Gefühle auslösen, aber Urlaub ist eben Urlaub und endet nach der kirchlichen Zeremonie. Bei nicht wenigen jedoch lösen die Urlaubsfahrten in das Land der kirchlichen Kindheit auch ein Kopfschütteln aus, das die Frage stellt: Wie konnte mir das überhaupt jemals gefallen?
Jewgenij L., *1989 – Hauptkommissar
Jewgenij meldete sich 2002 freiwillig zum Konfirmandenunterricht an. Seine aus Kirgisien stammenden Eltern und seine ganze Familie lebten fern der Kirche. Im Konfirmandenunterricht war Jewgenij interessiert, entdeckte gern mit Gleichaltrigen kirchliches Leben, Glauben und Bibel. Nach der Konfirmation kam er regelmäßig zur Jugendgruppe, machte die Ausbildung für jugendliche Begleiter bei kirchengemeindlichen Aktivitäten für Kinder und Jugendliche. Er begleitete etliche Jahre die Konfirmandenfahrten und engagierte sich bei Sommerfreizeiten, die die Kirchengemeinde anbot.
Zum Studium ging Jewgenij in eine andere Stadt. Als Polizeikommissaranwärter heiratet er 2016 eine Frau, die noch nie Kontakt zu Kirche oder christlichem Glauben hatte. Er wünscht sich, dass seine Freunde aus der Gemeinde vor dem Standesamt dem Brautpaar „Viel Glück und viel Segen …“ singen. Kirchliche Trauung kam für seine Frau nicht infrage.
Jewgenij wohnt in der Stadt, geht ganz in seinem Beruf auf, verliert den Kontakt zur Kirche. 2023 tritt er aus der Kirche aus. „Meine Zeit mit der Kirche war in einem anderen Leben“, sagt er.
Die Kirche – ob römisch oder lutherisch – lebt gesellschaftlich eher marginalisiert in ihrer Seniorenresidenz, umgeben von im Wesentlichen Gleichaltrigen, von den Erinnerungen an die vermeintlich großartigen Zeiten einer schon längst vergangenen Volkskirchlichkeit und bewegt sich auf ein Sterben der sie bisher tragenden Strukturen und Volkskirchenbräuche zu.
Der Weg aus der Seniorenresidenz auf die Pflegestation und dann auf die Intensivstation ist vorbereitet. Dazu tragen ganz sicher die schrecklichen und erschreckenden Missbrauchstaten bei, durch die auch eine unfassbar widerliche Fratze der Kirche zum Vorschein gekommen ist. Die daran Beteiligten zerstören durch ihr verbrecherisches Verhalten nicht allein das Vertrauen der unmittelbaren Umgebung, sondern vernichten die gute Kraft des Evangeliums auch in der Fläche.
Es bleibt der klägliche Versuch, mit viel Geld das nach wie vor nicht unbedingt unangenehme Leben in der Seniorenresidenz noch möglichst lange finanzieren zu können. Der Tod, der die alte Dame ins Visier genommen hat, wird noch möglichst lange mit Geld bestochen, das ihn daran hindern soll, sie schon bald zu besuchen. Und der Tod lässt sich bestechen … Aber wie lange noch? Tatsache in der Welt rings um die Kirche herum ist schon lange, was Jewgenij für seine Generation feststellt: „Meine Zeit mit der Kirche war in einem anderen Leben.“
„Niemand hört es gern, dass man ihn Greis nennt“
Es ist verstehbar und sogar nachvollziehbar, dass die bis heute gebliebenen Verehrer*innen der Kirche es natürlich nicht gern hören, dass der Kirche ein gebrechlicher Zustand zugeschrieben wird. Es ist wie bei Politiker*innen der modernen Welt oder bei Herrschenden vergangener Zeiten. Krankheit und Schwäche werden bemüht hinter den für die Öffentlichkeit verschlossenen Türen gehalten: Ein Heer von schönredenden Öffentlichkeitsreferent*innen bescheinigt krank oder schwach gewordenen Kanzler*innen, Präsident*innen oder anderen Personen in Führungspositionen entgegen den hinter vorgehaltener Hand kolportierten Sachstand der Krankheit ungebrochenen Tatendrang. Denn Müdigkeit oder Zeichen der Schwachheit – selbst wenn sie nur vorübergehend gezeigt werden – lassen Zweifel an Führungsqualitäten aufkommen. Krankheit oder regeneratives Ruhebedürfnis können nicht zugegeben werden, weil das Machtverlust bedeuten könnte.
Dementsprechend hören die Funktionär*innen auch der Institution Kirche nicht gern die offensichtliche Diagnose sowohl jener, die die Kirche verachten, als auch jener, die die Kirche lieben, nämlich dass die Situation ernst ist und ein Beatmungsgerät dringend nötig wäre. Während die Verächter*innen bereits vom baldigen Sterben ausgehen, werden die, die die Kirche immer noch lieb haben, davon ausgehen, dass ihr mit der richtigen Pflege und der richtigen Therapie die Möglichkeit zur Rekonvaleszenz gegeben werden kann. Diese Rekonvaleszenz ist aber nur dann möglich, wenn die Verantwortungsträger*innen es zugeben, dass die Situation unschön und vielleicht sogar lebensgefährlich ist.
Margot H., *1934 – Rentnerin
Margot war seit 1956 mit Hermann verheiratet. Hermann hat sich mit dem Pastor des Ortes heftig gestritten. „Ich weiß gar nicht mehr, worum es ging. Es war etwas Politisches …“, erinnert sie sich. In der Folge des Streites trat Hermann, der bis dahin im Kirchenvorstand der Gemeinde war, aus der Kirche aus. „Es ging jedenfalls nicht darum, die Kirchensteuer zu sparen“, beteuert Margot. Im Juli 2021 erliegt Hermann einem Herzinfarkt, den er bei der freiwilligen Arbeit auf dem Friedhof der Kirchengemeinde erleidet. Der Pastor – nicht mehr derselbe, mit dem es einst Streit gab – weigert sich, die christliche Beerdigung zu halten. Trotz mancherlei Vermittlungsversuchen bleibt der Pastor bei seiner Haltung: „Keine kirchliche Beerdigung!“
Margot erkundigt sich, wie man das mit dem Kirchenaustritt machen muss. Gemeinsam mit ihren drei Kindern tritt sie im Herbst 2021 aus der Kirche aus. Sie schließt sich aber einer freien Gemeinde an: „Es geht ja nicht um den Glauben, sondern um dieses miese Verhalten.“





























