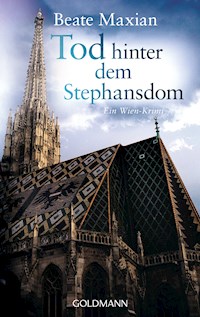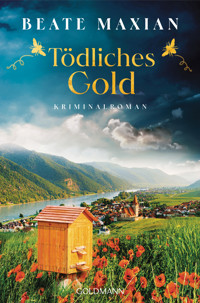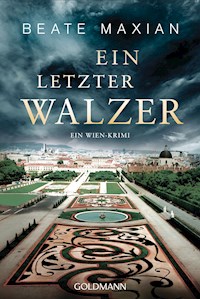9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Goldmann Verlag
- Kategorie: Krimi
- Serie: Die Sarah-Pauli-Reihe
- Sprache: Deutsch
Für ein Mitglied der feinen Wiener Gesellschaft führt eine Fiakerfahrt in den Tod ...
Als Chefredakteurin des Wiener Boten weiß Sarah Pauli stets Bescheid, wenn sich etwas Ungewöhnliches in der Donaumetropole ereignet. So schreibt sie auch als Erste über das geheimnisvolle Kreuzsymbol, das plötzlich überall in Wien an Häusern und Sehenswürdigkeiten prangt. Und die Graffiti sind erst der Anfang eines unheimlichen Rätsels. Denn an einem nebeligen Tag wird in der Wiener Altstadt der Fahrgast eines Fiakers ermordet – und in der Kutsche findet man eine mysteriöse Zahlenreihe und darüber ein Kreuzzeichen …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 394
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Buch
Sarah Pauli, Chefredakteurin beim Wiener Boten, kennt Wien wie ihre Westentasche und weiß stets Bescheid, wenn sich etwas Ungewöhnliches in der Donaumetropole ereignet. So schreibt sie auch als Erste über das geheimnisvolle Kreuzsymbol, das plötzlich überall in Wien an Häusern und Sehenswürdigkeiten prangt. Und die Graffiti sind erst der Anfang eines unheimlichen Rätsels. Denn an einem nebeligen Tag wird in der Wiener Altstadt der Fahrgast eines Fiakers ermordet – und in der Kutsche findet man eine mysteriöse Zahlenreihe und darüber ein Kreuzzeichen …
Weitere Informationen zu Beate Maxian sowie zu lieferbaren Titeln der Autorin finden Sie am Ende des Buches.
Beate Maxian
Der Tote im Fiaker
Der zehnte Fall für Sarah Pauli
Ein Wien-Krimi
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Originalausgabe März 2020
Copyright © 2020 by Beate Maxian
Copyright © dieser Ausgabe 2020
by Wilhelm Goldmann Verlag
in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,
Neumarkter Straße 28, 81673 München
Covergestaltung: UNO Werbeagentur, München
Covermotiv: franky242/alamy images; FinePic®, München
Redaktion: Susanne Bartel
KS · Herstellung: kw
Satz: Buch-Werkstatt GmbH, Bad Aibling
ISBN 978-3-641-22566-7 V004
www.goldmann-verlag.de
Böses Gewerbe bringt bösen Lohn.
Friedrich von Schiller, Wallenstein
Doch sag mir, Clifford, hast du nie gehört,
daß schlecht Erworbnes immer schlecht gerät?
William Shakespeare, König Heinrich VI.
Montag, 2. September
1
Der Ausblick widerte ihn an. Die Spinnweben in den Hecken ringsum kündigten den bevorstehenden Herbst an. Dazu gesellte sich Nieselregen samt Nebel. Ein Tag zum Trübsalblasen. Dabei war gestern noch Sommer gewesen. Der Reisepass glitt in die Tasche seines Sakkos, der Blick obligatorisch zum Nachbarhaus. Danach zur Uhr. Noch drei Minuten. Einen Morgen wie diesen hatte Leopold Bahnen schon gefühlte tausend Mal erlebt. Langweilig. Nervtötend. Zum Kotzen. Sein Leben war eine Endlosschleife aus Eintönigkeit.
Das Radio lief. ABBA. I have a dream.
Einen Traum hatte auch er.
Er brühte Pfefferminztee für Else auf, stellte die Eieruhr. Seine Frau bestand darauf, dass der Tee vier Minuten zog. Warum auch immer. Wieder wanderte sein Blick durchs Fenster. Noch eine Minute. Die Bewegung des Vorhangs im Haus gegenüber verriet, dass es gleich so weit sein würde. Die Nachbarin spähte durch die Gardine ihres Küchenfensters zu ihm herüber. Sobald er das Haus verließ, würde sie ihren Beobachtungsposten wechseln und sich ans Fenster des Esszimmers setzen, das zur Straße hinaus zeigte. Ab diesem Moment fixierte sie den halben Tag ihre Umgebung, registrierte jeden und alles. Ob er ihr einfach den Kopf einschlagen sollte? Mit einem kantigen Stück Hartholz aus dem Wald? Eiche böte sich dafür an. Wäre sie dann erlöst von ihrem kümmerlichen Dasein, oder empfand sie ihr Leben am Ende doch noch als lebenswert? Einsam hoffend, weitestgehend darauf angewiesen, dass etwas vor ihrer Haustür passierte. In dem Grätzel, in dem sie wohnten, war nicht viel los. Es würde ihm zweifellos gelingen, unbemerkt rüberzugehen, zu läuten, und dann: ein fester Schlag auf den Kopf. Doris würde tot zusammensinken, bevor sie realisiert hätte, was geschehen war. Ihre Leiche könnte er in die Wohnung zurückschieben, die Tür wieder zuziehen. Die Nachbarin hatte keine Familie, die sie regelmäßig besuchen kam. Auch Freundinnen waren rar gesät. Denkbar, dass es Wochen, wenn nicht sogar Monate dauern würde, bis man sie entdeckte. Er lächelte bei dem Gedanken. Seine Frau wäre entsetzt ob seiner Idee. Else war eine strenge Katholikin, eine Heilige. Auch so was, was ihn ankotzte.
Die Nachrichtensprecherin versprach schöneres Spätsommerwetter erst ab Mitte der Woche. Egal, die Touristen nahmen auch an einem trüben Tag wie diesem die Innenstadt in Beschlag. Wie die Fliegen krochen sie in jede erdenkliche Ritze. Möglicherweise würden sich einige in seinen Laden verirren. Darauf wetten wollte er aber nicht. Das Angebot war zu speziell. Christliches Zeug interessierte in der Stadt nur mehr eine Minderheit.
Im Radio lief ein Werbespot für ein Deo. Er schaltete das Gerät aus und trat mit dem Tablett in der Hand ins Wohnzimmer. Else lag auf dem Sofa, zugedeckt bis zum Hals. Teilnahmslos nahm er ihr blasses Gesicht zur Kenntnis. Das Haar klebte förmlich an ihrem Kopf. War sie eigentlich jemals attraktiv gewesen? Er stellte die Tasse auf den Tisch, daneben die Kanne und zwei Wassergläser.
»Ich muss gleich los.«
»Wann kommst du zurück?« Sie hielt sich ein Taschentuch unter die Nase. Die Erkältung wollte einfach nicht besser werden. Schon seit vier Tagen fesselte die Erkrankung sie ans Bett. Das spielte ihm in die Hand.
»Nach der Arbeit, wie jeden Tag.« Er reichte ihr das erste Wasserglas. »Trink das, da sind Erkältungstropfen drin.« Wie zur Bestätigung stellte er eine kleine Arzneiflasche neben die Teekanne. Sie leerte das Glas in einem Zug.
»Spül damit nach.« Er streckte ihr das zweite entgegen. Sie platzierte das leere auf dem Tisch, nahm einen großen Schluck aus dem anderen und verzog das Gesicht. »Was ist das? Es schmeckt bitter.«
»Gegen deine Kopf- und Gliederschmerzen. Die freundliche Dame in der Apotheke meinte, es schmecke grauslich, aber wirke wahre Wunder.« Er lächelte fürsorglich und legte eine Medikamentenpackung auf den Tisch. Der darauf abgedruckte Text versprach, dass das Präparat sämtliche Symptome einer Verkühlung lindern würde.
»Wenn es hilft.« Else setzte das Glas an, kippte den Rest hinunter. »Schmeckt wirklich grauslich.«
Er schenkte Tee in die Tasse. »Damit bekommst du den Geschmack weg. Und danach schlaf ein bisschen.«
»Ich habe das Gefühl, nichts anderes mehr zu tun.« Sie nieste, schnäuzte sich und trank den angebotenen Tee. Dann zeigte sie auf die aufgeschlagene Seite des Wiener Boten auf dem Tisch. »Wer macht denn so etwas?«
In der Ausgabe vom vergangenen Wochenende hatte eine Journalistin namens Sarah Pauli einen Artikel über die Bedeutung des Antoniuskreuzes geschrieben. Seit drei Wochen sprayte ein Unbekannter die T-förmigen Kreuze an Häuser, Sehenswürdigkeiten und auf Straßen.
»Ich weiß es nicht.« Woher sollte er auch? Er verkaufte christliche Erzeugnisse. Er malte sie nicht.
»Das ist Blasphemie.«
»Natürlich.« Es hatte keinen Sinn, mit Else darüber zu diskutieren. Mit Gott trieb man keine Späße, diese Meinung verteidigte sie, selbst gegen den Teufel. Ihm war’s egal. Es interessierte ihn nicht. Nicht mehr. Er verabschiedete sich im Stehen.
Sie griff nach der Teetasse. »Kein Kuss. Die Verkühlung«, wehrte sie ab.
Ihm war’s recht.
Kaum dass er die Haustür hinter sich ins Schloss gezogen hatte, öffnete sich die Tür des benachbarten Hauses. Offenbar hatte ihm Doris heute etwas mitzuteilen, sonst säße sie schon an ihrem Aussichtspunkt. Graue Jogginghose, graues T-Shirt, graue Haare. Wie alt mochte sie sein? Sechzig? Siebzig? Hatte sie das je erwähnt? Er erinnerte sich nicht. Und es gelang ihm auch nicht, ihr Alter zu schätzen. In der Hand hielt sie einen Müllsack, die Rechtfertigung für ihr Erscheinen. Ihre gegenseitige Abneigung verbargen sie voreinander hinter Oberflächlichkeit und höflichem Lächeln. In seinen Augen war sie nichts weiter als eine schreckliche Neugiernase. Außerdem ein verdammtes Lästermaul, das an kaum jemandem ein gutes Haar ließ. Eine gefährliche Mischung. Die Idee, ihr mit einem Stück Holz eins überzubraten, drängte sich ihm erneut auf. Er lächelte. »Guten Morgen, Doris.«
»Guten Morgen. Wie geht’s Else?«, fragte sie wie nebenbei und öffnete den Deckel der Mülltonne.
»Gut.«
»Die Verkühlung?«
»Wird besser.«
»Soll ich später mal nach ihr schauen?« Ein falsches Lächeln auf ihren Lippen. In Wahrheit wollte sie nachsehen, ob sie beide sich etwas Neues angeschafft hatten. Ein Sofa, einen Esstisch oder sonst etwas, über das es sich zu tratschen lohnte, auf die Art: Die müssen es ja dick haben. Oder sie haben alles auf Kredit gekauft. Wie oft hatte Else diese oder ähnliche Sätze schon von Doris gehört, weil sich einer der Nachbarn ein neues Auto, einen Pool oder Sonstiges geleistet hatte. Neid war Doris’ zweiter Vorname. Schön verpackt in geheucheltes Interesse.
»Ich hab eine Rindsuppe gekocht. Die tät ihr sicher gut«, setzte sie nach.
»Musst nicht nach ihr schauen. Ich komm mittags nach Hause, bis dahin schläft sie eh.« Eine Halbwahrheit. Er hatte vor heimzukommen, aber nicht, um nach Else zu sehen. Auf seinem persönlichen Plan stand heute etwas ganz anderes. »Und eine Suppe hab ich auch g’macht. Hühnersuppe, die hilft sogar noch besser bei einer Verkühlung als Rindsuppe.« Eine glatte Lüge. Natürlich gab es keine Suppe.
»Wenn das so ist, dann mach’s gut.« Die Enttäuschung stand Doris ins Gesicht geschrieben. »Schönen Tag noch, trotz des grauslichen Wetters.« Sie deutete nach oben. Ihre vom Nieselregen feuchten Haare kräuselten sich leicht. »Und grüß mir später die Else schön.«
»Mach ich! Servas, Doris.« Er stieg in den Ford Focus, der in der Einfahrt vor der Garage parkte, weil er gestern zu faul gewesen war, ihn reinzufahren, und startete ihn. Doris verweilte bei der Mülltonne, während er davonfuhr. Im Radio sangen Silbermond: Weg für immer.
Unwillkürlich musste er lächeln. Jetzt fing es wieder an.
Auf dem Weg in die Innenstadt kam er nur langsam vorwärts. Schlechtes Wetter und der erste Schultag nach den Sommerferien waren ein Garant für Chaos auf den Straßen. Zudem wimmelte es auf den Gehwegen von unzähligen Schulkindern, eine weitere Gefahrenquelle. Dazu mürrische Gesichter, wo man nur hinsah. Ihm war’s schon jetzt egal. Ab morgen würde er nicht mehr in der Stadt sein. Den Wagen stellte er in der Garage Am Hof ab. Der Dauerparkplatz kostete ihn ein Vermögen. Doch das war es ihm wert, nicht mit den öffentlichen Verkehrsmitteln fahren zu müssen. Frühmorgens ertrug er keine Menschenmengen. In Wahrheit ertrug er sie zu keiner Tageszeit.
Sein Geschäft lag im befahrbaren Teil der Goldschmiedgasse, einer Einbahnstraße: Christliche Geschenke Bahnen. Das beleuchtete Schaufenster mit der Madonna samt Kind in der Mitte, den Kreuzen und Weihwasserkesseln an den Seitenwänden verriet, dass Adele bereits im Laden stand. Sie arbeiteten seit acht Jahren zusammen. Ihre Betriebsamkeit war beeindruckend. Manchmal fragte er sich, ob diese Frau überhaupt jemals schlief. Er drückte die Tür auf. Adele bediente einen Mann, obwohl sie offiziell erst in einer halben Stunde öffneten.
»Guten Morgen«, flötete sie hinter dem braunen Verkaufstresen hervor.
»Guten Morgen«, erwiderte er.
Hinter Adele hingen weitere Kreuze und Weihwasserbrunnen. In Regalen, die im gesamten Verkaufsraum verteilt standen, reihten sich Heiligenfiguren an Madonnen, Krippen und Gebetswürfel. Nicht zum ersten Mal ertappte er sich bei dem Gedanken, dass seine Angestellte perfekt zur Einrichtung passte. Konservative Kleidung, brauner Rock, beige Bluse mit passender Strickjacke und robustes Schuhwerk ohne Schnickschnack. Der akkurat geschnittene Pagenkopf ließ sie strenger erscheinen, als sie in Wirklichkeit war. Adele beugte sich leicht zur Seite, um an dem dicklichen Kunden mit Krankenkassenbrille und Halbglatze vorbeizublicken. Erst jetzt registrierte er, dass jener Stammkunde vor dem Tresen stand, dessen Frau vor vier Jahren an Krebs gestorben war. Sie hatte Figuren aus Hallstätter Keramik gesammelt, eine Tradition, die er aus sentimentalen Gründen fortführte. Adele organisierte die reizvollsten Stücke für ihn und überreichte ihm in diesem Moment einen Marienkäfer.
»Er bringt Glück«, behauptete sie voller Überzeugung.
»Schön, Sie zu sehen, Herr Zwölfer«, sagte Bahnen mit zufriedenem Lächeln. »Noch dazu bei dem Wetter. Da verlässt man sein Haus doch normalerweise nicht freiwillig.« Er stellte den Regenschirm in den dafür vorgesehenen Ständer neben der Eingangstür.
»Es gibt kein schlechtes Wetter, nur schlechte Bekleidung«, antwortete Zwölfer mit einer Plattitüde.
Bahnen nickte freundlich und beeilte sich, durch die Tür in den hinteren Teil des Ladens zu kommen. Dort lag die Werkstatt, in der auch sein Schreibtisch stand. In ihr gab es weniger heiliges Zeug, dafür eine kleine Küche mit einer Kaffeemaschine, die guten Kaffee aufbrühte. Er gönnte sich eine Tasse.
Als er sich vor den PC setzte, vibrierte das Handy in der Sakkotasche. Ein rascher Blick, die Nachricht bestand aus einer Uhrzeit und einem Familiennamen: Zwölf Uhr, Huber.
Ausgerechnet. Der Name verursachte ihm ein ungutes Gefühl in der Magengegend. Obwohl es Tausende mit diesem Familiennamen in Österreich gab, verband er ein Geheimnis damit. Er ließ das Handy wieder zurückfallen und wischte die Beklemmung beiseite. Bald war es geschafft. Mit einem leichten Lächeln auf den Lippen sperrte er wie üblich die Tür zur Werkstatt hinter sich ab und machte sich an die Arbeit.
Die Zukunft begann heute Nacht.
2
Sarah war die Sache unangenehm. Sie hätte eine unspektakuläre Übergabe vorgezogen. Doch der zweite September fiel nun einmal auf den Wochenbeginn, und montags stand die alle Ressorts umfassende Redaktionssitzung im Wiener Boten auf dem Programm. Sie kam also nicht drum herum, im Beisein der Belegschaft ihren neuen Posten zu übernehmen. Sarah Pauli, Chefredakteurin. Daran musste sie sich erst gewöhnen. Allerdings hatte sie nicht vor, deshalb ihre Arbeitsweise zu ändern. Die Recherchen und das Verfassen von alltäglichen Beiträgen wollte sie sich nicht nehmen lassen.
»Wir machen es kurz und schmerzlos, versprochen«, beteuerte David, Herausgeber des Wiener Boten und Sarahs Lebensgefährte. »Aber eine inoffizielle Übergabe kommt nicht infrage. Deine Kollegen haben ein Recht darauf, dir die Hand zu schütteln und dir Glück zu wünschen. Vor allem deine Kolleginnen wollen das.« Er trug einen dunkelblauen Anzug mit einem weißen Hemd. Ein untrügliches Zeichen dafür, dass ein bedeutsamer Termin anstand. In T-Shirt und Jeans fühlte er sich wohler. Heute Morgen, als sie seine Kleidung registriert hatte, hatte sie vergessen, sich nach dem Grund für seinen Aufzug zu erkundigen. Jetzt zupfte sie am Ärmel seines Sakkos.
»Sag mir bitte, dass du dich nicht meinetwegen so aufg’mascherlt hast.«
David grinste herausfordernd. »Und was, wenn doch?«
Sarah riss ihre rehbraunen Augen auf, blickte erschrocken an sich hinunter. Wie üblich trug sie bequeme Kleidung: Jeans, Langarmshirt und Schnürstiefeletten. Ein Anflug von Unruhe überkam sie. Hätte sie etwas anderes anziehen sollen? Immerhin waren ihre Haare frisch gewaschen und glatt geföhnt. Sie glichen einem Seidenschal, der ihr knapp über die Schultern fiel. »Soll ich g’schwind meinen Blazer holen? Der hängt in der Redaktion.«
David lachte. »Du schaust wunderbar aus. Und keine Angst, ich treffe nachher noch einen wichtigen Werbekunden, deshalb der Anzug.«
Sarah atmete erleichtert auf. Sie versuchte, die Sache locker zu nehmen, war aber trotzdem hochgradig nervös.
»Endlich eine Frau in der ersten Reihe. Ich kann dir gar nicht sagen, wie oft ich diesen Satz in den letzten Wochen gehört habe.« David fuhr sich seufzend durch die dunklen Haare. Eine Geste, die Sarah selbst nach sechs Jahren Beziehung noch unsagbar sexy fand.
»Aber Conny leitet doch auch ein Ressort«, hielt sie dagegen.
»Weil sie die personifizierte Gesellschaftsredaktion ist und es beim Wiener Boten nur eine einzige Society-Lady gibt.« Wenn die Journalistin mit der kupferroten Lockenmähne keine Zeit für ein Event einplanen konnte, schickte sie zwar jemanden von der Lifestyle-Redaktion zur Veranstaltung, doch was auf ihrer Gesellschaftsseite erschien, darüber wachte sie mit Argusaugen.
»Außerdem bist du in deiner neuen Funktion nicht nur dem Chronik-Ressort verpflichtet, sondern hast die Macht über den gesamten Wiener Boten«, fuhr David fort und verzog übertrieben ehrfurchtsvoll das Gesicht.
Sarah musste lachen. »Ich werde aber weiterhin Artikel für die Chronik schreiben.«
»Du bist Chefredakteurin, du entscheidest.«
Inzwischen waren sie vor der geschlossenen Konferenzraumtür angekommen. »Also gut! Auf in den Kampf.« Sarah berührte kurz ihr rotes Corno an der Halskette, um sich zu beruhigen.
David registrierte die Geste mit einem spöttischen Grinsen. »Heute droht dir keine Gefahr durch den bösen Blick.«
»Man kann nie wissen. Es gibt Kolleginnen, die meinen, ich hätte den Job nur bekommen, weil ich mit dem Herausgeber ins Bett steige.«
David nahm ihre Hand, zog sie an sich und schob ihre halblangen dunklen Haare mit einer zärtlichen Bewegung nach hinten, um sie sanft auf den Hals zu küssen. Dann ließ er sie wieder los. »Das ist Blödsinn. Günther Stepan, Herbert Kunz und ich haben einstimmig entschieden, dass du die Beste für den Job bist. In unseren Besprechungen ging es nur um dein Können, nie um unser Privatleben. Also, lass die Neider glauben, was sie wollen.«
»Ich versuch’s. Im Übrigen trage ich mein rotes Horn fast jeden Tag. Das weißt du und alle anderen auch.«
»Nur im Bett legst du’s ab«, raunte er. »Aber das weiß nur ich. Hoffentlich«, fügte er gespielt misstrauisch hinzu.
»Wartet«, hörte Sarah plötzlich eine vertraute Stimme.
Sie drehte sich um und sah Gabi auf sie zulaufen. Ihre Freundin, die zugleich Davids Sekretärin und die Freundin ihres Bruders Chris war, hielt eine Tortenglocke in den Händen. Ihre blonden Locken wippten bei jedem Schritt auf und ab.
»Was ist das?«, fragte Sarah.
»Eine Tortenglocke.«
»Gabi!«
»Eine Sachertorte.«
»Warum?«
»Und warum bist du nicht mit uns gefahren?«, fragte David dazwischen.
Gabi und Chris wohnten ebenfalls in Davids Haus. Ihr Apartment im ersten Stock war mit seinen hundertsechzig Quadratmetern gleich groß wie ihres im Erdgeschoss. In ihrem Hinterhof befand sich ein kleiner Garten und vor ihrer Haustür der Türkenschanzpark. Sarah war es schwergefallen, die Wohnung am Yppenplatz im sechzehnten Bezirk zu verlassen. Ihr Bruder und sie hatten dort viele Jahre zusammengelebt, nach dem Unfalltod ihrer Eltern. Doch mittlerweile wollte Sarah die Ruhe im Cottageviertel des achtzehnten Bezirks nicht mehr missen.
»Chris ist um halb sieben losgefahren, und ich bin gleich mit ihm mit«, antwortete Gabi.
Sarahs Bruder arbeitete im AKH, dem größten Krankenhaus Wiens. Die Studentenzeit lag seit Kurzem endgültig hinter ihm, und er hatte die Fachausbildung zum Anästhesisten begonnen.
»Für das letzte Stück habe ich die U-Bahn genommen«, erklärte Gabi noch ganz außer Atem und küsste sie zur Begrüßung auf beide Wangen. »Ach, Sarah, ich freu mich so für dich.«
»Also dann!« Sarah drückte die Klinke nach unten.
Nahezu zeitgleich ertönte ein Chor: »Herzlichen Glückwunsch!« Fast die gesamte Mannschaft des Wiener Boten hatte sich versammelt und prostete ihr mit Sekt zu.
Sarah seufzte leise.
Herbert Kunz, der Chef vom Dienst, sah sie über seine rahmenlose Brille hinweg an und reichte ihr ein Glas. »Auf dich und deine bevorstehenden Aufgaben.«
Sie stießen an. Auf dem Tisch standen Kuchen und Trześniewski-Brötchen. Gabi stellte die Sachertorte dazu. Danach gratulierte Sarah Günther Stepan, ihr Vorgänger. Für ihn begann an diesem Tag die Altersteilzeit. Er wollte es so und sah dementsprechend zufrieden aus. Anschließend wünschten ihr nach und nach die Kollegen der anderen Ressorts viel Glück. Patricia Franz umarmte sie besonders fest. Die junge Kollegin hatte vor drei Wochen von der Chronik- in die Lifestyle-Redaktion gewechselt, womit endlich ihr Traum in Erfüllung gegangen war. Sie hatte lange auf diese Chance gewartet und die Wartezeit mit Hintergrundrecherchen für Sarahs Artikel überbrückt. Sarah bedauerte den Wechsel. Obwohl sie sich anfangs mit Misstrauen begegnet waren, hatten sie die letzte Zeit doch gut zusammengearbeitet. Simon, der Computerspezialist und Fotograf des Wiener Boten, stieß eine Kaffeetasse gegen ihr Glas. »Ich mag keinen Sekt, aber gratuliere.«
»Sekt passt auch nicht zu dir«, spielte Sarah auf sein Aussehen an. Wie immer trug Simon Skaterklamotten und eine dunkle Cap auf dem Kopf.
Zuletzt gratulierte ihr Maja Petrovic. Die junge Journalistin mit den schulterlangen rotbraunen Haaren gehörte inzwischen zu Sarahs Miniteam der Chronik-Redaktion. David hatte sie zum ersten September fest angestellt. Im Jahr davor hatte sie zuerst als Praktikantin, danach als freie Mitarbeiterin für den Wiener Boten gearbeitet. Günthers Altersteilzeit nicht eingerechnet, blieben nun also nur noch sie zwei übrig, um über gesellschaftsrelevante Themen zu berichten. Erschwerend kam hinzu, dass Maja noch studierte. Geschichte und Publizistik. Das bedeutete, dass sie ab und zu an der Uni zu tun hatte und nicht zur Verfügung stand, was das Team wiederum auf eineinhalb Personen reduzierte: Günther Stepan und Sarah.
»Ich freu mich sehr für dich«, sagte sie.
Sarah glaubte ihr aufs Wort. Sie ergänzten einander perfekt. Zwei strebsame, ungekünstelte Frauen. Falls ihnen die Arbeit dennoch über den Kopf wuchs, würde sie David bitten müssen, noch jemanden einzustellen.
Tapfer lächelnd nahm Sarah sämtliche Glückwünsche entgegen. Derweil klopfte ihr das Herz bis zum Hals. Was, wenn sie die Aufgabe überforderte? Was, wenn sie eine schlechte Chefredakteurin abgab? Tausend Gedanken schossen ihr durch den Kopf. Am Ende der Feier sprachen David, Herbert Kunz und Günther Stepan ein paar offizielle Worte.
»Du schaffst das«, raunte Conny ihr währenddessen aufmunternd ins Ohr und legte ihr beruhigend die Hand auf den Unterarm. Die Zähne der Gesellschaftsreporterin blitzten blendend weiß zwischen ihren rot geschminkten Lippen hervor. Die Society-Löwin war wie üblich perfekt gestylt. Als müsste sie gleich zu einem Fotoshooting bei der Vogue.
Sarah lächelte dankbar.
Fünfzehn Minuten später gab Herbert Kunz endlich das Zeichen, zur normalen Tagesordnung überzugehen. David entschuldigte sich, aus Zeitgründen nicht an der Sitzung teilnehmen zu können. Gabi und Simon verabschiedeten sich ebenfalls, weil die Chefsekretärin und der Fotograf nicht anwesend sein mussten. Als die Redaktionssitzung endlich anfing, atmete Sarah entspannt auf.
Zuerst bat der Chef vom Dienst um einen Bericht der anderen Ressorts, dann war die Chronik-Abteilung an der Reihe, und Sarah forderte Maja auf, mit ihrem Thema zu beginnen. Ihre Kollegin berichtete schon seit zwei Wochen regelmäßig über die Lage der Fiaker in der Innenstadt. Es gab Stimmen, die das Ende der Pferdekutschen im Stadtzentrum forderten.
Maja zählte die Argumente der Gegner auf. »Die Reparatur der von den Hufen verursachten Schäden auf dem Asphalt ist teuer.« Sie warf einen Blick auf ihre Notizen. »Laut Aussage der Straßenverwaltung belaufen sich die Kosten auf siebenhundertfünfzigtausend Euro. Die Pferde sollen zumindest mit Gummihufen beschlagen werden. Ein weiteres Thema ist die Verunreinigung durch die Ausscheidungen der Tiere.«
»Trotz des Pooh-Bag-Gebots?«, fragte Kunz, weil die Rösser schon längere Zeit Exkremententaschen tragen mussten.
»Offenbar.«
»Pferdemist ist übrigens der beste Rosendünger«, warf Patricia Franz dazwischen und erntete dafür einige Lacher. Schnell schlug sie sich die Hand vor den Mund. Der Kommentar war ihr scheinbar rausgerutscht.
»Vielleicht das nächste Thema für die Lifestyle-Redaktion? Den Artikel könntet ihr gleich neben einer Werbung für Parfüm platzieren«, witzelte ein Sportredakteur.
»Eins mit Rosenduft«, stieg die Kulturredakteurin auf die Bemerkung ein, und erneut lachten alle lauthals.
»Die Idee finde ich gar nicht mal so schlecht«, fing Herbert Kunz den Ball auf, als das Gelächter abebbte.
»Abgesehen von dem Blödsinn mit der Parfümwerbung daneben«, fügte Sarah hinzu.
Patricia machte sich Notizen, und Sarah gab Maja ein Zeichen fortzufahren.
»Das wichtigste Argument der Tierschützer für ein Ende der Fiaker lautet Tierquälerei. Was ein Tierarzt, den ich dazu befragt habe, allerdings entkräftet hat. Er meint, die Arbeit sei für die Pferde mit einer Beschäftigungstherapie vergleichbar und nicht übermäßig belastend. Vorausgesetzt, die tierschutzrechtlichen Vorgaben werden eingehalten. Einem anderen Arzt zufolge liegt die Wahrheit irgendwo dazwischen. Einig war man sich darüber, dass die Tiere Bewegung und Auslauf brauchen, weil andernfalls Verhaltensstörungen vorprogrammiert sind. Nur, sie frei umherlaufen zu lassen gestaltet sich schwierig. Dafür gibt es in Wien einfach zu wenig Platz.« Wieder warf sie einen Blick auf ihre Notizen. »Bisher habe ich zu dem Thema bereits unzählige Fiaker, deren Vertretung, Tierschützer, Tierärzte, Politiker und Innenstadtbewohner befragt. Ich zitiere Herwig Bontozky, einen Kutscher, den ich bereits mehrmals interviewt und in meinen Artikeln erwähnt habe: ›Würde man die Fiaker in Wien verbieten, wäre das so, als schaffte man die Gondeln in Venedig ab.‹« Ihr Blick wanderte zu Kunz. Ein Zeichen, dass sie fertig war.
Der Chef vom Dienst übernahm. »Scheint so, als bescherte uns die Sache noch viele Beiträge.«
»Auf jeden Fall«, bestätigte Sarah. »Genauso wie die Taukreuze, auch Antoniuskreuze genannt.«
»Über die du in der letzten Wochenendausgabe geschrieben hast?« Kunz nahm die rahmenlose Brille ab, putzte sie und setzte sie wieder auf.
»Genau die. Wie ihr wisst, sprayt irgendjemand die Dinger seit drei Wochen an Wände und auf Straßen.«
»Hast du nicht die Leser aufgefordert, dir Fotos zu schicken, falls sie eines entdecken?«, hakte Kunz nach.
Sarah nickte. »Seitdem habe ich einen weiteren Hinweis bekommen. Eine Mail heute Morgen. Von einer Leserin, der am vergangenen Freitag ein Kreuz am Mahnmal am Judenplatz aufgefallen ist. Damit wären es jetzt insgesamt sechs Kreuze. Das am Judenplatz ist, so wie alle anderen bisherigen, etwa zehn mal zehn Zentimeter groß.« Sie wandte sich an die Gesellschaftsreporterin. »Gibt es dazu etwas aus der Kunstszene, Conny?«
»Ich habe mich schon bei allen möglichen Leuten umgehört, aber niemand weiß etwas. Nicht einmal ein Pseudonym war herauszufinden«, antwortete die Society-Lady enttäuscht. »Der Künstler oder die Künstlerin scheint ein verdammtes Phantom zu sein.«
Schon seit dem Auftauchen der ersten Kreuze in Wien stand die These im Raum, dass sie das Werk eines Streetart-Künstlers seien. Vergleichbar mit dem Bananensprayer, der die Frucht auf Wände von Museen und Galerien sprayte, was mittlerweile einer Auszeichnung gleichkam. Nur, dass man in diesem Fall den Realnamen des deutschen Schöpfers kannte. Von den Taukreuzen wusste man bisher nur, dass es sich um ein Stencil handelte. Ein Schablonengraffiti, so wie die bekannten Werke des Briten Banksy, dessen wahre Identität geheim war. Viele Künstler dieser Szene hielten ihren bürgerlichen Namen verborgen. Erschwerend kam hinzu, dass bis dato niemand die Kreuze für sich reklamierte.
»Vielleicht sind’s ja tatsächlich nur Schmierereien von Jugendlichen, die sich einen Spaß erlauben«, warf Patricia Franz ein. Denn auch diese Meinung kursierte in der Öffentlichkeit.
»Das glaube ich nicht«, widersprach Sarah. »Dafür ist das Motiv zu speziell. Pubertierende sprayen ja viele Dinge an Wände, aber sicher kein Taukreuz.«
»Ein religiöser Fanatiker?«, schlug die Kulturredakteurin vor.
»Warum dann nicht das gängige Kreuz? Das würde wirklich jeder sofort als christliches Symbol erkennen. Nicht so das Taukreuz. Bestimmt steckt eine Botschaft dahinter.«
»Das Kreuz ist auch das Symbol des Franziskanerordens«, las Maja von ihrem Block ab. »Franz von Assisi verstand es als Zeichen der Demut und der Erlösung.«
Sarah nickte. »Es gilt zudem als Bußzeichen. Denkbar, dass unser Sprayer etwas büßen muss oder möchte, dass irgendjemand für irgendetwas büßt.«
»In der Mythologie des Alten Orients symbolisiert es die Vollendung. Das steht jedenfalls in deinem Artikel«, sagte Patricia und deutete auf die aufgeschlagene Wochenendbeilage des Wiener Boten. »Möglich, dass jemand etwas vollenden will?«
Sarah lächelte. Offenbar hatten alle am Wochenende ihren Beitrag über die Bedeutung des Kreuzes gelesen. »Daran habe ich auch schon gedacht. Aber egal, was am Ende herauskommt: Wir bleiben an der Sache dran.« Damit beendete sie das Thema, bevor noch jemand vorschlagen konnte, der Sprayer würde versuchen, Wien vor der Pest, Blitzen, Unwetter und der Verführung zur Unzucht zu schützen. Denn auch dafür stand das Taukreuz.
3
Zehn Minuten vor zwölf verließ Bahnen mit seiner Aktentasche das Geschäft. Davor hatte er mit seiner Angestellten noch über die gesprayten Taukreuze debattiert und dabei erzählt, wie sehr diese seine Frau ärgerten, was Adele Junk durchaus verstehen konnte. Noch immer tauchte dichter Nebel die Stadt in ein trübsinniges Grau. Wenigstens hatte sich der Nieselregen verabschiedet, und die Temperaturen waren etwas nach oben geklettert.
Trotz des deprimierenden Wetters verstopften dahinschlendernde Touristen die Goldschmiedgasse. Bahnen drängte sich grimmig dreinblickend an ihnen vorbei. Die Wiener waren berühmt für ihren Grant. Er war eine Art Heiligtum, das gepflegt und täglich zur Schau gestellt werden durfte. Als er am Fiakerstandplatz in der Jungferngasse ankam, war dieser verlassen. Weit und breit kein Gespann. Ein Blick auf die Uhr: Er war fünf Minuten zu früh dran.
Während er wartete, musterte er die Besucher, die in Scharen in die Peterskirche und wieder heraus strömten. Die Kirche stand in jedem Reiseführer über Wien, gehörte zum Standardprogramm. Bahnen hatte sie noch nie von innen gesehen, obwohl sein Geschäft nur einen Steinwurf davon entfernt lag.
Eine Zweispann-Kutsche mit zwei Braunen mit schwarzer Mähne und schwarzem Schweif näherte sich. Der Fiaker war mittleren Alters und vorschriftsmäßig gekleidet mit Dreiteiler, Hemd mit Mascherl, Budapestern an den Füßen und Melone auf dem Kopf. Er stoppte, stieg vom Bock.
Bahnen umklammerte den Griff der Aktentasche so fest, dass die Knöchel seiner Finger weiß hervortraten. Mit aufgesetztem Lächeln positionierte er sich direkt neben dem Fuhrwerk. »Sind Sie für Huber bestellt?« Wieder ein warnender Stich in der Magengegend, den er ignorierte.
Der Mann bejahte.
»Eine kleine Runde ohne irgendwelche Erklärungen«, wies Bahnen ihn an. »Ich bin Wiener und kenne die Sehenswürdigkeiten. Ich möchte nur ein bisserl ausspannen.«
Der Fiaker nickte. »Was immer Sie wollen.« Er machte eine Kopfbewegung Richtung Kutschwagen, hielt den Einlass auf und schloss ihn hinter Bahnen wieder. Die Melone nahm er dabei nicht ab, lüftete sie nicht einmal für einen kurzen Augenblick.
Bahnen hatte kürzlich gelesen, dass die Stadtverwaltung einen Kutscher zur Zahlung einer hohen Geldstrafe verdonnert hatte. Nur weil dieser den runden Hut für einen flüchtigen Moment abgenommen hatte, während er Gäste kutschierte. An diesem Tag waren es dreißig Grad im Schatten gewesen. Bahnen hatte Verständnis dafür, dass der Mann den Kopf hatte entlüften wollen. Die Fahrgäste wahrscheinlich auch. Die Stadt Wien nicht. Bekleidungsvorschrift war nun einmal Bekleidungsvorschrift. Und nach dieser hätte der Fiaker aufgrund der Hitze zwar im Gilet fahren dürfen, jedoch nicht ohne typische Kopfbedeckung.
Der Pferdelenker kletterte auf den Bock und nahm die Zügel in die Hand. »Also, fahr ma, Euer Gnaden!«
Die muskulösen Pferde setzten sich in Bewegung, umrundeten die Peterskirche. Sie kannten den Weg.
Bahnen überlegte. Er wusste nicht, wie die Person aussah, der er das Kuvert aus der Aktentasche überreichen musste und von der er im Gegenzug einen Umschlag mit Geld erhalten würde. Er wusste nur, wo ungefähr die Übergabe über die Bühne gehen sollte. Auf dem kurzen Straßenabschnitt mit dem Namen Schulhof, der zu dem Platz Am Hof führte.
Der Fiaker hielt sich an seine Bitte, blickte nach vorne, lenkte mit stoischer Ruhe das Gespann, ohne ihn mit Erklärungen über historische Ereignisse und Sehenswürdigkeiten zu belästigen.
Direkt vor ihnen fuhr ein anderer Zweispänner, gezogen von Schimmeln. Auf dem Kutschbock saß eine Frau. Leopold Bahnen musterte sie und hoffte, dass sein Kunde nicht die Fuhrwerke verwechseln würde. In dem Moment bog die Kutsche vor ihnen in die Tuchlauben ab. Bahnen atmete auf.
Sie setzten ihren Weg durch die Steindlgasse fort und kamen kurz darauf an der Gösser Bierklinik vorbei, einem der ältesten Gasthäuser Wiens. Wie gerne hätte er seine Nervosität jetzt mit einem Krügel Bier runtergespült, aber der Fiaker rollte weiter über das Kopfsteinpflaster.
Bei dem Alt-Wiener Innenstadthaus, in dem sich das Uhrenmuseum befand, bogen sie rechts ab, und Bahnen entnahm der Aktentasche Kuvert und Handy. In wenigen Minuten musste die Übergabe stattfinden. Sie würden für die Durchfahrt nicht lange benötigen, die Gasse war kurz. Angestrengt hielt er Ausschau, sah jedoch niemanden, dem er den Umschlag hätte überreichen können. Der Schulhof war menschenleer. Egal, gleich würde sicher jemand auftauchen. Der Platz Am Hof, wo sich definitiv mehr Menschen tummelten, lag nur noch wenige Meter entfernt. Er legte das Handy neben sich auf den Sitz. Durchaus möglich, dass ihm der Kunde eine Nachricht schickte, weil der Plan sich geändert hatte.
In dem Moment ertönte ein lauter Schlag. Die Pferde schnaubten. Der plötzliche Knall dröhnte noch in Bahnens Kopf, und sein Herz raste, als ein zweiter Kracher folgte. Die Rösser spitzten die Ohren, scheuten kurz.
»Heast!« Der Kutscher zog an den Zügeln und fluchte laut. »Depperte Gfrastsackln!«
Bahnen wusste nicht, ob er die unsichtbare Gestalt, die unverkennbar mehrere Böller geworfen hatte, oder die Braunen beschimpfte. Auf der Straße war noch immer niemand zu sehen.
»Da schmeißt einer mit Schweizer Krachern.« Die Information des Kutschers galt Bahnen zur Erklärung seiner Schimpftirade.
»Depperter Fetznschädl!«, brüllte er nun in Richtung der Seitengasse. »Der zweite is direkt vor die Haxen der Viecher g’flogen … Die kriegen mir gleich an Herzkasperl. Als wenn’s net reichert, dass s’ Silvester mit dem Glumpert in der Gegend umadumschmeißen.«
Seine Empörung erschien Bahnen grenzenlos, doch plausibel. Pferde waren Fluchttiere. Ein Charakterzug, für den er tiefstes Verständnis hatte. Auch er mochte das ohrenbetäubend knallende Zeug nicht und floh aus unangenehmen Situationen, wenn er dazu die Möglichkeit hatte.
»Sind die nicht verboten?«, rief er nach vorne und dachte, dass es, so die Tiere jetzt durchdrehten und die Kutsche kippte, reine Ironie des Schicksals wäre. Ein Unfall so knapp vor dem Ziel, und ihm wäre Hohn gewiss. Er verschwendete keinen Gedanken daran, dass das Feuerwerk für ihn bestimmt war. Sein Blick wanderte nach oben. Fenster und Türen der Häuser blieben verschlossen. Das Restaurant am Eck hatte noch nicht geöffnet. Die Pferde standen nun still.
»Nur einen kurzen Moment«, sagte der Fiaker und stieg vom Bock, um nach den Tieren zu sehen. Er bückte sich, strich behutsam mit der Hand über deren Beine, hob die Füße an, um die Hufe zu kontrollieren.
Bahnen sah auf die Armbanduhr. Zehn Minuten nach zwölf. Die Übergabe hätte längst abgeschlossen sein sollen. Er blickte auf und sah sich um. Die Gasse war noch immer menschenleer. Nicht einmal Touristen trieben sich hier herum. Doch dann registrierte er im Augenwinkel eine Bewegung. Eine Person, die wie ein sich plötzlich materialisierender Geist aus der Parisergasse kam. Nur ihre schwarze Bekleidung, die dunklen Turnschuhe und der tief ins Gesicht gezogene Kapuzenmantel, passte nicht zu einer paranormalen Erscheinung. Vielmehr erinnerte sie ihn an Jugendliche aus amerikanischen Gangsterfilmen, die etwas zu verbergen hatten oder aus einem anderen Grund nicht erkannt werden wollten. War das etwa sein Kunde?
Die Gestalt steuerte direkt auf ihn zu, sie musste also der Käufer oder derjenige sein, der den Tausch Ware gegen Bargeld abwickelte. Hatte die Person die Schweizer Kracher geworfen? Diese Art der Aufmerksamkeit hätte es nun wirklich nicht gebraucht, dachte Bahnen wütend, dann ließ er rasch das Kuvert aus der Kutsche fallen. Wie vereinbart.
Die Hand des Kapuzenmantelträgers zuckte unter dem Ärmel hervor. Bahnen beugte sich leicht nach vorne, um einen Blick auf das Gesicht zu erhaschen, aber der Kerl trug allen Ernstes eine Sturmmaske. Man konnte Vorsichtsmaßnahmen auch übertreiben. Im nächsten Augenblick sah Bahnen den Revolver. Mit Schalldämpfer. Er riss die Augen auf, sein Kopf schnellte Richtung Fiaker. Aber der bemerkte nichts, strich gerade einem seiner Pferde zum wiederholten Mal über den Fuß. Bahnen wollte schreien, doch seine Stimme versagte. Nicht einmal ein heiseres Krächzen konnte er den Stimmbändern entlocken. In dem Moment wurde er in den Hals getroffen. Eine Blutfontäne schoss aus seiner Kehle, ergoss sich auf seinen Anzug und die Kutsche. Ein letztes Mal versuchte er, sich bemerkbar zu machen, brachte jedoch kein Wort heraus. Dann verschwand die Gestalt, und Bahnen glitt in ein dunkles Loch.
4
Nach der Sitzung hatten Sarah und Herbert Kunz noch über ihre zukünftige Zusammenarbeit gesprochen. Sie verließ soeben das Konferenzzimmer, als auf dem Display ihres Handys Martin Steins Name aufleuchtete. Den Chefermittler und sie verband eine spezielle Beziehung. Sie kannten einander schon viele Jahre und schätzten sich inzwischen auch. Aus ihrer anfänglich gegenseitigen Abneigung hatte sich eine Freundschaft entwickelt. Im Laufe der Zeit waren sie ein eingespieltes Team geworden. Sarah teilte mit ihm ihre Rechercheergebnisse, und der Chefinspektor ließ ihr gegenüber ab und zu einen internen Sachverhalt fallen. Martin Stein war leidenschaftlicher Wiener mit all dem dazugehörigen Grant und der widersprüchlichen, aber ebenfalls typischen Gutmütigkeit. Kurzum: Er war ein Brummbär mit einem weichen Herzen. Der ihr erst kürzlich beim Malern ihrer alten Wohnung und beim Umzug ins neue Zuhause geholfen hatte.
»Hallo, Martin! Rufst du etwa an, um mir zu meiner Beförderung zu gratulieren?«, witzelte sie, während sie die Stufen in den zweiten Stock hinunterlief.
»Natürlich auch. Gratuliere. Wo bist du?«
»Im Wiener Boten.«
»Ich brauche deinen Rat.«
Sarah stoppte abrupt. »Du brauchst meinen Rat? Ich bin … echt sprachlos.«
»Dass ich das noch erleben darf.«
»Hast du mich schon jemals um Rat gefragt? Was ist passiert? Sind Dämonen in Wien unterwegs, und du verstehst ihre Sprache nicht?« Bei der Vorstellung lachte Sarah laut auf.
»So etwas Ähnliches. Am besten kommst du her, Innenstadt, Schulhof. Jetzt!« Er legte auf.
Sarah starrte noch einen kurzen Moment auf ihr Handy. Es war außergewöhnlich, dass Stein sie ernsthaft um Hilfe bat. Sie eilte in die Redaktion und erzählte Maja mit knappen Worten, was passiert war.
»Das klingt in der Tat sehr dringend. Und er hat nicht gesagt, was los ist?« Ihre Kollegin begann augenblicklich, die aktuellen Polizeimeldungen zu durchforsten. »Offiziell gibt’s nichts Neues.«
»Keine Ahnung, was er von mir will«, gestand Sarah. »Ich melde mich, wenn ich mehr weiß.« Sie schnappte sich ihre Tasche und Jacke, verließ dann eilig den Wiener Boten und lief zur U-Bahn-Station Neubaugasse.
Auf dem Weg zermarterte Sarah sich das Hirn, weshalb Stein sie so dringend sprechen wollte. Und kam zu keinem anderen Ergebnis außer dem, dass im Schulhof etwas geschehen sein musste.
Die Polizei hatte das Absperrband an der Stelle gezogen, wo die Steindl- in die Seitzergasse mündete. Von dieser Ecke aus konnte Sarah noch nichts erkennen. Zudem stand ein Polizeiwagen wie ein zusätzlicher Sichtschutz hinter dem Band auf der mit Kopfstein gepflasterten Straße. Immerhin reduzierte sich damit die Zahl der Schaulustigen auf eine Handvoll. Fröstelnd zog Sarah die Jacke enger um ihren Körper. Gefühlt wurde der Tag von Minute zu Minute dunkler. Auch der Nebel verdichtete sich immer stärker, anstatt sich endlich aufzulösen. Nachdem sie dem jungen Polizisten an der Absperrung ihren Namen genannt und ihm ihren Presseausweis gezeigt hatte, hob er das Plastikband an und ließ sie durchschlüpfen.
Dort, wo die Parisergasse vom Schulhof abzweigte, sah Sarah einen Fiaker stehen. Ein Uniformierter hielt das Halfter eines Pferdes und strich ihm und dem Tier daneben abwechselnd beruhigend über die Nüstern. Der Kutscher saß auf einem Klappstuhl vor der Kirchenmauer und starrte mit leerem Blick auf den Becher in seiner Hand, aus dem es dampfte. Der Schock war ihm ins bleiche Gesicht geschrieben. Neben ihm war eine Polizistin in die Hocke gegangen. Sie sprach mit ihm. Sarahs Herz begann zu rasen. Was zum Teufel war hier passiert? Den Durchgang, der die Kirche am Hof mit dem Palais Collalto verband, versperrte ein Einsatzfahrzeug der Berufsrettung. Zwei Uniformierte sorgten dafür, dass keine Schaulustigen Fotos schossen, die später womöglich im Netz landeten. Bilder von Unfällen und Verletzten zu veröffentlichen empfand Sarah als widerliche Unsitte, die bestraft gehörte.
Sarah steuerte direkt auf Stein zu, der sich mit jemandem von der Spurensicherung im weißen Ganzkörperoverall unterhielt und sein Gegenüber dabei mit der für ihn typischen stoischen Miene fixierte. Dabei fuhr er sich mehrere Male über seine kurz geschorenen Haare.
Sarahs Blick streifte die Person in der Kutsche. Ihr Kopf war nach hinten gekippt, als wären sämtliche Halswirbel gebrochen. Überall war Blut. Wie paralysiert betrachtete sie den Toten, registrierte ein Allerweltsgesicht, dunkle Augen, einen hoch auf der Stirn beginnenden Haaransatz, den hellen Übergangsmantel, einen dunkelblauen Anzug, das hellblaue Hemd, das dazu passende Einstecktuch. Ein Mann, der Wert auf ein stilvolles Äußeres legte. Im Bereich seines Oberkörpers war die Kleidung blutdurchtränkt. Die rote Spur zog sich vom Hals über den Körper, den Sitz und den Kutschenboden bis auf die Gasse, wo sie einen kleinen See bildete. Der Täter musste die Halsschlagader getroffen haben. Zufall, oder war ein Profi am Werk gewesen? Sie überlegte, ob sich überhaupt noch etwas Blut in dem Toten befand. Während sie die Sauerei in Augenschein nahm, hatte Sarah das Gefühl, als stünde die Zeit von einem Moment auf den anderen still. Sie wurde ruhiger, betrachtete die Szenerie vor sich wie ein Gemälde im Museum. Ein Wort lief in Endlosschleife durch ihren Kopf: abgeschlachtet. Und dann kam ihr der groteske Gedanke, dass dieser Ort im fünfzehnten Jahrhundert dem Karmeliterkloster als Friedhof gedient hatte.
»Ich lehne mich jetzt mal ganz weit aus dem Fenster und behaupte, er wurde mit einem Revolver erschossen. Wir finden nämlich keine Patronenhülse in der gesamten verfluchten Gasse«, hörte sie Steins sonore Stimme neben sich.
»Vielleicht hat der Täter sie aufgehoben und mitgenommen.« Sarahs Antwort war ganz automatisch gekommen.
»Dazu hatte er keine Zeit. Auch wenn diese Sauerei hier laut Aussage des Fiakers nahezu lautlos vonstattengegangen ist. Ich tippe auf Schalldämpfer.«
»Kann der denn mit einem Revolver verwendet werden?« Sarah verstand nicht viel von Waffen.
»Natürlich. Jedenfalls werden wir nach der Obduktion schlauer sein, wie immer. Und bis dahin bleib ich bei meiner These. Du musst ihn dir nicht näher ansehen.«
Sarah war nicht aufgefallen, dass sie das Opfer noch immer anstarrte. Endlich gelang es ihr, den Blick abzuwenden.
»Der Kutscher hat so gut wie nichts mitbekommen. Irgendjemand hat vor der Tat den Rössern Silvesterkracher direkt vor die Füße geworfen. Als der Mord passierte, sah er gerade nach den Tieren. Eins wurde leicht verletzt. Ein Glück, dass sie ihm nicht durchgegangen sind.«
Sarah stand still, sah zu, wie der Tote aus der Kutsche gehoben und für den Abtransport in einen Metallsarg gelegt wurde. Ihr Blick wanderte nur kurz zu den Pferden. »Wenn der Fiaker niemanden gesehen hat, muss der Täter die Böller aus großer Distanz geworfen haben«, mutmaßte sie.
Manuela Rossmann, die Polizistin mit den langen blonden Haaren, die Sarah seit dem Mordfall in der Kaisergruft kannte, ging an ihr vorbei und hob die Hand zur Begrüßung.
Sarah winkte zurück. Neben dem Einsatzfahrzeug der Berufsrettung im Durchgang zum Hof tauchten die ersten Journalisten auf. Der Buschfunk hatte offenbar wieder einmal funktioniert. Dabei war klar, dass die Sache nicht lang geheim bleiben würde. Dafür war das Verbrechen zu aufsehenerregend.
»Vermutlich. Leider gibt es außer dem Kutscher keine weiteren Zeugen. Sehr schlau, ausgerechnet hier einen Mord zu begehen. Der Schulhof ist eng, überschaubar und weit weniger belebt als die Plätze und Gassen der Umgebung. Zudem sind hier keine Kameras installiert, die das Geschehen auf der Straße aufzeichnen«, erklärte Stein währenddessen.
»Woher kam der Unbekannte?«
»Wahrscheinlich aus der Parisergasse. Während sich der Kutscher um die Pferde gekümmert hat, hat er sich genähert, abgedrückt und ist dann wieder unbemerkt verschwunden. Vom Kutscher wissen wir übrigens, dass das Gespann auf den Namen Huber vorbestellt war und der Gast keine Erklärungen der Sehenswürdigkeiten wünschte, weil er Wiener war und die Fahrt lediglich zur Entspannung nutzen wollte. Der Fiaker hat also nach Fahrtbeginn nicht oft nach hinten gesehen.«
»Der Tote heißt Huber?«
Stein grinste schief. »Du weißt, dass ich dir den Namen aus Gründen des Datenschutzes nicht nennen darf.«
Sarah runzelte die Stirn. »Und du solltest wissen, dass ich nicht vorhab, ihn samt Porträtfoto auf die Titelseite des Wiener Boten zu bringen.«
»Huber heißt er jedenfalls nicht.«
»Warum hat er den Fiaker dann unter dem Namen gebucht?«
Stein zuckte ahnungslos mit den Achseln. »Was da geworfen wurde, waren übrigens keine gewöhnlichen Schweizer Kracher.«
»Sondern?«
»Der verdammte Mist, der vor Silvester zuhauf illegal über die Grenze eingeführt oder in Hinterhöfen von irgendwelchen Wapplern produziert wird«, polterte der Chefermittler. »Das Zeug, das dir die halbe Hand abreißt, wenn du’s nicht rechtzeitig wegwirfst.«
»Hör mir bloß auf!« Sarah machte eine genervte Handbewegung. »Der Wiener Bote ist jedes Jahr zum Jahreswechsel voll von Meldungen über Leute, die aus Versehen sich und das halbe Haus in die Luft gesprengt haben. So gesehen kann man von Glück sprechen, dass die Tiere nicht schlimmer verletzt wurden. Also: Wer tötet warum jemanden in einem Fiaker?«
»Der Täter hat uns leider keinen Brief mit Erklärung und seiner Adresse hinterlassen«, höhnte Stein.
»Die Frage war eh rhetorisch gemeint.«
»Außerdem hat er die Aktentasche mitgenommen, die der Fahrgast laut Fiaker bei sich trug. Handy haben wir auch keines gefunden, obwohl sich der Kutscher sicher ist, eines gesehen zu haben. Es lag neben dem Mann auf dem Sitz, als er vom Bock stieg. Dafür steckte sein Reisepass in der Innentasche des Sakkos.«
»Wollte er heute noch verreisen? Denn meines Wissens braucht man für eine Fiakerfahrt keinen Pass.«
Stein zuckte mit den Schultern. »Das wird sich hoffentlich herausstellen.«
»Aus dem Grund hast du mich aber nicht herbestellt.« In der engen Gasse hörte sich ihre Stimme gedämpft an. »Warum bin ich hier?«
Stein fuhr sich mit der Hand über seine kurzen Haare. »Du musst etwas für mich herausfinden.« Er winkte einem Kollegen im weißen Ganzkörperoverall, der sich einen Plastikbeutel schnappte und diesen Stein brachte. »Was ist das?«, fragte der Chefermittler und sah Sarah dabei forschend an.
»Ein Blatt Papier mit einem Taukreuz, unter das jemand Zahlen geschrieben hat.«
»Welche Bedeutung hat das?«
»Für das Kreuz gibt es verschiedene Auslegungsmöglichkeiten.«
»Ich weiß«, unterbrach Stein ungeduldig. »Ich habe deinen Artikel gelesen. Was ich meine, ist: Sagt das Kreuz in Kombination mit der Zahlenreihe etwas Bestimmtes aus?«
Sarah blähte die Backen und stieß leise Luft aus. »Puh. Unter Umständen könnte es für Vollendung stehen.«
»Warum?«
»Weil dafür das Taukreuz in der Mythologie des Alten Orients ein Symbol und der Mann tot ist, ergo das hier die Vollendung einer vorangegangenen Auseinandersetzung ist?«
»Bist du dir sicher?«
»Ich habe keine Ahnung, Martin. Ich sinniere einfach vor mich hin, weil ich die Kombination von Kreuz mit Zahlen zum ersten Mal sehe. Bisher begnügte sich jemand damit, lediglich Kreuze an Wände oder auf Straßen zu sprayen. Wo habt ihr das gefunden?«
»Das Blatt steckte in einem Kuvert, das auf dem Kutschenboden lag. Was sagen dir die Zahlen?«
»Meines Erachtens ist das ein Kryptogramm.«
»Kryptogramm«, wiederholte Stein nachdenklich. »So was wie an der Mariensäule?« Er deutete in Richtung Am Hof, wo die bronzene Statue der Muttergottes auf einer Säule wachte.
»Nein, das ist ein Chronogramm, also ein zumeist in lateinischer Sprache verfasster Satz. Die Verschlüsselung erfolgt dabei ausschließlich mit römischen Ziffern, weil diese aus Buchstaben gebildet werden. Etwa steht das C für hundert, das M für tausend und so weiter. Aber auf diesem Blatt stehen die von uns normalerweise verwendeten arabischen Zahlzeichen.«
Stein drehte den Plastikbeutel zu sich und betrachtete stirnrunzelnd die Ziffernfolge.
Sarah beobachtete ihn. Der Chefermittler wirkte empört darüber, dass er sich mit solchem Firlefanz beschäftigen musste. Zahlenspiele schienen nicht in seine Welt zu passen. Der Gedanke zauberte ihr ein zartes Lächeln auf die Lippen, das Stein nicht bemerkte.
»Will uns der Mörder damit etwas mitteilen?«, fragte Stein.
»Du denkst, dass es sich um eine Botschaft an die Polizei handelt?«
»Genau.«
»Warum hast du mir eigentlich nicht einfach ein Foto davon aufs Handy geschickt?«
»Ich wollte, dass du ein Gefühl für den Tatort bekommst. Immerhin stehen wir neben der Kirche am Hof. Vielleicht ist der Tatort selbst ein Hinweis, den nur Hexen verstehen.«
Sarah schmunzelte, zog ihr Handy hervor, bat Stein, das Blatt noch einmal in ihre Richtung zu drehen, und fotografierte es. »Du wirst doch nicht plötzlich an Symbole und Zeichen glauben, Martin?«
Stein hatte sich schon oft über Sarahs Wissen, was Aberglauben, Symbolik und die mystischen Seiten der Walzerstadt betraf, lustig gemacht, das im Wiener Boten regelmäßig in ihren Kolumnen zu den Themen durchschien. In erster Linie spottete er darüber, wenn sie ihn damit im Zusammenhang mit einem Mordfall konfrontierte. Nichtsdestotrotz hatte Sarahs ungewöhnlicher Blick bereits öfter zur Lösung eines Falls geführt. Und offenbar hatte sie ihn bekehrt. Oder das Antoniuskreuz, kombiniert mit einer Zahlenreihe und einem Toten, überzeugte sogar einen eingefleischten Realisten wie Stein, etwas mal von einer anderen Seite zu betrachten.
»Ein Mann mit einem Loch im Hals und so seltsamem Zeug in der Kutsche … Das kann ich nicht ignorieren«, brummte er wie zur Bestätigung.
»Ich stell mir gerade die Frage, weshalb er das siebte Taukreuz auf Papier gesprayt hat. Warum nicht wie bisher an ein Gebäude, eine Sehenswürdigkeit oder auf eine Straße?«
»Das hat er auch getan.« Der Ermittler zeigte auf die gegenüberliegende Straßenseite. »An der Seitenmauer der Kirche am Hof haben wir noch so ein Kreuz entdeckt.«
Sarah drehte den Kopf Richtung Gotteshaus, schärfte ihren Blick. »Wo genau?«
»Du kannst es nicht sehen. Es ist sehr klein und wird im Moment vom Kutscher verdeckt.«
»Ich freue mich auf jeden Fall, dass du in der Sache an mich gedacht hast«, sagte Sarah.
»Deine Freude wird dir gleich vergehen, wenn ich dir sage, dass ich die Lösung am besten gestern gehabt hätte. Ich muss so schnell wie möglich wissen, ob das Geschmiere etwas mit unserem Toten zu tun hat oder nicht.«
»Wir reden hier von einem Kryptogramm, Martin. Das schreibt keiner zufällig auf, natürlich bedeutet das etwas. Aber um das Rätsel zu lösen, muss ich zuerst einmal herausfinden, welche Zahl für welchen Buchstaben steht. Da gibt es viele Möglichkeiten. Meines Wissens gibt es in der Geschichte Geheimtexte, die nie gelöst wurden.«
»Mag schon sein, aber ich bin davon überzeugt, dass der Täter will, dass wir seine Botschaft lesen können. Du hast Zeit bis morgen früh.«