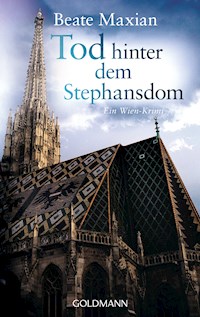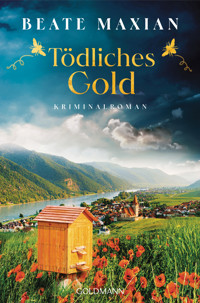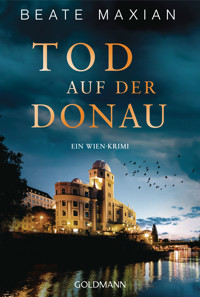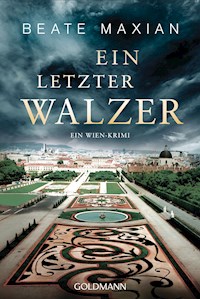10,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Goldmann Verlag
- Kategorie: Krimi
- Serie: Die Sarah-Pauli-Reihe
- Sprache: Deutsch
Ein Toter im Schlossteich des Wiener Belvedere – der dreizehnte Fall für die Journalistin Sarah Pauli.
Sarah Pauli, Journalistin beim Wiener Boten und Expertin für Aberglauben, lässt einen lauen Sommerabend ruhig ausklingen. Schließlich ist Freitag, der 13., und sie will das Pech nicht herausfordern. In diesem Moment erhält sie einen Anruf von Chefinspektor Martin Stein: Im Spiegelungsteich des berühmten Schlosses Belvedere wurde ein Toter entdeckt – in der Brust des Mannes steckt ein rubinbesetzter antiker Dolch. Was hat es mit dem mysteriösen Mord auf sich? Sarah ahnt, dass hier noch weiteres Unglück lauert, und stürzt sich in die Ermittlungen …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 405
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Buch
Sarah Pauli, Journalistin beim Wiener Boten und Expertin für Aberglauben, lässt einen lauen Sommerabend ruhig ausklingen. Schließlich ist Freitag, der Dreizehnte, und sie will das Pech nicht herausfordern. In diesem Moment erhält sie einen Anruf von Chefinspektor Martin Stein: Im Spiegelungsteich des berühmten Schlosses Belvedere wurde ein Toter entdeckt – in der Brust des Mannes steckt ein rubinbesetzter antiker Dolch. Was hat es mit dem mysteriösen Mord auf sich? Sarah ahnt, dass hier noch weiteres Unglück lauert, und stürzt sich in die Ermittlungen …
Weitere Informationen zu Beate Maxian sowie zu lieferbaren Titeln der Autorin finden Sie am Ende des Buches.
Beate Maxian
Tod im Belvedere
Der dreizehnte Fall für Sarah Pauli
Ein Wien-Krimi
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Originalausgabe April 2023
Copyright © 2023 by Beate Maxian
Copyright © dieser Ausgabe 2023
by Wilhelm Goldmann Verlag, München, in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Str. 28, 81673 München
Die Veröffentlichung dieses Werkes erfolgt auf Vermittlung der literarischen Agentur Peter Molden, Köln
Umschlaggestaltung: UNO Werbeagentur, München
Umschlagmotive: FinePic®, München
Redaktion: Susanne Bartel
KS · Herstellung: ik
Satz: Buch-Werkstatt GmbH, Bad Aibling
ISBN: 978-3-641-28449-7V001
www.goldmann-verlag.de
Keinem vernünftigen Menschen wird es einfallen, Tintenflecken mit Tinte, Ölflecken mit Öl wegputzen zu wollen. Nur Blut soll immer wieder mit Blut ausgewaschen werden.
Bertha von Suttner, Die Waffen nieder
Dienstag, 13. Juli
1
Britta Eckenberg fuhr in die Höhe.
Ihr Herz führte einen wilden Tanz auf. Ein Geräusch wie von zersplitterndem Glas hatte sie regelrecht aus dem Schlaf katapultiert. Sie hatte geträumt, starrte nun an die dunkle Wand gegenüber ihrem Bett und versuchte, gleichmäßig zu atmen, während der vermeintliche Traum nachhallte.
Vor dem Zubettgehen war ihr ein Trinkglas aus der Versace-Serie aus der Hand gerutscht. Karl, ihr verstorbener Mann, hatte ihr sechs der edlen Kristallgläser geschenkt. Wenige Wochen vor seinem Tod. Sie hatte ihn mit geschlossenen Augen vorgefunden. Zuerst hatte sie gedacht, er genieße die Musik. Ein Hornkonzert von Mozart. Erst nachdem der letzte Ton verklungen gewesen war, hatte sie Karls Ableben entdeckt, da er sich immer noch nicht bewegt hatte. Er war friedlich im Ohrensessel im Wohnzimmer für alle Ewigkeit eingeschlafen, im Alter von neunundachtzig. Britta war damals vierundsechzig gewesen. Das lag sieben Jahre zurück.
Ihre Gedanken wanderten wieder zu den Versace-Gläsern. Sie waren mit einem goldfarbenen Band eingefasst und mit dem legendären Medusa-Logo verziert. In Wahrheit konnte sie das zerbrochene Glas problemlos ersetzen. Die knapp fünfhundert Euro, die so ein Kristallglas kostete, bereiteten ihr keine schlaflosen Nächte. Britta Eckenberg war dank ihres toten Mannes Millionärin und könnte sich somit unzählige Designergläser leisten. Außerdem konnte es einem mit einundsiebzig Jahren schon mal passieren, dass man etwas fallen ließ. Gleichwohl hatte das Missgeschick sie offenbar bis in den Schlaf verfolgt.
Langsam drehte sie den Kopf zur Seite zu ihrem Wecker. Die grünen Ziffern zeigten 02:30. Sie hatte erst zweieinhalb Stunden geschlafen. Neben dem Wecker stand ein leeres Glas. Vor dem Schlafengehen genehmigte sie sich gerne einen Balvenie. Der schottische Whisky half ihr, leichter ins Land der Träume zu gleiten. Sie beschloss, sich einen weiteren Drink zu gönnen, tastete nach der Nachttischlampe und drückte den Schalter. Licht flammte auf.
Sie schälte sich aus dem Bett, zog ihren altrosa Seidenmorgenmantel über ihr Nachthemd mit französischer Spitze und schlüpfte in die eleganten schneeweißen Pantoletten von Chanel. Noch immer legte sie großen Wert auf ihr Aussehen, selbst wenn niemand sie sah. Nicht nur, was die Kleidung betraf. Ihr Gesicht war annähernd faltenfrei, was sie auf die aufwendige Pflege und Gesichtsyoga zurückführte. Das Dekolleté bedeckte sie in der Öffentlichkeit dennoch schon seit Jahren mit einem Seidentuch oder einer pompösen Halskette. Nur um ihren Mund und ihre Augen hatten sich im Laufe der Zeit feine Striche eingegraben, was sie dem Ärger mit der Familie zuschrieb.
Sie warf einen Blick aus dem offen stehenden Fenster in den parkähnlichen Garten. Meterhohe Hecken schirmten die zweistöckige Luxusimmobilie ab. Dahinter lagen die Weinberge, für die der Ortsteil Grinzing im Wiener Stadtteil Döbling weltbekannt war. Genauso wie für die Heurigen, in denen selbst erzeugter Wein ausgeschenkt wurde und die sogar zum Kulturerbe zählten. Und dennoch hatte sich dieser Teil des neunzehnten Bezirks den Charme eines alten Weindorfes bewahrt. Auch das Eingangstor am Ende des Zufahrtswegs zur Villa wehrte die meisten Einblicke ab. Von der Straße konnte man höchstens einen flüchtigen Blick auf die noble Liegenschaft erhaschen.
Sie wandte sich der Schlafzimmertür zu. Als sie sie aufzog, hörte sie plötzlich Schritte im Erdgeschoss. Das war doch unmöglich! Sie war allein im Haus. Angestrengt horchte sie in die Dunkelheit und vernahm einen gedämpften Laut im unteren Parterre. Da war eindeutig jemand in der Villa. Britta Eckenberg hatte auch noch in ihrem hohen Alter ein ausgesprochen gutes Gehör und eine schnelle Auffassung. Das Geräusch von zerbrechendem Glas war demzufolge kein Traum gewesen. Der Eindringling musste eine Scheibe eingeschlagen haben. Einbrecher! Das Herz schlug ihr bis zum Hals, ihre Hände zitterten.
Ruf die Polizei!, schrillte es in ihrem Kopf. Wo war das Mobiltelefon? Sie nahm es nie mit ins Schlafzimmer, weil sie überzeugt war, dass es ihre Nachtruhe störte. Doch wo lag es jetzt? Verflucht! In der Aufregung konnte sie sich nur schwer konzentrieren. Immer wieder entglitten ihr die Gedanken. Dann erinnerte sie sich, dass sie es auf dem Couchtisch im Wohnzimmer im Erdgeschoss liegen gelassen hatte. Und der Festnetzapparat stand auf dem Schreibtisch im Büro, das sich ebenfalls unten befand. Sie atmete mehrmals lautlos durch, nahm all ihren Mut zusammen, schlich zum Absatz der breiten Holztreppe und sah hinunter. Das Foyer lag im Halbdunkeln. Durch die Verglasung der Haustür schien Mondlicht auf den silbergrau geflammten Quarzitfußboden. Die weiße Tür, die in die Garderobe führte, schien geschlossen zu sein. Sie überlegte, wieder ins Schlafzimmer zurückzugehen und sich einzuschließen. Aber damit würde sie dem Gesindel sozusagen einen Freibrief geben, sie auszurauben. Kurz entschlossen schlüpfte sie aus den Hausschuhen und stieg barfuß nach unten.
Weil sie wusste, dass die Stufe unterhalb des Gemäldes von Oskar Kokoschka, das eine Frau beim Nähen zeigte, knarzte, schritt sie weit aus und setzte den Fuß auf die darunter. Einen Moment lang hielt sie den Atem an, ehe sie vorsichtig ihren Weg fortsetzte. Sie schlich an den Originalen von Gustav Klimt und Egon Schiele vorbei. Zum Glück lagerte der überwiegende Teil der Gemäldesammlung hinter Sicherheitstüren in drei Kellerräumen der Villa, die einem kleinen privaten Museum glichen. Begehbar von Menschen, die den Zugangscode kannten, und das waren nur sie und Ramona, ihre Assistentin. Der Einbrecher würde es nicht hineinschaffen. Es sei denn, er erwischte sie und nötigte sie, ihm den Code zu verraten. Die Kunstsammlung war ewiger Streitpunkt mit der Familie aus Karls erster Ehe. Seine Kinder Daphne und Konstantin behaupteten, dass ihnen ein großer Teil davon zustand. Dabei hatte Karl sie Britta zur Gänze vermacht. Das Testament war niet- und nagelfest. Aber die Nachkommen ihres Mannes gönnten ihr die Sammlung nicht. Die fünfundzwanzig Jahre, die Britta jünger als Karl gewesen war, gaben seiner Nachkommenschaft das Recht, sie Erbschleicherin und Schmarotzerin zu nennen. Attribute wie verschlagen, heimtückisch und maßlos gehörten noch zu den netteren, die die Brut für sie übrighatte. Mittlerweile stießen Karls Enkel Richard und Tilmann in das gleiche Horn. Letzterer war besonders schlecht auf sie zu sprechen, warum auch immer. Sie hatte aufgehört, sich diese Frage zu stellen, weil sie ohnedies nie eine Antwort bekommen würde. Davon abgesehen hatte sie nicht vor, ein Kunstwerk herauszurücken. Mochte die gierige Mischpoke auch noch so oft auf ihr angebliches Recht pochen. Das Testament war bis ins kleinste Detail von einem angesehenen Notar verfasst worden, der in Karls Auftrag sämtliche Schlupflöcher zugemauert hatte. Darüber hinaus war es längst rechtswirksam. Die Kinder und Enkel hatten genug bekommen. Noch zu Lebzeiten hatte Karl die Eckenberg Metall- und Anlagen AG an Daphne und Konstantin übergeben.
Leises Schaben riss sie aus den Gedanken. Ein Geräusch, als zöge jemand Schubladen auf. Es kam aus dem Büro. Britta hatte das Ende der Treppe erreicht und schlich an der Bürotür vorbei. Mit etwas Glück würde sie es unbemerkt ins Wohnzimmer schaffen, wo ihr Mobiltelefon lag. Es waren nur noch ein paar Schritte.
Eins, drei, drei, Polizei, sagte sie in Gedanken einen Kinderreim auf, um gleich die Ziffern ins Telefon zu tippen. So leise wie möglich, drückte sie die Klinke der doppelflügeligen Tür nach unten und schob sie auf. Augenblicklich bemerkte sie die Gestalt mit Sturmhaube, die Karls Dolch in der Hand hielt. Das grelle Licht einer Taschenlampe blendete Britta. Sie schirmte ihre Augen mit der Hand ab, drehte sich instinktiv um und stürzte zur Eingangstür. Der Eindringling aus dem Wohnzimmer war dicht hinter ihr. Er holte sie ein. Dann traf sie etwas Hartes an der Schläfe, und alles wurde schwarz.
Ein Monat späterFreitag, 13. August
2
Der Minoritenplatz wurde von Palais, Ministerien und vom Haus-, Hof- und Staatsarchiv gesäumt. Sein Zentrum dominierte die Minoritenkirche. Sarah Pauli musste stets an ihre verstorbene neapolitanische Großmutter denken, wenn sie, so wie jetzt, an dem Gotteshaus vorbeikam. Denn die Kirche war zugleich die italienische Nationalkirche Maria Schnee, und ihre Nonna hatte hier des Öfteren die heiligen Messen besucht, weil diese nicht nur in Deutsch, sondern auch in ihrer Muttersprache abgehalten wurden. Sarah blieb stehen, legte den Kopf ein wenig in den Nacken und sah nach oben. Sie wusste, dass die Spitze des Kirchturms erstmals 1529 im Zuge der ersten Türkenbelagerung zerstört worden war. 1633 hatte man das Dach wieder aufgebaut, aber die Kirchturmspitze war im Zweiten Türkenkrieg 1683 erneut durch Beschuss beschädigt und durch ein Flachdach ersetzt worden, das noch heute den Abschluss des Turms bildete.
Sarah genoss die Wärme der Sonne in ihrem Gesicht. Generell mochte sie den Sommer in der Stadt, trotz der immer länger werdenden Hitzeperioden. Viele Einheimische waren in Urlaub, was sich auf den Straßen und in den U-Bahnen bemerkbar machte. Außerdem waren die Leute allgemein besser gelaunt, und die Hektik hatte Pause. Denn die Touristen schoben sich im eher gemächlichen Tempo durch die Gassen, um eingehend die unzähligen Sehenswürdigkeiten zu betrachten. Normalerweise entschleunigte das auch Sarah. Doch heute blieb ihr leider keine Zeit, sich treiben zu lassen. Es war fünf Uhr nachmittags, und Herbert Kunz, der Chef vom Dienst, wartete in der Redaktion auf sie. Sie mussten noch die morgige Ausgabe des Wiener Boten durchsehen, bevor diese in den Druck ging, aber die Pressekonferenz des Bundeskriminalamtes im nahe gelegenen Presseclub Concordia hatte länger als geplant gedauert. Und vor dem offiziellen Ende hatte Sarah nicht aufbrechen wollen. Die beiden Beamten der Kriminalprävention hatten wertvolle Tipps gegeben: wo man Wertsachen aufbewahren sollte, wenn man in den Urlaub fuhr, und wie man sich zur Hauptreisezeit vor Einbrüchen schützen konnte.
Obwohl Sarah inzwischen Chefredakteurin war, ging sie bisweilen noch immer selbst auf Konferenzen und recherchierte. Im Chefsessel zu versauern lag nicht in ihrer Natur. Da kam ihr so eine Presseeinladung gerade recht, um mal wieder rauszukommen.
»Sarah? Sarah Pauli?«, stoppte sie plötzlich eine Stimme.
Sarah sah einen Hünen vor sich. Trotz der sommerlichen Hitze trug er einen dunklen Anzug, als käme er von einer Beerdigung.
»I pock’s ned. Du bist es wirklich. Sarah! Das darf ned wahr sein. Wie lange haben wir uns ned g’sehen? Zehn, fünfzehn Jahre?«
Sarah blickte den Mann lächelnd an, versuchte verzweifelt, sich zu erinnern, woher sie das Gesicht kannte. War er ein Kollege von einem Konkurrenzblatt? Ein Werbekunde des Wiener Boten? Jemand, den sie irgendwann mal interviewt hatte? Sie hoffte, dass er ihr die Ahnungslosigkeit nicht ansah und ihr Lächeln nicht aufgesetzt wirkte.
Plötzlich realisierte sie, wer da vor ihr stand, und ihre Augen blitzten freudig auf. »Peer Schneider! Was für eine schöne Überraschung, dich wiederzusehen. Wie geht’s dir?«
»Super. Ich verkaufe Kunstwerke an reiche Leute. Seit acht Jahren führ ich mein eigenes Auktionshaus in der Stallburggasse.« Er zeigte hinter sich.
»Das klingt großartig.« Sarah war beeindruckt. »Stell ich mir spannend vor, immer von Kunst umgeben zu sein.«
Peer nickte. »Ist es auch. Aber sag mal, hast noch Kontakt zu den Leuten von früher?«
Sarah schüttelte den Kopf. »Leider nicht. Irgendwie haben wir uns alle aus den Augen verloren.« Sie und Peer hatten sich zwar nicht ausschließlich innerhalb desselben Freundeskreises bewegt, waren sich jedoch oft auf Studentenfesten oder in Bars begegnet. »Du?«
»Nein, eigentlich auch nicht. Nur zu Amanda.«
Sarah überlegte einen Moment. Dann erschien vor ihrem inneren Auge eine attraktive Frau mit goldbraunen Locken, die manchmal auf eine Art ein wenig unbeholfen wirkte, die bei den Männern den Beschützerinstinkt geweckt hatte. Sie war Teil von ihrem und Peers Freundeskreis gewesen. »Amanda Wenger?«
»Ja. Nur, dass sie jetzt Schneider heißt.«
»Ihr seid verheiratet?«, begriff Sarah. »Das sind ja schöne News. Aber ihr wart damals nicht zusammen, oder erinnere ich mich jetzt grad nur nicht daran?«
»Nein. Unsere Verbindung ist auch erst mal abg’rissen. Zwischenzeitlich waren wir mit anderen Partnern liiert. Obwohl ich gestehen muss, ich bin schon damals auf sie g’standen.« Er zuckte mit den Achseln. »Nach unseren jeweiligen Scheidungen sind wir uns dann zufällig übern Weg g’laufen. So wie du und ich heute. Und jetzt sind wir schon vier Jahre verheiratet.«
»Du und Amanda. Na geh, mach keinen Schmäh!« Sarah starrte ihn mit offenem Mund an.
»Wenn ich’s dir sag.« Peer hob belustigt die Augenbrauen.
»Ich fass es nicht«, sagte Sarah immer noch überrascht. »Mein Gott, was hatten wir damals Spaß.«
In den nächsten Minuten erinnerten sie sich an intensive Gespräche an Sonntagnachmittagen in diversen Kaffeehäusern und an Abende in Bars. Vorrangig in jener im siebten Bezirk, in der sie manchmal die halbe Nacht Würfelpoker gespielt hatten. Und an laue Sommernächte, in denen sie als Gruppe durch die Lokale im Bermudadreieck, einem beliebten Ausgehviertel in der Innenstadt, gezogen waren. Um fünf oder sechs Uhr morgens waren sie dann oft an einem der legendären Wiener Würstelstände gestrandet und hatten sich Fast Food auf Wienerisch gegönnt. Zumeist eine Käsekrainer mit scharfem Senf, einem Scherzel Brot und einer Dose Ottakringer Bier. Wenn er zu viel getrunken hatte, gab Peer seine Bestellung manchmal aus Spaß im breiten Wiener Dialekt auf, erinnerte sich Sarah: »A Eitrige mit an Schoafn, an Buggl und an Sechzehnerblech.« Sechzehnerblech deshalb, weil die Brauerei in Ottakring, dem sechzehnten Wiener Gemeindebezirk, zu Hause war.
»Du schaust übrigens immer noch wie damals aus.« Peer musterte sie, als sähe er sie zum ersten Mal. Sarah hatte ihre halblangen dunkelbraunen Haare zu einem hohen Zopf zusammengebunden und trug einen ärmellosen terrakottafarbenen Jumpsuit, der ihre sonnengebräunte Haut akzentuierte.
»Du aber auch«, gab sie das Kompliment zurück, obwohl sie sich im ersten Moment, nachdem sie realisiert hatte, wer sie da ansprach, erschrocken hatte. »Also, fast«, schränkte sie ein und zeigte auf Peers kahles Haupt. Nichts erinnerte mehr an die braune Lockenpracht, um die ihn viele Frauen beneidet hatten. Zudem hatte er seine sportliche Figur verloren. Sarah vermied es, mit ihrem Blick seinen Bauchansatz zu streifen. Stattdessen konzentrierte sie sich auf sein Gesicht. Peer strahlte immer noch genauso spitzbübisch, wie sie ihn in Erinnerung gehabt hatte.
»Du trägst ein Corno«, merkte er an.
Instinktiv schnellte ihre Hand zu dem roten Anhänger an ihrer Halskette. »Du kennst das? Die meisten fragen mich, ob das eine Chilischote oder ein Pfefferone ist.«
»Natürlich kenne ich ein Corno.« Er klang fast ein wenig beleidigt. »Es schützt vor dem bösen Blick. Du hast wohl vergessen, dass wir früher häufig über Bildsymbole diskutiert haben.«
Sarah dachte nach.
»Vor allem über Symbolik in Gemälden. Das war schon während des Kunststudiums meine Passion«, half ihr Peer weiter auf die Sprünge.
»Stimmt«, erinnerte sich Sarah langsam. »Wir haben öfter über Vanitas-Gemälde gesprochen.« Der Bildtypus war bei Malern ab dem 17. Jahrhundert sehr beliebt gewesen. Darin hatten sie irdische Gegenstände wie Bücher, Wein, Schmuck und Ähnliches mit Sinnbildern der Vergänglichkeit dargestellt. Mit einem Totenkopf, einer Sanduhr oder einer erloschenen Kerze. Es war die Absicht der Künstler gewesen, an die Sterblichkeit und die Unsinnigkeit weltlicher Wünsche zu erinnern. Sie wusste noch, wie Peer stundenlang über den Symbolgehalt der Gemälde von Pieter Claesz oder Hieronymus Bosch referiert hatte.
»Und die faszinieren mich immer noch. Gerade wollte ich in die Minoritenkirche, das Mosaik Das letzte Abendmahl fotografieren.«
»Aber das ist kein Vanitas-Gemälde«, entgegnete Sarah.
»Nein«, kam es gedehnt zurück. »Ist es nicht. Aber du weißt sicher, dass Leonardo da Vinci angeblich einen geheimen Code in dem Bild verarbeitet hat und dass es Giacomo Raffaelli als Vorlage für sein Mosaik diente.«
Sarah nickte. Tatsächlich wusste sie noch viel mehr, nämlich dass das Mosaikbild einst Napoleon in Auftrag gegeben hatte, es aber erst nach dessen Sturz fertiggestellt worden war. Weshalb seinerzeit Napoleons Schwiegervater Kaiser Franz das Kunstwerk fürs Belvedere erworben hatte. Als es sich dafür als zu groß entpuppte, war es kurzerhand in die Minoritenkirche gewandert.
»Ich hab den Wiener Boten abonniert«, wechselte Peer das Thema. »Du bist Chefredakteurin. Gratuliere.«
»Danke.«
»Ich lese regelmäßig deine Kolumnen.«
»Freut mich.«
»Erst heute Morgen deinen Artikel über Freitag, den Dreizehnten.«
Sarah hatte ihre aktuelle Kolumne zum Thema Aberglauben dem vermeintlichen Unglückstag gewidmet. Der genaue Ursprung des Mythos war unbekannt. Der Überlieferung nach war Jesus Christus an einem Freitag, den Dreizehnten, gekreuzigt worden. Eine andere Theorie besagte, dass am dreizehnten Oktober 1307 der französische König Philipp IV. den einflussreichen Tempelorden zerschlagen hatte und die Mitglieder unter Mitwirkung von Papst Clemens V. grausam ermorden ließ.
»Freitag, der Dreizehnte, ist ein guter Tag, um sich um einen Verräter zu kümmern. Meinst nicht auch?« Er zeigte lachend auf die Kirche.
Sarah glaubte die Bemerkung zu verstehen. Peer sprach von Judas, dem Verräter, der naturgemäß auf dem Mosaik mit den Aposteln abgebildet war.
»Das kann kein Zufall sein, dass wir uns nach so vielen Jahren ausgerechnet heute, am Freitag, den Dreizehnten, treffen, gell? Ich denke, unsere Begegnung bringt mir Glück«, fuhr er gut gelaunt fort.
In ihrem Artikel hatte Sarah angemerkt, dass die Dreizehn in manchen Kulturen wie der japanischen eine Glückszahl war. In der jüdischen Überlieferung war sie sogar ein Symbol Gottes, weil sie über der Zwölf stand. Ebenso schrieb man in der frühen Menschheitsgeschichte Freya, der altnordischen Göttin der Liebe, des Segens, der Lust und Fruchtbarkeit und des Kriegs, die Glückszahl Dreizehn und den Freitag zu.
»Verlass dich lieber nicht darauf, dass ich dir zur Glücksbringerin tauge«, entgegnete Sarah grinsend.
»Schaun ma mal«, erwiderte Peer augenzwinkernd. »Apropos Glück und Unglück. Sagt dir der Begriff Triskaidekaphobie etwas?«
»Natürlich. Das ist die Angst vor der Dreizehn.«
»Meine Sekretärin leidet daran. Nicht mal der Absatz in deinem Artikel darüber, dass es statistisch g’sehen nicht vermehrt zu Unglücksfällen am Dreizehnten kommt und die Dreizehn auch eine Glückszahl ist, konnte sie davon heilen.« Er lachte lauthals.
Sarah lächelte. Die Haare mochten Peer ausgegangen sein, aber seinen fröhlichen Charme hatte er sich bewahrt.
Er warf einen Blick auf seine Armbanduhr. »Ich wäre jetzt wirklich gerne mit dir auf einen Kaffee g’gangen. Aber leider …« Er hob bedauernd die Schultern. »Ich mach nur schnell das Foto und muss dann gleich weiter zu einem Termin.«
»Ja, wirklich schade. Da läuft man sich nach so vielen Jahren endlich mal wieder über den Weg … Aber kein Problem. Ich bin sowieso am Weg in die Redaktion, und der Chef vom Dienst wartet schon auf mich.«
Peer griff in die Innentasche seines Sakkos, zog eine Visitenkarte hervor und reichte sie Sarah. »Wennst ein andermal Zeit und Lust auf a Plauderei über alte Zeiten hast oder in den Kunstwerken in meinem Laden nach Symbolen und mystischen Zeichen suchen willst, schau vorbei. Amanda würde sich sicher auch freuen, dich wiederzusehen. Und dann gemma gemeinsam ins Café Bräunerhof auf ein Kaffeetscherl.«
»Abgemacht. Ich komm gern bei euch vorbei.« Sarah nahm die Karte, ließ sie in ihre Umhängetasche fallen, fingerte aus deren Tiefen ihre hervor und überreichte sie ihm.
Er ließ sie in der Innentasche des Sakkos verschwinden.
»Wirklich schön, dich getroffen zu haben, und grüß mir Amanda lieb.«
Er schenkte ihr ein joviales Lächeln. »Mich hat es auch g’freut, dich wiederzusehen. Sehr sogar. Baba, Sarah.« Er küsste sie nach österreichischer Art auf beide Wangen.
»Baba«, verabschiedete auch sie sich.
Dann sah sie ihm hinterher, wie er Richtung Kircheneingang eilte, und überlegte, ob es vielleicht doch etwas zu bedeuten hatte, dass sie sich ausgerechnet heute über den Weg gelaufen waren. Nach so vielen Jahren.
Nein, maßregelte sie sich. Wahrscheinlich lag es nur an der Minoritenkirche, dass sie normale Zufälle wie ihre abergläubische Großmutter interpretierte. Sie hörte ein Telefon läuten und sah, wie Peer vor dem Kircheneingang stoppte. Er holte sein Handy hervor, blickte den Bruchteil einer Sekunde auf das Display, steckte es wieder ein und verschwand in der Kirche.
3
»Mailbox.« Amanda verzog entschuldigend das Gesicht, tippte auf den roten Kreis am Bildschirm des Smartphones und legte es auf den weißen Empfangstresen, vor dem sie stand. Ausgerechnet jetzt, wo ihr unangenehmster Kunde unangemeldet hereingeschneit war, hob Peer nicht ab. »Vor einer Viertelstunde war er noch da«, sagte sie. »Vielleicht holen Sie ihn ja noch ein, wenn Sie sich beeilen. Er wollte zur Minoritenkirche.« Ihr Blick wanderte Richtung Eingangstür, wo soeben ein Fiaker mit Touristen vorbeifuhr.
Mit etwas Glück verstand Tilmann Eckenberg den Wink mit dem Zaunpfahl und verabschiedete sich gleich wieder. Der Unternehmer war Amanda unsympathisch, mochte er noch so millionenschwer sein und, zugegeben, verdammt gut aussehen. Peer behauptete, dass dem begehrten Junggesellen die Frauen reihenweise zu Füßen lagen. Aber in ihren Augen war er nur ein reicher, großer, dunkelblonder und teuer gekleideter Schnösel, der überzeugt war, sich alles erlauben zu dürfen. Er war überheblich, selbstgefällig und protzte mit seinem Reichtum. Das mochte manche Frauen beeindrucken, doch Amanda gehörte nicht zu ihnen. Den Ferrari, den er fuhr, fand sie nur großkotzig.
»Kein Problem.« Eckenberg schien es nicht eilig zu haben, mit Peer zu sprechen. Er rührte sich nicht vom Fleck und musterte sie für ihren Geschmack zu intensiv. Sein Blick streifte schamlos über ihre Hüften und ihre gebräunten Arme und Beine, die das ärmellose, knielange Kleid nicht verdeckte. Hätte sie heute Morgen trotz der Wärme doch nur eine lange Hose und eine langärmelige Bluse angezogen. Mit einer verunsicherten Geste strich sie über ihre streng zusammengebundenen goldbraunen Locken. Sollte sie ihm einen Espresso anbieten, wie es Peer immer tat? Andererseits wollte sie Eckenbergs Anwesenheit nicht unnötig in die Länge ziehen.
»Hatten Sie einen Termin?«, hakte Amanda schließlich nach, weil ihr kein anderer Grund für sein Kommen einfiel. In letzter Zeit erschien ihr Peer extrem zerstreut. Er arbeitete zu viel, kam kaum einen Abend vor halb elf nach Hause. Ein Treffen zu vergessen würde zu seinem derzeitigen Zustand passen.
»Nein, er weiß nicht, dass ich vorbeischauen wollte. Aber wir haben letzte Woche telefoniert. Er meinte, dass heute neue Ware käme. Und da ich grad in der Nähe war …« Eckenberg drehte sich etwas, und im nächsten Augenblick wirkte er, als wäre er in die Betrachtung des Bildes in dem dunklen Barockbilderrahmen vertieft, das die Wand hinter dem Tresen beherrschte.
Das Gemälde eines unbekannten Künstlers aus dem 17. Jahrhundert zeigte einen umgefallenen Zinnkrug, Pfirsiche, ein halb volles Glas Rotwein, gebrochenes Brot und eine Sanduhr. Wie in der Epoche üblich, hatte der Maler dunkle Farben mit einem Hauch Gold verwendet. Die Symbolfarbe für Macht, wie Peer Amanda erklärt hatte. Eckenberg hatte ihrem Mann schon ein paarmal eine unverschämt hohe Summe dafür geboten. Eine, die den tatsächlichen Wert des Bildes bei Weitem überstieg.
»Warum macht er das?«, hatte sie Peer gefragt.
»Das ist sein Spiel. Er versucht zu bekommen, was anderen gehört. Alles und jeder hat seinen Preis, das ist Eckenbergs Devise, und danach lebt er«, hatte Peer leichthin gesagt.
»Na, hoffentlich gebärdet er sich nicht wie ein Dreijähriger, wenn er endlich kapiert, dass er es nie bekommen wird«, hatte sie erwidert. Denn egal, was der Unternehmer ihrem Mann bot, das Bild war das erste Kunstwerk, das dieser selbst erstanden hatte. Somit sein Glücksbringer und unverkäuflich.
»Er wird es niemals hergeben. Sein Herz hängt daran«, sagte Amanda jetzt und flüchtete hinter den Tresen.
»Das macht nichts«, erwiderte Eckenberg gönnerhaft, löste seinen Blick vom Bild und fixierte sie mit seinen unnatürlich blauen Augen erneut um eine Spur zu penetrant. Nicht zum ersten Mal fragte sie sich, ob er farbige Kontaktlinsen trug. Sein Blick glitt zu dem Schreibtisch, der noch vor dem Türbogen stand, durch den man in den rückwärtigen Bürobereich gelangte.
Axel Kowalski und Gerlinde Göhr, zwei ihrer Angestellten, saßen an dem Schreibtisch. Seit zwanzig Minuten bestückten sie die Homepage des Auktionshauses mit Neuzugängen, die morgens von einem auf Kunstwerke spezialisierten Transportunternehmen geliefert worden waren. Ein paar von den Objekten waren vorbestellt und somit bereits verkauft. Die restlichen waren Teil der bevorstehenden Versteigerung und mussten demzufolge auf die Homepage geladen werden. Darunter befand sich eine wirkliche Rarität, die ihnen viel Geld einbringen würde. Gerlinde streckte sich, bevor sie sich schnell durch ihre hüftlangen dunklen Haare fuhr. Eine Geste, die Eckenberg zu gefallen schien. Er lächelte anerkennend.
Unauffällig schaute Amanda auf die Uhr. Es war halb sechs. In dreißig Minuten schlossen sie den Laden, und Eckenberg machte noch immer keine Anstalten zu gehen. Sie warf Axel einen flehenden Blick zu. Der Achtunddreißigjährige mit, wie Amanda fand, ausgesprochen vornehmen Gesichtszügen war Peers rechte Hand. Er hatte Kunstgeschichte studiert und verstand ebenso viel von ihrem Geschäft wie ihr Mann. Axel begriff sofort, stemmte sich aus dem Stuhl und gesellte sich zu ihnen.
»Bei einem Bild, das wir heute erhalten haben, bin ich mir sicher, dass es zu Ihnen passt. Wenn Sie wollen, zeig ich es Ihnen«, sagte er zu Eckenberg.
Amanda lächelte gefällig. Sie wussten beide, dass er Axels Angebot ablehnen würde. Denn beraten ließ sich der Unternehmer ausschließlich vom Chef des Hauses. Aber der Vorschlag verschaffte Amanda eine Pause.
»Der König der technischen Welt verlangt nach dem König des Kunsthandels«, machte sich Peer regelmäßig darüber lustig. Doch der wahre Grund war, dass er und Eckenberg bei ihren Gesprächen über jene Leidenschaft fachsimpeln konnten, die sie verband. Die Symbolik in Gemälden. Das wusste auch Amanda. Peer brannte dafür, arbeitete seit einem Jahr sogar an einem Podcast, in dem er das Thema fesselnd erläutern wollte. Er plante, damit vorwiegend junge Menschen anzusprechen. »Wir müssen dafür sorgen, dass sich auch die nächste Generation für die Kunstwelt interessiert. Und das gelingt am ehesten über die Mystik und mit spannenden Hintergrundinfos«, war er überzeugt und führte als Beispiel gerne Harry Potter an. In Amandas Augen hinkte der Vergleich, aber sie ließ Peer seine Überzeugung.
Symbole! Damit konnte Amanda ebenso wenig anfangen wie generell mit Kunst. Sie war Buchhalterin, eine Frau der Ziffern, keine Kunstliebhaberin. Ob sie Erbsen oder einen Brueghel verkauften, war ihr egal. Hauptsache, die Erlöse verschafften ihr ein angenehmes Leben.
Wieder sah Eckenberg zum Türbogen und gleich darauf zu der freitragenden Holztreppe, die zum Auktionssaal hinaufführte. Ob er vermutete, dass Peer sich vor ihm versteckte und verleugnen ließ? Was lächerlich wäre. Denn Peer mochte Tilmann Eckenberg. Er fand ihn amüsant und schätzte ihn als interessanten Gesprächspartner.
»Warten Sie, ich werfe einen Blick in den Kalender. Dann kann ich Ihnen sagen, wann er sicher hier sein wird. Carola, unsere Sekretärin und die Hüterin all unserer Termine, hat heute frei. Wie immer an einem Freitag, den Dreizehnten. Sie fürchtet den Tag wie der Teufel das Weihwasser«, sagte sie lachend.
Warum tat sie das?, fragte sie sich im nächsten Moment. Ihr konnte doch egal sein, was Eckenberg über sie dachte. Aber irgendetwas an dem Mann brachte sie dazu, sich ihm wortreich zu erklären. Froh, ihm kurz zu entkommen, ging sie zum rückwärtigen Großraumbüro. Sie setzte sich vor Carolas Computer und rief den Online-Planer auf. Für heute war nur der Abendtermin eingetragen. Sie hörte, wie Axel erneut versuchte, mit Eckenberg Small Talk zu machen. Die Antworten des Unternehmers fielen vorhersehbar knapp aus.
Ihr Blick streifte das Deck Tarotkarten. Wie immer lag es griffbereit auf Carolas Tisch. Manchmal streckte die Sekretärin demjenigen, der gerade vorbeikam, den Stoß entgegen und forderte ihn auf, eine Karte zu ziehen. Sie alle machten mit, aus Spaß an der Sache. Carola hingegen nahm das Spiel ernst. Erst gestern vor Ladenschluss hatte Peer eine Karte gezogen. Den Tod. Die Sekretärin war erschrocken, hatte ihn zur Vorsicht ermahnt. Doch Peer hatte nur gelacht und gemeint, die Karte würde perfekt zum morgigen Freitag, den Dreizehnten, passen. Und jetzt war er nicht erreichbar. Eigentlich würde sie sich deshalb keine Gedanken machen, aber heute …
Im nächsten Moment schalt sie sich dafür, dass sie sich schon vom Anblick der Karten in Carolas verrückte Gedankenwelt ziehen ließ. Entschlossen stand sie auf und ging wieder nach vorne. Ohne dass sie es mitbekommen hatte, war Tilmann Eckenberg verschwunden.
»Er meinte, er würde Peer später sowieso noch treffen«, erklärte Axel.
»Aha«, sagte Amanda verwundert. Woher wusste der Kerl, was Peer an diesem Abend vorhatte?
4
Peer Schneider war ein Mann mit festen Regeln. An diese galt es, sich zu halten und sie bei Verstößen zu verteidigen. So wie jetzt. Ungehorsam bedrohte sein erfolgreiches Geschäftsmodell. Der Fehler, der begangen worden war, musste so schnell wie möglich korrigiert werden. Zum Glück hatte er noch keinen Schaden davongetragen. Aber es musste etwas geschehen, bevor ihm doch noch alles um die Ohren flog. Er hatte nicht so lange an dem Konzept gearbeitet, um es sich jetzt durch einen blöden Fauxpas – nicht mal von ihm selbst! – kaputtmachen zu lassen. Der Gedanke vermieste ihm den Genuss an den Kunstwerken, die sich im Schlossgarten Belvedere vor ihm aufreihten. Verflucht noch mal!
Die anderen zur Ausstellung gehörenden Werke hingen im Belvedere 21, dem Museum für zeitgenössische Kunst. Es lag in fußläufiger Entfernung. Die dort stattfindende Vernissage war noch nicht zu Ende gewesen, als er das Gebäude vor wenigen Minuten verlassen hatte.
Erstaunt stellte er fest, dass er allein in der barocken Parkanlage war. Das hatte er auch noch nie erlebt. Vermutlich hatte die Hitze, die wie eine dicke Decke über der Stadt lag, die Menschen längst in die schattigen Gastgärten und ans Ufer der Donau getrieben. Er sah auf seine Uhr. Oder es lag daran, dass die Tore des Parks in zehn Minuten geschlossen wurden. Rasch begann er, die Skulpturen abzuschreiten, die rund um den eindrucksvollen Spiegelungsteich beim Oberen Belvedere standen. Knallrote Bronzefiguren: Waffen, Pistolen, Panzerfäuste, Speere, Gewehre, Kanonen. Sie symbolisierten das Blut, das die Menschheit seit Jahrtausenden auf der gesamten Welt sinnlos vergoss. Lilo, eine argentinische Künstlerin, hatte sich mit dem Thema Krieg und Gewalt auseinandergesetzt. Ihr Tod vor drei Jahren hatte ihm in die Hände gespielt. Seitdem stieg der Wert ihrer Werke kontinuierlich. Schon demnächst würde er eines ihrer Gemälde zu einem horrenden Preis an einen Sammler verkaufen. Die roten Tötungsmaschinen standen im krassen Gegensatz zu den Ausstellungstücken im Oberen Belvedere. Etwa zu der weltgrößten Sammlung von Gustav-Klimt-Werken inklusive des berühmten Gemäldes Der Kuss.
Er atmete tief durch. Sodbrennen quälte ihn. Der Sekt, der zur Eröffnung gereicht worden war, hatte zu viel Säure gehabt und bekam ihm nicht. Und sein Ärger verstärkte das Brennen nur noch. Aber sein Problem ließ ihm keine Ruhe, es gelang ihm schlichtweg nicht, sich auf die Kunstwerke zu konzentrieren. Er wusste, dass nur hartes Durchgreifen die Sache regeln würde. Genauso, wie er wusste, dass Münzen in einem Gemälde häufig Geiz, Bestechung oder Korruption versinnbildlichten.
»Dreizehn funkelnde Gründe«, murmelte er. Schwachsinn. Es war ein Fehler gewesen. Basta. Nein, das konnte er ihm nicht durchgehen lassen.
Ein Lächeln huschte über sein Gesicht. Dreizehn, in Carolas Augen eine Unglückszahl. Und sie würde auch zu seiner Unglückszahl werden, wenn er nicht aufpasste. Aber dass er so dachte, würde er gegenüber seiner Sekretärin niemals zugeben.
Trotzdem würde es schwierig werden, die Sache zu regeln. Er sah wieder auf die Uhr. Zeit zu gehen. Er warf einen letzten Blick auf das knallrote Messer neben dem Teich.
Großartig, dachte er, als er sein Problem endlich für einen Augenblick verdrängen konnte. Lilo war es sogar gelungen, die Schärfe der Klinge sichtbar zu machen.
Dann lenkte ihn ein Geräusch ab. Schritte auf Asphalt. Sie kamen näher.
Er blickte sich um, sah aber niemanden. Plötzlich beunruhigte ihn die Menschenleere des Parks. Er wandte sich zum Gehen. In dem Moment hörte er seinen Namen.
5
»Danke für den schönen Abend.« Gabi drückte Sarah zwei Abschiedsküsse auf die Wangen.
Sarah kicherte. Die blonden Locken ihrer Freundin kitzelten sie an der Nase.
»Und eine super Idee von dir, Essen zu bestellen, David.« Chris’ dunkle Augen blitzten zufrieden. »So hat keiner von uns kochen müssen.«
»Wann hast du denn zum letzten Mal für uns gekocht, Bruderherz?«, fragte Sarah mit einem Augenzwinkern. »Ist sicher schon ein Jahr her.« Die vier aßen oft zusammen. Miteinander Zeit zu verbringen war ihnen wichtig. Aber meistens kochte David oder Sarah.
Ihr jüngerer Bruder küsste sie anstelle einer Antwort auf die Stirn. Er und seine Freundin Gabi wohnten in dem Apartment im ersten Stock über ihnen. David hatte die Villa mit der Backsteinfassade im Cottageviertel im achtzehnten Bezirk vor zwei Jahren gekauft. Davor hatten Sarah und Chris zusammen in einer Wohnung am Yppenplatz im sechzehnten gewohnt. Nach dem Unfalltod ihrer Eltern war ihr Bruder zu Sarah gezogen, da er damals noch zur Schule ging. Seitdem verband sie beide ein unsichtbares Band, das dicker als ein Stahlseil war. Zu seiner Studienzeit hatte Chris mit seinem Charme und dem südländischen Aussehen die Frauenwelt bezirzt und Eroberung um Eroberung mit nach Hause gebracht. Sarah war es schwergefallen, sich die Namen der Mädels zu merken, die bei ihm übernachtet hatten. Doch Sarahs Freundin Gabi, die zugleich Davids Sekretärin war, hatte Chris bezaubert. Der Casanova war in den letzten Jahren solide und erwachsen geworden.
»Sorry, dass wir euch schon verlassen müssen«, entschuldigte Chris sich. »Normalerweise …« Er machte eine bedauernde Geste. »Aber die Arbeit …«
Sarahs Bruder war Anästhesist im AKH, dem größten Krankenhaus Wiens, und hatte Wochenenddienst.
»Schon okay. Aber, Gabi, wenn dir ohne Chris fad ist, dann komm runter«, schlug David vor. Er hatte die Ärmel des hellblauen Hemdes, das er zu den Jeans trug, hochgekrempelt. Eine dunkle Strähne, durchzogen von feinen Silberfäden, fiel ihm über die Augen und ließ ihn überaus verführerisch aussehen, wenn es nach Sarah ging. »Ich werfe Sonntagnachmittag den Griller im Garten an«, fügte er hinzu.
»Yeah, Grillparty!«, rief Sarah.
Gabi lächelte. »Klingt super.«
Chris machte ein trauriges Gesicht. »Könntet ihr mir dann bitte etwas ins Spital liefern?«
»Oh, jetzt mach halt nicht deine Bambiaugen«, sagte Gabi und strich ihm wie eine Mutter einem kleinen Kind tröstend über die Wange. »Wir sitzen sicher noch im Garten, wenn du Dienstschluss hast.«
»Und wir heben dir eine Portion auf. Dann hast du etwas, worauf du dich den ganzen Tag lang freuen kannst«, versprach Sarah.
Chris zupfte an ihrem Pferdeschwanz. »Ich verlass mich drauf, Schwesterherz.« Die beiden verabschiedeten sich mit Luftküssen und liefen die Stufen nach oben.
David schloss die Wohnungstür und folgte Sarah auf die Terrasse. Gemeinsam räumten sie die Teller und Chris’ und Gabis Gläser vom Tisch in die Landküche, in die man vom Esszimmer aus durch einen breiten offenen Durchgang gelangte. Ihre schwarze Halbangora rollte sich derweil genüsslich auf einem Stuhl zusammen.
»Ist dir eigentlich aufgefallen, dass Marie noch nie im Haushalt geholfen hat?«, witzelte David und stellte das Geschirr in den Spüler.
»Definitiv ein Erziehungsfehler«, lachte Sarah.
David startete die Geschirrspülmaschine. »Lass uns noch ein bisschen draußen sitzen und ein Glas Wein trinken. Die angebrochene Flasche Cabernet Sauvignon vom Leberl steht noch am Tisch. Sie jetzt nicht auszutrinken wär ein Frevel. Außerdem haben wir morgen frei und können ausschlafen.« Er trat wieder durch die offene Terrassentür nach draußen.
Sarah schaltete den Player im Wohnzimmer ein und folgte ihm. Kubanische Klänge schwebten leise bis auf die Terrasse. Sie streifte ihre Flipflops ab. Der Terrakottaboden unter ihren Füßen war warm und erinnerte an Urlaub. Ebenso der Rosmarin, Salbei, Thymian, Lavendel, die Minze und das Basilikum in den Tontöpfen auf der Terrasse. Im jetzt dunklen Teil des Gartens wuchsen Rosen und unzählige weitere Kräuter. Gabi und sie pflegten und nutzten ihr kleines mediterranes Paradies voller Hingabe.
David schenkte den restlichen Wein in ihre Gläser, sie wechselten auf die Liegestühle und lehnten sich entspannt und zufrieden zurück. Ein gemeinsames freies Wochenende stand bevor. Sie planten, es sich gut gehen zu lassen und die Tür zum Homeoffice geschlossen zu halten. Sarah nippte am Wein, betrachtete den Sternenhimmel und genoss die dezente Musik.
Das Klingeln ihres Handys zerstörte die Idylle.
David runzelte die Stirn. »Wer ruft denn jetzt noch an? Es ist gleich halb elf. Haben Gabi und Chris etwas vergessen?«
»Die würden vor unserer Tür stehen, wenn’s so wäre.« Sarah erhob sich. Ihr Smartphone lag auf dem Esstisch. »Es ist Stein!«, rief sie kurz darauf nach draußen.
»Das ist kein gutes Zeichen«, gab David zurück.
Alarmiert hob Sarah ab. »Hallo, Martin.«
»Ich hoffe, ich hab dich nicht geweckt?«
»Nein. David und ich sitzen auf der Terrasse und trinken noch ein Glaserl. Chris und Gabi waren hier, sind grad gegangen.«
»Bist im Öl?«
»Nein, ich bin nicht betrunken. Warum die Frage?«
»Dann lass ich dich jetzt gleich abholen.«
»Ich hab aber doch nichts verbrochen«, tat sie empört.
»Manuela Rossmann ist in fünfzehn Minuten bei dir und bringt dich zum Belvedere«, ignorierte Stein ihre spöttische Bemerkung. »Schöne Grüße an David. Und tut mir leid, dass ich euren gemütlichen Abend ruiniere.«
Er legte auf, ehe Sarah noch etwas erwidern konnte. Sie starrte das Handy in ihrer Hand verdattert an, dann ging sie wieder auf die Terrasse.
»Was wollte er?«
»Er lässt mich abholen. Zum Belvedere. Hab keinen Schimmer, weshalb.« Sarah zuckte die Schultern.
»Vielleicht gibt es da wieder mal ein kryptisches Zeichen, das er nicht versteht«, schlussfolgerte David.
»Vielleicht«, wiederholte sie mechanisch. Es war schon vorgekommen, dass Stein sie diesbezüglich um Rat gefragt hatte. Am Beginn ihrer Bekanntschaft, die mittlerweile zu einer Freundschaft geworden war, hatte er Sarahs Meinungen zu so manchem Mordfall belächelt. Ihre Thesen, die sie stets mit Symbolik begründete, hatten für ihn keinen Sinn ergeben. Er war ein Pragmatiker, orientierte sich ausschließlich an Fakten und Tatsachen. Doch inzwischen bat er Sarah manchmal sogar aktiv um ihre Meinung, etwa wenn ihm der Ort eines Verbrechens rätselhaft erschien oder er und seine Kollegen im Zusammenhang mit einem Fall unbestimmte Zeichen entdeckten. Sie war Expertin für Symbolik und Aberglauben. Und das Belvedere war voller Sinnbilder, griechischer Mythologie und mittelalterlicher Zahlenmystik. Sarah liebte es, diese bei Spaziergängen durch die Anlage jedes Mal aufs Neue zu analysieren.
»Aber wo Stein ist, gibt es leider meist auch Tote«, sagte sie, nichts Gutes ahnend, und verschwand im Haus.
Im Schlafzimmer zog sie die gemütliche Sommerhose mit Blumenmuster und die Tunika aus, die sie nach dem Büro gewählt hatte, und schlüpfte in Jeans und T-Shirt.
Fünf Minuten später öffnete sie die Gartentür zur Hasenauerstraße. Der Streifenwagen wartete schon. Das zuckende Blaulicht auf dem Autodach mahnte sie, sich zu beeilen. Sarah beugte sich nach unten, sah durchs Beifahrerfenster Manuela Rossmann im Auto sitzen und stieg ein.
»Tut mir leid, dass wir Sie zu so einer unchristlichen Zeit noch stören.« Die Polizistin hatte ihre langen blonden Haare im Nacken zu einem straffen Knoten gedreht.
»Muss ja ziemlich dringend sein, wenn Martin mich extra abholen lässt. Was ist denn passiert?« Sarah machte sich darauf gefasst, eine blutige Geschichte zu hören.
»Ich weiß auch nichts Genaues. Stein hat mich nur angefunkt, ich soll Sie abholen und so schnell wie möglich ins Belvedere bringen.« Damit legte Manuela Rossmann den Gang ein und fuhr los.
Der VW Touran bahnte sich in hohem Tempo den Weg durch die nächtlichen Straßen. Sarah blickte aus dem Fenster. Die Fassaden der Häuser glitten vorbei. Vereinzelt brannte hinter geöffneten Fenstern Licht. Je näher sie der Innenstadt kamen, umso mehr Menschen waren unterwegs. Jugendliche scharten sich auf Gehwegen, Plätzen oder rund um Straßenbahnhaltestellen, waren auf dem Weg irgendwohin. Viele Tische vor den hell erleuchteten Lokalen, an denen sie vorbeifuhren, waren noch besetzt. Die Menschen der Stadt waren auf dem Weg ins Sommerwochenende.
Als die Ampel am Schwarzenbergplatz auf Rot sprang, drosselte Manuela Rossmann die Geschwindigkeit nur gering, schaltete das Martinshorn in den Blaulichtmodus und fuhr weiter. Das flackernde Licht samt Alarmton ließ die anderen Autos auf der Stelle anhalten.
»Ich hab nur mitbekommen, dass es ein Mordopfer gibt«, verriet sie kurz vor dem Ziel dann doch noch.
»Hatte ich schon befürchtet«, stöhnte Sarah. Es war zu erwarten gewesen, dass sie gleich eine Leiche zu sehen bekam. »Ausgerechnet im Belvedere. Der Tourismusverband wird sich freuen«, versuchte sie einen Witz.
Die barocke Schlossanlage war ein Touristenmagnet. Der bedeutende Feldherr des Habsburger Reiches Prinz Eugen von Savoyen hatte den imposanten Bau im 18. Jahrhundert errichten lassen, erinnerte sie sich. Sein Verdienst waren die Siege über das osmanische Heer. Als junger Soldat bewährte er sich 1683 in der Schlacht am Kahlenberg in Wien unter der Führung des polnischen Königs Sobieski, später festigte er sein Ansehen mit dem Sieg in dem Gefecht bei Zenta, wo es ihm gelang, die Hauptmacht des osmanischen Heeres zu vernichten. In der Folge nahm er Sarajevo ein, was 1699 den Frieden von Karlowitz zur Folge hatte, mit dem Österreich seinen Status als Großmacht untermauerte. Prinz Eugen von Savoyen wurde Präsident des Hofkriegsrates in Wien und Generalleutnant, damals der höchste militärische Titel des Landes. Nach seinem Tod erwarb Kaiserin Maria Theresia die gesamte Anlage von Prinzessin Victoria, der Erbin und Nichte von Prinz Eugen. Unter der Kaiserin und deren Sohn Joseph II. war das Obere Belvedere zum Ausstellungsort der kaiserlichen Sammlung und somit zu einem der ersten öffentlichen Museen weltweit geworden.
»Ich soll Sie hier vor dem Eingang am Rennweg absetzen«, riss Manuela Rossmann Sarah aus ihren Gedanken und hielt den Wagen an. »Jemand wird Sie am Tor abholen. Ich muss gleich weiter.« Die Polizistin schaltete Blaulicht und Folgetonhorn aus.
Nachdem sie ausgestiegen und Manuela Rossmann wieder losgefahren war, wandte Sarah sich dem schmiedeeisernen Eingangsportal zu. Dahinter wartete schon Martin Stein. Trotz der tropischen Sommernacht trug er eine dunkle Lederjacke über dem T-Shirt. Er öffnete das Tor und schloss es wieder, nachdem sie eingetreten war.
»Ich würde ja sagen, ich freu mich, dich zu sehen«, begrüßte Sarah ihn. »Aber ich befürchte, wir beide gehen jetzt nicht auf ein Glaserl, oder?«
»Hast leider recht.« Sein Blick war grimmig, und seine Haltung erinnerte an die eines gereizten Bären.
Sarah beunruhigte sein Gebaren nicht. Der bullige Chefermittler mit den kurz geschorenen Haaren war ein Musterbeispiel des grantigen Wieners mit weichem Herz. Als er sich in Bewegung setzte, folgte sie ihm.
»Jedenfalls danke, dass du gleich gekommen bist«, sagte er, während sie den Durchgang passierten, der in den Schlosspark führte.
»Du hast mir ja keine Wahl gelassen, oder hab ich da was überhört?« Im nächsten Moment sah sich Sarah irritiert um. Sie hatte eine taghelle Anlage erwartet, erleuchtet von gleißenden Scheinwerfern der Polizei. Doch der Park schien menschenleer zu sein. Nur die Straßenbeleuchtung schickte ihr dürftiges Licht über die hohe Mauer, und die Außenstrahler, die die Fassade des Belvedere beleuchteten, sorgten für eine helle Lichtwolke nahe dem Gebäude.
»Was ist eigentlich los?«, drängte Sarah den Chefermittler, sie endlich einzuweihen. Seite an Seite eilten sie auf die monumentalen Treppen zu, über die man die dreiundzwanzig Meter Niveauunterschied im Garten überwand.
»Wir haben eine Leiche.«
»Darüber hat mich Frau Rossmann schon aufgeklärt.« Sie waren inzwischen am Fuß der Treppe angelangt. Sarah blieb stehen und blickte sich übertrieben um. »Nur wo? Ich sehe hier im Halbdunkeln nur meterhohe Hecken, die Schlossmauer und die Putti, die wie üblich auf den Treppenbalustraden wachen. Keine Polizisten.« Sie verkniff sich eine Bemerkung über die symbolische Bedeutung der kleinen Knaben aus Stein, die die zwölf Monate des Jahres verkörperten, und über die vier Vasen auf den Sockeln, die die Jahreszeiten darstellten. Dass die verschlungenen Kreise und Quadrate auf der Mittelrampe der Treppe die kosmische Harmonie versinnbildlichten, erwähnte sie ebenfalls nicht. Das auszuführen hätte Steins Nerven in einem solchen Moment überstrapaziert.
»Er lag im Teich«, knurrte der Ermittler.
Sarah wandte sich nach rechts und deutete zum Kaskadenbrunnen, dessen Figuren wie graue Geister aus dem Dämmerlicht auftauchten. Das Wasser schimmerte nebulös. Der Brunnen lag im Zentrum der Parkanlage und mündete über fünf Stufen in einen Wasserfall. Die Zahl Fünf stand symbolisch für die Mitte. »Hier ist aber niemand, oder hat am Ende jemand einer der Najaden den Kopf abgeschlagen?« Sarah lachte, aber sie klang nervös.
»Beim Oberen Belvedere«, erwiderte Stein ernst und stieg die Stufen nach oben.
Sarah folgte ihm, während sich ihre Augen langsam an die schummrigen Lichtverhältnisse gewöhnten.
»Hast du gewusst, dass die siebzig Stufen der beiden Treppen für die zehn jeweils siebenjährigen Lebensabschnitte des Menschen stehen?«, konnte sie sich jetzt eine Erörterung doch nicht verkneifen.
»Unser Toter hat seine Lebensabschnitte jedenfalls beendet, wie viele auch immer das waren. Und du pass auf, dass du nicht stolperst und dir womöglich noch den Hals brichst, bevor deine zehn Abschnitte um sind.«
Sarah schenkte ihm ein schiefes Lächeln. Allmählich bekam sie das Gefühl, in eine Parallelwelt geraten zu sein. Vor der Schlossmauer tobte das normale moderne Leben, während dahinter Skulpturen, die den Aufstieg aus der Unterwelt in den Olymp symbolisierten, auf die Historie verwiesen. Sie blieb stehen, betrachtete eine der Sphinxe. Die Mischwesen aus Löwe und Frau wirkten selbst im Zwielicht wie die unbestrittenen Herrscherinnen der Parkanlage.
Stein grinste schief, als er sich neben Sarah stellte. »Kennt ihr euch?«
»Sphinxe sind die Hüterinnen des geheimen Wissens. Wart, ich stell dir eine Frage: Welches Wesen hat am Morgen vier, am Mittag zwei und am Abend drei Beine? Aber bedenke deine Antwort«, warnte Sarah im Flüsterton, »denn wenn sie falsch ist, so wirst du von den Sphinxen verschlungen. Und wenn dir keine einfällt, auch.«
»Was ist das? Ein Rätsel aus Harry Potter?«
»Nein, ein Rätsel, das die Sphinx, die die Stadt Theben belagerte, Ödipus gestellt hat.«
Stein setzte sich wieder in Bewegung. »Mir reicht unser Rätsel im Teich.«
»Es ist der Mensch«, gab Sarah sich selbst die Antwort und lief ihm hinterher. »Als kleines Kind kriecht er auf allen vieren, als Erwachsener steht er auf zwei Beinen, und als Greis geht er am Stock.« Sie zuckte mit den Achseln. »Aber was hat es Ödipus genutzt, die Denkaufgabe zu lösen? Er hat trotzdem nichts ahnend seinen Vater getötet und seine Mutter geheiratet, wie es das Orakel geweissagt hat.«
»Hm«, brummte Stein gleichgültig. »In unserem Teich lag auch ein Mensch.«
»Jetzt hast sicher ein bisserl Angst.« Sarah lachte gekünstelt. »Ödipus hat sich übrigens die Augen ausgestochen, als er die Wahrheit erfuhr, und ist als blinder Bettler nach Athen gegangen.«
»Traurige Geschichte«, höhnte Stein und blieb ein paar Schritte vor der hohen Mauer stehen, hinter der der Obere Belvederegarten lag. »Ich hab auch gleich eine für dich. Eine traurige Geschichte.«
»Übrigens war der Sphinx im alten Ägypten männlich, ein Symbol des Sonnengottes. Erst auf griechischem Boden wurde daraus eine Frau mit Löwenleib, die auch eine neue Bedeutung bekam«, fuhr Sarah fort.
»Merkst eigentlich, dass du ununterbrochen quatschst?«, fragte Stein. »Oder rennt deine Pappalatur automatisch?«
»Ich bin total nervös. Reden lenkt mich ab.«
»Es gibt keinen Grund, nervös zu sein.«
»Hallo? Du hast mich mitten in der Nacht an einen Tatort geholt.« Sarah hob die Hände und drehte die Handflächen nach oben. »Das macht jeden nervös, der kein Krimineser ist.«
»Das schaffst schon«, sagte Stein lapidar, deutete auf das offen stehende schmiedeeiserne Tor, das zur Südseite des Oberen Belvedere führte, und reichte ihr Schuhüberzieher. »Zur Sicherheit. Bleib auf jeden Fall bei mir und beweg dich nur in dem Bereich, den die Kollegen von der Kriminaltechnik für uns abgesteckt haben. Andernfalls lynchen sie dich. Auch ohne dir vorher ein Rätsel aufgegeben zu haben.« Er trat durch das Tor.
Sarah nickte und folgte Stein. Von einem Moment auf den anderen wandelte sich das Bild. Halogenscheinwerfer beleuchteten den Großteil des Spiegelungsteiches, der tagsüber die Fassade des Barockschlosses reflektierte. Der Anblick wirkte, als würde eine künstliche Sonne die Hälfte eines Planeten bestrahlen, denn der untere Teil des Bassins lag in gräulicher Dunkelheit. Die vielen Kriminaltechniker in weißen Overalls, die ringsum ihren jeweiligen Job erledigten, erschienen Sarah wie eine Armee kalkweißer Ameisen. Sie alle folgten einer Logik, fotografierten, vermaßen, prüften, sicherten, besprachen sich, warteten.
»Du kannst dir denken, wie viele Spuren wir hier sichern müssen. Ich mein, da trampeln tagtäglich Tausende von Menschen aus verflucht vielen Ländern durch den Park. Und uns Kieberern fällt jetzt die Aufgabe zu, die Spreu vom Weizen zu trennen, um etwas Brauchbares zu finden. Das wird Wochen dauern, wenn nicht Monate«, stöhnte er.
Sarah starrte auf die Kunstwerke, die rund um den Teich arrangiert waren. Der Wiener Bote