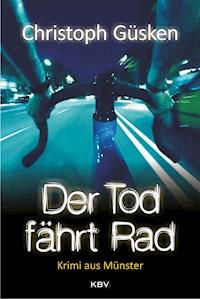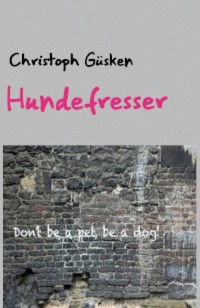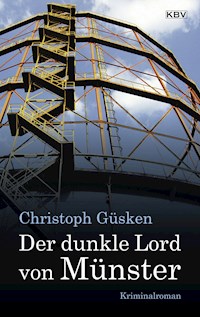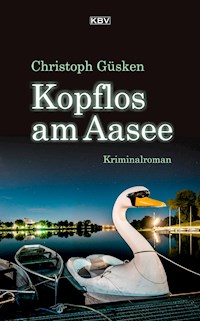Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: KBV Verlags- & Medien GmbH
- Kategorie: Krimi
- Serie: KBV-Krimi
- Sprache: Deutsch
Eine mörderische Wanderung durch den Teutoburger Wald In seinem einsamen Haus im Osnabrücker Land wird der ehemals bekannte Horrorschriftsteller Rufus Kolk ermordet aufgefunden. Hat die Tat etwas mit dem jähen Karriere-Ende des Autors zu tun? Oder mit dem Umstand, dass er von der gesamten Dorfgemeinschaft bitter angefeindet wurde? Auf der Suche nach einem Motiv für das undurchsichtige Verbrechen stolpern der Münsteraner Hauptkommissar Reinbeck und sein Bramscher Kollege Ascher immer wieder über Hinweise auf Kolks Romane, die sich stets mit »dem Bösen« befassten. Kolk schien bizarren Obsessionen verfallen. Offenbar trieb ihn das Gefühl um, in seinem einsamen Haus nicht alleine zu sein. Kannte er seinen Mörder? Die Ermittler stoßen auf ein Manuskript, das von einer Gruppenwanderung von Tecklenburg zum Großen Freeden berichtet, die in einer Katastrophe endete. Schon bald ahnen sie, dass es sich hierbei nicht etwa um eine erfundene Geschichte handelt, sondern um die Chronologie einer grauenhaften Wirklichkeit …
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 343
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Bisher vom Autor bei KBV erschienen:
Der Tod fährt Rad
Das Wunder von Hiltrup
Das Mordkreuz von Tilbeck
Der Glöckner von St. Lamberti
Kopflos am Aasee
Der dunkle Lord von Münster
Christoph Güsken wuchs in Mönchengladbach auf, studierte in Bonn und Münster und war Buchhändler in Köln. Er verfasste Texte im Geist der legendären Monty Pythons, u. a. für die »Springmaus«. Seit 1995 lebt er als freier Autor in Münster, schrieb zahlreiche Krimis, einige wenig ernste Romane und Hörspiele. Seine Krimireihe um den schrägen Ex-Hauptkommissar de Jong, umfasst inzwischen sechs Bände, zuletzt Der dunkle Lord von Münster (2021). Mit Der Totensammler macht er eine Pause von der erfolgreichen Münster-Krimireihe.
www.christoph-güsken.de
Christoph Güsken
Der Totensammler
Originalausgabe
© 2022 KBV Verlags- und Mediengesellschaft mbH, Hillesheim
www.kbv-verlag.de
E-Mail: [email protected]
Telefon: 0 65 93 - 998 96-0
Umschlaggestaltung: Ralf Kramp
unter Verwendung © Joel Wüstehube und
© rosifan19 - beide adobe.stock.com
Lektorat: Volker Maria Neumann, Köln
Print-ISBN 978-3-95441-623-3
E-Book-ISBN 978-3-95441-638-7
INHALT
1. KAPITEL
2. KAPITEL
3. KAPITEL
4. KAPITEL
5. KAPITEL
6. KAPITEL
7. KAPITEL
8. KAPITEL
9. KAPITEL
10. KAPITEL
11. KAPITEL
12. KAPITEL
13. KAPITEL
14. KAPITEL
15. KAPITEL
16. KAPITEL
17. KAPITEL
18. KAPITEL
19. KAPITEL
20. KAPITEL
21. KAPITEL
22. KAPITEL
23. KAPITEL
24. KAPITEL
25. KAPITEL
26. KAPITEL
27. KAPITEL
28. KAPITEL
29. KAPITEL
30. KAPITEL
31. KAPITEL
32. KAPITEL
33. KAPITEL
34. KAPITEL
35. KAPITEL
36. KAPITEL
37. KAPITEL
38. KAPITEL
»The woods are lovely, dark, and deep,
But I have promises to keep
And miles to go before I sleep
And miles to go before I sleep.«
Robert Frost
1. KAPITEL
Das Böse beschäftigte ihn mehr, als ihm lieb war. Es blieb in seinem Kopf und sorgte dafür, dass es dort drinnen niemals wirklich hell war, jedenfalls nicht strahlend hell und sonnendurchflutet. Dabei kam ihm auch oft in den Sinn, dass es eigentlich nicht klug war, sich das Böse dunkel und finster vorzustellen. Mit heulender Einsamkeit und kalter Seelenverlassenheit. Von vorneherein davon auszugehen, dass das Böse ein furchterregendes Äußeres hatte und allein sein Anblick schon den Atem stocken ließ. Das nämlich machte es ihm so leicht, uns zu täuschen! – Viel wahrscheinlicher war es doch, dass das Böse, wenn es uns heimsuchte, scheinbar arglos im Mantel des Schönen daherkam. Wenn es eines Tages vor uns stand, würde sein Gesicht nicht die vernarbte, arglistige Fratze eines Unholds sein, sondern das vertraute Antlitz eines Menschen, der uns nahe war …
Er wusste nicht mal mehr, woher er das hatte. Ein bloßer Gedanke, eine Spekulation, fernab der Wirklichkeit. Aber dennoch spukte er durch seinen Kopf wie das Gerücht einer bösen Zunge, das umso lauter wird, je mehr man ihm widerspricht.
Nicht dass er jetzt noch einen Menschen gehabt hätte, der ihm nahestand. Aber da waren ganz besonders zwei, die er eigentlich nie gekannt hatte, und die ihm jetzt am Herz lagen, ob ihm das lieb war oder nicht. Erst seit sie tot waren.
Das war nicht sicher, aber er konnte sich nicht vorstellen, dass sie noch lebten. Nein, es war nicht möglich. Es war zu lange her, und man hatte nirgends eine Spur von ihnen gefunden. Man hätte in der Tat von einem Wunder sprechen müssen, wenn sie noch gelebt hätten.
Dabei konnte er, wenn er sich nicht allzu sehr dagegen sträubte, sogar spüren, dass sie nicht weit weg waren. Mutter und Tochter. Es war ein vages Gefühl – oder sogar mehr als das. Man konnte es nicht wegschieben. Eine gefühlte Gewissheit. Wenn er den Atem anhielt, konnte er sogar ihre Schritte auf dem Bürgersteig hören, wie sie sich näherten. Die nackten Füße auf dem Stein, nicht gerade besonders laute Geräusche, aber lauter werdend. Warum kamen sie barfuß?
Was wusste er denn, vielleicht hatten sie sich befreien können und mussten dabei ihre Schuhe zurücklassen. Irgendwie mussten sie es geschafft haben herauszukommen. Aus ihrem Gefängnis, wie auch immer das ausgesehen haben mochte. Wo immer es sich befunden haben mochte. Woher sollte er das wissen?
Jedenfalls waren sie von dort auf dem Weg hierher. Sie waren schon ziemlich nahe. Er wollte nicht, aber er hörte ihre Schritte, nicht laut, aber deutlich, unverwechselbar – die der Mutter und die der Kleinen, sie ist fünf oder sechs Jahre alt.
Jetzt waren sie da. Unten. Direkt vor der Haustür müssten sie stehen. Das Trippeln hatte aufgehört. Was jetzt?
Er hielt den Atem an.
Und dann klingelte es.
Sein Herz schien stillzustehen. Alles wartete. Auch die Zeit hielt an. Dann erneutes Klingeln. Sein Herz hämmerte jetzt, Schweiß brach aus. Ich komme, wollte er rufen, bin schon unterwegs! Einen Augenblick! Und dann hinaus aus dem Schlafzimmer und die Treppe hinunterrennen. Die Tür weit aufreißen und …
Aber es drang kein Laut aus seiner Kehle. Und seine Glieder waren schwer wie Blei. Selbst wenn er aufstehen konnte und nichts ihn aufgehalten hätte – wollte er das? Wollte er die Tür wirklich öffnen? Die beiden da unten, die draußen warten, obwohl sie gar nicht da sein konnten; es war doch gar nicht möglich, dass sie sich von da, wo sie eingesperrt gewesen waren, hatten befreien konnten. Dass sie hatten fliehen können. Also woher kamen sie? Wo waren sie all die Jahre gewesen? Wie sahen sie aus, nachdem sie verschwunden waren und vielleicht tot, aber nie begraben worden waren? War er auf diesen Anblick vorbereitet?
Auf einen Anblick, von dem er sich keine Vorstellung machen wollte? Er dachte an das Böse im Gewand des Vertrauten. Dass die beiden nicht mehr lebten, war so gut wie sicher. So gut wie. Nicht weil er es mit seinen Augen gesehen hatte, sondern weil alles andere nur denkbar war, aber nichts mit der Realität zu tun hatte. Reines Wunschdenken. Und das bedeutete, dass da unten vor der Tür zwei Tote Einlass begehrten.
Es klingelte ein weiteres Mal. Und dann klopfte es. Es war deutlich zu hören.
Trotzdem würde er nicht aufmachen. Es ging nicht mit rechten Dingen zu! Er wollte nicht wissen, wer dort Einlass begehrte. Natürlich, die beiden hätten allen Grund gehabt, ihn zu besuchen, denn ihm und niemandem sonst verdankten sie schließlich, dass sie verschollen und vergessen waren. Tot und nicht mal begraben. Er war derjenige, der ihnen Tod und Vergessen eingebrockt hatte.
Es klingelte und klopfte, immer lauter. Drängender und ungeduldiger. Wütend geradezu. Lange würde die Tür nicht mehr halten.
Endlich wachte er schwer atmend auf.
THERAPIEPROTOKOLL
Vorbemerkung: Seit über zwanzig Jahren übe ich meine Tätigkeit als Therapeut aus. Es hat sich als sehr nützliche Maßnahme erwiesen, jeden meiner Fälle in seinem Verlauf zu Dokumentationszwecken zu archivieren. So wie diesen Fall auch. Heute jedoch hat sich eine kleine, aber wesentliche Änderung hinsichtlich meines therapeutischen Konzeptes ergeben, die ebenso zwangsläufig wie folgenreich ist. Als Therapeut sollte ich diesen Umstand nicht in mein Handeln einbeziehen, das wäre jedem Anfänger klar; als Mensch weiß ich aber im selben Moment, dass dies gar nicht in meiner Macht steht. Von dem Moment an, als ich mich mit dem biografischen Hintergrund meines neuen Klienten konfrontierte, mit der Genese seiner psychischen Probleme, gab es für mich praktisch keine andere Wahl mehr. Es handelt sich wohl um einen dieser Fälle, die zu selten sind, als dass es für sie kluge Ratschläge zu lesen oder einschlägige Literatur zum Nachschlagen gäbe. Fälle, die einen zwingen, vollkommenes Neuland zu betreten. Und obwohl mein Verstand mir nahelegt, in meinem Beruf Kategorien wie Schicksal oder Fügung gar nicht erst in Erwägung zu ziehen, weiß ich im selben Moment, dass sie sich längst in meinem Kopf eingenistet haben. Als hätten sie vor dem Eintreten dieser Situation schon dort gewartet.
Wenn es einen Gott gibt, dann hat er sicher gute Gründe dafür, dass dieser Mann an diesem Tag ausgerechnet zu mir in die Therapie kommt. Es ist wie ein Auftrag für mich und eine Mahnung, nicht weiter tatenlos zu ertragen, was sich ereignet hat. Sondern endlich etwas zu unternehmen, eine aktive Rolle zu spielen. Was und wem würde es denn helfen, die Therapie wegen Befangenheit abzubrechen? Darf ich es mir so leicht machen? Abgesehen davon ist es lächerlich und verharmlosend, von Befangenheit zu sprechen. Zudem aussichtslos zu glauben, dass ich mich so einfach aus der Affäre ziehen könnte. Und dass ich es wollte.
Da ist eine Stimme in mir, die es mir nicht erlaubt, einfach den Schwanz einzuziehen. Du bist kein Therapeut, sagt sie, sondern Opfer oder wenigstens Betroffener. Und als Betroffener solltest du handeln, nicht als Psychotherapeut. Die Therapie bestimmt nur die Art und Weise, wie du handelst.
So stecke ich schon längst, ob es mir recht ist oder nicht, in diesem fatalen Rollenkonflikt. In einem Dilemma, das mich zu etwas zwingt, das man als unethisch betrachten könnte: ein Brechen des hippokratischen Eids, den ich vor langer Zeit geschworen habe.
Vielleicht sollte ich lieber nicht sagen, dass ich ihn breche: Ich interpretiere ihn auf eine andere Weise, sehe ihn aus einer anderen, gegensätzlichen Perspektive an. Passe ihn einer Ausnahmesituation an, auf die niemand vorbereitet sein kann. Einer Situation, die mir jetzt, da die Dinge so liegen, wie sie liegen, nicht mehr erlaubt, mich ihr zu entziehen. Die mich zum Handeln zwingt.
2. KAPITEL
Ich bezeichnete mich als vorsichtigen Optimisten. Zugegeben, man merkte es mir nicht so an, weil ich nicht andauernd mit lauter Stimme Kopf-hoch-Parolen ausgab oder mir und anderen versicherte, dass »alles gut« sei. Die Hoffnung darauf behielt ich lieber für mich. Aufgeklärte Zuversicht war mein Motto. Mir war klar, die meisten kannten mich als in sich gekehrten Menschen und hielten mich allemal für einen vorsichtigen Skeptiker, einen, der mit seiner Einschätzung der Lage abwartete und sich nicht zu früh festlegen wollte.
Auch zugegeben, grüblerische Selbstzweifel waren mir nicht fremd, jedoch bildete ich mir ein, ihnen zu widerstehen, wo immer es ging. Und es kam so gut wie nie vor, dass ich mich in einem Stimmungsloch verfing, das mich deprimiert, schwierig und unumgänglich sein ließ.
»Du musst trotzdem verstehen, dass ich dich noch nicht an die heißen Geschichten heranlasse«, erklärte Nielsson.
Er war mein Chef. Und er sagte es nicht nur einmal, sondern alle paar Tage in schöner Regelmäßigkeit. Meistens, wenn wir uns mittags zufällig in der Kantine über den Weg liefen. Der Kriminalrat entschuldigte sich dafür, dass ich immer noch Hintergrunddienst schob, dabei wäre ich niemals auf die Idee gekommen, mich darüber zu beschweren. Alte, ungeklärte Fälle noch mal durchzusehen, Fakten zu ordnen und herauszufinden, ob sich aus heutiger Sicht eine neue Sachlage ergab – das mochte eine ungeliebte Tätigkeit für Greenhorns und lästige Praktikanten sein, aber in meiner speziellen Situation war das sicher einer der besten Jobs bei der Kripo.
Zurzeit hatte ich mir eine Serie von Autodiebstählen aus dem Jahr 2015 vorgenommen, deren Spur höchstwahrscheinlich nicht, wie man damals angenommen hatte, nach Polen führte, sondern ins südliche Münsterland. Kein aufregender Job. Aber er musste erledigt werden.
»Da hast du natürlich auch wieder recht.«
Nielsson war ein kleiner, umgänglicher Bulle Mitte vierzig mit zu großen Händen und einer Vorliebe für ausladende Gesten – eine Kollegin hatte ihm irgendwann den Spitznamen »Herr Nielsson« verpasst, in Anlehnung an Pippi Langstrumpfs besten Freund. Was er, als es ihm zugetragen wurde, nicht krummgenommen hatte.
Nach allem, was passiert war, hatte ich jedenfalls wenig Anlass, den Kopf hängen zu lassen. Alles ging seinen Gang, ich würde schon wieder auf die Beine kommen, nur Geduld, das braucht eben alles Zeit.
Bis auf diese Träume, dass es an der Haustür klingelte. Die störten allerdings und kamen immer noch relativ oft. An den Morgen nach den Nächten, in denen sie über mich gekommen waren, fiel das Arbeiten dann doch schwerer. Dann wurde mir klar, dass ich mehr als sonst ankämpfen musste gegen die schleichende, düstere Stimmung, die sich verdichtete wie ein dunkles Unwetter, das sich über mir zusammenbraute. Dann war es hilfreich, eine Zuflucht in der Nähe zu wissen, um nicht von der Düsternis hinweggespült zu werden. Ich glaubte, mich tapfer zu halten, aber im ersten Moment japste ich jedes Mal nach Luft, darauf gefasst, jämmerlich in dieser Stimmung zu ersaufen oder von ihr wie von einer ablandigen Strömung erfasst und aufs offene Meer hinausgezogen zu werden. Ein Gefühl, das sich allerdings auch aus heiterem Himmel einstellen konnte, an Tagen, an denen ich über nichts zu klagen wusste, sodass ich mich immer vor diesem Hinterhalt vorsehen musste. Oft lag es genau dort auf der Lauer, wo ich es niemals vermutet hätte.
Wahrscheinlich war es eben nicht damit getan, sich einzureden, was passiert sei, sei passiert. Man konnte es nicht mehr rückgängig machen. Niemand konnte das. Schön, wenn es damit getan gewesen wäre, aber das war zu einfach. Wohl eine zu schlichte Art der Verdrängung.
Dr. Sassnitz, meine psychologische Betreuerin, hatte es immer gewusst. Sie hatte mir damals dringend ans Herz gelegt, die Angelegenheit nicht »liegen zu lassen«.
»So schwer es fällt, Sie sollten sich dem stellen, sich damit auseinandersetzen. Sonst machen Sie es immer stärker, und eines Tages werden sie ihm nicht mehr gewachsen sein.« Erst war sie voll des Lobes gewesen, dass ich so schnell in mein altes Leben zurückgefunden hatte und es mir auf unkomplizierte Weise gelungen war, mich wieder alltäglichen Dingen zuwenden zu können. Aber bevor ich darauf stolz sein konnte, äußerte sie die Vermutung, es sei mir allzu schnell gelungen.
Was passiert war, war passiert, schlimm genug. Aber jetzt schaute ich nach vorn. Die Psychologin hatte leicht reden, denn es war so verführerisch, die Sache »liegen« zu lassen. Abgesehen davon ließ ich sie auch nicht einfach da liegen, wo sie lag. Mitten im Weg. Wo ich täglich über sie hinwegsteigen musste. Ich hatte sie aufgehoben und ganz nach hinten in einen der Schränke gepackt, in die man so gut wie nie hineinschaute. So weit, so gut. Aber leider schien Dr. Sassnitz recht damit zu behalten, dass sie mir trotzdem auf die Füße fiel.
Ich tat alles, um das Geschehene zu ignorieren; und längst bildete ich mir nicht mehr ein, die Sache sei damit erledigt.
Die Träume kamen häufiger. Sie variierten – mal spielten sie frühmorgens, kurz vor dem Aufstehen, mal in der Nacht. Mal war ich auf dem Bett festgeschnallt und konnte mich nicht rühren, mal sprang ich auf, rannte die Treppe hinunter und stand schwer atmend vor der Tür. Starrte sie an, wie sie vom Klopfen so sehr erzitterte, dass sie fast aus den Angeln sprang. Allen Varianten war gemeinsam, dass es an der Haustür klingelte. Das schrille Klingelgeräusch, das durch Mark und Bein ging. Und jedes Mal jagte mir die Vorstellung, wer da auf der anderen Seite der Tür stand, einen eisigen Schauer über den Rücken.
Kirsten und Felice Glauser. Mutter, 39, und Tochter, sechs Jahre alt. Warum der Kidnapper es auf beide, Mutter und Tochter, abgesehen hatte, darüber war später viel gemutmaßt worden. Einige hielten es für denkbar, dass Carsten Stieleke, Pächter einer Tankstelle, persönliche Gründe für seine Tat gehabt hatte, etwa eine Abfuhr Kirsten Glausers, die ihn gekränkt haben könnte. Die meisten Ermittler gingen jedoch davon aus, dass es dem Mann ausschließlich um Geld zu tun war. Stieleke war nämlich hochverschuldet. Vieles deutete im Nachhinein darauf hin, dass ihn ein Blockbuster im Fernsehen zu seiner Tat inspiriert hat: Dort hatte jemand ein Mädchen entführt und in einer hölzernen Kiste gefangen gehalten, die er im Wald vergraben hatte. Über einen Schlauch hatte er sein Opfer mit Sauerstoff und Nahrung versorgt. Einem seiner Freunde hatte Stieleke jedenfalls des Öfteren von diesem Film vorgeschwärmt und die Methode als genial gelobt, weil man seiner Meinung nach auf diese Weise der Polizei gegenüber alle Trümpfe in der Hand behalten könne und im Falle einer Verhaftung die beste aller möglichen Verhandlungspositionen habe. Im Film wurde nach einer äußerst spannenden Schlusssequenz das gekidnappte Mädchen in letzter Sekunde aus ihrem schauerlichen Gefängnis befreit.
Anders als im Fall Glauser. Ich hatte die Einsatzleitung. Damals war ich schon lange Bulle und hatte meine gesamte Erfahrung in die Waagschale geworfen, als ich Erik Glauser, dem Ehemann, versicherte, dass wir alles daransetzen würden, den Kidnapper zu schnappen. Aber dann kam es zu einem entscheidenden Fehler: Nach einer arrangierten Geldübergabe ordnete ich an, dem Täter zu folgen, natürlich im gebotenen Abstand, um ihn nicht zu warnen. Das klappte. Für ein paar Kilometer auf der Landstraße lief alles nach Plan, dann gab Stieleke plötzlich Gas. Ein völlig überraschendes Manöver, das uns kalt erwischte. Ob Stieleke die Verfolger bemerkt hatte, ließ sich nie klären; meine Anweisung, unbedingt auf Distanz zu bleiben, war jedenfalls peinlich genau eingehalten worden. Aber als der Kidnapper plötzlich losraste, nahmen zwei Kollegen die Verfolgung auf. In einer unübersichtlichen Kurve raste Stieleke frontal in einen entgegenkommenden LKW.
Die Suche nach Mutter und Tochter wurde umgehend eingeleitet. Aber es gab null Hinweise. In diesem Punkt schien sich Stieleke an sein Fernsehvorbild gehalten zu haben: keinerlei schriftliche Aufzeichnungen oder Skizzen zu hinterlassen. Niemanden einzuweihen. Es war die Suche nach der Stecknadel im Heuhaufen, mehr noch: Man konnte nur willkürlich in einem von unzähligen Heuhaufen suchen, dann im nächsten, denn die Annahme mit der Kiste im Wald war schließlich nur eine Theorie von vielen, für die es Anhaltspunkte, aber keine Beweise gab. Wenngleich eine Hypothese, die stündlich, ja täglich an Plausibilität gewann. Tausende von Beamten waren im Einsatz, auch der Katastrophenschutz und die Bundespolizei, sie durchkämmten ein Waldstück nach dem anderen. Trotzdem wurden Kirsten und ihre Tochter Felice niemals gefunden. Es gab einfach zu viele Waldstücke.
Ich hatte später versucht, Erik Glauser mein Mitgefühl auszudrücken, aber der hatte mich nicht einmal angesehen, sondern sich nur abgewandt. Nicht angeekelt oder so, als litte ich an einer ansteckenden Krankheit, eher so, als existierte ich überhaupt nicht. Ich konnte es ihm nicht verdenken.
Nielsson nahm mich aus der ersten Reihe, schickte mich in den Urlaub und steckte mich später zu den alten Fällen ins Archiv. Mochte der Chef dies auch als Zumutung empfinden und sich immer wieder dafür entschuldigen, mir kam es gerade recht. Mittlerweile war ich mir gar nicht mehr sicher, ob ich zurück zur Mordkommission wollte. Vielleicht war es besser, im Büro zu sitzen und Fälle zu bearbeiten, die nie richtig zu einem Ende gekommen waren, als nach draußen zu gehen und dafür zu sorgen, dass neue Fälle in einer Katastrophe endeten.
Ehrlich, ich wollte es mir nicht zu leicht machen. Nicht, wie Dr. Sassnitz vermutete, die Dinge liegen lassen. Aber es kostete Kraft, enorm viel Kraft, sich aufzurichten. Ihnen auch nur den Blick zuzuwenden.
* * *
Heute war einer dieser Tage, in die ich aus meinem vermaledeiten Traum hineingestolpert war. Das war der Grund, weshalb ich in meinem Büro saß und keinen einzigen Gedanken auf die Arbeit verschwendete, sondern nur gegen die Wand glotzte und zurückdachte an das, was passiert war. Ich kam nicht davon los. Etwas mehr als ein Jahr war es jetzt her. Was brachte den Traum nur dazu, mir vorzugaukeln, es seien seitdem so viele Jahre vergangen? Was hatte das zu bedeuten, war das eine Art Zukunftsvision?
Das Klingeln des Telefons riss mich aus meiner Grübelei. Ich nahm ab, räusperte mich und sagte meinen Namen.
»Polizeikommissariat Bramsche«, antwortete eine männliche Stimme. »Hauptkommissar Ascher.« Ein Räuspern, und der formelle Tonfall zerbröckelte. »Ich bin’s, Elmar.«
»Elmar?«
»Polizeiakademie Hiltrup.« Ein Moment verlegenen Schweigens verging. »Lange her, ich weiß.«
Elmar Ascher. Jetzt kam die Erinnerung wieder, allerdings nur dunkel und schemenhaft. Eine sehr flüchtige Bekanntschaft. Zwei Abende oder so hatten wir zusammen abgehangen. Mehr waren es bestimmt nicht. Oder doch: Am Ende der Ausbildung hatten wir einander versprochen, auf jeden Fall in Kontakt zu bleiben. »Stimmt«, sage ich. »Elmar Ascher. Tut mir leid, dass der Groschen so spät fällt. Wie geht’s dir denn?«
»Na ja, aus der steilen Karriere beim LKA ist doch nichts geworden. Vielleicht auch besser so, wer weiß. Und ansonsten kann ich nicht klagen.«
»Du bist also jetzt in Bramsche?«
»In der tiefsten Provinz, genau. Und um es gleich zu sagen, es gibt einen ernsten Grund, weshalb ich dich anrufe. Ist dir der Name Rufus Kolk ein Begriff?«
»Natürlich. Er ist vielen ein Begriff«, antwortete ich. »Kolk hat eine Menge Bücher geschrieben.«
»Also gut. Standest du auch in einer persönlichen Beziehung zu ihm?«
»Er ist mein Onkel, ja. Aber wir stehen uns nicht nahe, im Gegenteil. Warum sagst du ›standest‹?«
Ascher räusperte sich. »Er wurde ermordet.«
Ich atmete plötzlich schneller. Nicht weil ich schockiert war. So lange schon bei der Kripo, aber noch nie in meinem Leben hatte es das Wort »ermordet« bis in den Kreis der Familie geschafft. Jetzt schon.
»… und ich habe die Ermittlungen in dem Fall übernommen.«
Es war falsch, von persönlicher Beziehung zu sprechen. Nur weil er mein Onkel war. Das haute nicht hin. Onkel Rufus gehörte überhaupt nicht zu meinem Leben. Ich fragte: »Wie ist es passiert?«
»Herr Kolk wurde gestern im Keller seines Hauses in Evingerloh tot aufgefunden. Die Todesursache steht noch nicht fest. Aber da er angekettet war, gehen wir von Mord aus.«
»Er war angekettet? Wer hat ihn angekettet?«
»Tut mir leid, Lukas, aber wir stehen noch ganz am Anfang. Du weißt doch, wie das ist. Bisher gibt es praktisch nur Fragen, keine Antworten. Dein Onkel hat wohl die letzten Jahre ziemlich isoliert in seinem Haus gelebt. Er hatte keine Bekannten in dem Ort, galt als Außenseiter und wollte es wohl auch nicht anders. Na ja, das Einzige, was wir bis jetzt haben, ist ein Brief, den wir auf seinem Schreibtisch gefunden haben. Und der ist an dich gerichtet.«
»An mich?«, wunderte ich mich. »Aber wieso? Wir hatten nie Kontakt, geschweige denn per Brief. Ich habe Rufus das letzte Mal gesprochen, da muss ich so vier oder fünf Jahre alt gewesen sein.«
Der Mann am anderen Ende sagte nichts.
»Da ist irgendetwas sehr seltsam«, sagte ich.
»Wenn du das sagst, will ich nicht widersprechen.«
»Was steht denn in dem Brief?«
»Ich werde nicht schlau daraus. Er schrieb darüber, dass er das Böse gefunden hatte.«
»Das Böse? Was meint er denn damit?«
»Ehrlich gesagt, hatte ich gehofft, du kannst mir das erklären. Und dass es an der Tür klingelt und er weiß, wer draußen steht. Es klingt alles ziemlich wirr.«
»Was sagst du da?« Ich bekam nicht mit, wie der andere Hauptkommissar das mit der Tür noch mal wiederholte. Ich hatte es sehr wohl verstanden. Aber im selben Moment sah ich meine eigene Haustür vor mir, die aus den Träumen, in den Angeln bebend, weil von außen jemand mit aller Gewalt dagegen pochte …
»Könnte eventuell darauf hindeuten, dass er seinen Mörder gekannt hat«, meinte Ascher. »Aber vielleicht bedeutet es ja auch was ganz anderes. Übrigens nennt er dich seinen Sohn, und so wie ich das verstehe, will er dir alles vermachen.«
»Das bin ich aber nicht.« Mein Widerspruch klang fast gereizt. »Er ist mein Onkel, der Bruder meines Vaters. Und die beiden waren alles andere als ein Herz und eine Seele.«
»Verstehe«, sagte Ascher. Trotzdem wartete er offenbar, ob mir noch etwas einfiel. »Was uns auch noch zu denken gibt, ist«, fügte er schließlich hinzu, »dass er in dem Brief Gäste erwähnt. Dass er nicht allein in diesem Haus wohnt.«
»Ja, und?«
»Es gibt keinerlei Hinweise auf Gäste. Null. Das Haus macht einen sehr schrägen Eindruck. Es fällt schwer sich vorzustellen, dass sich dort Gäste aufgehalten haben könnten. Geschweige denn wohlgefühlt.«
»Na gut, dann hat er es vielleicht nicht wörtlich gemeint. Eher als Metapher.«
»Glaube ich auch. Es hört sich fast so an, als ob er es sich eingebildet hat. Aber da er wohl ermordet wurde, muss jemand dagewesen sein. Also …«
Dabei durfte es aber ziemlich unwahrscheinlich sein, dass man denjenigen, der gekommen war, einen zu töten, seinen Gast nannte. »Kannst du mir diesen Brief vielleicht schicken?«, fragte ich.
»Klar, kein Problem. Ich scanne ihn ein. Du kriegst ihn per Mail.«
»Und wie geht es jetzt weiter?«
»Na, das kennst du doch. Nach Hinweisen suchen, Hauszu-Haus-Befragungen durchführen. Bisher haben wir damit noch keinen Erfolg, aber hier auf dem Land dauert es immer eine Weile, bis die Leute den Mund aufmachen. In den sozialen Netzwerken sieht das ganz anders aus.«
»Wie denn?«
»Rufus Kolk war früher wohl nicht nur ein bekannter Schriftsteller, er hatte auch eine Art Kultstatus. Seine Horrorgeschichten waren keine so leichte Kost. Und jetzt, nachdem er auf diese Weise zu Tode gekommen ist, schießen die Spekulationen durch die Decke.«
»Okay«, sagte ich und buchstabierte Ascher meine E-Mail-Adresse.
* * *
Das Erste, was ich nach dem Telefonat unternahm: den Namen Rufus Kolk in eine Suchmaschine eingeben. Während ich auf die Ergebnisse wartete, tauchten Bilder in meiner Erinnerung auf: ein großer Garten, eine Schaukel. Die Sonne schien. Auf dem Rasen ein Fußballtor für Kinder, Onkel Rufus als Torhüter, der sich mit äußerster Konzentration bemühte, Bälle zu halten, die im Schneckentempo auf ihn zurollten. Was ihm trotzdem nicht gelang, obwohl er sich wie ein richtiger Keeper auf den Boden warf und möglichst echte Enttäuschung zeigte, wenn der Ball im Netz landete. Er trug ein weißes T-Shirt, Shorts und Turnschuhe, hatte stark behaarte Beine und einen Bauchansatz.
Das war auch schon meine einzige Erinnerung an Rufus: ein Besuch bei meinem Onkel, er hatte länger gedauert, einige Wochen mindestens. Der Anlass: Arne und Lore, meine Eltern, hatten sich eine USA-Rundreise gegönnt, weil Arne eine neue Stelle als Verlagslektor in Aussicht hatte. Damals hatten sich die beiden Brüder noch verstanden, Arne und Onkel Rufus. Ich konnte mich sogar noch an das Ende dieser Episode erinnern, als meine Eltern aus den Staaten zurückgekehrt waren und Lore mir anvertraute, dass ich nun bald einen kleinen Bruder bekommen würde.
Der Monitor zeigte die Treffer an. Die neuesten waren Pressemeldungen, die den Mord zum Thema hatten. Es sei eine besonders brutale Tat, und die Kriminalpolizei tappe bis jetzt im Dunkeln, mehr gebe es noch nicht zu berichten. Ein Porträtfoto zeigte den heute Achtzigjährigen um die vierzig, wohl auf dem Höhepunkt seiner literarischen Karriere.
Schon seltsam, mein Onkel wurde ermordet, und ich versuchte, mir im Internet ein Bild zu verschaffen, wer er überhaupt war. Ich betrachtete den gut aussehenden Kerl auf dem Foto in einem bunten Hemd ohne Krawatte, fast schulterlanges Haar, den selbstsicheren Blick, das schiefe Grinsen, das seine Miene arrogant wirken ließ, fast höhnisch. Noch in den Achtzigern einer der schillerndsten und umstrittensten deutschsprachigen Autoren, so der Kommentar, bis es Anfang der Neunziger still um ihn geworden war.
Es war still um ihn geworden. Kolk selbst – daran konnten kein Zweifel bestehen – war gern recht laut gewesen, wenn auch kamerascheu, er hatte Fernsehauftritte gehasst. Bis auf das brave Pressefoto im bunten Hemd, das aus dem Verlagskatalog stammte, kursierten so gut wie keine Fotos von ihm – viele vermuteten darin eine Vermarktungsstrategie, den Meister des Unheimlichen mit der Aura des Unheimlichen zu umgeben, um die Fantasie der Fans anzufachen. Die Printmedien hatten Kolks Interviews abgedruckt, in denen er Kollegen als armselige Stümper und Hobbyschreiberlinge beschimpft und Kritiker Parasiten des Literaturbusiness genannt hatte, neidisch auf Erfolg und Talent anderer. Schließlich hatte sich Rufus Kolk selbst mit seinen Lesern angelegt, indem er sie als notorisch gelangweilte Entertainment-Junkies bezeichnet hatte, die nicht in der Lage seien zu verstehen, woran ihm, Kolk, eigentlich lag.
Aber es ging nicht nur um Unverschämtheiten und verbale Zuspitzungen. Auch von diversen Affären war die Rede, von Alkoholexzessen und Drogenkonsum. Ein zweites, wenig schmeichelhaftes Foto zeigt Onkel Rufus mit aschfahlem Gesicht und dunklen Ringen unter den Augen im Park einer Privatklinik während eines Entzuges. Ich sah genauer hin: Die Aufnahme stammte aus dem Jahr 1994. Wenige Monate zuvor hatte man den Schriftsteller in verwahrlostem Zustand in einem Waldgebiet aufgegriffen, in dem er orientierungslos herumgeirrt war. Stark alkoholisiert sei er gewesen, habe unter dem Einfluss von Beruhigungstabletten gestanden und keinerlei Angaben darüber machen können, wer er war. Filmriss – Endstation Suchtklinik? Und Grandioser Absturz einer Legende hatte die Regenbogenpresse getitelt. Rufus Kolk war am Ende.
War das der Wendepunkt gewesen? Jetzt begann die Zeit, die man damit beschrieb, dass es still um ihn wurde. Der sogenannte Filmriss datierte auf den 12. August. Gut sechs Wochen später, Anfang Oktober, hatte Kolk seine Zelte am Prenzlauer Berg abgebrochen. Der gefragte Bestsellerautor stahl sich quasi über Nacht davon und zog weit weg aufs platte Land, irgendwo in die niedersächsische Provinz. Wollte er Hektik und Glamour der Großstadt gegen ländliche Beschaulichkeit eintauschen? Unwahrscheinlich, denn Rufus hatte nicht nur den Wohnort gewechselt, sondern auch der literarischen Welt den Rücken gekehrt. Mit den Bestsellern war es vorbei, als Autor hörte er gleichsam auf zu existieren. Rufus Kolk, der über zwanzig Romane des Horrorgenres veröffentlicht hatte, die in zig Sprachen übersetzt worden waren und es selbst auf dem US-amerikanischen Markt zu Ruhm und Ansehen gebracht hatten, hängte praktisch von heute auf morgen seine Schriftstellerei an den Nagel. Ein reichlich mysteriöser Abgang, darin stimmten Kritiker und Fans ausnahmsweise überein. Aber was steckte wirklich dahinter? War dieser streitbare Geist, der nie ein Fettnäpfchen ausließ, plötzlich so dünnhäutig geworden, dass er vor der Häme der Yellow Press den Kopf einzog und die Flucht ergriff?
Mein E-Mail-Postfach meldete einen Eingang. Ich öffnete die Datei. Elmar Ascher schickte Grüße, seine Telefonnummer und im Anhang den Brief, den er am Tatort sichergestellt hatte. Ich hatte alle Mühe, die krakelige Handschrift des alten Mannes zu entziffern:
Lukas, mein Sohn,
ich weiß ja, wir kennen uns nicht. Was soll ich dir sagen? Dass ich das Böse gefunden habe? Hier im Haus leben Menschen, das kannst du mir glauben oder nicht. Schwer zu erklären, ich weiß. Hör zu, was ich dir sagen will: Ich bin ein böser Mensch, das war mein Leben. Früher wollte ich das nicht hören, aber hier hatte ich Zeit genug, mich meinem Spiegelbild zu stellen. Was ich bekomme, steht mir zu. Ich beklage mich nicht. Wenigstens haben wir geredet, verstehst du? Und wenn es an der Tür klingelt, weiß ich, wer draußen steht. Ich habe sonst niemanden mehr, deshalb sollst du alles bekommen, mein Junge.
Dein R.
Noch eine andere Szene kam mir in den Sinn, ein anderes Kindheitserlebnis. Eines Abends, ich war etwa acht Jahre alt oder neun. Die Stimmen der Eltern auf dem Flur. Sie tuschelten erregt, es hörte sich an, als hätten sie sich wieder einmal gestritten. Was oft vorkam. Sie bildeten sich ein, ihre dauernden Scharmützel und Zankereien vor den Kindern verheimlichen zu können. Ich lauschte an der Tür, die einen Spalt offen stand. Es war ein altes Haus, manche Wände waren krumm, und die Tür zum Kinderzimmer sprang hin und wieder von selbst auf, wie von Geisterhand geöffnet. Jetzt war sie nur angelehnt.
»Mein Bruder ist tot«, stieß Arne hervor. Er flüsterte, aber in der Stille des Flurs verstand man ihn klar und deutlich. »Ich habe keinen Bruder mehr.« Und dann noch: »Lass mich bloß in Ruhe.« Kurz darauf schlug eine Tür.
Ich versuchte, mir einen Reim auf das zu machen, was ich da eben gehört hatte.
»Onkel Rufus ist gestorben?«, fragte Tillmann, der auch gelauscht hatte, nach einer Weile, als wir wieder in unseren Betten lagen. Es ließ ihm wohl keine Ruhe.
»Nein, keine Sorge«, sagte ich. »Papa hat es nur so gesagt. Sie haben sich wieder gestritten, und deshalb sagt er das. Onkel Rufus ist bestimmt nicht wirklich tot.«
Und ich behielt recht, damals.
Jetzt allerdings war genau das passiert. So viele Jahre später. Arne hatte keinen Bruder. Sein Bruder war tot.
Ich holte mein Telefon aus der Tasche und wählte die Nummer, die auf dem Bildschirm flimmerte.
»Ascher?«
»Ich bin’s noch mal. Lukas. Danke für den Brief.«
»Und? Kannst du dir irgendeinen Reim darauf machen?«
Nicht den geringsten. Wieso nennst du dich einen bösen Menschen? Welche Leute wohnen bei dir, und wieso soll das schwer zu erklären sein? Warum soll ich alles bekommen und vor allem: Was erzählst du mir da mit der gottverdammten Türklingel? Ich sagte: »Vielleicht. Aber du könntest mir die genaue Adresse geben.«
»Klar, mach ich gern. Aber falls du erwägst zu kommen, solltest du dein Navi benutzen. Evingerloh liegt nämlich ein bisschen abseits der Route.«
3. KAPITEL
Evingerloh, eine Ortschaft mit knapp neunhundert Einwohnern, lag etwa zehn Kilometer südöstlich von Bramsche, am Rand des Teutoburger Waldes. Es gab keinen Bahnhof, nur eine Haltestelle für den Bus nach Osnabrück. Mitten im Ort stand ein Kirchlein, umgeben von einem winzigen Kirchhof, gegenüber ein Mahnmal aus Stein für die im Zweiten Weltkrieg Gefallenen. Etwas weiter die Straße hinunter befanden sich ein winziger Edeka-Markt, ein von Unkraut überwucherter Kinderspielplatz mit stark rostenden Spielgeräten und eine Gaststätte. Kolks Anwesen, ein ehemaliger Bauernhof, lag weiter außerhalb, man muss etwa anderthalb Kilometer durch Ackerland in westlicher Richtung fahren. Ein Ort, wie geschaffen für jemanden, der sich verstecken wollte – oder der Welt den Rücken kehren.
Zunächst hatte ich vorgehabt, unbezahlten Urlaub zu beantragen, aber mein Chef, Herr Nielsson, hatte das vom Tisch gewischt. »Wir machen das so«, schlug er vor. »Du sitzt an den alten, ungelösten Fällen. Sagen wir einfach: Der Fall Rufus Kolk ist einer von ihnen.«
»Aber weder ist er ein alter Fall, noch liegt er in unserer Zuständigkeit.«
Nielsson grinste wie ein Verschwörer. »Das regele ich schon, vertrau mir.«
»Und ich fahre aus rein privaten Gründen hin.«
»Na ja, da wollen wir mal professionell widersprechen und behaupten, dass Mordfälle nie rein privat sind.« Der Chef breitete die Arme auf seine typische Weise aus, ließ sie länger wirken, als sie waren. »Ich gebe dir fünf Tage. Wenn du mehr brauchst, rufst du mich an. Einverstanden?«
Es hatte dann aber doch noch eine Woche gedauert, bis ich wegkam. Die Obduktion war inzwischen abgeschlossen, die Leiche freigegeben. Ich verabredete mich mit Hauptkommissar Elmar Ascher für 14:30 Uhr zum Mittagessen. Vorher wollte ich an der Trauerfeier teilnehmen, die für den Morgen anberaumt war.
Am Freitag gegen zehn. Es war Anfang Juni, und der Monat versprach sommerlich zu werden. Beste Voraussetzungen auch für eine Trauerfeier, besonders wenn sie im Freien stattfand, auf dem winzigen Friedhof neben der Dorfkirche in Evingerloh. Ich hatte mich mit dem Weg verschätzt und traf erst ein, als Holger Dürselen, der evangelische Pfarrer, ein großer, hagerer Mann mit schütterem, grauem Haar, schon mit der Beisetzung der Urne begonnen hatte. Auf dem Friedhof duftete es nach Frühling und Landwirtschaft. Die Vögel gaben sich alle Mühe, mit ihrem lautstarken Gezwitscher die pflichtgemäße Niedergeschlagenheit, um die sich alle bemühten, zu stören.
Das Wort Trauerfeier hatte in meinem Kopf eine falsche Vorstellung entstehen lassen: eine große Trauergemeinde, die traurige Lieder anstimmte, eine lange Reihe Kondolierender, später ein üppiges Festmahl zu Ehren des Toten. In Wirklichkeit fand ich eine Handvoll schwarz gekleideter Personen vor. Wie denn auch nicht? Für einen Mann, der, wie Hauptkommissar Ascher erwähnt hatte, weder Bekanntschaften noch Freundschaften gepflegt und sich in seinem Haus regelrecht verbarrikadiert hatte. So gesehen konnte man es sogar noch beachtlich nennen, wie viele ihn zu seiner letzten Ruhestätte begleiteten.
Der Pfarrer las aus der Bibel über die Auferstehung der Toten am Jüngsten Tag. Anschließend ließ er einen Augenblick besinnliche Stille folgen, die von Räuspern und Hüsteln gefüllt wurde. Dann griff Dürselen hinter sich, um einen CD-Player einzuschalten. Es rauschte, und blechern quäkte Herr deine Liebe ist wie Gras und Ufer über den Kirchhof. Einige der Anwesenden fühlten sich aufgefordert und leisteten durch leichte Lippenbewegungen einen stummen Beitrag zum Gesang. Mein Blick schweifte über die Anwesenden und verweilte bei zwei Frauen, deren hellblondes Haar sich auffällig von den eher dunklen und gedeckten Farben der Umgebung abhob. Beide waren schätzungsweise Mitte vierzig und sahen einander ziemlich ähnlich. Neben ihnen stand ein etwas vierschrötiger Kerl mit einer dickrandigen Brille, der dem Geschehen mit zusammengekniffenen Augen folgte, so als wollte er keine Sekunde verpassen. Und hinter ihm bemerke ich Lore und Arne, meine Eltern.
Natürlich waren sie gekommen. Arne konnte bei der Beisetzung seines Bruders nicht fehlen. Auffällig und bezeichnend, dass er als einziger noch lebender Hinterbliebener nicht in der ersten Reihe stand, sondern fast schon abseits. Er und Lore wirkten wie Zaungäste, die unsicher waren, ob sie sich in der Veranstaltung geirrt hatten. Man sah ihnen an, dass sie nichts lieber wollten als diese Zeremonie hinter sich bringen. Wie immer standen sie auf diese typische Art nebeneinander, für mich war es eine neutrale, distanzierte Art. Sie hatten es so gehalten, solange ich denken konnte. Damals vielleicht, als Lore mir zuraunte, dass ich bald ein Geschwister bekommen würde, da waren sie inniger gewesen und hatten sich öfter berührt. Aber jetzt, wo sie alt waren, schienen sie Welten voneinander entfernt. Man wäre nie auf die Idee kommen, sie für ein Paar zu halten. So wie ein Mann und eine Frau, die nebeneinander an einer Bushaltestelle warteten. Lore hatte mich inzwischen bemerkt und nickte mir zu. Arne sah nicht zu mir, offenbar vermied er Blickkontakt, gab mir so zu verstehen: Du warst es, der sich von mir abgewandt hat, also ist es an dir, einen Schritt auf mich zuzutun.
Nachdem der Pfarrer geendet hatte, trat ein kleiner, korpulenter, älterer Herr mit einem grau melierten Backenbart vor und räusperte sich. Stellte sich als Dr. Gunnar Haldermann vor, Rufus Kolks Verleger. Mit leicht gequetschter Stimme pries er die Lebensleistung des Verstorbenen, nannte ihn einen Pionier des künstlerischen Wortes, der es vollbracht habe, das immer noch verfemte Genre des »schwarzen Romans« aus dem trivialen Meer der reinen Unterhaltungsschreibe zu manövrieren und eine Brücke zur literarischen Kunst zu schlagen. Dabei habe er stets polarisiert, habe es niemandem leicht gemacht und sich nie gescheut, eindeutig Position zu beziehen.
Ein Pionier des künstlerischen Wortes. Ich konnte geradezu fühlen, wie schwer es Arne fallen musste, diese posthume Lobesrede auf seinen Bruder unwidersprochen über sich ergehen zu lassen. Wenn man bedachte, wie er immer über ihn geschwiegen hatte. Und wie er meistens über ihn gesprochen hatte. Denn auch nach jenem Abend, an dem er Rufus auf reichlich theatralische Weise für tot erklärt hatte, war der Onkel noch viele Jahre immer wieder ein Gesprächsthema in unserer Familie gewesen. Tillmann und mir war jedenfalls schon bald klar gewesen, dass Onkel Rufus keineswegs tot, sondern quicklebendig war.
* * *
Es war eines dieser Mittagessen. Ich sah die Familie um den Tisch herumsitzen – Papa, Mama und meinen kleinen Bruder Tillmann. Und ich, Lukas. Es gab Eintopf mit Mettenden, nicht gerade meine Lieblingsspeise, Tillmann dagegen schwärmte für Eintopf, er könne sich hineinsetzen, wie er immer wieder versicherte, wenn er sich für diese Art von Bewunderung auch einen nicht ganz ernst gemeinten Rüffel der Eltern einfing – alle Rüffel, die Tillmann einfing, waren nicht ganz ernst gemeint. Wie immer herrschte eine seltsam angespannte Atmosphäre bei Tisch, eine Stille wie während einer Waffenpause, ausschließlich garniert mit Atemgeräuschen, gelegentlichem Schmatzen und dem Kratzen der Löffel auf den Suppentellern. Gespräche während der Mahlzeit waren nicht verboten, aber solche während des Kauens und mit vollem Mund – und wann hatte man während des Essens schon keinen vollen Mund?
»Dein Bruder hat wieder ein neues Buch herausgebracht«, sagte Mama, ohne aufzusehen, so als würde sie mit der Suppe reden.
Statt zu nicken, schüttelte Arne den Kopf auf eine angewiderte Weise, die mich noch vor Jahren hatte vermuten lassen, dass das Herausbringen eines Buches etwas Peinliches sei, das man besser verheimlichte, etwa so wie ins Bett machen. »Bin mir sicher, es fließt wieder jede Menge Blut«, sagte Papa, den Blick auf den Löffel mit Eintopf gerichtet, der in Höhe seines Mundes auf Einlass wartete.
Mir fiel auf, wie streng Arnes Gesicht war. Zwei tiefe Furchen zogen sich wie eingeprägt an den Wangen entlang bis zu den Mundwinkeln hinunter. War es überhaupt Strenge? Oder eher Unzufriedenheit mit sich selbst, damit, dass man sich mit weniger abgefunden und arrangiert hatte, mit einem schmaleren Leben als dem, das man geplant hatte? Oder das jemand anderer für einen geplant hatte?
Der Mund öffnete sich, Arne schluckte hinunter. »Die große Hoffnung unserer deutschen Literatur«, sagte er und klang wie der Spott in Person.
»Er hat auch wieder eine neue Freundin«, fügte Mama nach einer Weile hinzu. Sie war mit der Suppe fertig und fing an, den Tisch abzuräumen.
Arne lachte nur zischend.
»Alle paar Wochen eine neue«, sagte Mama. »Die eine zieht aus, die nächste kommt.«
Diese Gespräche waren wie eine Art Ritual. Als wären sie in einem Drehbuch festgelegt, füllten sie regelmäßig die sprachlosen familiären Räume, alltägliche Situationen, in denen man zusammensaß, ohne zu reden, sondern zu schmatzen, zu kauen oder fernzusehen: Rufus, dessen Name nie genannt wurde, immer war er nur »dein Bruder«. Was für ein Machwerk ihm dieses Mal wieder das große Geld einbringe und dass es ihm, dem sogenannten Schriftsteller, ja bei all seiner Schreibkunst nur darum gehe: Asche zu machen. Und wie er die, sobald er sie eingeheimst habe, mit immer neuen und immer jüngeren Gespielinnen durchbringe. Rufus, der sexuell zügellose Lebemann, Alkoholiker und Tunichtgut. Über Jahre spukte dieses hässliche Bild von ihm über dem Mittagstisch der Kolks.
* * *
Die kleine Trauergemeinde hatte genug gehört. Unruhe machte sich breit, Hüsteln, hier und da sogar Gähnen. Trotzdem kam Haldermann, der Verleger, noch auf einige Beispiele aus Kolks Werk im Einzelnen zu sprechen, als ob er es darauf anlegte, eine Vorlesung zu halten. Auch ich folgte seinen Ausführungen nicht, fragte mich stattdessen, wie Rufus zum schwarzen Schaf der Familie geworden wart. Und ob ich jemals von ihm gehört hätte, wenn er friedlich verstorben und nicht auf brutale und rätselhafte Weise ermordet worden wäre.
Jonathan Kolk, das war mein Großvater, Arnes und Rufus’ Vater. Er war ein erfolgreicher Schauspieler, hatte eine feste Stelle beim Berliner Ensemble. In den Dreißigerjahren bekam er sogar als einer der ersten Schauspieler Fernsehrollen und brachte es zu einigem Wohlstand.