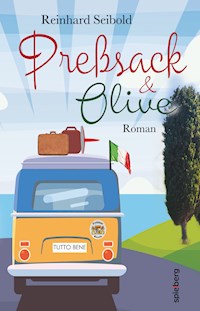Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Riccardi
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Wolfgang hat ein angeborenes Lächeln, was so reizend wie abstoßend wirkt. Er liebt seine Mutter über alles und sie liebt ihn. Ohne Vater wächst der kleine Wolfgang nach dem Krieg bei der Familie seines Onkels am Starnberger See auf. Der gut vernetzte Patriarch ist ein ehrloser Mensch, er nötigt die schöne Mutter von Wolfgang als Edelprostituierte zu arbeiten. "Warum kann man nicht immer so schön weinen, Mama?", fragt Wolfgang seine Mutter. "Man muss einige Male traurig weinen, um einmal schön weinen zu können, mein Liebling", sagt Gerda als sie ihren Sohn freudig nach langer Abwesenheit umarmt. Eine einfühlsame, emotionale und auch humorige Lebensgeschichte vom Aufbruch der Nachkriegsgeneration, geprägt von Hoffnungen, Enttäuschungen, Siegen und Niederlagen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 391
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inahltsverzeichnis
Ouvertüre
1957 Das tu ich alles aus Liebe
1958 Grüß’mir die Damen aus der Bar
1959 Musik liegt in der Luft
1960 Kriminaltango
1961 Wir wollen niemals auseinandergeh ‘n
1963 Junge komm bald wieder
1964 Geld wie Heu
1965 Das war mein schönster Tanz
1966 Liebeskummer lohnt sich nicht
1968 Hare krishna
1969 Der letzte Walzer
1970 Samba pa ti
1971 Spiel mir das Lied vom Tod
1972 Wer hat mein Lied so zerstört, Ma?
1974 Der Junge mit der Mundharmonika
1977 If you leave me now
1980 The winner takes it all
1987 1000 und 1 Nacht
1992 Wind of change
1998 Heast as net, wia die Zeit vergeht
1999 Out of the dark
2000 Moment of glory
2001 Wenn das Liebe ist
2002 Ab in den Süden
2007 Ich bin ich
2009 Disturbia
2014 When the beat drops out
Finale
Nachspann
Vollständige e-Book-Ausgabe 2022
Copyright © 2022 RICCARDI-Books
ein Imprint der Spielberg Verlagsgruppe, Neumarkt
Korrektorat: Kati Auerswald
Umschlaggestaltung: © Ria Raven, www.riaraven.de
Bildmaterial: © shutterstock.com
Alle Rechte vorbehalten.
Vervielfältigung, Speicherung oder Übertragung können zivil- oder strafrechtlich verfolgt werden.
(e-Book) ISBN: 978-3-98510-841-1
www.spielberg-verlag.de
Reinhard Seibold ist Theaterbuchautor, Schauspieler, Regisseur und Kabarettist. Seit 1996 schreibt er für seine Theatergruppe Haager Komödienbrettl die Stücke. Sie werden von Bühnen in Deutschland, Österreich und Südtirol gespielt. Sein erfolgreichstes Theater- und Filmprojekt Tutto Bene hat er auf satirische Weise im Roman Preßsack und Olive, der 2020 im Spielberg-Verlag erschienen ist, verarbeitet.
Für meine Kinder und Enkelkinder, die das Leben der Nachkriegsgeneration nicht mehr kennen und für die Franzheimer, die ihre Heimat für den Münchner Flughafen opfern mussten.
Tiefe Wurzeln überstehen Stürme besser als flache.
Manchmal ist das ein Nachteil.
Drahnier Dlobies
Lieben Dank für das Probelesen und das Auffinden von Fehlern an Stutzi, Helga, Petra und Thomas.
Ouvertüre
Es ist ein Schwarz-Weiß-Foto. Weißer Rand. Geriffelt. Zerknittert. Wolfgang mit seiner Mutter. Tante Gerda. Wolfgang und Tante Gerda sitzen im hohen Gras in der Wiese. Leiten hat man zu der Wiese gesagt. Die gibt es heute nicht mehr. Die Leiten schon, aber die Wiese nicht. Die wurde mit Häusern bebaut. In den 1960er Jahren oder schon früher? Renate weiß es nicht mehr genau, aber sie kann sich noch gut erinnern, wie ihr Vater das Bild gemacht hat. Da war sie elf und Wolfgang neun.
»Gerda, kannst du nicht einmal in deinem Leben lächeln?«, hatte ihr Vater gesagt. Tante Gerda konnte nicht. Aber Wolfgang. Der hatte ein angeborenes Lächeln. Wenn man gar nicht lächeln kann, ist das wirklich schrecklich. Doch wenn man immer lächelt, dann ist das noch schrecklicher. Renate hatte miterlebt, wie Wolfgang verdroschen wurde, auch von ihrem Bruder Peter. Die meinten einfach, er lache sie aus. Einmal lief das Blut aus Wolfgangs Nase direkt in seinen lächelnden Mund.
»Das ist das einzige Bild, das ich gefunden habe, Peter. Das lag in der Tischschublade. Da ist Wolfgang noch ein Kind. Das können wir doch nicht nehmen.«
»Wir brauchen auch kein Bild. Hab ich gleich gesagt.«
»Zu einer Beerdigung gehört doch ein Sterbebild.«
»Sagt wer?«
Renate antwortet nicht. Das hätte auch keinen Sinn. Wenn Peter sich festgelegt hat, dann bleibt es dabei. So war ihr älterer Bruder schon immer. Er hat das Sagen. Sonst niemand. Dass Inge es fast zwanzig Jahre mit ihm ausgehalten hat, ist Renate heute noch ein Rätsel. Peter ist genauso wie Vater war. Immer Recht haben. Nur die eigene Meinung zählt. Stur wie ein anatolischer Esel. Seit Inge weg ist, wurde Peter noch seltsamer und eigensinniger. Renate ist froh, dass sie ihn kaum noch sieht. Wenn Inge nicht gewesen wäre, hätte sie den Kontakt zu ihm noch früher abgebrochen. Als Kind war sie stolz auf ihren großen Bruder, er hatte sie immer beschützt und verteidigt. In ihrer Bande »Schwarze Patrone« war Renate die Vertreterin des großen Anführers Peter. Als Mädchen! Ende der 1950er-Jahre! Heute, wenn sie Peter darauf ansprechen würde, dann würde er das leugnen. »Du bist doch plemplem im Kopf«, würde er sagen. So war immer sein Spruch. Plemplem. Das war auch das erste, was er zu ihr sagte, als sie ihm am 21. Juli 1969 Ali vorstellte. Ali aus Anatolien. »Du bist doch vollkommen plemplem im Kopf«, hatte er sie angebrüllt und Ali mit einem Fußtritt aus seiner Wohnung befördert. Am liebsten hätte er ihn auf den Mond geschossen, aber da waren schon die Amerikaner. Renate hat Ali trotzdem geheiratet, vielleicht auch gerade deshalb. Heute würde sie Ali selbst zum Mond schießen, aber man weiß nicht, ob die Amerikaner dort nicht schon alles reserviert haben für ein paar ihrer Leithammel.
»Lauter Gerümpel. Ich hab das befürchtet. Von wegen Wertgegenstände. Schade um die Zeit.«
»Wir sind die einzigen Verwandten, Peter. Jemand muss sich doch drum kümmern. Das sind wir dem Wolfgang schuldig.«
»Dem Wolfgang schuldig! Dass ich nicht lache. Bist du ein bisschen plemplem im Kopf? Wie lange haben wir den Wolfgang nicht mehr gesehen? 40 Jahre? 50 Jahre? Wir würden ihn nicht mal mehr erkennen, wenn er noch leben würde.«
»Ich würd ihn noch kennen. Ganz bestimmt. Der Bestatter hat gesagt, er muss einsam gewesen sein. Er hatte einen traurigen Blick, als sie ihn gefunden haben.«
»Ha, ha, ha. Wahrscheinlich würde er sich jetzt gerade kaputtlachen, wenn er uns von da oben, was du wahrscheinlich glaubst, zusehen könnte, wie wir uns für ihn abrackern und seinen Müll entsorgen.«
»Auch wenn das hier für dich alles nur Müll ist, Peter, für das Haus bekommen wir doch auch einiges. Ist das nichts?«
»Für das Haus! In Neu-Torfheim! Wie weltfremd bist du denn, Schwester? Direkt in der Einflugschneise. Wer will da hin? Wir können froh sein, wenn wir die Beerdigungskosten und Entsorgungskosten reinholen. Was ja irgendwie dasselbe ist. Deshalb Beerdigung so billig wie möglich. Geht das rein in deinen Kopf? Karl, wo bist du eigentlich, schläfst du wie immer?«
Karl steht vor dem alten Bauernschrank in Wolfgangs Schlafzimmer. Peter hat ihn nach oben in diesen Raum geschickt, weil Karl eh keinen Geruchssinn mehr hat. Eine Folge des Unfalls von damals. So konnte Karl unbeschwert in das Zimmer gehen, in dem man Wolfgang gefunden hatte. Der lag da immerhin einige Wochen. Entsprechend der Geruch. Tatortreiniger war Fehlanzeige. Wo kein Tatort, da auch kein Reiniger. So einfach ist das. Das ist der Nachteil eines natürlichen Todes. Unbekannte Türen sind ein Gräuel für Karl. Davor hat er Angst. Schon einmal in seinem Leben musste er durch eine unbekannte Tür. Seitdem hört er nicht mehr gut, riecht nichts, und seine Gedanken kommen oft nicht mehr zu einem rationalen Ergebnis. Man könnte auch sagen, er denkt quer. Aber Peter hat gesagt, er müsse alles genau anschauen, auch in den Schrank rein. Das Bett war kein Problem, wenn man nichts mehr riecht. Unansehnliche Flecken, aber davor hat Karl keine Angst. Im Bett war sonst nichts. In der Schublade des Nachtschränkchens hat er eine Praline gefunden. Keine zum Essen. Nur zum Anschauen. Eine Zeitschrift aus den 1980er Jahren. Schöne Busen. Ja, dafür hat auch Karl ein Auge. Aber jetzt der große Schrank. Wenn er wüsste, dass der nur mit Pralinen gefüllt wäre. Aber das kann man ja nicht wissen. Leider eine Holztüre. Glas wäre besser. Das ist ihm schon klar. Querdenken hin oder her. Eine unbekannte Tür in Wolfgangs Zimmer. Ausgerechnet Wolfgang. Der war doch auch dabei, oder? Der war es doch, der …, oder nicht? Da hat er jedenfalls keine guten Erinnerungen. Was, wenn dieses Mal wieder….
»…. schläfst du wie immer?«, hört er Peter von unten brüllen. Karl reißt die Schranktür mit einem Ruck auf und lässt sich im selben Augenblick auf den Boden fallen, beide Hände an den Ohren. Nichts passiert. Kein Knall, kein Blitz. Alles still. Er hört nur sein Herz. Schnell rast das, sehr schnell. Das beruhigt sich schon wieder. Das weiß Karl aus Erfahrung. Ein bisschen muss er noch liegen bleiben. Nur ein bisschen. Er betrachtet die Dachschräge. Holz. Fichte wahrscheinlich. Viele Äste. Teilweise auch Astlöcher und Harzspuren. Könnte also auch Tanne sein. Oder Kiefer? Eher nicht. Bei Kiefer fallen die Äste nicht so leicht heraus. Hat er mal im Fernsehen gesehen. Karl beginnt, die Äste zu zählen. Bei dreihundertsiebenundvierzig steht Peter in der Zimmertür.
»Wusste ich’s doch. Schläft hier in Seelenruhe, als hätten wir Zeit bis zum Sankt-Nimmerleinstag. Du bist nicht mehr in der Oberfinanzdirektion, Karl. Da konntest du dir das erlauben. Das ist vorbei. Und? Schon was Brauchbares gefunden? Pfui Teufel, stinkt es da. Jetzt aber dalli!«
Karl hat keine Gelegenheit zu antworten. Peter ist schon wieder weg. So schnell er kann, ist er wieder auf den Beinen. Sein Herz hat sich beruhigt. Dreihundertsiebenundvierzig! Wenn er bis fünfhundert gekommen wäre, würde sein Herz wieder ganz normal schlagen. Aber dreihundertsiebenundvierzig ist in Ordnung. Vorsichtig schaut er in den Schrank. Sein Herz schlägt wieder schneller. Es ist bei zweihundertzehn Ästen angekommen. Fünf Unterhosen, drei Paar Socken, drei Unterhemden, eine Jeans, eine kurze Lederhose, drei langärmelige Hemden, zwei kurzärmelige Hemden, zwei Pullover, eine dicke Jacke und eine dünne Jacke. Viele Plastiktüten. Mehr ist nicht im Schrank. Doch. Unten am Boden gibt es noch einen Karton. Karl zieht ihn vorsichtig heraus. Schweiß steht auf seiner Stirn. Herz? Einhundertvierundzwanzig Äste. Als er ihn öffnet, ist er fast wieder bei null Ästen angekommen. Zwei Leitzordner, ein Notizbuch, ein Kuvert, eine Visitenkarte und lose Blätter. Da freut sich Karl, denn jetzt wird sich auch Peter freuen, wenn er etwas gefunden hat. Es ist gut, wenn sich Peter freut. Das war immer so. Wenn Peter sich freut ist die Welt in Ordnung. Er muss nur noch sein Herz beruhigen, dann kann er zu Peter gehen. Also noch mal Äste zählen. Wenigstens zweihundertfünfzig. Zufrieden mit sich und mit dem Karton stapft Karl die alte Holztreppe runter und präsentiert Peter seine Fundstücke.
»Im Schrank, Peter. Das hab ich gefunden. Schau. Gut gemacht?«
»Sonst nichts?«
»Sonst auch noch was.«
»Ja und was? Muss man dir alles aus der Nase ziehen?«
»Eine Hose, lang. Eine Hose, kurz. Zwei Pull…«
»Hast du in den Hosentaschen nachgesehen, ob da was drin ist?«
Karl schüttelt den Kopf.
»Abmarsch!«
Karl geht wieder nach oben. Traurig. Wenigstens gut gemacht hätte Peter sagen können. Er will doch alles gut machen.
»Musst du Karl immer so kommandieren, Peter? Das ist dein Bruder und nicht dein Lakai.«
»Unser Bruder braucht klare Ansagen. Das weißt auch du. Schau mal. Nicht zu glauben. Hat der Arsch sein ganzes Leben nichts gearbeitet?«
Peter hält Renate den Rentenbescheid, den er im Karton gefunden hat, unter die Nase.
»Fünfhundertachtzehn Euro! Ich krieg die Krise. Wovon hat der Kerl gelebt?«
»Wolfgang war halt genügsam, Peter. Er musste keine Miete zahlen, er hatte kein Auto, er war bestimmt…«
»Pemplem war der. Plemplem. Ich zahl die Beerdigung nicht. Am liebsten würde ich ihn da im Garten verscharren lassen.«
»Das ist nicht erlaubt, Peter.«
»Das weiß ich selbst auch, Schwester. Oder glaubst du, ich bin blöd?«
»Schau mal, Peter. Da im Leitzordner sind Kontoauszüge. Da sind immerhin über sechstausend Euro drauf.«
Peter reißt ihr den Ordner aus der Hand und sieht sich den letzten Auszug an.
»Bis jetzt war ich mir nicht sicher, aber jetzt weiß ich es, Schwester. Auch du bist plemplem. Sechsttausend Euro und ein paar Zerquetschte sind drauf. Aber Miese!«
Putz bröckelt von der Wand ab, als der Ordner dort landet und eine weiße Schramme hinterlässt. Die Gesichtsfarbe von Peter hat sich entsprechend angepasst. Nicht der Schramme, sondern der noch heilen Wand. Die Wand ist dunkelrot. Die einzige Wand im Haus mit dieser Farbe.
Das war Renate als Erstes aufgefallen, als sie das Haus betrat. Die Farben. Fast jede Wand eine andere Farbe. In der Diele die linke Wand gelb, die rechte Wand orange. Das Badezimmer hatte wohl einmal weiße Fliesen, die sind jetzt mit blau überstrichen, hellblau, auch die Fugen. Der Boden dunkelblau. Die Küche ist grün, jede Wand ein anderer Grünton. Am auffälligsten sind die Wände im Wohnzimmer. Das wirkt einerseits interessant, aber auch wieder befremdlich. So eine Farbenzusammenstellung hat sie noch nie irgendwo gesehen. Blau, braun, cyan und rot. Wenn man sich in diesem Zimmer langsam dreht, erlebt man völlige Stimmungsschwankungen, wenn man sich schnell dreht, glaubt man zu schweben. Karl hatte das beim ersten Betreten auch sofort bemerkt. Er drehte sich unaufhörlich und rief »ich fliege, Renate, ich fliege«, und sie antwortete ihm »schön, Karl, aber nicht so schnell, sonst wirst du schwindelig.« Peter sagte »Plemplem.« Die Wand neben der Treppe ist grau und das Schlafzimmer, das sich über das ganze Dachgeschoss erstreckt, ist schwarz gestrichen. Zwei Wände sind das. Der Ostgiebel und der Westgiebel. Auf den beiden anderen Seiten des Zimmers geht der Dachstuhl bis zum Boden. Kein Kniestock. Das Bett steht mitten im Raum, im Rücken an der Ostwand ein Kleiderschrank und in der gegenüberliegenden Wand ein einflügliges Fenster. Diese schwarze Wand ist mit weißen Schmetterlingen bemalt, die links und rechts vom Fenster wegfliegen. Renate war bei diesem Anblick sogleich befremdlich bedrückt, aber auch irgendwie von Sehnsucht erfüllt. Sie konnte jedoch nicht darüber nachdenken, weil sie den Raum wegen des penetranten Leichengeruchs auf der Stelle wieder verlassen musste. Wenn sie jetzt die Augen schließt, sieht sie sofort die Schmetterlinge. Große und kleine.
Renate nimmt das Kuvert aus dem Karton und öffnet es.
»Oh Peter, da sind ja doch noch Fotos. Aber … aber kein Bild von Wolfgang. Nur Frauen, Mädchen. Vier, vier verschiedene.«
»Dann nimm doch eines für das Sterbebild, wenn du unbedingt eines willst«, lacht er sie aus.
»Sehr witzig. Ob das seine Liebschaften waren?«
»Liebschaften! Wie sich das anhört. Wenn er sein ganzes Leben nur vier Weiber hatte, dann hat er eh umsonst gelebt.« So gesehen lebte Peter nicht umsonst. Er ist jetzt neunundsechzig. Tennis, Golf, Segeln gehört nach wie vor zu seinen Leidenschaften. Früher ist er auch noch Marathon gelaufen. Seine Figur konnte er sich bis heute bewahren. Sein Haar ist nach wie vor dicht und schwarz. Kein bisschen grau. Vor ein paar Jahren hat ihn ein Tennisgegner angesprochen, ob er sich das von Gerhard Schröder abgeschaut hätte. Daraufhin hat er seinen Tennisschläger zerbrochen, nicht am Netz oder am Boden, sondern am Gegner. Ein weiteres Hobby ist die Jagd. Peter behauptet von sich, in seinem Leben habe er nicht wenige kapitale Hirsche erlegt, jedoch noch weit mehr Weiber flachgelegt. Eine höhere dreistellige Zahl sei das. Die in den Bordellen nicht mitgezählt. Das ganze Leben bestehe aus Jagd. Vater hat ihm beim Abitur ein bisschen geholfen, mit einer großzügigen Spende an die Schule und dann studierte Peter auf Geheiß von Vater Jura, zehn Semester. Im elften Semester hat er nicht mehr studiert, dafür aber weiter demonstriert. Es interessierte ihn nicht wofür, aber bei diesen Demonstrationen gab es immer enthemmte Weiber. Als Vater das mitbekam, verschaffte er ihm eine vielversprechende Position in einem großen Münchner Rüstungskonzern. Peter hatte zwar kein Examen, Vater kannte jedoch aus seiner eigenen Studentenzeit in Berlin Onkel Otmar und Onkel Kurt Georg. Die drei waren damals in der Studentenverbindung Askania aktiv. Peter kannte beide Onkel nicht, einer hatte 1969 was mit Geld und Banken zu tun, der andere war wohl in der Politik. Im Münchner Rüstungskonzern kannte man die beiden Onkel offensichtlich sehr gut. Das merkte auch Peter schnell, denn immer wenn Vater dort schöne Grüße von den Onkeln ausrichten ließ, stieg Peter eine Stufe höher auf der Karriereleiter. 1970 heiratete Peter die Studentin Inge. Inge fiel eigentlich gar nicht in sein Beuteschema, er hatte sie jedoch geschwängert. Da müsse er wohl besoffen gewesen sein, behauptet er noch heute. Vater bestand auf die Heirat. Man müsse immer zu seinen Taten stehen, das war sein Grundsatz, auch wenn er nie zu seinen eigenen Taten in der NSDAP stand. »Es wär eh nur ein Mädchen gewesen«, sagte Peter nach Inges Fehlgeburt. Sie war auf der Treppe gestolpert. Wie das passieren konnte, darüber schwieg sich Inge immer aus. Sie wurde nie mehr schwanger. Wie auch? Inge war treu und Peter hat sie nie mehr angerührt. Er hatte ja überall seine Weiber. 1990 starben die Eltern von Inge bei einem Verkehrsunfall. Peter ging nicht mal zur Beerdigung. Zwei Wochen später war Inge weg. Aber nicht nur sie, sondern auch der Inhalt des Schließfachs bei der Deutschen Bank. Wie Inge an den Schlüssel kam, ist Peter noch heute ein Rätsel. Achtundzwanzig Kilogramm Gold. Weniger der Verlust des Goldes hat ihn geärgert, desto mehr aber der Umstand, dass Inge das geschafft hatte. Ausgerechnet Inge, die plemplem im Kopf war und mit der er umspringen konnte wie er wollte. Das wurmte und wurmt noch heute. Achtundzwanzig Kilogramm! Da kann sie nicht alleine gewesen sein. Zwei Detektive setzte er ein. Die Spur führte in die ehemalige DDR. Dort verlief sie sich. Einmal kam eine Ansichtskarte aus Kuba. Mit einem aufgemalten, lachenden Gesicht. Die Karte hat er als Toilettenpapier missbraucht. Dabei merkte er schnell, dass sich Karten dazu nicht missbrauchen ließen.
»Schau Peter. Hab was gefunden. Taschenmesser. Sonst nix in den Hosentaschen. Nur das noch«, verkündet Karl freudig seinen Fund und hält ihn Peter entgegen.
Nur das noch ist ein angeschnäuztes Taschentuch, das ihm Peter aus der Hand schlägt. Das Taschenmesser reißt er ihm aus der anderen.
Ein silbernes Messer. Mit Verzierungen. Eichenlaub und ein Adler. Außerdem gibt es noch einen Spruch. Deutschland erwacht.
»Das gehörte Vater. Das hat ihm diese Drecksau geklaut.«
»Das ist nicht wahr, Peter. Das hat Vater Wolfgang geschenkt. Das war nach Karls Unfall. Als sie von Kempfenhausen weggingen.«
»Sag mal, Schwester, wie plemplem bist du eigentlich? Das Messer hätte Vater niemals verschenkt und wenn, dann mir. Aber schon gar nicht diesem Idioten. Außerdem war das kein Unfall, sondern Vorsatz.«
Renate widerspricht nicht. Warum auch. Es würde nichts bringen. Sie weiß es besser und Wolfgang hätte von ihrem Widerspruch auch nichts mehr. In einem hat Peter allerdings recht. Es war kein Unfall, sondern tatsächlich Vorsatz, allerdings ganz anders als Peter es suggeriert.
Peter lässt das Messer in seiner Hosentasche verschwinden.
»Jetzt hat es wenigstens sein rechtmäßiger Besitzer.«
»Na, dann hat sich die Fahrt hierher für dich ja schon mal gelohnt.«
Peter überhört die Spitze von Renate und schiebt mit der Fußspitze das am Boden liegende Taschentuch zu Karl.
»Da Bruder. Das kannst du behalten.«
»Mag ich nicht, kannst du selber haben«, wagt Karl trotzig zu entgegnen, was in seinem Leben sehr selten vorkommt. Am Gesicht von Renate merkt er, dass er das richtige gesagt hat. Er hat im Schrank noch eine weitere Praline gefunden. Das sagt er dem Peter nicht. Er ist ja nicht plemplem, auch wenn Peter das glaubt. Die zwei Pralinen hat er in sein Hemd geschoben. Da können sie zunächst mal bleiben. Die können nicht schmelzen. Das weiß er.
Karl ist sehr dünn, er kann nicht viel essen. Isst nur in kleinen Etappen, sonst ist der Beutel seines künstlichen Ausgangs zu schnell voll. Sein Gesicht wirkt eingefallen, und seine blonden Haare sind nicht mehr so dicht wie früher, sie sind angegraut. Karl hat keinen Schulabschluss. Dabei war er ein aufgewecktes Bürschchen. Bis zu seinem sechsten Geburtstag. Da war der Unfall. An seinem siebten Geburtstag war er immer noch im Krankenhaus. Aber nicht mehr lange. Nur noch einen Monat. Mit Acht hat man ihn eingeschult. Doch das Denken fiel ihm schwer, und das Hören auch. Vater hat ihn dann mit dreizehn von der Schule genommen. Er hätte eigentlich bis vierzehn bleiben müssen, aber Vater hatte einen Onkel im Kultusministerium. Onkel Hans. Der sagte, das gehe schon in Ordnung. Dann hat Karl den Gärtnern geholfen. Zwei Gärtner arbeiteten für Vater, denn so ein Garten will gepflegt sein, hat Vater immer gesagt. Und die können jede Hilfe gebrauchen, das hat er auch gesagt. Nach sieben Jahren wollte Karl aber nicht mehr helfen, weil seine Fingernägel immer schwarz waren von der Erde. Das gefiel ihm nicht mehr, weil das auch den Mädchen nicht gefiel. So hatte Helga ihm das mal erklärt. Die Helga, die die Eintrittskarten in dem Tanzlokal abriss, in das Karl immer ging um zu tanzen, aber nie zum Tanzen kam, weil die Mädchen immer nein sagten. Vater kannte jemanden im bayerischen Finanzministerium. Onkel Anton. Ein hohes Vieh, sagte Vater. Dieses hohe Vieh hat ihn dann direkt zur Oberfinanzdirektion gebracht. Mit dem Vater sind sie da hin gegangen und das Vieh hat dort zum Chef gesagt, »da bring ich dir einen Schwerbeschädigten und den stellst du sofort ein, weil das ist der Sohn vom Walter, du weißt schon!«. Aber gleich musste er nicht arbeiten. Erst ist er mit dem Vater und dem Onkel Anton noch in den Wienerwald gegangen und dort haben sie jeder ein ganzes Hendl gegessen. Schön braun gegrillt waren die. Eine schöne Farbe, hat der Vater gesagt und dann haben sie gelacht, der Onkel Anton und der Vater. Die Hendl hatten nicht einmal was gekostet, denn die hat der Wienerwaldchef selbst gebracht. Der Onkel Friedrich. »Bist auch wieder mal da?«, hat der zum Onkel Anton gesagt und der hat dann gemeint: »Ich hab halt wenig Zeit, ich bin schließlich bei den Finanzen und da muss ich steuern«. Und dann haben sie wieder gelacht, auch der Onkel Friedrich. So war das. Am nächsten Tag war der Karl dann schon Beamter. Schwerbeschädigt halt. Die Fingernägel waren jetzt immer sauber. Tanzen wollten die Mädchen im Park Café trotzdem nicht mit ihm. Vierzig Jahre hat er in der Sophienstraße gearbeitet. Fünfunddreißig Jahre davon für die Oberfinanzdirektion. Dann hatte diese ausdirigiert. Es gab in Bayern nur noch eine in Nürnberg. Da ist der Karl aber nicht hingegangen, denn in Nürnberg sind nur Franken und die mag er nicht. Die reden so komisch. Aber in München ist er geblieben. Das Hauptzollamt ist in die Sophienstraße gezogen. Die haben ihn übernommen. Waren ja nur noch fünf Jahre bis zur Pensionierung. So hat er, wie vorher für die Oberfinanzdirektion, jetzt halt für das Hauptzollamt Akten hin und her getragen. Wenn es zu viele waren, ist er mit einem Handwagen gefahren oder einfach mehrmals gelaufen, so ist der Tag schneller vergangen. Heute lebt er in einem Wohnheim in Giesing.
»Haftpflichtversicherung und Brandversicherung, das ist alles, was der Trottel an Versicherungen hatte«, brüllt Peter während er in dem zweiten Leitzordner blättert. »Ein Auto gab es scheinbar auch mal. Hab aber draußen keines gesehen. Wir schlagen das Erbe aus, da ist nichts zu holen, außer Schulden. Wer weiß, was da neben den Sechsttausend noch alles auf uns zukommen würde. Los, wir fahren.«
»Ich bleibe und führe das hier zu Ende. Und wenn du das Erbe ausschlagen möchtest, Peter, dann mach das. Ich nicht. Karl, wie sieht’s bei dir aus?«
»Ich schlage auch niemanden.«
»Ich helfe euch nicht aus, wenn ihr mit den Schulden nicht zurande kommt.«
»Und wir geben dir auch nichts ab, wenn wir noch etwas finden oder mit dem Haus doch noch Gewinn machen, Peter.«
Peter wirft den zweiten Ordner an die Wand. Dieses Mal hatte ihn die braune Wand darum gebeten. Er ist sich sicher, dass hier nichts zu holen ist, aber wenn doch? Er ist beileibe nicht darauf angewiesen, er hat wirklich mehr als genügend zum Leben. Den Geschwistern würde er es jedenfalls nicht vergönnen, wenn doch noch etwas übrigbleiben sollte.
Das weiß auch Renate. So konnte man Peter schon immer locken. Als Kind hatte sie beim Osternestsuchen, nachdem schon alle Nester gefunden waren, einmal behauptet, sie habe den Osterhasen nochmal rennen sehen. Peter suchte dann, bis es dunkel wurde. Erst dann gab er ihr eine Ohrfeige. Das machte ihr aber nichts aus, denn Ohrfeigen bekam sie auch ständig vom Vater. Das gehörte zum guten Ton in der Familie. Selbst die Mutter blieb davon nicht verschont. »Zucht und Ordnung schadet weder der Jugend noch der deutschen Frau«, hat Vater oft gesagt. »Man muss den Fuß in der Tür haben, wenn sie offen ist«, hat er auch immer gesagt und so hat er seinen Fuß reingehalten, als ihm Onkel Fritz eine Villa in Kempfenhausen am Würmsee anbot. Onkel Fritz brauchte die nicht, der hatte schon eine am Schliersee in Aussicht, die er ein paar Jahre später für 6988,50 Mark kaufte. Außer den Ohrfeigen wuchs Renate dort sehr behütet auf. In der Schule war sie sehr gut, viel besser als Peter. Eines Tages kam ein Brief vom Lehrer, der Vater solle in der Schule vorsprechen. Der Vater antwortete ihm, wenn er etwas wolle, dann solle er gefälligst in die Villa kommen, was der Lehrer dann auch tat. Er schlug dem Vater vor, Renate auf die höhere Schule zu schicken, da sie sehr begabt sei. Der Vater aber sagte, ein Dorflehrer habe ihm nichts vorzuschlagen und ein deutsches Mädchen sei dazu geboren, hinter dem Herd zu stehen und Kinder zu bekommen. Dazu brauche es keine höhere Schule. Mit vierzehn Jahren fing sie dann bei der Deutschen Bundesbahn eine Ausbildung an. Jetzt konnte sie es dem Vater heimzahlen, denn am Hauptbahnhof kamen Züge aus Istanbul an, mit vielen hübschen Männern. Einige zumindest. 1966 stand plötzlich Ali mit einem Koffer vor Renate und zeigte ihr einen Zettel mit der Adresse eines Wohnheimes. Ali konnte nur ein deutsches Wort. Danke. Er tat Renate leid, wie er da so hilflos stand und so nahm sie sich ein Herz und eine Hand von ihm und führte ihn an dieser zum Wohnheim einer Baufirma. Da sie wissen wollte, wie er in dem fremden Land zurechtkam, besuchte sie ihn manchmal. Schnell konnte er schon viel mehr deutsche Wörter, und weil sie ihm noch mehr deutsche Wörter beibringen wollte, nahm sie ihn ein halbes Jahr später wieder an die Hand und führte ihn dieses Mal in ihre Wohnung. Dort gefiel es ihm und deshalb blieb er. Ali war ausdauernd. Nicht nur beim Wörter lernen. Das gefiel wiederrum Renate. Teschekürlasch, sagte sie dann. Bald konnte sie auch ein wenig mehr türkisch sprechen. Nach einem Jahr fuhr Ali heim zur Familie und brachte Renate von seinem Urlaub einen ganzen Koffer getrockneter Aprikosen mit. »Geschenk von meiner Mutter«, sagte er. »Nächstes Mal soll ich bringen dich mit. Aber da fahren wir nicht mit Zug, sondern mit Mercedes. Ich habe neue Stelle bei BMW«, sagte er auch noch. Im Mai 1969 kaufte sich Ali einen gebrauchten Mercedes für zweitausend Mark. Mit dem wollte er auch zur Arbeit fahren, um ihn seinen Kollegen zu zeigen, aber Renate sagte, er solle lieber weiter mit dem Bus fahren, weil ein Mercedes auf dem BMWParkplatz sei ein schwarzes Schaf. Das verstand Ali nicht, denn der Mercedes war weiß und hatte Räder, doch er hielt sich an ihren Rat. Im Juli machte er Renate einen Heiratsantrag, er wollte aus traditionellen Gründen bei ihren Brüdern und ihrem Vater um die Hand anhalten. Von Karl lernte er mir Wurst, von Peter plemplem, und der Vater las ihm die Leviten, obwohl Ali ein Alevit war. Die Mutter bekam er nicht zu Gesicht, weil der Vater die Tür versperrte. In Kuluncak wurde Renate ein Jahr später herzlich empfangen. Dort war die Hochzeit, die fünf Tage dauerte. Vor der Hochzeit musste sich Renate aber noch vor der Mutter und Alis Schwestern nackt ausziehen. Dann mischten sie Zitronensaft, Zucker und Wasser zusammen und kochten das Gemisch auf einem Holzherd. Die zähe Masse strichen sie ihr auf die Scham und entfernten sie mit einem Ruck. Renate brüllte. Die Frauen lachten und sagten etwas, das wie aada klang, Renate sah aus wie sie mit zehn Jahren ausgesehen hatte. Und so war sie im zwanzigsten Jahrhundert schon eine deutsche Frau wie aus dem einundzwanzigsten, nur nicht tätowiert und ohne Piercing. Zwei Jahre später brüllte Renate wieder. Dieses Mal in Harlaching, als sie den kleinen Ali gebar. Den Enkel wollte sie dann ihrem Vater und ihrer Mutter zeigen, aber der Vater sagte, das sei kein Enkel, sondern ein Türke und die Mutter ließ er wieder nicht an die Tür kommen. 1978 fuhr Renate mit den zwei Alis in einem neuen Mercedes in die Türkei. Sie kauften sich eine Aprikosenplantage und blieben dort. Ab 1985 arbeitete der große Ali immer weniger. Er vertrieb sich die Zeit lieber mit alten Männern, um mit ihnen Backgammon zu spielen. Er sei Alevit, und deshalb zeichne ihn Bescheidenheit und Geduld aus. Mit der war Renate schließlich am Ende. Als 1987 ihr Vater starb, flog sie zur Beerdigung mit dem kleinen Ali heim und erfuhr dort vom anwesenden Ministerpräsidenten bei dessen Trauerrede, dass Vater stets ein treuer und loyaler Weggefährte und Jagdkamerad gewesen sei, ein Vorzeigemann der Nation und ein vorbildlicher Familienvater. Da Vater so loyal war, holte er den Ministerpräsidenten ein Jahr später zu sich in die ewigen Jagdgründe. Vater hatte Renate enterbt, aber mit dem ihr zustehenden Pflichtteil eröffnete sie auf dem Viktualienmarkt einen Obstund Gemüseladen und kaufte sich eine Doppelhaushälfte in Moosach, in die sie mit ihrer Mutter einzog. Peter bewohnte die Villa. Etwas über zehn Jahre lebte Mutter noch bei Renate. Ihre letzten Worte zu ihr waren, »danke für die schönste Zeit meines Lebens.« Der kleine Ali, der dreißig Zentimeter größer als der große Ali ist, beliefert Renate bis heute mit frischen und getrockneten Aprikosen aus Ostanatolien. Der große Ali ist nach wie vor bescheiden. Mutter ist zu Beginn des neuen Jahrtausends gestorben, konnte ihren Mann aber in den ewigen Jagdgründen nicht finden, da sie sofort eine Etage höher angesiedelt wurde. Einmal im Jahr fährt Renate in die Türkei. Dort ist sie von den meisten türkischen Frauen nicht zu unterscheiden, vor allem wenn sie ein Kopftuch trägt. Aprikosenmarmelade ist ihre Lieblingsspeise. Davon isst sie täglich ein Glas. Das erinnert sie an den jungen Ali, an den alten auch, aber der ist ihr inzwischen egal. Vor zehn Jahren hatte sie noch Kleidergröße achtunddreißig. Heute hat sie…, aber darüber spricht sie nicht.
»Mir tut Wolfgang echt leid. Er muss sehr einsam gewesen sein, keine Bilder, nichts Persönliches von ihm zu finden. Ein paar vergammelte Lebensmittel. Unzählige Papiertüten, Plastiktüten, Gummibänder, leere Gläser, kahle Wände.«
»Aber bunte Wände, Renate, bunte Wände«, antwortet Karl und dreht sich.
»Das schon, ja. Ich mach mir Vorwürfe, weil wir ihn nie besucht haben. Neu-Torfheim ist gerade mal dreißig Kilometer von München entfernt.«
»Jetzt hör bloß mit der Gefühlsduselei auf. Er hat dich ja auch nicht besucht, Schwester. Da schau, das ist eine Visitenkarte von Vater. Er hat uns nicht mal Bescheid gegeben, als Tante Gerda starb.«
»Ja. Das wundert mich noch heute.«
»Mich nicht.«
»Das einzige Persönliche ist hier das Notizbuch. Das hatte Wolfgang schon mit neun. Ich kann mich noch erinnern. Das hat er von Vater bekommen. Zum Geburtstag. Da sind nur Jahreszahlen drin und… und ein paar Stichworte. Und Liedertexte könnten das sein. Das müssen wir uns genauer anschauen.«
»Wir müssen gar nichts. Jetzt gehen wir in den Keller, vielleicht gibt’s wenigstens da noch was Brauchbares. Und dann ist es gut.«
»Ich gehe nicht in den Keller«, ruft Karl angstvoll.
»Das musst du auch nicht, Karl. Du kannst schon mal alles, was du alleine tragen kannst, zum Container rausbringen«, tröstet ihn Renate.
Die Kellertreppe ist sehr steil. Dort unten gibt es einen Heizungsraum mit einem Öltank. Er ist vollgestellt mit Kartons, befüllt mit Geschenkpapier, Zeitungen, Joghurtbechern, Gläsern und Quelle-Katalogen. In der daneben liegenden Waschküche steht eine AEG-Waschmaschine mit leuchtend rotem Lämpchen. Im Inneren liegt noch Wäsche. Als Renate die Maschine öffnet, kommt ihr ein unangenehmer, muffiger Geruch entgegen. Die Wäsche ist mit Schimmel überzogen. Schnell verschließt sie wieder die Fensteröffnung. Die Constructa-Wäscheschleuder ist leer. In einem Korb befindet sich Schmutzwäsche, die Wolfgang wohl noch waschen wollte. An einer Wand hängt ein Schränkchen mit Werkzeug. Hammer, Zangen, Schraubenzieher, Vierkantschlüssel. Daneben ein Regal mit ein paar verrosteten Schrauben und Nägeln, zwei Sägen, eine Gartenschere und eine alte Bohrmaschine. An das Regal ist ein Damenfahrrad gelehnt. Drei-Gang-Nabenschaltung. Das Rad und das Regal sind eine Einheit, verbunden mit Spinnfäden.
»Ist das nicht das alte Fahrrad von Mutter?«
»Kann schon sein. Haben sie wahrscheinlich auch geklaut.«
»Die haben nichts geklaut, Peter.«
»Der hat gelebt wie ein Penner. Und so was ist mit mir verwandt. Pfui Teufel.« Angewidert reißt Peter einen löchrigen Wandteppich herunter, hinter dem eine Tür zum Vorschein kommt. Die Tür ist verschlossen. »Warum ist die verschlossen? Verdammte Scheiße, warum ist die verschlossen?«. Peter nimmt sofort Witterung auf. Peter mutiert. Vom Jäger zum Jagdhund. Zornig rüttelt er an der Klinke, setzt seine Fäuste und seine Füße ein und wirft sich schließlich in Schimanskimanier mit der Schulter gegen das Türblatt. Die Tür bleibt unbeeindruckt, was den Jagdhund noch wütender macht. Zähnefletschend bellt er die Tür an, dann Renate und dann wieder die Tür. Im Werkzeugschränkchen gibt es keinen Hobel und so bleiben die gebellten Ausdrücke ungehobelt. Viele katholische Heilige müssen jetzt dran glauben. Peter ist nicht gewöhnt, dass Türen vor ihm verschlossen bleiben. Bisher ließ er sie von anderen öffnen oder sie öffneten sich von selbst. Winselnd lässt sich der Jagdhund auf den Boden fallen, um neue Kräfte zu sammeln, um schließlich zur angeschossenen Wildsau zu werden, die die Waschmaschine umwirft, den Werkzeugschrank von der Wand reißt und das Fahrrad gegen die Tür schleudert.
Renate zieht den Schlüssel von der Waschküchentür aus dem Schloss und sagt: »Vielleicht passt der ja auch dort.«
Eine Minute später stehen Peter und Renate wie angewurzelt nebeneinander. Sie bewegen sich nicht. Sie sind starr. Nur ihre Augen sind in Bewegung und haben den Glanz, den Kinderaugen haben, wenn sie das erste Mal in ihrem Leben einen Christbaum erblicken. So etwas lässt sich fast nie mehr im Leben wiederholen. Aber jetzt ist das wie Winter, Tür auf, Sommer. Alaska, Tür auf, Seychellen. Autobahn, Tür auf, Wald. Magentropfen, Tür auf, Honig. Nacht, Tür auf, Tag. Oktoberfest, Tür auf, Mozart oder Jauchegrube, Tür auf, 4711. Falsch. Andersrum. 4711, Tür auf, Jauchegrube. Peter fängt sich als Erster.
»Ich hab es immer gesagt, der ist plemplem.«
Hinter der Tür herrscht eine andere Welt. Die Wände rot gestrichen, himbeerrot, der Teppichboden ist rot, himbeerrot und der Raum verströmt einen süßen, angenehmen Geruch. Es riecht nach Himbeeren. An der linken Wand stehen drei Gitarren. Eine Akustikgitarre, Naturholz. Eine E-Gitarre, Gibson, golden. Eine Fender-Stratocaster, weiß. An der rechten Wand befindet sich ein Gitarrenverstärker mit Lautsprecher. Marshall steht darauf. Daneben ein Regal mit CDs, DVDs, und einer Stereoanlage. Die Boxen stehen an der zur Tür gegenüberliegenden Wand. Sie sind schwarz und fast zwei Meter hoch. Zwischen den Boxen ist eine weiße Leinwand gespannt. Vom Boden bis zur Decke. Vier Meter breit. Neben der Tür ein Beamer. An die Wand geschraubt. Alles wirkt nagelneu. Edel. Peter reißt die Leinwand herunter. Es kommt ein Regal zum Vorschein. Mit Gläsern. Keine leeren Gläser, sondern gefüllt. Mit einer roten Masse. Renate öffnet ein Glas.
»Zwar nicht Aprikosenmarmelade. Himbeermarmelade wohl. Riecht noch gut.«
Sie probiert mit dem Finger.
»Wahnsinn. Schmeckt auch gut. Nach all den Jahren.«
Sie steckt ihren Finger nochmal rein. Tiefer. In der Masse steckt etwas. Ungläubig zieht sie es heraus.
»Was ist das? Oh Gott. Peter schau dir das mal an.«
1957 Das tu ich alles aus Liebe
»Die passt dir, Wolferl. Schön siehst du damit aus. Schau dich mal im Spiegel an.«
Schwarz-rot-kariert war die Hose, die ihm Mama zum Geburtstag schenkte. Sie hatte sie selbst geschneidert. Den Stoff besorgte sie aus Starnberg. Dort sollte ein Haus abgerissen werden, das seit dem Krieg einsturzgefährdet noch sein Dasein fristete. Onkel Walter hatte der Mama den Tipp gegeben und sie holte dann eines Nachts die alten Vorhänge aus dem »Betreten-Verboten-Haus«. Ein dünner, blonder Junge mit großen, blauen Augen und kurz geschnittenen Haaren blickte im Spiegel zuerst auf sein grünes Hemd und dann auf die neue Hose.
»Gefällt sie dir?«
Peter hatte eine Jeans. Die gefiel Wolfgang. Jeans waren teuer, das wusste er. Aber Peter hatte Onkel Walter als Vater und er selbst hatte keinen Vater.
»Ja, schön, Mama.«
»Schön oder sehr schön?«
»Sehr schön, Mama.« Wolfgang lächelte dabei. Nicht weil er lächeln wollte, sondern weil er immer lächelte.
»Da werden sie morgen alle Augen machen in der Schule, mein Liebling.«
Wolfgang graute es jetzt schon davor. Deshalb wird er morgen seine alte, löchrige Hose in den Ranzen packen und sich auf dem Schulweg umziehen.
»Schau, Wolferl. Mama hat noch was für dich. Das ist von Onkel Walter. Das hat er gestern schon vorbeigebracht. Für dich. Zum neunten Geburtstag.«
»Gestern?«
»Ja, gestern. Da hast du schon geschlafen. Aber Onkel Walter wollte, dass du es heute noch bekommst.«
Wolfgang wusste genau, dass Onkel Walter öfter zu Mama kam, wenn er schon schlief, aber Mama wusste nicht, dass er es wusste. Onkel Walter war manchmal nett, aber meistens war er nicht nett. Zu Mama war er immer nett. Zu Tante Hilde war er nie nett, zu Renate und Karl war er selten nett, zu Peter war er auch immer nett. Außer er gab Peter ein paar Ohrfeigen. Aber da war er eigentlich auch nett, denn wenn er Peter Ohrfeigen gab, sagte er meistens, das habe er nur gut gemeint. Wenn er anderen Ohrfeigen gab, sagte er nichts. Zu Wolfgang sagte er auch nichts, wenn er ihm Ohrfeigen gab. Aber das machte Wolfgang nichts aus. Hauptsache, er bekam auch mal eine. Denn von seinem Vater konnte er ja keine mehr bekommen und ein Leben ohne Ohrfeigen, wäre das überhaupt schön?
»Was ist das?«
»Ein Notizbuch.«
»Aber da steht ja gar nichts drin.«
»In ein Notizbuch kannst du selbst was reinschreiben. Onkel Walter hat gesagt, da kannst du dein ganzes Leben reinschreiben.«
»Das ist aber nicht dick. Muss ich bald sterben, Mama?«
»Nein Wolferl, Liebling. Das musst du nicht. Du hast dein ganzes Leben noch vor dir. In so ein Buch schreibt man nur die wichtigen Dinge seines Lebens rein.« Mama zog ihn an sich und drückte ihn an ihren üppigen Busen. Wolfgang lächelte wie immer.
»Heute kannst du reinschreiben. 9. Geburtstag. Mein schönstes Geschenk ist dieses Buch.«
»Nein, ich schreibe, mein schönstes Geschenk ist eine neue Hose.«
»Ich hab dich so lieb, Wolferl. Du bist mein Ein und Alles.« Am Nachmittag kamen Renate und Karl. Die hatten es nicht weit. Die wohnten in der Villa, Mama und Wolfgang im Gärtnerhaus. Bis letztes Jahr wohnten sie in einem Bauernhof, weil München nach dem Krieg kaputt war. Dort hatten sie aber nur ein kleines Zimmer. Das reichte gerade so für zwei Menschen. Mama hatte ihm erzählt, am Anfang hat dort auch Papa gewohnt. Der ist im Sommer 1948 von der Gefangenschaft heimgekommen. Er hat immer gehustet und das hat dem Bauern nicht gefallen, aber sie durften trotzdem bleiben, weil der Bauer sagte, das wird eh nicht lange dauern. Im August ist er dann gestorben, da war die Mama dann kurz alleine in dem Zimmer, aber dann ist im November schon er gekommen und dann waren sie wieder zu zweit. Wolfgang hat im ersten Jahr viel geschrien, hat sie auch gesagt, doch der Bauer meinte, Kindergeschrei ist besser als Husten. Als der Onkel Walter dann in die Villa einzog, hat er ihnen erlaubt, dass sie im Gärtnerhaus wohnen dürfen. Das ist er seinem Bruder schuldig, hat er gesagt. In dem Gärtnerhaus gab es sogar einen Ofen und ein eigenes Klo. Das war aus Holz, gleich neben dem Haus. Da musste man gar nicht weit gehen, wenn man musste.
»Wir sollen dich holen, hat der Peter gesagt. Weil wir heute ein Lager bauen im Wald. Darf der Wolfgang mit, Tante Gerda?«
»Natürlich darf er mit, Renate. Wolfgang hat heute Geburtstag.«
»Aha.«
»Da dürft ihr ihm schon gratulieren.«
»Gratuliere«, sagte Renate. »Du auch, Karl.«
»Alles Gute, wie alt?«
»Neun.«
»So viel?«, er zeigte fünf Finger seiner Hand.
»So viel und noch ein bisschen, Karl«, erklärte es ihm Wolfgangs Mama. Dann liefen sie in den Wald, wo Peter schon wartete. Als Begrüßung bekamen alle drei eine Ohrfeige, da er so lange warten musste. Renate erzählte Peter, dass Wolfgang Geburtstag hat, und so gab er ihm noch eine Ohrfeige, weil er sonst auch kein Geschenk hatte. Mit einem Leiterwagen hatte Peter eine Säge, einen Hammer, zwei Zangen, einen Spaten und Bretter mitgebracht. Ein größerer Stapel mit Brettern lagerte schon einige Wochen im Wald. Die Bretter waren zwar nicht neu, aber sie waren umsonst. Peter hatte sie bei einem Bauern geklaut. Wolfgang und Renate mussten Schmiere stehen. Der Bauer war eh auf dem Feld. Peter sagte aber, das ist wurst, Schmiere stehen gehört dazu, auch wenn keiner da ist. In den Brettern waren rostige Nägel. Das war gut, denn die Nägel brauchten sie für das Lager. Die Bretter mussten ja irgendwie an die Bäume genagelt werden. Renate und Wolfgang zogen die Nägel aus den Brettern, Peter legte sie auf den Spaten und klopfte sie gerade. Ab und zu klopfte er sich auf die Finger. Da schimpfte er und sagte zu Wolfgang, er soll nicht so blöd lachen, obwohl der gar nicht lachte.
Dann musste Karl die Nägel halten. Das hat dem Peter nicht mehr weh getan, beim Karl war es ihm egal. Der hat nur leise geweint. Drei Seiten hatte das Lager schließlich. Eine Seite war der Eingang.
»Jetzt brauchen wir noch Waffen«, meinte Peter und zog ein silbernes Klappmesser aus seiner Hosentasche.
»Das gehört Vater«, protestierte Renate.
»Na und? Das hab ich mir nur ausgeliehen. Wenn du was sagst, ist übermorgen deine Beerdigung.«
Mit dem Messer schnitt er Schilf am Lüßbach ab und sägte von einem Haselnussstrauch kräftige Zweige. Die kleinen, dünnen Ästchen daran entfernte er mit dem Messer, so dass nur die Haselnussstöcke übrigblieben. Diese bog er und verband die Enden mit einer Schnur, die er in der Hosentasche hatte. Fertig waren drei Bögen. Das Schilf schnitt er dann auf gleiche Längen, machte an einem Ende mit dem Messer eine Kerbe und auf das andere Ende steckte er kurze Holunderholzstücke, bei denen er das weiche Mark herausgekratzt hatte. Fertig waren die Pfeile. Dann mussten sich die anderen drei in fünf Meter Entfernung mit dem Rücken zu ihm aufstellen und er zielte auf sie. Nachdem er jeden mindestens einmal getroffen hatte, sagte er:
»Funktioniert. Jetzt müssen wir noch eine Friedenspfeife rauchen.«
Er zog aus einer Hosentasche eine Tabakpfeife und Zündhölzer. Wolfgang staunte, wie viel Platz in Peters Hosentaschen war.
»Gehört Vater, Peter. Darfst du das?«, fragte Karl angstvoll.
»Halt dein Maul, du Hosenscheißer!«
Peter sammelte trockenes Laub, zerrieb es zwischen seinen Handflächen und stopfte es in die Pfeife. Ein paar Minuten später stieg Rauch auf, nachdem Peter immer wieder gezogen hatte. Dann mussten sich alle im Kreis auf den Boden setzen und die Pfeife wurde von einem zum anderen gereicht. Karl durfte nur reinblasen. Sehr schnell wurden sie zu Indianern, denn vor Aufregung waren ihre Köpfe ganz rot und sie stießen unverständliche, krächzende Laute aus. Es dauerte nicht lange und es saßen Bleichgesichter da, die dieselbe Indianersprache beherrschten. Karl sprang als Erster auf, riss sich die Hose herunter und düngte den Wald. Vor ein paar Monaten hätte er es leichter gehabt. Da trug er noch Windeln. Dann folgte Renate. Bei ihr ging es hinten und vorne los. Laub war schon von den Bäumen gefallen. Damit deckte sie alles zu. Wolfgang war es so schlecht wie noch nie in seinem Leben. In seinem Bauch brodelte es wie im Waschbottich, wenn Mama Unterwäsche wusch. Er wollte nicht, dass sie schon wieder waschen musste. Er hatte seine Unterhose erst fünf Tage an. Und er wollte sich keine Blöße geben. Keine Blöße vor Peter. Mit eisernem Willen drückte er sämtliche Muskeln seines Körpers zusammen. So fest er konnte. Ihm wurde heiß, ihm wurde kalt. Und ihm wurde wieder heiß. Seine Haut sah aus wie die einer gerupften Gans. Aber seine Muskeln waren stark wie sein Wille.
»Lach nicht so saublöd«, sagte Peter, als dieser ein paar halbverdaute Brocken seines Mittagessens neben einem Baum ablegte und versetzte ihm eine Ohrfeige. »Jetzt machen wir noch Schießscharten ins Lager.«
Dazu musste Wolfgang ein Brett auf einer Seite halten und Renate auf der anderen.
»Ihr müsst die Hände näher zur Säge nehmen, sonst schwingt das Brett zu sehr, ihr seid doch so blöd. Völlig plemplem.«
Wolfgang und Renate rückten mit ihren Händen ganz nah an das Blatt der Säge und Peter begann mit Wucht zu sägen. Aber er war zu blöd zum Sägen und sägte nicht in das Brett, sondern in die linke Hand von Wolfgang. Da wurde er zornig und rot vor Wut. Auch das Brett wurde zornig, das war nämlich auch plötzlich rot.
»Du bist doch zu blöd zum Halten«, schimpfte er und gab Wolfgang einen Fußtritt. »Hau ab, ich kann dich hier nicht gebrauchen. Schau dir mal das Brett an, das hast du völlig versaut. Du bist ein Vollidiot!«
Wolfgang rannte nach Hause. Ihm lief nicht nur das Blut aus seiner Wunde, sondern es liefen vor allem Tränen aus seinen Augen. Er hatte doch alles richtig gemacht. So wie es Peter gesagt hatte. Er konnte doch gar nichts dafür. Warum hatte er ihn verjagt? Warum hatte er ihn beschimpft? Er hätte ihm doch auch eine Ohrfeige geben können und alles wäre in Ordnung gewesen.
Mama aß gerade ein Marmeladenbrot, als er ins Haus kam und erschrak gewaltig beim Anblick seiner blutenden Hand, die ihm ja gar nicht mal so weh tat. Viel größer war der Schmerz im Herzen. Der tat höllisch weh. Das wusste sie freilich nicht und das sollte sie auch nicht wissen. Nachdem sie Wolfgang die Hand verbunden hatte, nahm sie ihn in die Arme und drückte ihn an die weiche Brust. Jetzt hatte sein Schließmuskel verloren. Das Grummeln im Bauch hatte doch noch gewonnen. Aber Mama drückte ihn dennoch fester und fester an sich. Es war so schön warm bei Mama. Er fühlte sich so geborgen. Sie putzte ihm die Nase. Die war jetzt auch frei. So frei hatte sich seine Nase noch nie angefühlt. Alle Muskeln waren frei. Er war leicht. Ganz leicht. Wie ein Luftballon. Sein Körper schwebte, obwohl er festgehalten wurde.
Mama strich zärtlich über sein Haar. Sie roch gut. Viel besser als er. So süß. Sie roch nach Himbeermarmelade. Der Duft kroch in seine Nase, erst ganz vorsichtig und dann nahm er wie eine Lawine seine freigelegten Nasenschleimhäute vollständig in Besitz, er begrub sie und wanderte weiter und weiter und weiter. Bis er sich festgesetzt hatte. Endgültig. Für immer. Im Gehirn. Wolfgang schloss die Augen, dann schlief er ein.
Erschrocken saß er plötzlich im Bett. Hatte er nur geträumt? Nein, er hatte nicht geträumt. Das war Onkel Walter. Der hatte gerade gestöhnt, nebenan im Wohnzimmer. Onkel Walter kam öfter herüber zum Stöhnen. Wahrscheinlich hatte er Schmerzen und wollte nicht, dass sich Tante Hilde Sorgen machen musste. Er kam immer, wenn Wolfgang schon schlief. Wahrscheinlich sollte sich auch Wolfgang keine Sorgen machen, weil der ja wusste, dass sein Vater auch krank und schließlich gestorben war. Hoffentlich muss Onkel Walter nicht sterben, weil dann können sie vielleicht nicht mehr im Gärtnerhaus wohnen. Wolfgang fing an zu beten. Lass den Onkel Walter nicht sterben, lieber Gott, lieber Jesus. Weil, wo sollen wir dann hin? Aber du lässt ihn nicht sterben, oder? Das ist keine böse Krankheit. Nur eine leichte. Onkel Walter stöhnt ja nur immer ganz kurz und dann geht es ihm doch immer gleich wieder besser. Dann wollte Wolfgang wieder einschlafen, aber das ging nicht. Onkel Walter fing an zu reden.
»Ich will euch helfen, Gerda.«
»Wie meinst du das?«
»Wolfgang wird nächstes Jahr zehn. Der ist nicht dumm. Er sollte auf eine höhere Schule gehen, gell.«
»Aber das kostet und ich…«