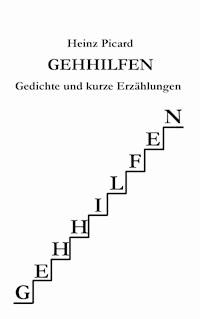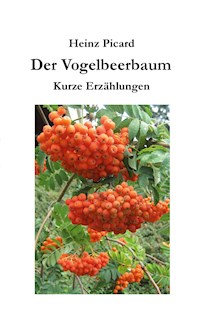
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Aus "Der Vogelbeerbaum": Im Grunde geht es mir vor allem um die erbsengrossen roten Beeren, welche diese Bäume hervorbringen. Besonders kostbar sind sie in meiner Kindheitserinnerung, wenn nach einem nächtlichen Schneefall die Sonne zur späten Vormittagsstunde den Schnee langsam zum Schmelzen brachte und die Vögel sich begeistert an den Beeren gütlich taten.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 82
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhalt
Statt eines Vorworts
Am Bach
Meine Cousine
Operettenzauber
Die Flucht
Patres, die wir hatten
Heimweh
Der Vogelbeerbaum
Strategien
Aufsicht
Es wird heute etwas später…
Männerabend
Die Fahrtüchtigkeitsüberprüfung
Demaskierung
Vita brevis, ars longa
Am See
Nachwort
Statt eines Vorworts
Einszweidrei, im Sauseschritt
Läuft die Zeit; wir laufen mit. –
Wilhelm Busch
Am Bach
Der Bach markierte das Ende des Grundstücks, auf dem mein Elternhaus stand und war ein wunderbarer Begleiter in meiner Kindheit.
Im Sommer zeigte er sich offen für Spiele jeder Art. Manchmal baute ich mit Hilfe eines Schulfreunds eine so hohe Staumauer, dass er zum kleinen See wurde, den wir mit einem selbstgebastelten Floss schiffbar machten und der uns zu ersten Schwimmversuchen einlud. Abends – ich konnte ihn bei geöffnetem Schlafzimmerfenster gut hören – half er mir mit seinem fröhlichen Plätschern in den Schlaf.
Er wird es mir nicht übelnehmen, wenn ich auch seine Schwächen erwähne: Mit Gewittern und Dauerregen hatte er seine liebe Not. Und das Bisschen Eis, das er manchmal im Winter anbot, eignete sich höchstens für Mutproben.
Nach einem Gewitter jagte er oft in schmutzigen schäumenden Wellen Bretter, Balken und Baumäste vor sich her, als müsse er eine unbezähmbare Wut los werden. Ja, einmal verliess der Bach gar sein Bett, schwoll immer mehr an, trieb braune Fluten übers Ufer, höher und höher. Man musste befürchten, er setze unser Haus unter Wasser. Aber dann, als wir gerade die Feuerwehr mobilisieren wollten, besann er sich eines Bessern, fuhr die überschäumenden Kräfte langsam runter und fand schliesslich zu seinem gewohnten Lauf.
Auf einem ortsüblichen, schulfreien Julimarkt trafen wir einst Schüler aus dem Bezirkshauptort am Rhein. Sie hatten von unserer Stauung gehört und fragten, ob sie das Wunderwerk mal besichtigen könnten. Dagegen war nichts einzuwenden. Aber sie gaben sich auch gar überheblich: «Der Rhein ist nun mal kein Bach», dozierte ihr Sprecher. «Er ist bekannt für seine Wirbel. Für Einheimische ist das nicht weiter schlimm. Man lässt sich vom Wirbel in die Tiefe ziehen, stösst dann im richtigen Winkel mit den Füssen kräftig vom Grund ab und steigt so wieder hoch.»
«Hat schon jemand von der Lorelei gehört?» fragte ein Knirps. Er sah sich um. Und als sich niemand meldete, fuhr er fort: «Wie jedermann weiss, das endete tödlich. Aber in unserem Fall und mit der richtigen Technik …» Der Sprecher entzog dem Kleinen das Wort: Ob wir Lust hätten, mal einen Versuch zu wagen? – Ich wehrte ab. Es gebe an diesen Tropentagen viel zu tun im Bach. Aber bei Gelegenheit, warum nicht?
Ich hatte Grösseres im Sinn. Etwas in der Art der abenteuerlichen Flossfahrt auf dem Mississippi, wie sie in meinem Jugendbuch beschrieben war: Knaben unterwegs mit ihrem schwarzen Freund, um in einen Staat zu gelangen, der die Sklaverei bereits abgeschafft hatte. Eine solche Tat würde die vom Bezirkshauptort überfordern. Wobei ich zugeben muss, dass bei mir der ganz grosse Coup auch noch auf sich warten liess.
Doch zur Sache. Mein lieber Bach, du frägst dich wohl, warum man mich nie mehr bei dir antrifft. Zum Beispiel auf der kleinen Brücke, welche die Zwidellen mit der Dörrmatt verbindet. Du wirfst mir vor, früher hätte ich sie nie betreten, ohne dir ein Weilchen zuzusehen. – Es ist ganz einfach, ich wohne längst nicht mehr hier. Das hat sich halt so ergeben. Einverstanden, ich habe dereinst davon geträumt, Enkel rechtzeitig ganz praktisch in mein Jugendparadies einzuführen. Das ist nun nicht mehr möglich. Und vielleicht ist es gut so. Die Welt hat sich verändert, es ist eine technisierte Welt, in die sie hineinwachsen. Und dahin gehören sie auch. Aber mir ist sie manchmal fremd. Das hindert mich aber nicht daran, ihnen von früher zu erzählen. Ohne zu werten oder ihnen was aufzudrängen. Und wenn sie sagen: «Grossvati, erzähl mal, oder lies vor!» Dann überkommt mich ein tiefes Behagen. Und ich spüre: Man wird im Leben nicht alles richtig machen, aber auch nicht alles falsch.
Anmerkung
Der Text spielt u.a. an auf die Bücher von Mark Twain (Tom Sawyer’s und Mark Finn’s Fahrten und Abenteuer), die meine Jugend in jeder Hinsicht bereichert haben.
Meine Cousine
In meiner frühen Jugend galt der Fussball als eine eher verachtenswerte Sportart. Vor allem die Lehrerschaft tat sich schwer damit. Wenn der Lehrer in der fünften Klasse uns Knaben dabei erwischte, dass wir nach Schulschluss nicht sofort nach Hause gingen sondern auf der Schulwiese noch Fussball spielten, rief er uns ins Zimmer zurück. Das hatte Arrest zur Folge und schriftliche Strafaufgaben. Dabei machte er eine bedenkenswerte Entwicklung durch. Jahre später, als sein jüngster Sohn dem Fussballclub beitrat und ein wertvolles Mitglied für die erste Mannschaft wurde, erschien der Lehrer bei jedem Heimspiel auf dem Platz – auch mit Regenschutz bei Bedarf – und genoss es, wenn ihn jemand beim Vorbeigehen ansprach: «Der Allerweltskerl dort, ja der, das ist doch Ihr Sohn.»
Doch zurück zu den Anfängen. Wer dem Fussballclub beitrat, qualifizierte sich in der Meinung vieler gar als Bürger einer minderen Gesellschaftsschicht. Der Turnverein dagegen genoss allgemein den Nimbus einer Vorzeigedisziplin. Das mochte auch damit zu tun haben, dass im Turnverein verschiedene Mitglieder mit ihren Leistungen brillierten. Ich erinnere mich an einen Langlaufspezialisten und einen Reckturner, die gar auf eidgenössischer Ebene auf sich aufmerksam machten. Bei trockenem, warmem Wetter übten die Könner am Abend an den Geräten auf dem Schulareal. Sie liessen sich auch nicht beirren von den Schulkindern, die regelmässig um diese Zeit auf den Platz kamen und sich nach dem Star-Training ebenfalls an den Geräten versuchten.
In meinem Alltag spielte der Fussball eine wichtige Rolle. Nur hatte ich in der Freizeit keinen ebenbürtigen Partner, mein Bruder war noch viel zu klein. Und Mädchen hatten andere Interessen.
Kurz vor den Sommerferien schrieb meine Cousine aus Zürich, sie möchte uns gern wieder einmal besuchen; sie habe an zwei Wochen gedacht, wenn das für uns in Frage käme. Die Eltern willigten sofort ein, und ich war im siebten Himmel: Endlich hatte ich einen Spielpartner, leider halt behaftet mit dem Makel des weiblichen Geschlechts. Aber ich war besessen von der Idee, sie zu einer ebenbürtigen Spielerin aufzubauen.
Die Tage schleppten sich dahin. Ich riss sorgfältig Zettel um Zettel vom Kalender an der Wand. Das vereinbarte Datum rückte langsam näher. Ich wurde ungeduldig: Und wenn sie die Einladung vergessen hatte? – Das gibt’s nicht. – Nicht bei meiner Cousine. Ein Oberschüler hatte mir einmal erzählt, Mädchen seien launisch, auf sie sei kein Verlass. Aber der kannte meine Cousine nicht. – Und dann kam wie aus heiterem Himmel der erlösende Anruf einer Nachbarin (bei der Cousine gab’s noch keinen eigenen Telefonanschluss) mit genauen Angaben betreffend Wochentag und Zugsankunft.
Alles Warten hat ein Ende. Gleichzeitig mit dem Zug traf ich am Bahnhof ein. Türen schlugen auf. Ich sah meine Cousine winken, stolperte über die Geleise – damals gab es hier noch keine Unterführung – und nahm ihr den Koffer ab. Sie umarmte und küsste mich. Das war mir etwas unangenehm. Sonst stimmte alles, sie war wie die Mädchen in unserer Klasse.
Der Koffer war furchtbar schwer. Am liebsten hätte ich ihn kurz abgestellt. Aber das konnte ich mir jetzt nicht leisten. «Zeig mal», sagte sie unvermittelt, «lass mich mal tragen.» – Um abzulenken erzählte ich ihr, sie müsse durchhalten bis zur Wiese hinter dem Haus, wo ich noch vor dem Mittagessen ein erstes Training vorgesehen hätte. Meine Mutter war nicht sehr erfreut. «Jetzt lass sie doch erst mal ankommen», sagte sie. «Reisen ermüdet. Ich zeig ihr das Zimmer, dann soll sie sich ruhig mal hinlegen.» Meine Cousine meinte, sie sei gar nicht müde und interessiere sich sehr für Fussball. – «Es handelt sich um ein kurzes Torwarttraining», beschwichtigte ich Mutter. «Fünf Minuten», meinte sie, «und nicht mehr. Und Hände waschen!» Dann gingen wir zur Wiese.
Mit zwei Bohnenstangen hatte ich am Vorabend die Pfosten beidseits der Torlinie markiert. Ich setzte meinen hart aufgepumpten Lederball etwa zehn Schritte vor das fingierte Tor, nahm Anlauf und knallte das Leder mit Wucht über die Torlinie. Dann wies ich die Cousine an, den Ball zu holen und ihn nach meinem Vorbild im Tor zu versenken. Das Unternehmen erwies sich als schwierig. Die Cousine lief zwar voll an, aber traf meist den Ball nicht. – «Wir beginnen mit dem Essen», rief Mutter. «Vater kommt heute später.»
Trotz des mässigen sportlichen Erfolgs nahm ich am Nachmittag den nächsten Schritt in Angriff. Ich zog mich sportgerecht um – schwarze Turnhose, grüner Pullover, Fingerhandschuhe, Knieschoner – und zeigte ihr, mit welchen Sprüngen und Paraden ein Torwart sein Tor rein zu halten versucht. In einer alten Reisetasche hielt ich für sie eine Zweitausrüstung bereit: überlange Turnhose, Fausthandschuhe, leicht verwaschener grauer Pullover, Binde statt Knieschoner. Sie verschwand als Stadtgirl kurz im Haus und kam als valabler Torwart heraus. Dann übten wir mit Positionswechseln.
Als ich einem Kameraden von meinen sportlichen Versuchen mit der Cousine erzählte, versicherte er, der Frauenfussball sei im Kommen. Seine Zürcher Tante plane eine Mitgliedschaft in einem dortigen Damenfussballclub. Ich zweifelte daran, dass bei meiner Cousine Talent und Fleiss dereinst für ein solches Vorhaben genügten. Aber es waren immerhin erste Schritte in der richtigen Richtung.
Wer am Bahnhof Frick der Hauptstrasse in Richtung Dorfkern folgt, kommt nach einer ersten Kehre an einem frisch renovierten Haus vorbei. Hier hatten um 1920 die Geschwister Paul und Theres Schuhmacher ihren Tuch- und Kolonialwarenladen eröffnet. Zum richtigen Zeitpunkt. Die Bahnhofstrasse wurde nach Eröffnung der Bahnlinie 1875 das erste «Neubaugebiet» der Gemeinde.