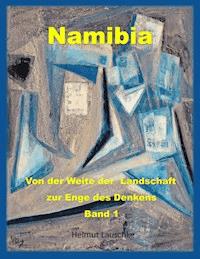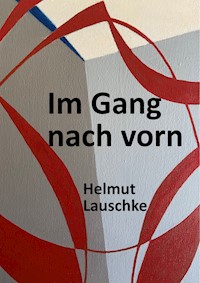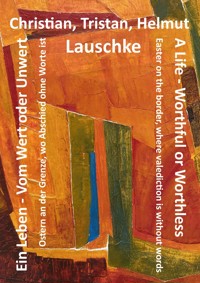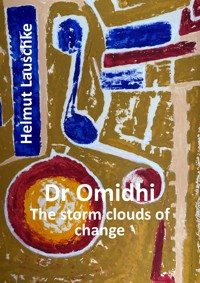Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: neobooks
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
In Afrika sollst du nicht leben, ohne der Armut etwas abzugeben, denn wer als Mensch will immer nehmen, der sollt sich der Armut andrer schämen. An der Armut wird sich von allein nichts ändern. Die Taten sind's, die zählen, was dich auf die Waage stellt und misst. Die Sirenen heulten das zweite Mal und länger auf, und Dr. Lizette konnte ihre Nervosität nicht verbergen, als aus dem Dorf mit einem Lärm die schweren Haubitzen ihre Salven schossen, die in der Ferne hörbar detonierten. "Das hört sich ja wie Krieg an", sagte Dr.Lizette mit bleichem Gesicht. Dr. Ferdinand meinte, dass die Schiesserei zu dieser Tageszeit ungewöhnlich sei, man sich daran aber auch gewöhnen müsse. "Das hört sich nicht gut an", erwiderte Dr. Lizette. Die Abschüsse waren so heftig, dass der Boden vibrierte und die Instrumente auf dem Tisch klimperten. Mit dem Wissen, dem Schicksal nicht entrinnen zu können, legte Dr. Ferdinand den Verband an und half beim Rüberheben des Patienten auf die Trage. Er zog sich im Umkleideraum um, als ein schweres Geschoss über das Dach zischte, dass die Fenster klapperten und die Türen schlugen. Er sah, wie die Schwestern im Korridor hin und her liefen, und dachte an die Worte des Brigadiers, dass viel auf dem Spiel stehe und die Weissen auf dem Pulverfass sässen, das jederzeit hochgehen könne. Dr. Ferdinand wurde es von Tag zu Tag klarer, dass das weisse Apartheidsystem nicht mehr weit vom Ende ist. Er verliess mit Dr. Lizette das 'theatre', die bleich im Gesicht war, weil ihr die Schiesserei in die Knochen gefahren ist. Sie trennten sich vor der OPD (Outpatient department), als Dr. Lizette den Satz mit dem Wort 'Zukunft' nicht zu Ende sprach, weil ihr da etwas dazwischengefahren oder dazwischen gefallen ist, und Dr. Ferdinand zum Untersuchungsraum 4 ging, um vor der Mittagspause noch einige Patienten zu sehen, die sich auf den Bänken stauten.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 444
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Helmut Lauschke
Der Weg nach Afrika
Jahre der Entscheidung
Dieses ebook wurde erstellt bei
Inhaltsverzeichnis
Titel
Im Lauf der Jahre
Ein Major als Superintendent
Der Fallensteller in einer Zeit der höchsten Bedrängnis
Härteste Donnerschläge mit wild gleissenden Blitzen
Kristofina, das Mädchen, das vom Blitz getroffen wurde
Das abgemagerte Mädchen mit den elf Steinen im Magen
Die weisse Apartheid mit dem Verrat an der ärztlichen Ethik
Was Zeiten brachten
Das Dach des Wasserturms wurde zur MG-Doppelstellung ausgebaut
Vom Sinn der Lernens
Wie sich die Welt auf den Alltag einstellt
Besuch des Brigadegenerals in der Morgenbesprechung
Die katholische Missionsstation in Okatana
Meditatives Intermezzo gegen Mitternacht
Die katholische Missionsstation in Oshikuku
Schwere Haubitzen schossen Salven
Die Knochenverpflanzung in der Behandlung der Schienbeinosteomyelitis beim Kind
Afrikanische Merkwürdigkeiten im Beruf des Arztes
Impressum neobooks
Im Lauf der Jahre
Jahre der Entscheidung
Autobiographie Teil 2
Denk ich an Afrika und die Welt bei Tage, dann erhebt sich doch die Lebensfrage, wo wir im Ruf der neuen Zeiten sind mit der Kultur und dem verlornen Kind.
In Afrika sollst du nicht leben, ohne der Armut etwas abzugeben, denn wer als Mensch will immer nehmen, der sollt sich der Armut andrer schämen.
An der Armut wird sich nichts ändern, solange Altersringe deine Augen rändern, denn das Leben ist für alle begrenzt, Taten sind’s, was dich auf die Waage stellt.
Die Brücke über den Cuvelai war wieder hergestellt. Alle Brücken wurden von Soldaten bewacht. Die Lage hatte sich weiter zugespitzt. Der Krieg mit dem Ziel der Unabhängigkeit Namibias auf der einen Seite und dem Halten des 'status quo' eines von Südafrika verwalteten und abhängigen Südwest-Afrikas auf der anderen Seite hatte viele Opfer unter der Zivilbevölkerung gefordert, und er fordert täglich mehr. Zum Hospital kamen auch Menschen mit blutunterlaufenen und aufgerissenen Wunden über dem Brustkorb, dem Rücken, an den Armen und Beinen, die ihnen durch Stockhiebe auf den Polizeistationen oder vor ihren Hütten, oder auf freiem Felde bei Verhören von Polizisten oder der Spezialtruppe Koevoet (Brecheisen) zugefügt wurden. Dabei schlugen Schwarze in den Felduniformen der Koevoet auf ihre Brüder und Schwestern ein, wenn der weisse Mannschaftsführer meinte, dass es sich um aktive Swapounterstützer handle, die er der schwarzen Mitverschwörung verdächtigt. In den meisten Fällen traf die brutale Stockbehandlung unschuldige und wehrlose Menschen, da der Verdacht eine unbegründete Vermutung blieb, die sich nicht bestätigte. Die Spirale der Gewalt nahm ohne Rücksicht auf die notleidenden und hilflosen Menschen zu. Sie wurden geschlagen, gefoltert, verschleppt und getötet. Ihre Krale wurden beim geringsten Verdacht der Kollaboration dem Erdboden gleichgemacht. So blieben viele Mütter mit weinenden Kindern und den hilflosen Alten zurück, denen es die Sprache verschlug, wenn sie auf offenem Felde vor dem Nichts standen und es nicht erklären konnten.
Die Unsicherheit der allgemeinen Lage und die militärische Zuspitzung im Grenzgebiet zu Angola, das vom mehr als zehnjährigen Bürgerkrieg der unterschiedlich verstandenen Unabhängigkeit weitgehend verwüstet war, hatte auch zur Veränderung in der Administration des Hospitals geführt. Dr. Witthuhn war seines Stuhles enthoben. Auf seinem Stuhl sass nun ein strammer, gross gewachsener Mittdreissiger in der Uniform eines Majors, der geschmeidig afrikaans und englisch sprach und seine Sätze in unvergleichbarer Weise wiederholte und mit jeder Wiederholung weiter dehnte, als zöge er den Kaugummi aus dem Munde, den er zwischen den Zähnen hielt, indem er die Haupt- und Tätigkeitsworte mit anderen Eigenschaftsnamen derselben Bedeutungsfamilie anreicherte und streckte. Er schaffte es, minutenlang über ein und dasselbe Ding zu reden, ohne dass man wusste, worüber er redete, weil der Redefaden mit zunehmender Länge immer undeutlicher wurde. Er besass die Kunst viel zu reden, ohne etwas zu sagen. Dazu kam seine Freude, in den beiden Sprachen herumzuspringen, indem er englisch fünfmal wiederholte, was er in afrikaans gesagt, oder zehnmal in afrikaans wiederholte, was er in englisch gesagt hatte. Durch die Anwendung der Sprachleier in zwei Sprachen war seinem Redefluss kein Einhalt zu bieten. Die Teilnehmer der Besprechung schauten auf die Uhr und grübelten über zwei Dinge nach: 1. Was mag der Superintendent gedacht haben; 2. Wann hört der Redeschwall endlich auf. Eine Frage wurde nicht beantwortet, sie wurde solange gekaut, bis von ihr nichts mehr übrigblieb, keiner mehr wusste, was eigentlich gefragt wurde. Der Superintendent, der soviel reden und nichts sagen konnte, führte denselben Doktorgrad wie die ihm unterstellten Ärzte in der Leutnantsuniform. Dieser Titel wurden den Examinanden verliehen, die erfolgreich ihr letztes Staatsexamen abgelegt hatten. Die besondere Anstrengung einer Dissertation wurde ihnen in Südafrika wie im ganzen British Empire erlassen. Sie nannten sich Doktor ohne die akademisch herausragende Qualifikation. Dr. Ferdinand bewohnte mittlerweile ein kleines Einzimmerflat mit Schlafraum, Küche, und Duschraum mit Toilette. Es wurde ihm von einem weissen Beamten der Bantu-Administration zugewiesen und übergeben. Insofern hatte es einen Fortschritt gegeben, Der Schlafraum war doch grösser als das enge, voll gestellte Schlafkabinett in des Freundes Haus.
Schwer zu ertragen war der palavernde Superintendent. Keiner konnte sich vorstellen, dass er ein Arzt sei, der schon mal einem Patienten gegenübersass. Das erste, was er in seiner Amtszeit tat, er versetzte den Schreibtisch mit Stuhl auf die gegenüberliegende Raumseite, also dort, wo zu Dr. Witthuhns Zeiten die Matronen und die Apothekerin während der Morgenbesprechungen sassen, die schwarze Matrone ihre Grimassen schnitt, wenn die weisse Hauptmatrone vom Uringestank des Vorplatzes sprach, der dem auf Sauberkeit Bedachten die Nase zuhalten liess, weil die Penetranz die Nasenschleimhaut ätzte und sich in der Kleidung festsetzte, als hätte man selbst hinein uriniert. Dr. Witthuhn wurde der Posten des 'Principal medical officer' zugewiesen und in die innere Medizin abgeschoben. Er liess es mit sich machen, weil er das Geld zum Leben brauchte und im Glauben war, dass die anachronistischen Verrücktheiten der weissen Apartheid nicht ewig dauern würden. So traten die Zeichen des Niedergangs des Rassensystems mit jedem Sonnenaufgang klarer über dem Horizont. Dr. Witthuhn hielt an diesem Glauben fest, wenn er in den Männer- und Frauensälen nach den Patienten sah und seine Anweisungen zur Behandlung gab oder die ambulanten Patienten im kleinen überhitzten Raum der Station 7 untersuchte, wo ihm ein laufender Ventilator vom Nebenstuhl die kühlere Luft ins Gesicht, oder wenn er zurückgelehnt am Tisch der diagnostischen Dürftigkeit irgendwelchen Gedanken nachging, während ihm der Patient noch gegenübersass, oder sich im Gang der Gemächlichkeit gedanklich verloren hatte, dass man ihn im Vorbeigehen wecken musste.
Dr. Witthuhn hatte viel Herz und viele Sorgen, als dass man ihn mit den fünf Sinnen sogleich verstehen oder messen konnte. Es war seine menschliche Grösse, dass ihn Dr. Ferdinand niemals verdriesslich antraf. Das Kleinkalibrige des Neides und der Hässlichkeiten passte nicht zu ihm, doch hatte er ein waches Gespür für das, was falsch und listig war. Da das Hospital nicht von solchen Gefechten der Arglist und Hinterhältigkeit verschont blieb, traute er so schnell keinem über den Weg der Anständigkeit. Das hatte er im Leben gelernt, dass es nur wenige Freunde gibt, die zu einem halten, wenn es einem nicht gut geht.
Der ärztliche Direktor sass weiterhin und ungestört im Range des Colonels auf dem bequemen Sessel mit der hohen Rückenlehne hinter dem leeren, hochpolierten Schreibtisch. Da hatte er Zeit genug, sich mit seinen Zähnen zu beschäftigen und mit den Zahnstochern zwischen den Zähnen herum zu stochern und das Gebiss auf dem neuesten Stand zu halten. Das tat er bedenkenlos unter dem Grossfoto des südafrikanischen Präsidenten, der hinter Glas und mit Goldrahmen versehen an der Wand aufgehängt war. Es war der Verdacht des Militärs, dass Swapokämpfer als Patienten kommen und im Hospital einsickern. Da misstrauten sie dem zivilen Superintendenten, von dem das Engagement für die notleidende Bevölkerung bekannt und auch ein Dorn im weissen Auge war. Das Militär hatte die Administration unter Druck gesetzt, und die Administration hatte erwartungsgemäss nachgegeben. Offiziere führten nun die höchsten Posten im Hospital. Der Bevölkerung, den Patienten, Schwestern und Pflegern sowie den zivilen Ärzten gefiel es nicht. Das Hospital bekam eine militär-strategische Bedeutung, die auf Kosten eines Hauses zur Behandlung kranker Menschen ging. Damit verschaffte sich das Militär einen ungehinderten Zugang zum Hospital, von dem die Koevoet Gebrauch machte, wenn sie vor allem nachts mit ihren 'Casspirs' das eingezäunte Gelände abfuhr, mit Scheinwerfern die Winkel ausleuchtete und nach Swapokämpfern absuchte.
Eine Verbesserung für das Hospital brachte dieser Wechsel nicht. Der 'Sekretaris' hatte sein Versprechen, das er vor einem Jahr Dr. Witthuhn anlässlich eines Gespräches über die notwendigsten Reparaturarbeiten gegeben hatte, nicht eingehalten. Nicht einer der weissen Verwaltungsmänner erschien in all den Monaten im Hospital, um die Zustände der totalen Vernachlässigung und ihre Folgen in Augenschein zu nehmen, die Dinge der höchsten Dringlichkeit in einem Protokoll aufzulisten und es dem 'Sekretaris' auf seinem polierten Schreibtisch vorzulegen, damit er die Reparaturarbeiten und Neuanschaffungen in Auftrag geben konnte. Nichts dergleichen war passiert. Die zentrale Sterilisationsanlage brach von Zeit zu Zeit zusammen. Der alte, schrottreife Operationstisch wurde nicht durch einen neuen ersetzt. Neue, zeitgemässe Instrumente wurden nicht angeschafft. Die Krankensäle, denen die Verrottung durch ramponierte Türen und Fenster anzusehen war, verblieben im Zustand des Unzumutbaren.
Die beschädigten Toilettenschüsseln wurden nicht ausgewechselt, und die dringend benötigten Betten der einfachsten Stahlbauweise wurden nicht angeschafft. Die zerrissenen, schmutzig verfleckten Schaumgummimatratzen wurden weiterhin aufgelegt, die schon lange den Verbrennungstod verdient hatten, weil aus ihnen der Geruch des eingetrockneten Urins eines Jahrzehnts nicht rauszukriegen war. Der 'Sekretaris' hielt seine Zusage nur in Sachen Wasserschlauch zum Abspritzen des Vorplatzes, weil Dr. Witthuhn ihn vor einem Jahr von der Unzumutbarkeit des platzbeherrschenden Uringestanks überzeugte, als er spontan vom Ekel befallen wurde und seine Gesichtszüge, ähnlich wie es die schwarze Matrone tat, in zuckenden Grimassen entgleisen liess. Was der neue Superintendent als Major und Doktor der Medizin tat, war die Anschaffung eines neuen Krankenwagens und zwei offener Ford-Kleinlader, von denen er sich einen für sich selbst vorbehielt. Es war unverkennbar, dass das Militär die Führung des Hospitals übernommen hat und sich von den Zivilbehörden dabei nicht reinreden liess, die ohnehin nicht daran dachten, sich in die Brisanz der Verstülpung einzumischen, da ihnen die zugesicherten Posten der abgenommenen Verantwortung und wenigen Arbeit bei hoher Bezahlung und den vielen Extras näher waren als die Probleme eines Hospitals, das der Bevölkerung vorgehalten wurde.
Die Weissen bedienten sich des Flugzeuges in Ondangwa, das sie nach Windhoek und Pretoria brachte, um dort die weissen Ärzte vom hohen medizinischen Standard einer ersten Welt in Anspruch zu nehmen, der sie mehr vertrauten als der dritten Welt Medizin am Oshakati Hospital, wo schon das Wegspritzen des Urins vom Vorplatz als grosses Ereignis gefeiert wurde. Hinzu kam, dass diese Weissen in regelmässigen Abständen in die Stadt- und Verwaltungsmetropolen der pyramidalen Machtzentren flogen, um vertrauliche Gespräche der Beförderung und weiterer Vergünstigungen zu führen, die in eigennütziger Vorausschau in einer Zeit der zunehmenden Unsicherheit der zukünftigen Absicherung dienen und den unverdienten, hohen Lebensstandard festschreiben sollten. Mit diesen Flügen der regelmässigen Notwendigkeit wurden die zukünftigen Geschäfte abgesprochen und mit Friseur, Zahnarzt und Einkäufen der dort erhältlichen Luxusartikel gleich verbunden.
Ein Major als Superintendent
Obwohl die Morgenbesprechungen nun länger dauerten aufgrund der Wortspielereien des Majors und neuen Superintendenten, kam auch die schwarze Kollegin, wenn auch mit regelmässiger Verspätung hinzu, die zu Dr. Witthuhns Zeiten, als der grosse Schreibtisch voll beladen auf der anderen Seite stand, ihren Stuhl leer stehen liess und sich nur vom Ende der Besprechung überzeugte, wenn sie ihren Kopf durch die offene Tür durchsteckte und wieder zurückzog. Das wollte sie sich jetzt nicht mehr leisten, obwohl es mit weniger Fragen nun länger dauerte. Sie beteiligte sich an den Diskussionen mit Intelligenz und einer exaltierten Sprache, weil ihr durch das Fehlen bei den Morgenbesprechungen unter dem vorherigen, zivilen Superintendenten die nötige Erfahrung fehlte, sich kurz und sachbezogen auszudrücken.
Eine weitere Veränderung war mit Dr. Hutman eingetreten, der bei diesen Besprechungen nicht mehr so vorlaut und besserwisserisch war. Das stand seiner durchschnittlichen Intelligenz besser. Er verhielt sich nun mehr zurückhaltend und verdeckter, als wollte er es mit dem Major nicht verderben. Hinzugekommen war Dr. Bernstein, ein nicht mehr junger Kollege aus der Schweiz, der fliessend deutsch, englisch und französisch sprach. Er war Facharzt der Chirurgie und hatte seine traumatologischen Kenntnisse während des Vietnamkrieges auf dem Hospitalschiff 'Vietnam' gesammelt, das vor dem damaligen Saigon vor Anker lag. Er war im Operieren talentiert und gründlich und kam mit den guten Absichten des Helfenwollens nach Oshakati, wo er die Verantwortung in der traumatologischen Orthopädie übernahm. Dr. Ferdinand, der auch Traumatologe war und vor dem Erscheinen des Schweizer Kollegen für beide operativen Gebiete zuständig war, in denen im ersten Jahr seines Dortseins fast eintausendsechshundert Operationen durchgeführt wurden, zog sich in der Verantwortung nun auf die Chirurgie zurück. Er bedauerte aufrichtig, dass er die freundschaftliche Zusammenarbeit mit Dr. van der Merwe nicht fortsetzen konnte, der seinerseits den Superintendenten ersuchte, für die letzten Monate der verbliebenen Dienstzeit von der Orthopädie zur Chirurgie zu wechseln, was dieser ihm zusagte, sobald die neuen Kollegen einträfen.
Auch Dr. Bernstein fiel es schwer zu glauben, dass ihm seine Schweizer Facharztzertifikate trotz des Weltrufes der schweizerischen Universitäten in Südafrika nicht anerkannt wurden. Er wurde wie Dr. Ferdinand in die lächerliche Gehaltsgruppe eines 'Senior medical officer' eingestuft. Dr. Bernstein empfand diese Arroganz als eine schallende Ohrfeige. Die Administration stellte ihnen in Aussicht, dass beide Chirurgen nach Ablauf eines Jahres in die höhere Gruppe eines 'Chief medical officer' eingestuft würden, das höchste, was ihnen die Bantu-Administration unter Befolgung der Richtlinien des 'South African Medical & Dental Council' in Pretoria anzubieten hatte; als müssten die beiden Kollegen der beachtlichen Erfahrungen im Grenzgebiet zu Angola, wo der Krieg sinnlos zerstörte und die Agonie des aufgesetzten, weissen Systems nicht zu übersehen war, noch eine Probezeit durchlaufen, weil das Beachtliche im burischen Querverstand keine Beachtung verdiente. Für Dr. Bernstein war hier die Grenze der Toleranz nach wenigen Tagen erreicht. Er sagte, dass er sich von diesen Typen der fehlenden Intelligenz nicht auf der Nase rumtanzen lasse. "Dann sollen sie ihren Dreck alleine machen, wenn sie so dämlich sind und nicht begreifen, was hier vonnöten ist", schimpfte er heraus und beschloss in der zweiten Woche, nicht länger als ein Jahr im Land der weissen Apartheid zu bleiben.
Dr. Hutman blieb undurchsichtig und suchte nun täglich das Büro des Major-Superintendenten auf. Die Kollegen der gleichen Uniform vertrauten ihm nichts Persönliches an. Das sagte Dr. van der Merwe zu Dr. Ferdinand im Gespräch anlässlich des Todes des vierzehnjährigen Jungen auf dem Op-Tisch, als Dr. Hutman bei der Kraniotomie sich nicht helfen liess und den Tod Dr. Ferdinand anlasten wollte und selbst keine Freunde habe. Dr. Hutman war das verlängerte Ohr des ärztlichen Direktors und des Truppenkommandeurs geblieben. Jetzt wollte er noch das Majorsohr des Superintendenten verlängern, weil er sich durch die Ohrverlängerungen der Höhergestellten persönlich versprach, was für ihn zum Nutzen sein konnte. Dass der versprochene.Nutzen ein Versprechen war, weil es auch Schaden machte, daran dachte der jüdisch erzogene Karrierearzt aus der angesehenen Johannesburger Familie mit der auffallenden Gefühlsabstinenz schwarzen Patienten gegenüber nicht zu der Zeit, als sie es ihm noch freistellte und überliess, die Münze rumzudrehen und die Kehrseite nicht weniger sorgfältig zu betrachten und darüber nachzudenken, was ihm die Kehrseite aufzeigte.
Die Spezialisten kamen weiterhin am Dienstag und Freitag aus Ondangwa, wo sie alle zwei Wochen durch andere ausgewechselt wurden. Sie wurden von 'Waterkloof' (Wasserschlucht), dem Militärflughafen bei Pretoria zum Norden geflogen. Sie waren zum Dienst verpflichtet und kamen als Professoren und Dozenten der Universitäten und akademischen Lehranstalten Südafrikas in den Uniformen hoher Offiziere, um hier die medizinische Versorgung der diensttuenden Truppe sicherzustellen. Warum diese Spezialisten zweimal in der Woche das Hospital in Oshakati besuchen, das wurde Dr. Ferdinand nie richtig klar. Er konnte sich nicht vorstellen, dass diese regelmässigen Besuche nur etwas mit der medizinischen Versorgung der Truppe zu tun hatten, weil das Militär hier nicht behandelt wurde. Es passte ihm mehr in das Konzept der militärischen Aufklärung, bei den Saalrunden herauszufinden, ob sich unter den chirurgischen Patienten tatsächlich Swapokämpfer versteckten, was für diese Spezialisten, denen alle Türen zum Hospital offen standen, unschwer herauszufinden war, wenn sie die Krankengeschichten lasen und die Art der Verletzung der klinischen Betrachtung unterzogen.
Das Hospital als Einrichtung der medizinischen Hilfeleistung war eine Schwachstelle im strategischen Konzept der militärischen Führung, die die zunehmende Infiltration der Swapokämpfer und der sie aktiv unterstützenden Bevölkerung ins Kalkül einbezog. Es waren die strategischen Gesichtspunkte des Militärs mit den schärferen Kontrollen, die Dr. Ferdinand auf den Gedanken brachten, dass mit einer Verbesserung der Arbeitsbedingungen am Hospital nicht zu rechnen ist, solange die Weissen der Einrichtung misstrauen, dass dort Swapokämpfer und ihre Sympathisanten behandelt werden, was dem Schwur auf den südafrkanischen Präsidenten und dem Eid auf die gehisste Apartheidsflagge widersprach. Dagegen forderte der Eid des Hippokrates die gleiche Behandlung aller Menschen.
An der miserablen Bestückung und Ausstattung des Hospitals wurde das Ausmass der Schizophrenie sichtbar, die leeren Versprechungen machten politisch Sinn, und das wahre Arzttum wurde zum Krüppel geschlagen. Was für Konflikte mögen die Ärzte in ihrem Gewissen austragen, wenn sie es tun, die an einer südafrikanischen Universität mit Beendigung des Studiums der Medizin den Eid des griechischen Arztes aus vorchristlicher Zeit geleistet haben und dann in die Uniformen der Leutnants gesteckt wurden und dabei den weissen Schwur der herabgesetzten Menschlichkeit leisteten. Das waren die Bedingungen, unter denen hier Ärzte zu arbeiten hatten, wenn sie dem Patienten ins Gesicht sahen und ihn behandelten. Folgerichtig und systemkonform kamen dann die arroganten, bürokratischen Einschränkungen des `Medical & Dental Council' mit der Nichtanerkennung ärztlicher Qualifikationen noch hinzu. Dr. Ferdinand fiel es dennoch schwer sich vorzustellen, wie das Hospital weiter verrottet und dahinsiecht, bis es schliesslich den Geist der Zumutung aufgibt und seine ursprüngliche Bedeutung für die Menschen völlig verliert.
Die politischen Formeln für die dahinsiechende Verrottung wurden wirksam umgesetzt, man brauchte keinen Grips, um die Niedertracht zu verstehen, denn die Fakten sprachen eindeutig, als dass noch ein Gegenbeweis nötig gewesen wäre. In dieser Phase der grossen Zerreissprobe, vor dem Gewissen des Einzelnen wie vor der Gesellschaft in den Zeiten des absehbaren Umbruchs, war Dr. Hutman in seinem Element als getarnter Arzt, der für Gefühle den Patienten gegenüber nichts übrig hatte, dafür mehr seine verräterischen Ambitionen verfolgte, der denunzierte, auch wenn er dabei die Unwahrheit sagte, und bedenken- wie rücksichtslos anschwärzte, was nur anzuschwärzen war, als wollte er noch die Tapferkeitsnadel auf die Brust gesteckt bekommen, bevor er in den weissen Wohlstand seiner Eltern nach Johannesburg zurückkehrte, um seiner Karriere mit der ihm hier vergönnten Ellbogenfreiheit, von der er in anmassend frecher Weise Gebrauch machte, weiter nachzugehen. Er hatte es bei seinen hinterhältigen Unternehmungen besonders auf die zivilen Kollegen abgesehen, denen er Schaden zufügen wollte, wo es nur ging, weil er sich seines Status der eingebildeten Besonderheit des Höheren beraubt sah, die er im Aufstellen der täglichen Operationslisten und monatlichen Dienstpläne für sich zu verbuchen glaubte, was lächerlich und von kleinem Format war, das ihm Dr. Witthuhn aus Gründen der Sachlichkeit abnahm, als er noch auf dem Stuhl des Superintendenten sass, und diese Aufgabe Dr. Ferdinand übertrug.
Es gab viele unerfreuliche Wortgefechte mit Dr. Hutman, die dieser durch Einbildung und Borniertheit regelrecht provozierte, die alle durch ein bisschen mehr Bildung und Anstand vermieden werden konnten, wenn es nach den Regeln der Denk- und Sprachzivilisation gegangen wäre. So erinnerte sich Dr. Ferdinand nicht nur an das Gespräch beim ärztlichen Direktor wegen der falschen Schuldzuweisung am Tode des bewusstlosen Jungen, bei dem Dr. Hutman durch verlängertes Teetrinken bedenkenlos den lebensrettenden Eingriff der Kraniotomie hinauszögerte und dann seine Unerfahrenheit beim Setzen der Bohrlöcher probte, sondern auch an das Gespräch beim Superintendenten, als er noch Dr. Witthuhn hiess. Was war passiert? Dr. Ferdinand betrat sein Büro, Dr. Witthuhn sass auf seinem Stuhl vor einem aufgeschichteten Stoss von Krankengeschichten und bat ihn Platz zu nehmen, während er den Stoss von oben bis unten durchsah und seine Aufmerksamkeit den ärztlichen Eintragungen der täglichen Saalrunden zuwandte.
Der Fallensteller in einer Zeit der höchsten Bedrängnis
An der Fensterseite unter der ratternden Klimaanlage sass Dr. Hutman mit dem Fleckengesicht der teuflischen Verwünschung, der sich zur Verstärkung zwei junge Kollegen in Uniform mitgebracht hatte, die rechts und links neben ihm sassen, deren Augenspiel Nervosität ausdrückte, als wollten sie von etwas Aufgezwungenem reden, was ihrem Mund verboten war zu sprechen. Dr. Ferdinand spürte die gespannte Atmosphäre, konnte sich jedoch nicht zusammenreimen, warum die Augen der beiden gegenübersitzenden Kollegen den Zug der Angst trugen, wenn der Superintendent die ärztlichen Eintragungen durchsah und zu studieren schien. Das Gesicht des Dr. Hutman, das hatte er kennengelernt. Es sprach unverhohlen von einer List und neuen Gemeinheit, wobei ihm Dr. Ferdinand bei der Betrachtung der Leutnantsuniform und in gedanklicher Anspielung an Zuckmeyers "Des Teufels General" den Namen "Der Leutnant des Teufels" verpasste.
Dr. Witthuhn schob die Mappen mit den Krankenblättern zur Seite und fragte Dr. Ferdinand, wann er zuletzt seine Patienten gesehen hätte, der wiederum in der Plötzlichkeit der intuitiven Eingebung den Zusammenhang begriff. "Heute morgen", antwortete Dr. Ferdinand, wobei er nicht erwähnte, dass er schon vor sieben Uhr im Hospital war, um seine Patienten zu sehen. "Und wann davor?", fragte der Superintendent. "Gestern morgen", das der Wahrheit entsprach. "Ich frage Sie deshalb", fuhr der Superintendent fort, "weil Dr. Hutman sagt, dass Sie die Patienten vernachlässigen, sie nicht regelmässig gesehen werden." Dr. Ferdinand erregte sich über die erneute Unverschämtheit: "Wie kann er das sagen, ohne die nötige Gewissheit zu haben?" Dr. Hutman fühlte sich sicher und sprach schneidend: "Die Gewissheit liegt in den fehlenden Eintragungen in den Krankenblättern.” Da die Schwestern der Frühschicht nicht bestätigen konnten, dass Dr. Ferdinand die Patienten schon gesehen hatte, weil sie später kamen, und keiner die Patienten diesbezüglich gefragt hatte, nahm sich Dr. Hutman die Freiheit mit der frechen Behauptung heraus, dass der deutsche Kollege die Patienten vernachlässige, weil nachweislich keine Eintragungen im Krankenblatt zu finden waren. Dieser Vorwurf sollte sitzen, er sollte den Prestigeverlust wettmachen, den Dr. Hutman wenige Wochen vorher vor dem ärztlichen Direktor einstecken musste.
Es stimmte, dass nicht täglich Eintragungen gemacht wurden, das wusste Dr. Ferdinand auch, und er sah es nicht als unbedingtes Versäumnis an, weil die Zeit für die Saalrunde begrenzt war und mit den Operationen pünktlich begonnen werden musste. Er sagte, dass in Anbetracht der Vielzahl der Patienten und des Zeitdrucks, unter dem die Saalrunde vorgenommen werden muss, es kein ärztliches Versäumnis ist, von pedantischen Eintragungen des Normalen abzusehen, wenn die Patienten keine Besonderheiten gegenüber dem Vortag aufweisen. "Die Prioritäten sollten richtig gesetzt werden, dann wird auch dem Patienten unter den Bedingungen, die hier noch gegeben sind, am besten geholfen. Das sind Ehrlichkeit und Pünktlichkeit der ärztlichen Zuwendung", fauchte Dr. Ferdinand voller Wut dem Dr. Hutman ins Gesicht. In der Schweigeminute des Nachdenkens, Dr. Witthuhn schaute auf den Stoss scheinbar anstössiger Krankenblätter, die jungen Kollegen neben Dr. Hutman blickten entsetzt, der selbst in Blässe versank, vergegenwärtigte sich Dr. Ferdinand, dass "der Leutnant des Teufels" ihm in hinterhältig böser Absicht nachstieg, um Schaden zuzufügen und zu zersetzen, wo Zusammenarbeit das Gebot der Stunde war.
"Kehren Sie endlich vor der eigenen Tür, da liegt schon genug Dreck", fuhr ihn Dr. Ferdinand an. "Worin sehen Sie denn Ihre Aufgabe hier, wenn Sie sich als Arzt vertarnen, um zu zerstören, was andere mühsam aufbauen, weil denen die Not der Menschen am Herzen liegt. Anderen hinterherzusteigen, das ist unproduktiv und absurd in einer Situation, wo Ärzte fehlen. Sie sollten besser Ihre Arbeit tun, und so, dass sie hilfreich für die Patienten und Kollegen ist und einer Prüfung vor dem Gewissen standhalten kann." Dr. Ferdinand war wütend. Von nun an schwieg sich Dr. Hutman aus, der den Kopf nach links und rechts drehte und keine Ausrede fand. Dr. Witthuhn drückte ihm den Stempel der Anmassung und Zersetzung auf und warnte ihn vor weiteren Attacken der Bösartigkeit, die jetzt wirklich nicht zu gebrauchen sind. Er gab ihm zu bedenken, ob eine kollegiale Zusammenarbeit nicht sinnvoller wäre bei dem Umfang der zu leistenden Arbeit. Doch auch dazu schwieg sich Dr. Hutman aus. Es war offentsichtlich, dass er die Massstäbe, die den ärztlichen Kodex bestimmten, verloren hatte und sich nun hinter seiner Uniform versteckte. Verflucht sei das verlängerte Ohr des Ausspionierens und der listige Fallensteller, schwirrte es Dr. Ferdinand durch den Kopf.
"Der Leutnant des Teufels" gab auch danach nicht auf und spielte die Rolle des Charakterschweins weiter. Er war vom Auftrag der Zerstörung besessen. Ihn ritt die wilde Wut ohne Sinn und Verstand, weil er den Schaden nicht begriff, den er mit seinen Hinterhältigkeiten anstellte. Ob der nicht richtig tickt, fragte sich manchmal Dr. Ferdinand, wenn er nicht umhin kam, mit ihm die Saalrunde gemeinsam zu machen, am Op-Tisch ihm gegenüberzustehen oder im Teeraum gegenüberzusitzen, die permanente Unruhe auf seinem Gesicht mit den falschen Augenblicken herumfahren zu sehen und sich die Wichtigkeit seines Redens anzuhören. Der muss sich in der Anmassung des Masslosen und seiner zerstörerischen Zwangsneurose völlig verspiegelt haben, kam es in den Sinn, als sich Dr. Ferdinand die totale Verspiegelung der Persönlichkeit des Dr. Hutman gegen die harmlosen Schreiberlinge und Schreibärsche der verschwindenden Verantwortung in den Aufzügen der Verwaltungspyramiden vorstellte, die sich beim Hoch- und Runterfahren vor dem grossen, die ganze Rückwand einnehmenden Spiegel beim Anblick ihrer Fettheit mit den auf breiten Stiernacken aufgesetzten Rundköpfen und den ausdruckslosen, unbedeutenden und blöden Gesichtern ihre Wichtigkeit vorspiegelten.
Es bedurfte keiner besonderen Detektivarbeit, um herauszufinden, dass Dr. Hutman durch seine unablässige, zersetzende Wühltätigkeit das Misstrauen der Militärs geschürt und damit wesentlich an der Enthebung des Dr. Witthuhn vom Stuhl des Superintendenten beigetragen hatte. Durch Dr. Hutman wurde der von der weissen Matrone beschworene Teamgeist eine Totgeburt, die vorzeitig mit den Unreifezeichen eines frühen, missgebildeten Embryos wie bei einem Spontanabort im dritten Monat ausgestossen wurde. Das Arbeitsklima im Hospital blieb gespannt, weil dem "Leutnant des Teufels" das Handwerk der Niedertracht nicht gelegt werden konnte, der sich weiterhin als verlängertes Ohr mit der ihm zugesagten Bösartigkeit der Wortverdrehung betätigte, was der zwangsneurotischen Strategie der aus den Machtzentralen Pretorias aufgescheuchten Militärs vor dem Sonnenuntergang des abgewirtschafteten Apartheidssystems entgegenkam.
Die Zustände waren miserabel und menschenunwürdig im wortwörtlichsten Sinne, die trichterförmigen Zinktoiletten waren bis obenhin verstopft; davor und daneben und sonstwo lagen die Kothaufen herum, und es stank zum Himmel. Die Wasserspülungen taten es nicht, weil der Handgriff zum Spülarm fehlte, oder der Spülarm klemmte, verbogen oder abgebrochen war. Die Verstopfungen in den dicken Ablaufrohren hatten sich mit den Papierzulagen fest verschichtet und reichten weit in den Trichter hinauf, sie waren von langer Dauer und stanken bestialisch. Das Wegspülen der Exkremente, so wichtig es für die Sauberkeit ist, war eine Ausnahme, ein Glückstreffer, weil das Wasser meist zu wenig Druck hatte, wenn es nicht ganz abgedreht war aus Gründen von Reparaturarbeiten am Leitungssystem innerhalb des Hospitals oder draussen im Dorf. War dann der Wasserdruck höher als normal, dann passierte es, dass es aus den Löchern der vor vielen Jahren angeschlossenen und seit weniger Jahren durchgerosteten Eisen der gebogenen Verbindungsstücke oder den längst vergammelten und gerissenen Verbindungsschläuchen spritzte und dem ins Gesicht, der sich mit der guten Absicht über den hoch gefüllten Trichter gebeugt hatte mit dem Versuch, die Verstopfung und die am Boden liegende Unhygiene zu beseitigen, die Drainage durchgängig zu machen und sich dafür einsetzte, den ersten Ansätzen der Grundhygiene wieder auf die Beine zu verhelfen.
Da es sich hier um ein Fundamentalanliegen für ein Hospital handelte, nahm Dr. Ferdinand dieses Problem sehr ernst und rügte das Verhalten seiner zivilen wie unformierten Kollegen und besonders das der Superintendenten als unverantwortlich in punkto Sauberkeit und Grundhygiene, da aber auch keiner dieser Akademiker sich nur einmal die Mühe machte, sich persönlich über einen vollen Toilettentrichter zu beugen, um sich ein Bild vom Ausmass der Verstopfung zu machen. Er hätte es ihnen nicht verübelt, wenn sie für den Augenblick der Besichtigung des scheissvollen Trichters die Atmung eingestellt und die Nase zugequetscht hätten. Er hätte es mit einem Fragezeichen toleriert, wenn sie danach mit roten Köpfen einem Waschbecken mit funktionierendem Wasserhahn zugeeilt wären, um den Ritus des Händewaschens einzuhalten, auch wenn sie nichts berührt und den Spülkasten nicht angefasst hatten.
Dr. Ferdinand setzte deshalb das Fragezeichen hinter seine Toleranzbereitschaft, weil er den Händewaschzwang im Rahmen der blossen Besichtigung als heuchlerisch empfunden hätte, da es nur der Geruchsauflagerung gegolten hätte, die abzuwaschen war. Wie dem auch gewesen wäre, Dr. Ferdinand hätte den überzogenen Reinhaltungszwang mit einem Ausrufezeichen hingenommen, wenn die Kollegen und Superintendenten die Reinhaltung ihrer Hände auf die Hände der Patienten und die gesamte Hospitaleinrichtung übertragen hätten. Beim Waschvorgang der Hände konnten sie sich jedoch persönlich und physikalisch von den tropfenden Wasserhähnen überzeugen, die nach vollem Aufdrehen nur einen dürftigen Wasserstrahl hergaben, da der Wasserdruck nach mehr zu wünschen übrig liess. Doch nichts war geschehen, was dem Wort "Verantwortung" Ehre gemacht hätte, weshalb Dr. Ferdinand in ein Selbstgespräch verfallen war, dessen Satzgegenstände die Dinge der höchsten Dringlichkeit zwar exakt bezeichneten und ihnen die entsprechenden Tu- oder Tätigkeitsworte ebenso exakt zuordnete, jedoch konjunktivisch aussprechen musste, weil eben nichts in Richtung Grundhygiene geschah.
Er verurteilte scharf das nachlässige Verhalten gegen besseres Wissen und tadelte die ärztliche Verantwortungslosigkeit, auch wenn den "erhobenen" und von den stinkenden "Trivialitäten" des Alltags abgehobenen Akademikern der Ekel überkam und in der Blasiertheit, die viele "gebildete und feinfühlige" Akademiker fürchterlich auszeichnet, zum Ausdruck gebracht wurde, dass man schliesslich nicht so viele Jahre mit dem Studium der Medizin zugebracht hätte, um hinterher als "Arzt" mit Doktorgrad in einen voll geschissenen Toilettentrichter zu blicken. Dafür gäbe es doch Leute der geringeren Ausbildung, die mit Scheisse besser umgehen können als wir. Die Verkennung des Problems und die Arroganz der Worte, mit der Scheisse nichts am Hut zu haben, empfand Dr. Ferdinand als eine Unverschämtheit, und er tat sie in das Kästchen der bleibenden Erinnerung, wobei manche Doktoren aufgrund ihres unärztlichen Verhaltens mit den bis zur Kritiklosigkeit abgerichteten und skrupellosen Schreibärschen der verantwortungslosen Verblödung in einen Topf geworfen wurden.
Wie können die Patienten vor Ärzten Achtung haben, die ihnen den Scheissgestank und die verstopften Toiletten zur Benutzung vorhalten, fragte er sich in Erinnerung an das Sprichwort, dessen Ursprung wahrscheinlich Europa mit seinen ersten Spültoiletten war, und das ihm seine Mutter, als er schon Student war, zur Nachdenklichkeit so manches Mal vorgehalten hatte, als sie sagte: "Schau dir bloss die Toilette an, dann weisst Du, ob das Haus sauber ist oder nicht." Da sich Dr. Ferdinand nicht vorstellen konnte, dass die Mütter der Kollegen nicht dasselbe ihren Söhnen auch beigebracht hatten, wurde er böse, weil sie die Weisheit der Mütter nicht zu Herzen genommen hatten, die er diesbezüglich höher ansetzte als das später Hinzugelernte.
Da auch der neue Superintendent sich von der katastrophalen Toilettensituation nicht persönlich überzeugte, wahrscheinlich fühlte auch er sich zu "fein" dafür, blieb das Hospital, was die Toiletten anging, weiterhin ein "Saustall". In den Sälen änderte sich ebenso wie in den Operationsräumen nichts. Den Patienten, Schwestern und Ärzten wurde das Unzumutbare einfach weiter zugemutet; und von der Bantu-Administration, die in bequemen, vollklimatisierten Räumen mit Tee- und Speiseküche weit weg in Ondangwa untergebracht und mit polierten Schreibtischen, hochlehnigen Lederstühlen und Sitzgarnituren der höchsten Bequemlichkeit ausgestattet war, liess sich nicht ein Verwaltungsarsch im Hospital blicken, wie es der 'Sekretaris' vor einem Jahr versprochen hatte.
Bei dem Zustand des baulichen Verfalls und der sanitären Verrottung waren umfangreiche Reparaturarbeiten notwendig, die sicher kostenaufwendig gewesen wären, wenn die Einrichtung des Hospitals auf die Höhe des menschlich Zumutbaren gebracht werden sollte, was eine Anhebung der Arbeitsqualität zur Folge gehabt hätte. Die Menschen der Verwaltung kümmerten sich jedoch um nichts, als wäre es ihre Aufgabe nicht, den ihnen zugeschriebenen Teil der Verantwortung zu tragen und tätig zu werden, um den Zusammenbruch der Einrichtung zu verhindern. Sie lehnten sich in ihren bequemen Sesseln zurück, tranken Tee oder Kaffee pünktlich zur gewohnten Zeit und dachten über die Dinge des Privaten nach, denn der persönliche Vorteil lag ihnen am Herzen.
Am Telefon, wenn die Leitung es tat, und sie sich nicht verleugnen liessen, sprachen diese arbeitsscheuen Typen trotz leerer Schreibtische von Überlastung und der grossen Verantwortung, die sie trügen. Sie waren geübt, Lügen zu sprechen und Versprechungen zu machen, die nie gehalten wurden. Sie versicherten sich selbst und bewegten die bewilligten Gelder unsichtbar, das teilten sie und schoben die Teile der unterschiedlichen Anhäufung nach den Massstäben der persönlichen Unverschämheiten über den Tisch und in die weit geöffneten Taschen hinein, die zum leichteren Reinschieben an die Tischkanten herangehalten wurden. Beim Einfüllen fremder Gelder galt das Proporzprinzip, wobei die Taschen in direkter Proportionalitat zu den Gehaltsstufen abgefüllt wurden, dass der Reissverschluss der Tasche nicht mehr geschlossen werden konnte, deren Inhaber schon das meiste Geld per Gehalt einstrich. Es wurde als grosszügige Geste der anderen Taschenoffenhalter gewertet, dass ihnen aus der übervollen Tasche noch etwas nachgesteckt wurde, damit der Reissverschluss die bis zur Ausbauchung gefüllte Tasche endlich schliessen konnte, weil die verschlossenen Taschen den Trägern mehr Sicherheit gab, wenn sie die Büros pünktlich verliessen und so das reingeschobene und versteckte Fremdgut unauffälliger im Kofferraum der Autos zwischen Brennholz für das Barbecue und den neuen Reifen verstauten, die ihnen gratis dazugelegt wurden.
Die Geschäfte mit dem Ein- und Ansammeln zum Nulltarif hatten sie zu eingeschworenen Freunden gemacht; die Freundschaft lohnte sich, sie zahlte sich in einer Höhe aus, deren Zahlen soweit vor dem Komma standen, dass da spielend fünf und auch sechs Nullen Platz hatten, was alle vorherigen Erwartungen übertra£ Das war etwas, was richtig zum Anfassen war, mit dem jeder etwas Grösseres anfangen konnte. Sie fingen auch etwas mit den "verschwundenen" Geldern an, war es der Kauf von Farmen, Etagenhäuser zum Vermieten der Wohnungen oder Autowerkstätten mit angeschlossener Tankstelle, wobei die Gelder mühelos die Grenze passierten und bis nach Südafrika flossen. Es waren Geschäfte, die sich auszahlten, die lohnender waren und keine Kopfschmerzen machten, als sich mit dem elenden Hospital herumzuschlagen, wo die Hände durch das misstrauische Militär sowieso gebunden waren.
Dieses Händebinden nahmen die korrupten Vögel, die sich hinter den Verwaltungsärschen verbargen, gerne hin, um das Gebundensein aus militär-strategischen Gründen als Vorwand für die heuchlerische Entschuldigung zu benutzen, dass der Administration die Verantwortung für die Instandhaltung des Hospitals aus den Händen genommen wurde. Dabei wäre es eine Lüge zu behaupten, dass diese Vögel sich jemals verantwortlich um die Belange der Bevölkerung gekümmert und die Einrichtung des Hospitals auf Vordermann gebracht hätten. Diese Typen, die immer mit leeren Taschen zur Arbeit fuhren und mit vollen Taschen zurückkehrten, hatten es auf die Bewegungsfreiheit für die lohnenden Geschäfte abgesehen, wenn ihre beschmierten Hände weiterhin voll zupackten, wohl wissend, dass das nicht ewig so weitergehen würde. So sassen sie bequem an den polierten Tischen und liessen die Zeit für sich arbeiten, ohne sich durch irgenwelche Verantwortlichkeiten stören zu lassen, denn wirkliche Arbeit hatten sie nicht. Es kam heraus, dass sie auch die Schreiben mit dem Wort "Dringend!" zu Schnipseln verarbeiteten, diese in den Papierkorb warfen und bei Nachfragen sagten, dass die Schreiben nicht angekommen seien.
So gut wie alles blieb unbeantwortet und wurde ins Bodenlose zerschwiegen, besonders dann, wenn Arbeit damit verbunden war, die "unnötige" Kosten im Kostenvoranschlag verursachten. Der Besucher, wenn er mal unerwartet kam, um herauszufinden, warum die vielen Schreiben ohne Antwort blieben, fand während der Dienststunden leere Schreibtische vor, wenn von Tassen, Gläsern, Dosen, Kannen und Flaschen abgesehen wurde. Dem Spiel mit dem Geldverschieben gaben sie die höchste Aufmerksamkeit; hier liessen sie sich genügend Zeit, wie Dr. Ferdinand Jahre später in einem vertraulichen Gespräch erfuhr, als es das Apartheidssystem nicht mehr gab. Diese Typen, die sich beschissen anstellten, wenn es um die Nöte der Menschen und des Hospitals ging, die sie doch auswendig kannten, waren inwendig tief in die Korruption verstrickt, die sie professionell und unsichtbar übten. Diese graumelierten Herren mit dem Augenaufschlag der Unbedenklichkeit, von denen einige auch das Stottern nicht seinlassen konnten, waren raubmotiviert und gut ausgeschlafen, wenn sie das vollklimatisierte Büro noch während der Dienstzeit zum Spielkasino des Betrugs umfunktionierten, sich im Kollektivzwang betrügerischer Brüder aufeinander abstimmten, die Stahltür mit dem Schlüssel des aufgehobenen Vertrauens öffneten, den Inhalt plünderten, und den Tresor mit dem Achselzucken der Wiederholung wieder verschlossen.
Hier hatten sich die Täter, die ihre Taschen vollschoben, das Wort der Gegenseitigkeit und des proportionalen Schiebeverfahrens zugesprochen, dass einvernehmlich auch in Zukunft, das heisst, bei späteren Plünderungen so beibehalten werden sollte. Diesen Glauben auf Gegenseitigkeit mit dem Wissen der Mittäterschaft liessen sie dem Steuerzahler, dem sie es nicht glauben lassen wollten, gewaltig was kosten, weshalb die Bilanzbücher fast plump gefälscht wurden, als diese bei der Prüfung leere Seiten vorwiesen, wo das Papier so weiss war, wie nur die unberührte Reinheit weiss sein konnte, und die Buchprüfer die unbeschriebenen Blätter zwischen den Fingern hielten. Die skrupellose Unverschämtheit hatte die Täter des stillen Einsackens mehr als reichlich belohnt, und sie taten das überreichlich Eingesackte, das sie nicht nachprüfbar verschnürt hatten, zum unverdient Reichlichen ihrer Gehälter dazu. Die Buchprüfer kamen zu spät, auch wenn sie unangemeldet erschienen. Was sie eben fanden, waren die blütenreinen Blätter des Unbeschriebenen, und sie konnten nicht anders, als an das Weiss des Papiers zu glauben, dieses Weiss, das irritierend rein war, als die bare Münze zu nehmen. Das blendende Weiss der Papiere vermischte sich mit der Schwärze des dunklen Verdachts zu einem beständigen Grau, dass die Prüfer sich notierten.
Einem Schwindel kamen die Buchprüfer auf die Schliche, als sie die Zurückgelehnten der regionalen Verwaltung mit ihren arglos blickenden Augen fragten, wo denn der Ford-Kleinlader sei, der noch keine zwanzigtausend Kilometer gefahren hatte, dem innerhalb eines Jahres zweimal der Motor ausgewechselt und viermal die gesamte Bereifung erneuert wurde. Die Zurückgelehnten sahen sich fragend an, rutschten mit ihren Hintern auf den Stühlen und setzten sich aufrecht, während der 'Sekretaris' zum Telefonhörer griff, in die Sprachmuschel stotterte, aus der Hörmuschel den Zusammenhang des Gesagten nicht verstand und den Verantwortlichen herbeistotterte, dem die Fahrzeuge unterstanden. Der nicht mehr junge, leicht untersetzte Herr trat ein, wobei er sich das Gesicht der völligen Arglosigkeit aufgesetzt hatte. Er sprach das reine Afrikaans der Buren, sprach ohne stotternde Hindernisse und stellte alles in Frage, bis es den Prüfern zu dumm wurde, sie die entsprechenden Rechnungsbelege aus ihren Taschen zogen und dem 'Sekretaris' auf den Tisch legten, der wiederum ins Grimassieren geriet, das Gesichtskenner ihm dann zuschrieben, wenn er zwischen Nichtverstehenwollen und dem Graben der ersten Verteidigungslinie zu entscheiden hatte.
Es kam heraus, dass dieser Ford-Kleinlader vor zwei Jahren nach einem Unfall mit angeblichem Totalschaden verschrottet, auf das entfernte Nummerschild jedoch die jährlich anfallenden Strassengebühren weitergezahlt wurden. "Wo sind denn die Motoren und die vierfachen Reifensätze, die für diesen Kleinlader in Rechnung gestellt wurden?", fragten die Buchprüfer. Die Bestimmtheit ihres Fragens brachte den 'Sekretaris' und die anderen, aufrecht Sitzenden in die Verlegenheit der Beweisnot. Die Gesichter wurden blass und das Stottern des 'Sekretaris' unerträglich. Tatsache war, dass die Rechnungsbelege auf dem Tisch lagen, die bezahlten Motoren und Reifensätze sich jedoch in der Luft aufgelöst hatten. Diejenigen, die es wissen sollten, schwiegen sich aus. Andere kamen mit ausfahrenden Reden, aber keiner mit einer einleuchtenden Erklärung.
Die Buchprüfer insistierten: "Das nimmt Ihnen doch keiner ab" und machten sich eine Notiz. Der 'Sekretaris', dessen Gesicht rot angelaufen war, gab dem Buren des Fuhrparks keine Schützenhilfe; er liess ihn wie eine heisse Kartoffel fallen, obwohl der ihm so manchen Gefallen zum Nulltarif getan hatte. Er sollte allein aus dieser ‘Scheisse’ herauskommen, was ihm natürlich nicht gelang. Ihm wurde ein Disziplinarverfahren vorhergesagt, das allerdings nicht kam, weil es keinen gab, der nicht Dreck am Stecken hatte, von dem die anderen üblen Genossen nicht auch wussten. So verlief auch diese schamlose Geschichte der betrügerischen Bereicherung im Sande, dessen Spuren die Zeit verwischte, worauf diese Typen bauten. Das Schwarze des Verdachts, weswegen sie kamen, verschwand dann auch mit dem verwaschenen Grau der korrupten Grauzone. Die Buchprüfer hatten sich vom blütenreinen Weiss der unbeschriebenen Blätter in den Bilanzbüchern überzeugt. Sie kehrten in die gehobenen Etagen der Verwaltungspyramide zurück, verfassten ihren Report an den glashart polierten Schreibtischen mit dem verordneten Kopfnicken beim pretorianischen Fensterblick.
Der Report mit dem negativen Grauausgang einer Buchprüfung wurde unverzüglich von der höchsten Etage mit dem schwarz-weissen Karreemuster der Wände und den dicklehnigen Ledersesseln und angenehm federnden Metallstühlen, die wiederum in einem Silbergrau waren, abgesegnet und gegengezeichnet. Dann verschwand aus erhöhtem Sicherheitsbedürfnis die gesamte Akte mit dem unterschriebenen und gegengezeichneten Report in den unergründlichen Tiefen des Vergessensollens mit dem unersättlichen Schlund für die Dinge der dunklen Geschmäcker, die nie aufgeklärt wurden und niemals ans Tageslicht einer späteren Nachprüfung zurückkehrten. Damit entfielen nach menschlichem Ermessen auch die gefürchteten "Rechtsunsicherheiten", die theoretisch zu unliebsamen gerichtlichen Folgen führen konnten, wenn das Beweismaterial nicht gut genug weggestaut, besser, vernichtet war. Zum Dilemma der Verweigerung von Verantwortung und der Verschleierung, was da in die aufgehaltenen Taschen reingeschoben wurde, kam dann der pretorianische Hackgesang dazu, jene verspätete, stilistisch abgesackte Verknüpfung von gregorianischer Pentatonik altgriechischer Melancholie mit den manisch-depressiven Hüpf- und Seitensprüngen in Quarten, Quinten und Oktaven, dass da wieder die Eulen nach Athen getragen wurden, während die meisten Vögel schon nach Norden flogen. Es gab nächtliche Schwanengesänge, in die eingestimmt wurde, dass einem nichts Gutes schwante, wo dann noch die kapitolinischen Schnattergänse, von denen es hier genug gab, mit arrhythmisch zerhackten Aushalteparolen des Querformats dazwischenschnatterten. Es war eine überspannte Zeit, die gruselig zugleich war, als hätte man auf einem turmhoch gespannten Drahtseil ohne Netz und Balanzierstange die Gehprobe des Lebens zu bestehen, um vom Ende der Verwilderung zum Anfang der Zivilisation zurückzukehren.
Dr. Ferdinand wurde manchmal angst und bange, weil er sich vornahm, die Augen offenzuhalten, wenn andere sie verschlossen, sich das Zuquetschen der Nase zu untersagen, wenn er in die vollgeschissenen Toilettentrichter sah, und das Ohr zum Hören hinzuhalten, wenn andere es mit aufgepresster Hand zuhielten, um sich dem Ruf der Verantwortung nicht durch Feigheit zu entziehen, das hier als eine nicht angebrachte, bequeme Gewissenlosigkeit angesehen werden musste. Es war die Geschichte einer Zeit des Umbruchs, die ihn das Gruseln lehrte, weil sie in allen Dingen dem ordentlichen Ablauf des täglichen Lebens oder eines aufgeräumten Hospitals aufs Heftigste widersprach. Dass die Menschen dennoch von diesem Hospital, das den Abbruch wegen Auszehrung und vergammelter Altersschwäche längst verdient hatte, Gebrauch machten, lag schlichtweg daran, dass sie im Durcheinander, das ihnen der Krieg der aufgezwungenen Apartheid bescherte, keine Alternative sahen, auch dann nicht, wenn sie körperlich verpeitscht, angeschossen oder zerschlagen waren, oder ihnen der Arm oder das Bein oder beides von einer hochgegangenen Mine abgerissen wurde.
Härteste Donnerschläge mit wild gleissenden Blitzen
In der Nacht vom Samstag auf Sonntag der zweiten Februarwoche gab es einen Wolkenbruch, dessen Schwere Dr. Ferdinand noch nicht erlebt hatte. Die Gewitter schlugen mit unerhörten Stakkatos von felsiger Härte herab, rasten in schneller Folge, durchsetzt von bebenden Tremolos mächtigster Paukenschläge hintereinander her, liessen Mark und Bein erzittern, während die Sturzgüsse des Himmels im Nu das Gefurchte und Durchlöcherte flutartig zuschüttete, und die ergossene Last wie ein Meer das Beben erdrückte. Herabzuckende Blitze gleissten gespenstig und winklig über den Bodenschwamm, zertrennten Aststämme von ungewöhnlicher Dicke mit einem Schlag, durchschlugen den noch dickeren Mutterstamm, als wäre das alles nichts, durchrasten die Krale, verschockten im Bruchteil der Sekunde die zusammenliegenden Ziegen und Rinder und brannten das Fleisch bis auf die verkohlten Knochen weg. Das gleissende Todeszischen der unbändigsten Spannung, das sich mit dem Licht verzuckte, war hörbar, anders und stärker als das Zischen der tausend Pythons, als sich im Kurzschluss die Pole in der Krone eines alten Baumes entluden, ihm die mannsdicken Aststämme abschlugen und den Mutterstamm zerrissen. Die Donnerschläge fuhren wuchtig wie urgewaltige Hämmer auf den Amboss der Erde nieder, der den Schlag schluckte und verhallte, dessen Schlagwellen so kraftvoll rollten, dass das Fundament bebte und solange zitterte, bis sie sich in der Ferne verrollten und auf dem dicken Wasserteppich der Nacht endlich zur Ruhe kamen.
Der Schlafentrissene, der sich noch im Traum als Schiffbrüchiger in den Weiten des Meeres von den aufgebrachten Wellen treiben und schlagen liess und dem gewittrigen Grollen beim Wachwerden folgte, hielt die geträumten Bedenken der menschlichen Winzigkeit und Ohnmacht im Gedächtnis, als er sich zusammenrollte, um die Seele vor dem Riss des Ertrinkens zu bewahren. Er spürte jedesmal die Erleichterung, wenn die verdonnerten Stosswellen nach dem hart versetzten Aufschlag sich in der Ferne verrollten. Da hatte er jedesmal das Gefühl, mit dem Leben noch einmal davongekommen zu sein, wofür er der Vorsehung dankte, ohne deshalb grösseren umwegartig gedanklichen Ausschweifungen zu folgen. Die Donnerschläge hatten den Nachthimmel aufgerissen, wo das Wetterleuchten über die versetzten Wolkenbänke reihemweise entlangblitzte und sich im Zickzack uferlos verstreckte. Ob das Wetterleuchten eine Botschaft des Friedens war, die sich in hellgelb-rosanen Farben ankündigte, oder durch die blutrote Beimischung das Feuerzeichen des Infernos auf der Zunge hatte, diese Frage drückte sich auf, während Dr. Ferdinand durch das Fenster in den durchtobten Nachthimmel schaut und auf weitere Zeichen wartet, die nicht kamen.
Friedensengel oder zur Weissglut gebrachte Eisen, die zum Kriegsgerät geschmiedet wurden, diese Blitzbilder der nächtlichen Erleuchtung hatte er, als es draussen still geworden war und er nicht einschlafen konnte, weil ihm die Frage von Krieg und Frieden unbeantwortet nicht aus dem Kopf gehen wollte. Als ihm klar wurde, dass er das Wetterleuchten weder zur einen, noch zur anderen Richtung hin interpretieren konnte, drehte er sich schlafsuchend auf die Seite und versuchte, dem begrenzten Verstand für den Rest der Nacht die Ruhe zu geben und ihm nicht das Unfassbare weiter zuzumuten, und auch das sein zu lassen, was er nicht ändern konnte.
Kristofina, das Mädchen, das vom Blitz getroffen wurde
Dr. Ferdinand war auf dem Wege des Einschlafens, als er sein Bewusstsein sinken liess und die ersten Schwimmschritte des Abtauchens hinter sich hatte, dass das Telefon gegen drei Uhr morgens klingelte, was mit seinem Nachtdienst die Richtigkeit hatte. Die Schwester teilte ihm mit, dass ein Mädchen zum Hospital gebracht worden war, das vom Blitzschlag getroffen wurde. Er zog sich Hemd und kurze Hose an und ging die siebenhundert Meter zu Fuss, da es kein Auto für den Nachtdienst gab, ihn zum Hospital zu fahren. Dr. Ferdinand ging in der totalen Finsternis durch Matsch und Pfützen der aufgeweichten Sandstrasse, hielt sich in der Strassenmitte, so gut er konnte, passierte unter der unbeschirmten Strassenlampe mit einer Birne der niedrigen Wattzahl den schwach erleuchteten Kontrollpunkt, zeigte sein 'Permit' und ging weiter in der Strassenmitte. Ein Auto kam nicht, um ihm den Weg mit seinen Pfützen auszuleuchten, in die er weiter trat und völlig vermatscht am Hospital ankam. Er liess den rechten Torflügel der Einfahrt offen und überquerte den Vorplatz des gemilderten Uringeruchs. Dabei kam er nicht umhin, durch den tiefen Matsch und viele Pfützen zu waten, dass er völlig verdreckt die Tür zum 'Outpatient department' erreichte. Noch draussen vor der Rezeption wusch sich Dr. Ferdinand bei kläglicher Beleuchtung den Schmutz von den Beinen, hielt die Sandalen unter den Wasserhahn und ging tropfend mit quatschendem Sumpfton der aufgeweichten Korksohlen in die Wartehalle.
Die diensttuenden Nachtschwestern machten grosse Augen, als sie ihn kommen sahen, verloren aber kein Wort zur unzumutbaren Besonderheit, den Weg zu Fuss durch Matsch und Finsernis gemacht zu haben. Dr. Ferdinand sah das vierzehnjährige Mädchen, das mit einer Lake zugedeckt auf der Trage lag und vor Schmerzen stöhnte. Er sah dem Mädchen in das blasse Gesicht, das die Schwere, vom Blitz getroffen zu sein, sprachlos und stärker als alle Worte ausdrückte. Er hob und zog die Lake vorsichtig von oben nach unten und erschrak, als er das angekohlte rechte Schienbein sah, dessen vorderer Weichteilmantel der Blitz unterhalb des Knies bis zum Fussgelenk weggeschmort hatte. Weitere Verbrennungswunden der geringeren Tiefe fanden sich im Gesicht, am anderen Bein und dem linken Ober- und Unterarm. Die Schockbekämpfung hatte gleich begonnen, als das Mädchen gebracht worden war und die erfahrene Schwester die schnell tropfende Infusion an eine Vene in der rechten Ellenbeuge angeschlossen hatte.
Dem schmerzgeplagten Mädchen stand der Tod schon auf dem Gesicht, als es zur Intensivstation zur weiteren Überwachung und Schmerzbehandlung gebracht wurde. Dort nahm das Mädchen den Fensterplatz im ersten Zweitbettzimmer ein, wo ein alter Bügel aus vier verbogenen Stangen über den mit sterilem Verband abgedeckten Unterschenkel gestellt wurde, um die Berührung des Betttuches mit der grossen Wunde des Unterschenkel zu vermeiden. Im Falle des Überlebens war es unvermeidlich, dem Mädchen das rechte Bein abzunehmen, da eine Wiederherstellung des Unterschenkels bei fehlendem Weichteilgewebe und dem verkohlten Schienbein nicht mehr möglich war.
Dr. Ferdinand setzte sich auf einen Schemel neben das Bett, kontrollierte Blutdruck und Puls alle Viertelstunde und trug die Werte auf dem Überwachungsbogen ein. Er hatte in seiner Laufbahn nur Menschen auf dem Sektionstisch der Pathologie gesehen, die der Blitz gleich totgeschlagen hatte. Dass ein Mensch den Schlag der höchsten elektrischen Spannung überlebte, das wunderte ihn ebenso wie das Ausmass der Verbrennung. Das Mädchen war in einem kritischen Zustand, da auch innere Organe betroffen sein mussten. Dr. Ferdinand hatte seine Bedenken bezüglich des Überlebens. Er liess sich das alte EKG-Gerät bringen, schloss die Elektroden über dem Brustkorb an und verfolgte die Ausschläge des Oszillographen in den Standardableitungen der Herzaktionen. Die Herztätigkeit war beschleunigt (Tachykardie) mit Unregelmässigkeiten durch Extrasystolen. Der Tachykardie entsprach der rasche Pulsschlag und die wiederkehrenden Extrasystolen, die über den Schlagadern an der Beugeseite der Handgelenke zu tasten waren.
Die Schmerzmittel wirkten, so dass das Mädchen die Ruhe fand und die Augen schloss. Es war Sonntagmorgen kurz vor fünf. Dr. Ferdinand machte sich auf den Rückweg, um sich noch einmal hinzulegen. Kristofina war der Name des Mädchens. Er hielt es in seinen Gedanken fest, als er das Buch der Preisungen aufschlug und den fünften Psalm in der Verdeutschung des Humanisten und jüdischen Philosophen Martin Buber zu lesen begann: "Meinen Sprüchen lausche, DU,/ achte auf mein Seufzen,/ merk auf die Stimme meines Stöhnens,/ o mein König und mein Gott,/ denn zu dir bete ich./ DU,/ morgens hörst du meine Stimme,/ morgens rüste ich dir zu,/ und ich spähe.// Denn nicht bist du eine Gottheit,/ die Lust hat am Frevel,/ ein Böser darf nicht bei dir gasten,/ Prahler sich dir vor die Augen nicht stellen,/ die Argwirkenden hassest du alle,/ die Täuschungsredner lässest du schwinden. –/ Ein Greuel ist DIR der Mann von Bluttat und Trug."
Dr. Ferdinand spürte, wie sich das Mädchen im Schmerz der Todesqual krümmte, und las ihr zum Trost den sechsten Psalm dazu: "DU,/ nimmer strafe in deinem Zorn mich,/ nimmer züchtige in deiner Glut mich!/ Leih Gunst mir, DU,/ denn ich bin erschlafft,/ heile mich, DU,/ denn mein Gebein ist verstört,/ und sehr verstört ist meine Seele./ Du aber, DU, bis wann noch –!/ Kehre wieder, DU,/ entschnüre meine Seele,/ befreie mich/ deiner Huld zu willen!/ Denn im Tod ist kein Deingedenken,/ im Gruftreich, wer sagt dir Dank?!" Dr. Ferdinand fühlte sich schwach, als er bei aller Reinigung seines Geistes ihr den Mut zuzusprechen versuchte, den Weg unbeirrbar zu gehen, den ihr das Schicksal nach dem Blitzschlag aufgegeben hatte, das zu tun, was ihr Gesicht beim ersten Anblick wortlos sprach, dorthin zu gehen, woher sie gekommen war, und allen körperlichen Ballast samt des angekohlten Schienbeinknochens abzustreifen und zurückzulassen und den Weg mutig und getrost, wenn auch allein mit ihrer Seele zu gehen.
Das Telefon klingelte gegen zehn, und die Schwester teilte mit, dass das Mädchen Kristofina vor fünf Minuten verstorben sei. Dr. Ferdinand hatte Tränen des Abschieds in den Augen, und er wünschte dem Mädchen beim Überschreiten der letzten Brücke alles Gute und den Frieden, den es brauchte. Es tat ihm leid, dass es diesen Weg allein gehen musste, ohne die Hand der Mutter zu spüren, denn Kristofina war noch unbescholten und jung. Ergriffen, wie kurz das Leben auf dem Planeten sein kann, griff er zu den Preisungen und las ihr den letzten Psalm noch hinterher: "Preiset oh Ihn!// Preiset Gott in seinem Heiligtum,/ preiset ihn am Gewölb seiner Macht!/ Preiset ihn in seinen Gewalten,/ preiset ihn nach der Fülle seiner Grösse!"
Dr. Ferdinand war eingeschlafen, als gegen elf Herr C. an die Tür klopfte. Er kam vom Gottesdienst aus der Kirche, der weiss gestrichenen mit dem niedrigen Turm, wo vor dem kleinen Glockenstuhl die Tauben sitzen und von oben runter die Kirchgänger vor dem Eingang mit dem grauen Weiss beklecksen, dass sie unter der Schwanzfeder fallen liessen, wenn sie die kleine Glocke beäugen und das Hin-und-her mit dem Bimmelgeläut mit halb geschlossenen Augen vor sich ergehen lassen. Herr C. hatte seine Frau und die drei Söhne zuhause abgesetzt, um einmal bei Dr. Ferdinand hereinzusehn. Er setzte sich in einen der verschmutzten Sessel und zündete sich eine Zigarette der Marke 'Camel' an, während der aus dem Schlaf Gerissene unter die Brause ging, sich erfrischte und abgetrocknet in seine Kleidung mit der kurzen Hose stieg. Als Dr. Ferdinand im kleinen Wohnraum erschien, sah er, wie Herr C. in dem dicken Buch "Die grossen Philosophen" von Karl Jaspers blätterte, da ihm aus Kenntnismangel der deutschen Sprache ein tieferes Einlesen verwehrt war. Er legte es zur Seite und sagte, dass er von Jugend an an philosophischen Büchern interessiert sei und zuletzt Martin Buber gelesen habe. Dr. Ferdinand fragte ihn, was das Besondere an der Buber'schen Philosophie sei. Er sagte richtig, dass seine Denkweise Du-bezogen ist, dass über den Dialog zwischen dem Ich und dem Du die Wahrheit des Ichs gefunden wird. Dr. Ferdinand fügte folgendes hinzu: "Es ist ein Kernpunkt seiner Philosophie, dass die Herrschaft des Ichs über das’Es’ des untersuchten Objekts die analytische Denkweise der heutigen Wissenschaft sei, die zur unpersönlichen Manipulation geführt und zur spirituellen Verarmung, zum Verschwinden Gottes und zur Verachtung der moralischen Werte des Menschen beigetragen hat.