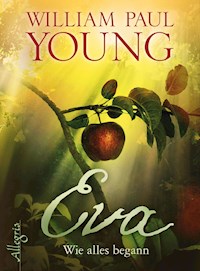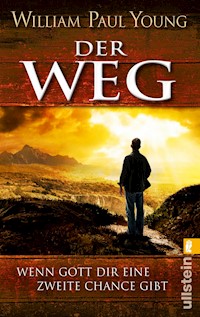
13,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Ullstein Ebooks in Ullstein Buchverlage
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
In seinem neuen Bestseller erzählt William Paul Young von der wundersamen Wandlung eines Mannes, der irgendwo zwischen Himmel und Erde feststeckt und von Gott die allerletzte Möglichkeit erhält, endlich einmal das Richtige zu tun. Nach einem Unfall fällt der skrupellose Multimillionär Tony Spencer ins Koma und »erwacht« in einer surrealen Zwischenwelt. Dort trifft er auf einen Fremden, der sich als Jesus zu erkennen gibt, und eine alte Dame, die sich als der Heilige Geist entpuppt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2012
Ähnliche
Die Originalausgabe erschien 2012 unter dem TitelCROSS ROADS im Verlag FaithWords der Hachette Book Group, Inc., New York, NY, USA
Allegria ist ein Verlag der Ullstein Buchverlage GmbH
ISBN 978-3-8437-0401-4
Alle Rechte vorbehalten. Unbefugte Nutzungen, wie etwa Vervielfältigung, Verbreitung, Speicherung oder Übertragung können zivil- oder strafrechtlich verfolgt werden.
© der deutschen Ausgabe 2012 byUllstein Buchverlage GmbH, Berlin © der Originalausgabe 2012 by William Paul Young This edition published by arrangement with FaithWords, New York, NY, USA. All rights reserved. Übersetzung: Thomas Görden Lektorat: Marita Böhm Umschlaggestaltung: FranklDesign, München Titelabbildung: Steve Gardner, PixelWorks Studios (männl. Figur) Shutterstock (Landschaft) Coverdesign: Jeff Miller, Faceout Studio Mit freundlicher Genehmigung der FaithWords, New York, NY, USA. Satz und eBook bei LVD GmbH, Berlin
Diese Geschichte ist unseren Enkelkindern gewidmet, von denen jedes ein einzigartiges Spiegelbild seiner Eltern ist, jedes sein eigenes unerforschtes Universum, Boten der Freude und des Staunens, die unsere Herzen und unser Leben tief greifend und für ewig verwandeln.
1
EIN STURM BRAUT SICH ZUSAMMEN
»Am bedauernswertesten sind jene, die ihre Träume in Silber und Gold verwandeln.«
Khalil Gibran
In manchen Jahren ist der Winter in Portland, Oregon, ein Raufbold. Er speit Graupel und Schnee und weigert sich, dem Frühling Platz zu machen, nimmt ein archaisches Recht für sich in Anspruch, das Amt des Königs der Jahreszeiten zu behalten – doch letztlich bleibt ihm nichts anderes übrig, als den Thron zu räumen. Dieses Jahr war es nicht so. Der Winter trat einfach ab wie eine geschlagene Frau, räumte mit gesenktem Kopf und zerfleddertem, schmutzig weißbraunem Kleid das Feld. Der Unterschied zwischen seiner Anwesenheit und Abwesenheit war kaum spürbar.
Anthony Spencer war das ohnehin gleichgültig. Den Winter betrachtete er als Ärgernis, und der Frühling war nicht viel besser. Hätte man es in seine Macht gestellt, er hätte beide aus dem Kalender gestrichen, zusammen mit dem nassen, regnerischen Teil des Herbstes. Ein Fünf-Monats-Jahr wäre ihm gerade recht gewesen. Jedenfalls hätte er es länger anhaltenden Zeiten der Ungewissheit klar vorgezogen. Immer wenn es Frühling wurde, fragte Tony sich, warum er eigentlich im Nordwesten blieb, aber in jedem Jahr stellte er sich die Frage erneut. Vielleicht lag in enttäuschender Vertrautheit ein ganz eigener Trost. Vielleicht war die Angst davor, irgendwo hinzuziehen, wo ihn niemand kannte, abschreckender als das gewohnte Elend. Eine sattsam bekannte Routine war zwar mitunter schmerzhaft, aber wenigstens vorhersehbar.
Tony war kein fröhlicher Mensch und fest entschlossen, sich keinen Vorteil entgehen zu lassen. Glücklichsein war eine alberne Sentimentalität. Und verglichen mit einem möglichen Deal und dem süchtig machenden Nachgeschmack des Sieges war es flüchtig wie Dunst. Freunde waren eine schlechte Investition, die Rendite war gering. Sich um andere zu kümmern war schlichtweg lästig.
Im Geschäftsleben wurde Anthony Spencer als zäher Verhandler und meisterlicher Manipulator verehrt und gefürchtet. Wie der alte Scrooge liebte er es, den Menschen in seiner Umgebung auch noch den letzten Rest ihrer Würde zu nehmen, besonders seinen Angestellten, die sich, wohl eher aus Angst als aus Respekt, für ihn abrackerten. Ganz sicher verdient ein solcher Mensch weder Liebe noch Mitgefühl.
Er maß seinen Erfolg an den ihm zur Verwaltung und Entwicklung anvertrauten Immobilien, diversen Geschäftsbeteiligungen und einem wachsenden Investment-Portfolio. Nach den meisten Standards war er wohlhabend, erfolgreich und als Single eine überaus gute Partie. Er gefiel sich ein wenig in der Rolle des Frauenschwarms, trieb genug Sport, um mithalten zu können, und leistete sich nur einen ganz leichten Bauch, der sich jederzeit einziehen ließ. Die Frauen kamen, und die klügeren von ihnen gingen meistens schnell wieder.
Wenn Tony lächelte, hätte man ihn fast für attraktiv halten können. Seine Gene hatten ihm eine Statur von über eins achtzig und volle Haare geschenkt, die auch jetzt noch mit Mitte vierzig keine Anstalten machten auszufallen, aber ein distinguiertes erstes Grau zeigten. Er war offenkundig von angelsächsischer Abstammung. Ein Anflug von etwas Dunklerem, Feinerem ließ sein Gesicht weicher erscheinen, vor allem, wenn irgendeine Laune oder ein ihn plötzlich überkommendes Lachen seine gewohnte geschäftsmäßige Nüchternheit durchbrach.
Er war zweimal verheiratet gewesen, beide Male mit derselben Frau. Aus der ersten Ehe, da waren sie beide Anfang zwanzig gewesen, gingen ein Sohn und eine Tochter hervor. Letztere war nun eine zornige junge Erwachsene, die mit ihrer Mutter an der Ostküste lebte. Der Sohn war eine andere Geschichte. Ihre Ehe war wegen unüberbrückbarer Differenzen geschieden worden, ein geradezu schulbuchmäßiges Beispiel für wohlkalkulierte Gleichgültigkeit und einen kaltschnäuzigen Mangel an Zuwendung. In wenigen Jahren schaffte es Tony, Lorees Selbstwertgefühl in Stücke zu zerlegen.
Dummerweise war sie es, die ihm schließlich überaus anmutig den Laufpass gab. Das konnte er nicht als echten Sieg für sich verbuchen. Also verbrachte Tony die folgenden zwei Jahre damit, sie zurückzuerobern. Er schmiss eine großartige Wiederverheiratungsparty, und zwei Wochen später präsentierte er ihr die Scheidungspapiere. Man erzählte sich, er hätte sie schon vorbereitet, noch bevor die Unterschriften unter das zweite Set von Hochzeitsurkunden gesetzt wurden. Aber diesmal ließ sie den ganzen Zorn einer verschmähten Frau an ihm aus, und er machte sie fertig – finanziell, juristisch und psychologisch. Das konnte er zweifelsohne als Gewinn verbuchen. Für ihn, aber auch nur für ihn, war es nichts als ein gnadenloses Spiel gewesen.
Der Preis, den er dafür zahlte, war, dass sich während des Scheidungsprozesses seine Tochter von ihm abwandte und nichts mehr mit ihm zu tun haben wollte. Wenn er ein bisschen zu viel Scotch getrunken hatte, kam das Gespenst dieses Verlustes aus den Schatten, aber er begrub es stets schnell wieder, indem er sich ganz der Arbeit und seinen geschäftlichen Siegen widmete. Sein Sohn war der eigentliche Grund für den Scotch. Rezeptfreie Medikamente hatten der Erinnerung ihre scharfen Kanten genommen und dämpften die schmerzhaften Migräneanfälle, die Tony gelegentlich überfielen.
So, wie Freiheit eine allmähliche Entwicklung ist, dringt auch das Böse Schritt für Schritt in ein Leben ein. Aus kleinen Beugungen der Wahrheit und geringfügigen Selbstrechtfertigungen entsteht mit der Zeit ein Gebäude, das niemand hätte vorhersagen können. Das gilt für jeden Hitler, jeden Stalin und jeden Alltagsmenschen. Das innere Haus der Seele ist großartig, aber zerbrechlich. Jeder Verrat, jede Lüge, die in seine Mauern und sein Fundament eingebaut werden, verändern die Ausrichtung der ganzen Konstruktion auf unvorhersehbare Weise.
Das Mysterium jeder Seele ist eigenartig, auch das der Seele von Anthony Spencer. Er wurde wie wir alle in ein expandierendes inneres Universum geboren, das mit unvorstellbarer Symmetrie und Eleganz seine eigenen Sonnensysteme und Galaxien hervorbrachte. Hier spielte sogar das Chaos seine Rolle, und Ordnung entstand als ein Nebenprodukt. Orte mit Substanz traten ein in den Tanz widerstreitender Gravitationskräfte, und jeder dieser Orte fügte der Mixtur seine eigene Rotation hinzu, wodurch die Positionen der anderen Teilnehmer des kosmischen Walzers sich veränderten und alle sich erweiterten und ausdehnten, in einem ständigen Geben und Nehmen aus Raum und Zeit und Musik. Entlang des Weges brachen Schmerz und Verlust über dieses Universum herein und bewirkten, dass es seine Tiefe verlor und die zarte Struktur allmählich in sich zusammenfiel. An der Oberfläche zeigte sich dieser Verfall in Form von Angst als Selbstschutzmechanismus, von selbstsüchtigem Ehrgeiz und der Verhärtung all dessen, was zuvor sanft und zart gewesen war. Was zuvor ein lebendiges Wesen war, ein Herz aus Fleisch, wurde zu Stein; ein kleiner, verhärteter Felsen lebte in der Schale, der Hülle des Körpers. Einst war die äußere Gestalt ein Ausdruck innerer Wunder und Pracht gewesen. Nun musste sie sich ohne innere Unterstützung ihren Weg suchen, eine Fassade auf der Suche nach einem Herzen, ein sterbender Stern, den seine eigene Leere gefräßig machte.
Schmerz, Verlust und schließlich das Verlassenwerden sind harte Lehrmeister und kombiniert erzeugen sie eine Trostlosigkeit, die fast unerträglich ist. Sie hatten Tony dazu gebracht, Worte als Abwehrwaffen einzusetzen und sein Inneres hinter Mauern zu verschanzen, die ihm Sicherheit vorgaukelten, während er in Wahrheit isoliert und einsam war. So gab es in Tonys Leben inzwischen fast keine wahre Musik mehr, nur kaum hörbare Fetzen von Kreativität. Der Soundtrack seines Daseins taugte noch nicht einmal als Muzak – überraschungsarme Aufzugsmusik für vorhersehbar verlaufende Verkaufsgespräche.
Die, die ihn auf der Straße erkannten, grüßten mit einem Kopfnicken. Und die scharfsinnigeren unter ihnen spuckten hinter seinem Rücken ihre Verachtung auf den Bürgersteig. Aber mehr als genug fielen auf ihn herein; katzbuckelnde Kriecher führten beflissen jede seiner Anordnungen aus, in der verzweifelten Hoffnung, ein Stückchen seiner Anerkennung oder vermeintlichen Zuneigung zu gewinnen. Im Kielwasser angeblichen Erfolges lassen andere sich gerne mittragen, getrieben von dem Bedürfnis, ihre eigene Bedeutung, Identität und Agenda abzusichern. Wahrnehmung ist Realität, sogar wenn die Wahrnehmung eine Lüge ist.
Tony besaß ein teures Haus in den oberen West Hills, das er, wenn er nicht eine seiner dem geschäftlichen Eigennutz dienenden Partys veranstaltete, nur zu einem kleinen Teil beheizte. Obwohl er sich dort nur selten aufhielt, behielt er das großzügige Anwesen als ein Monument des Sieges über seine Frau. Bei ihrer ersten Scheidung war es Loree zugesprochen worden, doch später hatte sie es verkauft, um die ausufernden Anwaltskosten der zweiten Scheidung bezahlen zu können. Über Mittelsmänner kaufte er es weit unter Wert von ihr zurück. Als der Verkauf abgeschlossen war, organisierte er noch am gleichen Tag eine regelrechte Zwangsräumungsparty einschließlich eines Polizeiaufgebots, das seine völlig fassungslose Exfrau vom Grundstück eskortierte.
Heute befand er sich in üblerer Stimmung als sonst. Geschäftliche Verpflichtungen machten seine Anwesenheit bei einer für ihn wenig interessanten Konferenz in Boston nötig, und dann musste er auch noch wegen einer kleineren Krise im Personalmanagement einen Tag früher als geplant zurückkehren. Zwar war es ärgerlich, sich um eine Situation kümmern zu müssen, die seine Untergebenen in der Firma auch gut ohne ihn hätten regeln können, aber immerhin lieferte ihm das eine gute Entschuldigung, von den nur mit Mühe erträglichen Seminaren in Boston zu jener ebenfalls schwer erträglichen Routine zurückzukehren, die ihm vertrauter war.
Aber etwas hatte sich verändert. Was als leises Unbehagen begonnen hatte, war zu einer bewussten Stimme geworden. Seit ein paar Wochen war Tony von dem nagenden Gefühl befallen, verfolgt zu werden. Zunächst tat er das als letztlich unerhebliches Stresssymptom ab, als Einbildungen seines überarbeiteten Verstandes. Doch der Gedanke fiel in ihm auf fruchtbaren Boden. Ein Samenkorn, das durch vernünftige Überlegungen schnell hätte weggewaschen werden können, schlug Wurzeln, die sich schon bald als nervöse Hyperwachsamkeit zeigten, und so wurde Tonys ohnehin schon ständig angespanntem Geist noch mehr Energie entzogen.
Er bemerkte Details, die für sich genommen kaum Anlass zur Besorgnis boten. Doch insgesamt gesehen wurden sie in Tonys Bewusstsein zu einem warnenden Chor. Da war der schwarze Geländewagen, der auf der Fahrt in die Firma manchmal hinter ihm fuhr. Da waren der Tankstellenmitarbeiter, der für Minuten vergaß, ihm seine Kreditkarte zurückzugeben, und der Sicherheitsdienst, der ihn über drei Stromausfälle in seinem Privathaus informierte, von denen nur sein Anwesen und keines der Nachbarhäuser betroffen gewesen war. Diese Stromausfälle hatten jeweils genau zweiundzwanzig Minuten gedauert und waren an drei Tagen hintereinander immer zur gleichen Uhrzeit erfolgt. Tony fing an, scheinbar banalen Unregelmäßigkeiten in seinem Alltag mehr Aufmerksamkeit zu schenken, und achtete sogar darauf, wie andere Leute ihn ansahen – die Bedienung bei Stumptown Coffee, der Wachmann am Eingang auf der ersten Etage und sogar die Büroangestellten in der Firma. Er registrierte, wie sie seinem Blick auswichen, wenn er in ihre Richtung schaute, und wie sie rasch ihre Körpersprache änderten, um vorzutäuschen, dass sie beschäftigt waren und ihn gar nicht bemerkten.
Die Reaktionen dieser sehr verschiedenen Leute waren beunruhigend ähnlich, als bestünde zwischen ihnen eine geheime Absprache. Sie teilten ein Geheimnis, in das er nicht eingeweiht war. Je mehr er hinsah, desto mehr fiel ihm auf und umso mehr schaute er hin. Er war immer schon ein wenig paranoid gewesen, aber nun eskalierte diese Neigung so weit, dass er hinter allem und jedem eine Verschwörung gegen sich vermutete. So lebte er in ständiger Sorge und Anspannung.
Neben seiner eigentlichen Wirkungsstätte, strategisch günstig in der mittleren Etage eines mittelgroßen Bürohochhauses im Stadtzentrum von Portland gelegen, besaß Tony ein kleines privates Büro, komplett mit Schlafzimmer, Küche und Bad. Die Adresse war noch nicht einmal seinem persönlichen Anwalt bekannt. Das war sein Refugium. Es lag unten am Fluss, nicht weit vom Macadam Boulevard. Dorthin zog er sich zurück, wenn er einfach mal für ein paar Stunden oder eine ganze Nacht verschwinden und für niemanden erreichbar sein wollte.
Das Gebäude, in dem sein Geheimquartier lag, hatte er über eine Briefkastenfirma erworben. Er ließ einen Teil des Kellergeschosses umbauen und modernste Überwachungs- und Sicherheitstechnologie installieren. Die Handwerker, die die Arbeiten ausführten, waren über die Briefkastenfirma beauftragt worden, sodass er anonym blieb. Und außer ihnen hatte nie jemand die Räume zu Gesicht bekommen. Sogar in den Bauplänen und -genehmigungen tauchten sie nicht auf, was durch gut platzierte Zuwendungen an die zuständigen Dezernate der Stadtverwaltung erreicht worden war. Wurde an etwas, das wie ein verrosteter Telefonschaltkasten in einem unbenutzten Hausmeisterraum aussah, die richtige Zahlenkombination in die Tastatur getippt, glitt eine Wand zur Seite, und dahinter kamen eine stählerne Brandschutztür mit Codetastatur und eine moderne Kamera zum Vorschein.
Das Refugium war fast völlig autark. Es verfügte über eigenen Strom- und Internetanschluss unabhängig vom Rest des Gebäudes. Wenn Tonys Sicherheitssoftware einen Versuch bemerkte, den Anschluss zu lokalisieren, fuhr sie das System automatisch herunter und sperrte es. Nur nach einem Reset und der Eingabe eines neuen, automatisch generierten Codes konnte es wieder hochgefahren werden. Das war nur von zwei Orten aus möglich: seinem Schreibtisch in der Firma oder dem Versteck selbst. Bevor er sein Versteck betrat, hatte er es sich zur Gewohnheit gemacht, sein Handy auszuschalten und die SIM-Karte und den Akku herauszunehmen. Drinnen gab es einen nicht registrierten Festnetzanschluss, den er jederzeit aktivieren konnte, was aber noch nie erforderlich gewesen war.
Hier wurde nichts zur Schau gestellt, gab es nichts zu repräsentieren. Die Einrichtung war schlicht, fast spartanisch. Niemand anderes würde diesen Ort je zu Gesicht bekommen, also bedeutete alles in diesen Räumen nur ihm ganz persönlich etwas. Bücher füllten die Wände. Viele von ihnen hatte er nie aufgeschlagen, aber sie hatten seinem Vater gehört. Andere, Klassiker vor allem, hatte seine Mutter ihm und seinem Bruder vorgelesen. Die Werke von C. S. Lewis und George MacDonald nahmen einen herausragenden Platz ein. Sie waren Lieblingsbücher seiner Kindheit. Eine Sammlung von sorgfältig mit Klebezetteln und Randnotizen versehenen Management- und Erfolgsbüchern füllte ein anderes Regal – die Mentoren seines Geschäftslebens. Ein paar Arbeiten von Escher und Doolittle hingen eher planlos an den Wänden, und in einer Ecke stand ein alter Plattenspieler. Tony bewahrte eine Sammlung von Vinylplatten auf, deren Kratzer tröstliche Erinnerungen an längst vergangene Zeiten waren.
In diesem Refugium verwahrte er auch besonders wichtige Gegenstände und Dokumente – Urkunden, Titel und vor allem seinen offiziellen Letzten Willen. Er änderte sein Testament oft, setzte Personen ein oder strich sie heraus, je nachdem, auf welche Weise sie sein Leben kreuzten und ob ihre Handlungen seinen Zorn erregten oder ihn zufriedenstellten. Gern malte er sich die Wirkung aus, die, wenn er sich eines Tages zu den »geliebten Verstorbenen« gesellte, ein Anteil an seinem Erbe oder die schmähliche Nichtberücksichtigung auf jene haben würde, die es auf seinen Reichtum abgesehen hatten.
Sein persönlicher Anwalt hatte, anders als sein Firmen-Justitiar, einen Schlüssel zu einem Schließfach bei Wells Fargo in Downtown Portland. Zugang zu diesem Schließfach würde er nur erhalten, wenn er Tonys Sterbeurkunde vorlegte. Darin befanden sich die Adresse und der Zugangscode zu seinem geheimen privaten Apartment und Büro sowie eine Beschreibung, wo sich dort die Codes befanden, mit denen sich der versteckt ins Fundament des Gebäudes eingelassene Safe öffnen ließ. Sollte jemals jemand versuchen, sich ohne die Sterbeurkunde Zutritt zu dem Schließfach zu verschaffen, hatte die Bank Anweisung, Tony unverzüglich zu informieren. Seinem Anwalt hatte er unmissverständlich klargemacht, dass ihre Geschäftsbeziehung und die üppige Honorarzahlung, die pünktlich am Ersten jeden Monats eintraf, dann für immer der Vergangenheit angehören würden.
Tony bewahrte, nur zum Schein, noch eine ältere Version seines »Letzten Willens und Testaments« in seinem Büro in der Firma auf. Einige seiner Partner und Kollegen hatten zu geschäftlichen Zwecken Zutritt zu diesem Büro, und er hoffte insgeheim, dass der eine oder andere, von Neugierde getrieben, einen Blick hineinwerfen würde. Er malte sich ihre anfängliche Freude darüber aus, in seinem vermeintlichen Letzten Willen bedacht zu werden, gefolgt von dem ernüchternden Ereignis der Verlesung des endgültigen Testaments.
Es war allgemein bekannt, dass Tony das Gebäude gehörte, das gegenüber von jenem lag, in dem sich sein Geheimquartier befand. Es war eine ähnliche Anlage mit Geschäften im Erdgeschoss und Eigentumswohnungen darüber. Die beiden Gebäude verfügten über eine gemeinsame Tiefgarage mit strategisch platzierten Kameras, die scheinbar das gesamte Parkgeschoss überblickten, jedoch in Wahrheit einen schmalen Korridor nicht abdeckten, durch den Tony unbeobachtet zu seinem Versteck gelangen konnte.
Um seine regelmäßige Anwesenheit in diesem Stadtviertel zu rechtfertigen, kaufte er eine repräsentative Eigentumswohnung mit zwei Schlafzimmern auf der ersten Etage des an sein Geheimbüro angrenzenden Gebäudes. Sie war luxuriös ausgestattet und bildete eine perfekte Fassade. Er verbrachte dort mehr Nächte als in seinem Besitz in den West Hills und seinem Strandhaus an der Küste bei Depoe Bay. Die Zeit, die er benötigte, um aus der Eigentumswohnung in sein Versteck zu gehen, hatte er genau gemessen. Es waren nur drei Minuten. Von dort wurden Wohnzimmer und Eingangsbereich der Wohnung kameraüberwacht. Neben der Liveübertragung fand auch eine ständige Videoaufzeichnung statt. Die aufwendige elektronische Hardware diente ausschließlich seiner eigenen Sicherheit. Er hatte in den Schlaf- und den Badezimmern bewusst keine Kameras installieren lassen, weil er wusste, dass auch andere Leute gelegentlich als Gäste bei ihm wohnen würden, wenn er die Wohnung selbst nicht benutzte. Er mochte einige unangenehme Charaktereigenschaften aufweisen, aber Voyeurismus gehörte nicht dazu.
Jeder, der ihn mit seinem Wagen in die Tiefgarage fahren sah, würde annehmen, dass er die Nacht in seiner Eigentumswohnung verbrachte, was in der Regel ja auch zutraf. Er gehörte hier inzwischen zur gewohnten Alltagsroutine. Seine An- oder Abwesenheit erregte keine besondere Aufmerksamkeit, und das war genau, was er wollte. Doch nun, in diesem Zustand erhöhter Ängstlichkeit und Anspannung, verhielt sich Tony noch vorsichtiger als sonst. Er änderte seine Routineabläufe gerade so viel, dass er bemerken würde, wenn ihn jemand verfolgte, aber nicht so sehr, dass es in seiner Umgebung auffiel.
Was er nicht verstehen konnte, war, warum er überhaupt verfolgt wurde, welche Motive und Absichten dahintersteckten. Er hatte viele Brücken hinter sich abgebrochen, gerade in letzter Zeit, und er vermutete, dass darin die Erklärung zu suchen war. »Es muss etwas mit Geld zu tun haben«, mutmaßte er. Ging es nicht letztlich immer um Geld? Vielleicht steckte seine Exfrau dahinter? Vielleicht hatten seine Teilhaberetwas ausgeheckt, um ihm seinen Anteil abzujagen, oder war es ein Konkurrent? Tony brachte Stunden, Tage damit zu, die Daten jeder früheren und aktuellen geschäftlichen Transaktion zu überprüfen, auf der Suche nach einer Ungereimtheit, doch er entdeckte nichts. Dann vertiefte er sich in die Geschäfte der Holdings, wieder auf der Suche … wonach? Etwas Auffälligem, einer Erklärung für das, was mit ihm geschah. Er stieß auf einige Anomalien, doch wenn er seinen Partnern vorsichtig diesbezüglich auf den Zahn fühlte, wurden diese Dinge schnell und geräuschlos korrigiert oder auf eine Weise erklärt, die völlig im Einklang mit jenen Prozeduren stand, die er selbst eingeführt hatte.
Trotz der schwierigen Wirtschaftslage liefen die Geschäfte gut. Tony war es gewesen, der seine Partner davon überzeugt hatte, genügend Kapitalreserven aufzubauen. Daher kauften sie nur sehr vorsichtig neue Immobilien hinzu und investierten in Geschäfte mit sicherer Rendite, was sie unabhängig von den Banken machte, die inzwischen übervorsichtig geworden waren und kaum noch Kredite vergaben. Derzeit war er der Held der Firma, aber das beruhigte ihn keineswegs. In dieser Branche durfte man sich keine Atempause gönnen, und jeder Erfolg bedeutete, dass die Messlatte immer noch höher gelegt wurde. Es war eine kräftezehrende Art zu leben, aber andere, weniger stressige Optionen kamen für ihn nicht in Betracht. Er wäre sich dann verantwortungslos und faul vorgekommen.
Er hielt sich immer weniger in der Firma auf. Nicht dass die Leute dort scharf darauf gewesen wären, mehr Zeit als nötig in seiner Nähe zu verbringen. Seine zunehmende Paranoia machte ihn noch reizbarer als sonst. Wegen jeder Kleinigkeit fuhr er aus der Haut. Sogar seine Teilhaber zogen es vor, wenn er von zu Hause aus arbeitete, und wenn das Licht in seinem Büro nicht brannte, seufzten alle erleichtert und arbeiteten viel besser und konzentrierter.
Aber dass er nun mehr Zeit für sich selbst hatte, verschaffte ihm keine Erleichterung, sondern seine Angst brach erst recht hervor, dieses Gefühl, dass irgendwer oder irgendetwas es auf ihn abgesehen hatte, ihm eine geheime Aufmerksamkeit widmete, die ihm ganz und gar unwillkommen war. Zu allem Überfluss meldeten sich auch noch seine Kopfschmerzen zurück, und zwar mit aller Macht. Diese Migräneanfälle begannen zumeist mit Sehstörungen und Sprachschwierigkeiten. Seine Aussprache wurde undeutlich, und er musste mühsam nach Worten suchen, um einen Satz zu beenden. Das war stets die Vorwarnung, auf die kurze Zeit später ein Schmerz folgte, als würde ihm ein unsichtbarer Nagel durch den Schädel in den Raum hinter seinem rechten Auge gerammt. Er wurde dann extrem licht- und geräuschempfindlich und schaffte es nur mit Mühe, seine persönliche Assistentin zu informieren, ehe er sich in die abgedunkelte Stille seiner Eigentumswohnung zurückzog. Gewappnet mit starken Schmerzmitteln und weißem Rauschen schlief er, bis es nur noch wehtat, wenn er lachte oder den Kopf schüttelte. Tony redete sich ein, dass Scotch bei der Erholung half, aber er suchte sowieso ständig nach Entschuldigungen, um sich ein Glas zu genehmigen.
»Warum gerade jetzt?« Nachdem er monatelang gar keine Migräne gehabt hatte, kamen die Anfälle nun fast wöchentlich. Er wurde vorsichtig bei der Auswahl dessen, was er zu sich nahm. Vielleicht schüttete ihm ja jemand Gift ins Essen oder seine Getränke. Ständige Müdigkeit machte ihm zu schaffen, und obwohl er mit pharmazeutischer Unterstützung durchschlief, fühlte er sich erschöpft. Schließlich vereinbarte er einen Termin bei seinem Hausarzt, den er aber nicht wahrnehmen konnte, weil er kurzfristig an einem Meeting teilnehmen musste, das sich um unerwartet aufgetauchte Probleme bei einem wichtigen Immobilienkauf drehte. Er ließ sich einen neuen Termin zwei Wochen später geben.
Wenn die Alltagsroutine infrage gestellt wird, beginnt man, über sein Leben im Ganzen nachzudenken, darüber, wer einem wichtig ist und warum. Insgesamt war Tony mit seinem Leben nicht unzufrieden. Er war wohlhabender als die meisten, was eine beachtliche Leistung darstellte für ein Heimkind, bei dem das System versagt hatte und das es aufgegeben hatte, darüber Tränen zu vergießen. Er hatte Fehler gemacht und Menschen verletzt, aber auf wen traf das nicht zu? Er war allein, aber meistens war ihm das gerade recht. Er besaß ein Haus in den West Hills, ein Stranddomizil in Depoe Bay, seine Eigentumswohnung am Willamette River, einträgliche Geldanlagen und die Freiheit, nahezu alles zu tun, was er tun wollte. Er hatte alle Ziele erreicht, die er sich gesteckt hatte, zumindest jedes realistische Ziel, und nun, mit Anfang vierzig, lebte er mit einem nagenden Gefühl der Leere und zunehmend hochkommenden Gefühlen des Bedauerns. Diese schluckte er schnell wieder herunter, stopfte sie in jene unsichtbare Grube, die Menschen erschaffen, um sich vor sich selbst zu schützen. Natürlich war er allein, aber meistens war ihm das gerade recht. Meistens …
Als er diesmal aus Boston zurückkam, war er gleich in seine Firma gefahren, nur um sich stundenlang mit seinen beiden Geschäftspartnern herumstreiten zu müssen. Aber das brachte Tony auf einen Gedanken. Er wollte eine Liste erstellen. Eine Liste jener Menschen, denen er wirklich trauen konnte, Menschen, denen er seine Geheimnisse und Träume anvertrauen mochte und gegenüber denen er bereit war, Schwächen zuzugeben. Er igelte sich in seinem geheimen Büro ein, nahm eine Weißwandtafel zur Hand, die er benutzte, um sich besser konzentrieren zu können, und fing an, Namen zu notieren. Die Liste war von Anfang an recht kurz. Zunächst setzte er Geschäftspartner darauf, ein paar seiner Angestellten, ein oder zwei Bekannte außerhalb seines beruflichen Umfelds und einige Leute, die er in privaten Klubs und auf Reisen kennengelernt hatte. Doch nachdem er eine Stunde über diese Liste nachgedacht hatte, strich er sie auf sechs Namen zusammen. Er lehnte sich zurück und schüttelte den Kopf. Die einzigen Menschen, denen er wirklich vertraute, waren alle tot. Nur beim letzten auf der Liste war er da nicht ganz sicher.
Sein Vater und vor allem seine Mutter standen ganz oben. Mit dem Verstand wusste er, dass, durch Zeit und Trauma, ein großer Teil seiner Erinnerungen an sie verklärt und idealisiert waren. Wegen seiner Sehnsucht nach den Eltern hatte er ihre negativen Eigenschaften verdrängt. Er hütete das verblichene Foto wie einen Schatz, das letzte Foto, aufgenommen, bevor ein Teenager, der unterwegs zu einer Party war, die Kontrolle verlor und die Herrlichkeit eines Lebens zertrümmerte. Tony öffnete den Safe und nahm das Foto heraus. Es war jetzt durch eine Klarsichthülle geschützt, aber er versuchte trotzdem, die zerknickten Ränder glatt zu streichen, als könnte diese liebevolle Zuwendung irgendwie seine Eltern erreichen. Sein Vater hatte einen Fremden überredet, draußen vor dem schon lange nicht mehr existierenden Farrell-Eissalon ein Foto von ihnen zu machen. Tony war ein schlaksiger Elfjähriger gewesen, und sein siebenjähriger Bruder Jake stand vor ihm. Sie hatten über irgendetwas gelacht, seiner Mutter stand die Freude des Augenblicks ins schöne Gesicht geschrieben, sein Vater grinste ironisch, was die beste Art von Lachen war, die er zustande brachte. Aber es genügte, dieses Grinsen seines Vaters. Tony erinnerte sich klar und deutlich daran. Der Vater war Ingenieur gewesen, der selten Emotionen zeigte. Aber dieses Grinsen rutschte ihm manchmal ganz unerwartet heraus und bedeutete Tony gerade deshalb viel, weil man es ihm nicht so leicht entlocken konnte. Tony hatte versucht, sich zu erinnern, worüber sie alle gemeinsam gelacht hatten. Stundenlang starrte er diese Frage in das Foto hinein, als könnte es das Geheimnis preisgeben. Aber sosehr er es auch versuchte, die Erinnerung lag knapp außerhalb seiner Reichweite, und das quälte ihn, machte ihn ganz verrückt.
Als Nächste auf der Liste kam Mutter Teresa, dicht gefolgt von Mahatma Gandhi und Martin Luther King. Alle groß, alle idealisiert, alle sehr menschlich, verletzlich, wundervoll und heute tot. Tony saß da und spielte zwischen rechtem Zeigefinger und Daumen mit der Liste. Warum hatte er gerade die Namen dieser Leute aufgeschrieben? Diese letzte Liste war ihm fast ohne nachzudenken aus der Feder geflossen, schien aus einer sehr tief liegenden, möglicherweise sogar echten inneren Quelle zu kommen. Vielleicht drückte sich darin eine Sehnsucht aus. Er verabscheute dieses Wort, und doch liebte er es irgendwie. An der Oberfläche klang es nach Schwäche, aber es hielt sich hartnäckig, überdauerte nahezu alles andere, was in seinem Leben gekommen und gegangen war. Diese drei standen, zusammen mit dem letzten Namen auf der Liste, für etwas, das größer war als er selbst. Es war eine Ahnung eines nie gesungenen Liedes, das noch immer nach ihm rief, die Möglichkeit des Menschen, der er hätte sein können, eine Einladung, ein Gefühl der Zugehörigkeit, ein sanftes Sehnen.
Der letzte Name war der schwierigste und doch der leichteste: Jesus. Jesus, Bethlehems Geschenk an die Welt, jener Zimmermann, in dessen Gestalt Gott angeblich Teil unserer Menschheit geworden war, Jesus, der, den religiösen Gerüchten zufolge, möglicherweise nicht gestorben war. Tony wusste, warum Jesus auf seiner Liste stand. Das hing mit den stärksten Erinnerungen zusammen, die er an seine Mutter hatte. Sie liebte diesen Zimmermann und alles, was mit ihm zu tun hatte. Gewiss hatte auch sein Vater Jesus geliebt, aber nicht so wie seine Mutter. Das letzte Geschenk, das sie ihm gemacht hatte, lag in dem Safe, der sein Versteck beherbergte. Dieses Geschenk war sein kostbarster Besitz. Keine zwei Tage bevor seine Eltern so gewaltsam aus seinem Leben gerissen worden waren, kam sie auf sein Zimmer. Die Erinnerung hatte sich tief in seine Seele eingegraben. Er war elf Jahre alt, machte gerade seine Hausaufgaben, und da stand sie, gegen die Tür gelehnt, mädchenhaft zierlich wirkend in ihrer geblümten Schürze, Mehl auf der einen Wange, wo sie sich das Haar, das ihrem Stirnband entkommen war, aus dem Gesicht gestrichen hatte. An dem Mehl sah er, dass sie geweint hatte. Die Tränen hatten verwaschene Spuren auf ihrer Wange hinterlassen.
»Mom, bist du in Ordnung? Was hast du denn?«, hatte er gefragt, während er von seinen Schulbüchern aufstand.
»Oh«, rief sie aus und wischte sich mit den Handrücken übers Gesicht, »es ist nichts. Du kennst mich doch. Manchmal fange ich an, nachzudenken – über alles, wofür ich so dankbar bin, ganz besonders dich und deinen Bruder, und dann bin ich ganz gerührt.« Sie schwieg einen Moment. »Ich weiß nicht, warum, mein Schatz, aber ich habe darüber nachgedacht, wie groß du wirst. In ein paar Jahren bist du ein Teenager, dann gehst du aufs College und dann heiratest du, und als ich über all das nachdachte, weißt du, was ich da gefühlt habe?« Wieder schwieg sie kurz. »Ich fühlte Freude. Es war, als wollte mir die Brust zerspringen. Tony, ich bin Gott so dankbar, dass es dich gibt. Darum habe ich beschlossen, dir heute deinen Lieblingsnachtisch zu machen: Brombeerkuchen und Karamellplätzchen. Aber als ich so dastand und aus dem Fenster schaute auf alles, was uns geschenkt wurde, vor allem du und Jake, wollte ich dir plötzlich etwas schenken, etwas, das mir besonders kostbar ist.«
Erst da bemerkte er, dass sie etwas in ihrer Faust verbarg. Was immer es sein mochte, es passte in die zarte Hand dieser Frau, die schon jetzt kleiner war als er. Sie streckte sie ihm entgegen und öffnete sie langsam. In ihrer Handfläche lag eine mit Mehl bepuderte Halskette, an der ein Goldkreuz befestigt war, fragil und feminin.
»Hier. Ich möchte, dass es ab jetzt dir gehört. Deine Großmutter hat es mir geschenkt, und sie hat es von ihrer Mutter bekommen. Ich dachte, ich würde es eines Tages einer Tochter schenken, aber ich glaube, das wird nicht geschehen, und ich weiß nicht, warum. Aber als ich heute an dich gedacht und für dich gebetet habe, schien es plötzlich der richtige Tag zu sein, um es dir zu schenken.«
Tony hatte nicht gewusst, was er anderes tun sollte, also öffnete er seine Hand, und seine Mutter ließ die fein gearbeitete Kette mit dem zarten Goldkreuz daran hineingleiten.
»Ich möchte, dass du sie eines Tages der Frau schenkst, die du liebst, und ich möchte, dass du ihr erzählst, woher sie stammt.« Jetzt liefen ihr die Tränen übers Gesicht.
»Aber, Mom, du kannst sie ihr doch selbst schenken.«
»Nein, Anthony, das spüre ich ganz deutlich. Ich verstehe nicht genau, warum, aber du wirst die Kette weiterverschenken, nicht ich. Versteh mich nicht falsch, ich habe natürlich vor, dann noch da zu sein, aber so, wie meine Mutter sie mir geschenkt hat, schenke ich sie jetzt dir, damit du sie der Frau schenkst, die du liebst.«
»Aber woher weiß ich, welche die Richtige ist …?«
»Das wirst du«, sagte sie. »Glaube mir, das wirst du!« Sie drückte ihn an sich, hielt ihn lange in ihren Armen, ohne an das Mehl zu denken, mit dem sie ihn einstaubte. Es war ihm auch egal gewesen. Er hatte das alles nicht verstanden, aber gespürt, wie wichtig es war.
»Halte dich immer an Jesus, Anthony. Du kannst nicht fehlgehen, wenn du auf Jesus baust. Und glaub mir«, sie löste sich ein Stück von ihm und schaute hoch in seine Augen, »wenn du dich an ihn hältst, dann wird er dich niemals verlassen.«
Zwei Tage später war sie nicht mehr, ausgelöscht durch die selbstsüchtige Entscheidung eines anderen, nur wenige Jahre älter als er. Die Halskette lag jetzt in seinem Safe. Er hatte sie nie aus der Hand gegeben. Hatte sie es gewusst? Oft hatte er sich gefragt, ob es eine Vorahnung gewesen war, eine Warnung oder eine Geste Gottes, damit ihm ein Erinnerungsstück von ihr blieb. Sie zu verlieren hatte sein Leben zerstört, ihn auf einen Karrierepfad geschickt, der ihn zu dem gemacht hatte, der er heute war: stark, hart und in der Lage, Dingen standzuhalten, die andere überforderten. Aber es gab Augenblicke, flüchtig und schwer fassbar, in denen das sanfte Sehnen sich in seine harte Schale hineinschlich und für ihn sang oder zu singen ansetzte, denn solche Musik sperrte er schnell wieder aus.
War Jesus immer noch an seiner Seite? Tony wusste es nicht, aber er zweifelte stark daran. Er hatte nur noch wenig mit seiner Mutter gemeinsam, aber wegen ihr hatte er die Bibel und einige andere ihrer Lieblingsbücher gelesen, versucht, auf den Seiten von Lewis, MacDonald, Williams und Tolkien einen Hauch ihrer Gegenwart zu finden. Für kurze Zeit ging er sogar zu der Gruppe Junger Christen an seiner Highschool und versuchte dort, mehr über Jesus herauszufinden. Aber das Heimsystem, in dem er und sein Bruder gelandet waren, schob sie von Heim zu Heim und Schule zu Schule hin und her, und wenn jedes Hallo schon den nächsten Abschied in sich trägt, wird es schmerzhaft, sich auf Freundschaften und Gruppenaktivitäten einzulassen. Tony bekam das Gefühl, dass Jesus genauso Lebewohl zu ihm gesagt hatte wie alle anderen auch.
Dass nun Jesus auf seiner Liste vertrauenswürdiger Personen stand, überraschte ihn selbst. Er hatte in den letzten Jahren wenig an ihn gedacht. Auf dem College hatte er sich für kurze Zeit wieder auf die Suche begeben, aber nach einem Semester mit Gesprächen und Studien hatte er Jesus auf die Liste der großen toten Lehrer verbannt.
Dennoch verstand er, warum seine Mutter so vernarrt in Jesus gewesen war. Wer hätte ihn nicht gemocht? Er war ein echter Mann und doch gut zu Kindern, gütig gegenüber jenen, die von Religion und Kultur abgelehnt wurden, ein Mensch voller ansteckendem Mitgefühl, jemand, der den Status quo infrage stellte und doch jene liebte, die er herausforderte. Er war all das, was Tony manchmal selbst gern gewesen wäre. Vielleicht war Jesus das Vorbild für ein Leben, in dem man über sich selbst hinauswuchs. Aber es war zu spät, um sich noch zu ändern. Je älter er wurde, desto abwegiger erschien ihm der Gedanke an eine solche Transformation.
Und dann war da die Sache mit Gott, die er nicht verstehen konnte, besonders was Jesus betraf. Tony hatte schon vor langer Zeit entschieden, dass Gott, falls es ihn tatsächlich gab, entsetzlich und böswillig, launisch und absolut nicht vertrauenswürdig war. Bestenfalls handelte es sich bei ihm um eine Form von kalter, dunkler Materie, unpersönlich und gleichgültig, und im schlimmsten Fall um ein Monster, dem es Vergnügen bereitete, Kindern das Herz zu brechen.
»Das ist alles Wunschdenken«, murmelte er, knüllte die Liste zusammen und warf sie in den Papierkorb. Es gab keine lebenden Menschen, denen man vertrauen konnte. Er öffnete eine neue Flasche Balvenie Malt Whisky, goss sich einen Dreifachen ein und wandte sich wieder seinem Computer zu, um zu arbeiten.
Er nahm sich sein offizielles Testament vor und brachte die nächste Stunde damit zu, sein Misstrauen und seine Antipathie dadurch zum Ausdruck zu bringen, dass er umfangreiche Änderungen vornahm. Er druckte eine neue Fassung aus, die er unterschrieb und oben auf den Stapel der anderen in den Safe legte. Er verriegelte ihn und aktivierte den Alarm wieder. Dann saß er in der Dunkelheit und dachte über seine Existenz und darüber nach, wer denn wohl hinter ihm her war. Er ahnte nicht, dass er gerade seinen allerletzten Scotch trank.
2
STAUB ZU STAUB
»Wie wunderbar und rätselhaft doch Gottes Wege sind!Er teilt das Meer mit seiner Kraft und reitet auf dem Wind.«
William Cowper
Er hatte die Vorhänge nicht zugezogen, und der Morgen fiel regelrecht über ihn her. Grelles Sonnenlicht mischte sich mit den Nachwirkungen des Scotchs und jagte krampfhafte Schmerzen durch seinen Schädel, eine Migräne, die ihm den Tag ruinierte, bevor er richtig begonnen hatte. Aber das war anders. Nicht nur konnte Tony sich nicht erinnern, wie er zurück in seine Wohnung gekommen war. Obendrein hatte er Schmerzen wie niemals zuvor. Dass er verkrampft und verdreht auf seinem Sofa lag, erklärte möglicherweise, warum sein Nacken und seine Schultern sich so steif anfühlten. Doch ein derartig bohrendes Hämmern hatte er noch nicht erlebt. Es war, als tobte in seinem Kopf ein Gewitter. Etwas war ganz und gar nicht in Ordnung mit ihm!
Plötzliche Übelkeit ließ ihn zur Toilette stürzen, doch ehe er es bis dorthin geschafft hatte, erbrach er heftig alles, was sich vom Abend zuvor in seinem Magen befand. Der grausame Schmerz verschlimmerte sich dadurch noch mehr. Nackte Angst packte Tony. Lange Zeit hatte er sie durch seine schiere Willenskraft im Zaum gehalten, doch jetzt brach sie hervor wie ein wildes Tier. Mit dem lähmenden Entsetzen ringend, taumelte er aus der Wohnung in den Hausflur, beide Hände gegen die Schläfen gepresst, als könnte er so seinen Schädel am Zerplatzen hindern. Er lehnte sich gegen die Wand und suchte nach seinem stets griffbereiten Smartphone. Er durchwühlte hektisch seine Taschen, fand aber nichts außer einem Bund mit Autoschlüsseln. Plötzlich überkam ihn eine schreckliche Leere, als hätte er völlig den Kontakt zur Welt verloren. Sein Retter, die elektronische Versorgung mit allem, was augenblicklich verfügbar, jedoch vergänglich war, fehlte.
Es kam ihm in den Sinn, dass sein Handy sich möglicherweise in seinem Mantel befand, den er normalerweise über die Lehne des Küchenstuhls hängte. Aber die Tür seiner Wohnung hatte sich automatisch hinter ihm verriegelt, als er hinaus auf den Flur getaumelt war. Ein Auge funktionierte nicht richtig, also kniff er es zusammen und starrte mit dem anderen auf die verschwommene Tastatur. Er versuchte, sich an den Code zu erinnern, der ihm wieder Zutritt verschaffen würde, aber die Zahlen wirbelten in seinem Kopf durcheinander und ergaben keinen Sinn. Er schloss die Augen und versuchte, sich zu konzentrieren. Sein Herz hämmerte. Der Schmerz in seinem Kopf loderte wie eine Flamme, Verzweiflung überwältigte ihn. Tony fing an, unkontrolliert zu weinen, was ihn wütend auf sich selbst machte. Panisch tippte er wahllos Ziffern ein, verzweifelt auf ein Wunder hoffend. Plötzlich wurde ihm schwarz vor Augen. Er sank auf die Knie und krachte mit dem Kopf gegen die Tür. Das verschlimmerte den Schmerz noch mehr. Aus einer Platzwunde, die er sich beim Aufprall am Türpfosten zugezogen hatte, rann ihm Blut übers Gesicht.
Tonys Verwirrung und Qual steigerten sich, bis er völlig desorientiert war. Er starrte auf ein ihm völlig fremd erscheinendes Zahlenschloss, und in der einen Hand hielt er Schlüssel, die ihm ebenso fremd erschienen. Stand vielleicht sein Auto hier irgendwo in der Nähe? Er taumelte durch eine kurze Eingangshalle, stolperte eine teppichweiche Treppe hinunter in die Parkgarage. Was nun? Er drückte auf alle Tasten an dem Schlüssel und wurde durch die blinkenden Lichter einer grauen Limousine belohnt, die keine zehn Meter entfernt parkte. Wieder wurde ihm schwarz vor Augen. Er ging zu Boden und kroch dann auf Händen und Füßen panisch auf den Wagen zu, als hinge sein Leben davon ab. Endlich hatte er es bis zum Kofferraum geschafft, zog sich am Blech nach oben. Einen kurzen Moment stand er aufrecht, doch die ganze Welt drehte sich, und erneut fiel er hin. Dieses Mal verschluckte ihn eine wohltuende Dunkelheit. Alles, was schmerzte und so verzweifelt seine Aufmerksamkeit beanspruchte, hörte einfach auf.
Es war niemand in der Nähe. Aber wäre jemand Zeuge seines Falls geworden, hätte dieser Jemand das wohl mit einem Kartoffelsack verglichen, der aus einem fahrenden Lastwagen geworfen wird. Der Körper sackte zu einem Haufen zusammen, als seien keine Knochen darin, totes Gewicht, von der Schwerkraft nach unten gezogen. Er schlug mit dem Hinterkopf hart gegen den Kofferraumdeckel, wurde von seinem Schwung herumgerissen und krachte mit voller Wucht auf den Betonboden, wo sein Kopf ein zweites Mal mit einem grässlich dumpfen Schlag aufprallte. Blut sickerte nun aus seinem linken Ohr und aus den Platzwunden an Stirn und Gesicht. Fast zehn Minuten lag er im Dämmerlicht der Tiefgarage, ehe eine Frau, die in ihrer Handtasche nach dem Autoschlüssel suchte, über sein Bein stolperte. Ihr Schrei hallte von den Betonwänden wider. Niemand hörte es. Zitternd rief sie die 9–1–1 an.
Um 8.41 Uhr nahm die Frau, die in der Notrufzentrale vor einer Batterie von Monitoren saß, den Anruf entgegen. »9–1–1. Von wo rufen Sie an?«
»Oh, mein Gott! Er ist überall voller Blut! Ich glaube, er ist tot …« Die Frau in der Tiefgarage war hysterisch und stand kurz vor einem Schock.
Das Personal in der Notrufzentrale war für solche Fälle geschult. Die Frau vor den Monitoren sagte mit ruhiger Stimme: »Ma’am, es ist wichtig, dass Sie sich beruhigen. Sie müssen mir sagen, wo Sie sich befinden, damit ich Hilfe schicken kann.« Während sie zuhörte, verständigte sie auf einer anderen Leitung Portland Fire, dass ein medizinischer Notfall vorlag. Rasch gab sie Informationen und Codes in das Anrufprotokoll ein. »Ma’am, können Sie mir sagen, was Sie sehen?« Sie schaltete ihr Mikrofon stumm und sagte: » Wagen 10. M333 Antwortcode 3 auf einer UN3 bei 5040 SW Macadam Avenue, Kreuzung Richardson Court, gleich nördlich der US Bank und unter Weston Manor, auf der ersten Ebene einer Tiefgarage an der Flussseite.«
»Medic 333, habe verstanden«, ertönte die Antwort in ihrem Kopfhörer.
»Gut, Ma’am, beruhigen Sie sich und atmen Sie tief durch. Sie haben einen Mann gefunden, der anscheinend bewusstlos ist, und da ist Blut … Okay, Hilfe ist unterwegs und müsste in ein paar Minuten eintreffen. Ich möchte, dass Sie vor Ort bleiben und warten, bis der Rettungswagen eintrifft. … Ja, das geht in Ordnung. … Ich bleibe bei Ihnen, bis die Helfer da sind. Sie haben das großartig gemacht! Der Wagen ist unterwegs und gleich bei Ihnen.«
Portland Fire kam zuerst. Als sie Tony gefunden hatten, leiteten sie stabilisierende Maßnahmen ein, während einer aus der Besatzung die völlig aufgelöste Zeugin beruhigte und befragte. Der Rettungswagen traf nur wenige Minuten später ein.
»Hey, Leute! Wen habt ihr denn da? Was kann ich tun?«, fragte der Rettungssanitäter.
»Wir haben hier einen Mann in den Vierzigern. Die Dame da hat ihn neben seinem Wagen gefunden. Er hat sich übergeben und riecht nach Alkohol. Er hat eine große Platzwunde am Kopf und Schnittwunden im Gesicht und ist nicht ansprechbar. Wir haben die Halswirbelsäule mit einem Stiffneck stabilisiert. Atmung wird durch Ambu-Beutel unterstützt.«
»Habt ihr schon seine Vitalfunktionen?«
»Blutdruck 260 zu 140. Puls 56. Atmungsfrequenz 12, aber unregelmäßig. Die rechte Pupille ist weit und lichtstarr, und er blutet aus dem rechten Ohr.«
»Sieht nach einer ziemlich schweren Kopfverletzung aus.«
»Ja, das denke ich auch.«
»Okay, dann auf die Rettungstrage mit ihm.«
Tony wurde von der Feuerwehrcrew sicher festgeschnallt, während der Sanitäter einen Zugang für eine Infusion legte.
»Er zeigt immer noch keine Reaktionen, und die Atmung ist unregelmäßig«, sagte der Feuerwehr-Rettungsassistent. »Sollte man ihn nicht intubieren?«
»Gute Idee, aber das machen wir besser im Rettungswagen.«
»Grünes Licht bei der Universitätsklinik«, rief der Fahrer des Rettungswagens.
Auf einer fahrbaren Trage rollten sie Tony rasch in den Rettungswagen, während der Fahrer die Klinik verständigte.
Tonys Vitalfunktionen fielen dramatisch ab, und er ging in eine Asystolie, eine Form des Herzstillstands. Hektische Aktivitäten der Sanitäter, zu denen eine Epinephrin-Injektion gehörte, brachten Tonys Herz wieder in Gang.
»Uniklinik, hier Medic 333. Wir kommen zu Ihnen, Code 3, mit einem Mann in den Vierzigern, der in einer Tiefgarage gefunden wurde. Der Patient hat eine Kopfverletzung und zeigt bislang keine Reaktionen. Patient ist eine 5 auf der Glasgow-Skala. Wirbelsäule wurde stabilisiert. Er hatte eine kurze Asystolie, aber nach 1 Milligramm Epi ist der Puls zurück. Blutdruck 80/60. Puls 72. Wir beatmen ihn zwölfmal pro Minute aus dem Beutel und bereiten die Intubation vor. Fahrzeit zu Ihnen etwa 5 Minuten.«
»Verstanden.«
Mit heulender Sirene fuhren sie aus der Tiefgarage. Die Fahrt auf der sich den Hügel emporwindenden Straße zur Oregon Health Uni-Klinik, die über der Stadt sitzt wie das Dämonengesicht eines gotischen Wasserspeiers, dauerte weniger als fünf Minuten. Als Tony in die Notaufnahme geschoben wurde, eilten Ärzte, Schwestern und Techniker herbei, und es folgte ein wohlgeordnetes Chaos, ein komplizierter Tanz, bei dem alle genau ihre Rollen und Aufgaben kannten. Die Ersthelfer wurden mit Fragen bombardiert, bis der verantwortliche Arzt zufrieden war. Dann durften sie gehen, und ihr bei solchen Einsätzen in die Höhe schnellender Adrenalinspiegel konnte sich wieder normalisieren.
Ein erster CT-Scan und die spätere CT-Angiografie zeigten eine subarachnoidale Blutung und einen Gehirntumor im Frontallappen. Stunden später wurde Tony auf die neurologische Intensivstation, Zimmer 17, gebracht. An Schläuche und medizinische Geräte angeschlossen, durch die man ihn ernährte und beatmete, bekam er nichts mit von all der Aufmerksamkeit, die ihm zuteilwurde.
Tony spürte, wie er aufwärts schwebte, als würde ein sanftes, aber starkes Schwerkraftfeld ihn anziehen. Es fühlte sich eher wie die Liebe einer Mutter und nicht so sehr wie eine physische Kraft an, und er widersetzte sich nicht. Er erinnerte sich dunkel, einen Kampf durchgemacht zu haben, der ihn völlig erschöpft hatte. Aber nun verblasste dieser Konflikt.
Während er hinaufschwebte, überkam ihn die Ahnung, dass er starb. Er versteifte sich innerlich, als hätte er die Macht, dagegen anzukämpfen. Wogegen? Gegen das Nichts? Seine Verschmelzung mit dem unpersönlichen All-Geist?
Nein. Er hatte schon vor langer Zeit entschieden, dass der Tod einfach das Ende war, das Verlöschen des Bewusstseins, Staub, der ohne jedes Gefühl wieder zu Staub wurde.
Eine solche Philosophie war ihm in seiner Selbstsucht ein Trost gewesen. War es angesichts dieser Sinnlosigkeit nicht gerechtfertigt, dass er sich ganz um sich selbst kümmerte und nicht nur sich selbst, sondern auch die anderen zu seinem Nutzen und Vorteil kontrollierte und beherrschte? Es gab nichts absolut Richtiges, keine absolute Wahrheit, sondern nur juristisch festgelegte soziale Sitten und auf Schuldgefühlen basierende Konformität. Der Tod, so wie Tony ihn sah, bedeutete, dass nichts wirklich wichtig war. Leben war ein gewalttätiges evolutionäres Keuchen ohne jeden tieferen Sinn, das vorübergehende Überleben der Geschicktesten und Schlauesten. In tausend Jahren, vorausgesetzt, die Menschheit existierte noch so lange, würde niemand wissen, dass es Tony je gegeben hatte, oder sich dafür interessieren, wie er sein Leben gelebt hatte.
Während er von der unsichtbaren Strömung in die Höhe getragen wurde, begann er, seine eigene Philosophie ziemlich hässlich zu finden. Etwas in ihm sträubte sich, wollte nicht akzeptieren, dass dann, wenn der letzte Vorhang fällt, nichts und niemand mehr einen Sinn haben soll, dass alles Teil eines zufälligen, selbstsüchtigen Chaos ist, in dem alle nach Macht streben und ihre Umwelt in rein egoistischer Weise zu manipulieren trachten. Aber welche Alternativen gab es?
An einem ganz bestimmten Tag seines Lebens war in ihm jede Hoffnung gestorben, dass da noch mehr sein könnte. An diesem stürmischen Novembermorgen hielt er fast eine Minute lang die erste Schaufel mit Erde in der Hand. In Regen und Wind stand er da und starrte hinunter auf die kleine, mit Schnitzereien verzierte Kiste, in der sein Gabriel lag. Kaum fünf Jahre alt, noch kaum gelebt, hatte sein kleiner Junge tapfer gekämpft, tapfer festgehalten an allem Guten und Schönen, nur um strampelnd und schreiend denen entrissen zu werden, die ihn liebten.