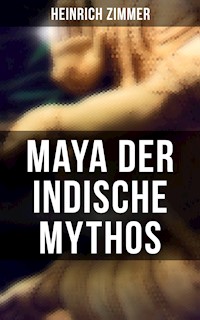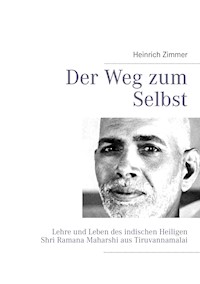
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Ramana Maharshi (1879-1950) gilt als einer der größten Advaita-Lehrer aller Zeiten. Er lehrte Selbstergründung (atma-vichara). Bereits im Alter von 17 Jahren verwirklichte er das Selbst und lebte fortan am Berg Arunachala in Südindien, wo ihn Menschen aus allen Kulturen und Erdteilen besuchten. Einige lebten bei ihm und viele sahen in ihm ihren Sat-Guru. Dieses Buch ist die erste Biografie über Ramana Maharshi im deutschen Sprachraum und das letzte Werk des bedeutenden Indologen Heinrich Zimmer. C.G. Jung hat es 1944, ein Jahr nach Zimmers Tod, herausgebracht. Die Neuauflage entspricht der Erstauflage und enthält u.a. einen ausführlichen Artikel von C.G. Jung über den großen Heiligen vom Berg Arunachala.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 342
Veröffentlichungsjahr: 2013
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Heinrich Zimmer
Der Weg zum Selbst
Lehren und Leben des indischen Heiligen
Shri Ramana Maharshi aus Tiruvannamalai
Books on Demand
Inhaltsverzeichnis
Vorwort zur 10. Auflage
Vorwort zur 1. Auflage
Worte des Nachrufs
Über den indischen Heiligen von C. G. Jung
I. Einführung Die Schale der Persönlichkeit
II. Der Kern des Selbst in Lehre und Gespräch
Begegnungen mit Shrî Ramana Maharshi aufgezeichnet von Râmânanda
III. Die kleinen Gespräche
Zweifel des Anfangs
Die Regungen verwerfen
Erkenntnis und Gnade
Der wahre Lehrer.
Das Selbst innen wartet
Das Fragen – kein Denkvorgang
Vollkommene Erkenntnis – keine Untätigkeit
Versenkung
Ist Brahman jenseits?
Die Zuflucht innen
Was ist mein Selbst?
Die geheime Stätte des Selbst
Der Erlöste und seine Kräfte
Übergib deine Last dem Herrn
Die Ordnung der Lebensstufen
Gemeinschaft und Menschheit
Dem Wissenden ist Alles gleich
Die Kraft und was sie trägt
IV. Wer bin ich?
Vorbemerkung
Wer bin ich?
Selbsterkenntnis
V. Wirklichkeit
VI. Merksprüche
Zum täglichen Gebrauch für die Schüler der Einsiedelei
Volkstümliche Belehrung
Umgang mit Heiligen
Belehrung in Fragen
Ich und Selbst
Torheiten
Das Herz
VII. Knappe Anweisung zum Forschen nach dem Selbst
1. Das Forschen nach dem Selbst
2. Die Erfahrung des Selbst
3. Das höchste Wesen ist das Selbst
4. Gottesverehrung ist Selbsterforschung
5. Persönliches Selbst und Befreiung
6. Schematische Darstellung der drei Sphären
7. Der »Seher« und was er sieht
8. Die Schöpfung des Alls
9. Weltentsagung
VIII. Vier Lehrgespräche über Weg und Ziel
1. Von geistlicher Unterweisung (Upadesha)
2. Der Weg der Übung (Sâdhanâ)
3. Unmittelbare Erfahrung (Anubhava)
4. Entfaltetes Verfahren in Erkenntnis (Ârûdha – Sthiti – Jñána)
Quellen und Bibliographie
Vorwort zur 10. Auflage
Die erste Auflage dieses Buches ist 1944 in Zürich erschienen und wurde von C.G. Jung herausgegeben. Es war die erste Biografie über Ramana Maharshi im deutschen Sprachraum und das letzte Werk des bedeutenden Indologen Heinrich Zimmer, der 1943 verstorben war. Es erschien sechs Jahre vor dem Tod des großen Weisen vom Berg Arunachala (1879-1950).
Ich habe mich aus gutem Grund für die Herausgabe der 1. Auflage vom Rascher Verlag Zürich mit dem Nachruf von Emil Abegg und dem Artikel von C.G. Jung entschieden, um dieses Buch in seinem historischen Zusammenhang zu belassen. In den späteren Auflagen vom Diederichs-Verlag wurden sie leider weggelassen.
Zimmer hat das Leben Ramanas bis etwa Mitte der 30er Jahre aufgezeichnet. Als Quelle hat ihm u.a. die erste englischsprachige Ramana-Biografie Self-Realization von Narasimha Swami gedient. Bereits zu Ramanas Lebzeiten wurden seine tamilischen Hauptwerke ins Englische übersetzt und im Buchladen des Ashram verkauft. Diese Werke sowie einige Sanskrittexte dienten Zimmer als Grundlage für seine Übersetzungen, die im Quellenverzeichnis detailliert angegeben sind.
Das Bildmaterial in diesem Buch wurde größtenteils ergänzt und stammt – falls nicht anders vermerkt – vom Ramanashram.
Vorwort zur 1. Auflage
von C. G. Jung
Als am 18. März dieses Jahres aus Newyork, wo er an der Columbia-Universität lehrte, die Nachricht vom plötzlichen Ableben Heinrich Zimmer's, des hervorragenden Indologen, der sich wie wenige in die Seele Indiens einzufühlen vermochte, hierher gelangte, befand sich das Manuskript des vorliegenden Buches seit zwei Jahren in der Schweiz. Zuerst lag es bei einem seiner Baseler Freunde, dann ließ der Verstorbene es mir mit der Bitte zusenden, seine Drucklegung besorgen zu wollen, sofern dies möglich wäre. Es war mir also eine schmerzliche Pflicht und eine willkommene, wenn auch traurige Gelegenheit zugleich, meinem leider allzufrüh dahingegangenen Freund Heinrich Zimmer meine Dankesschuld ein wenig dadurch abzutragen, daß ich, seinem Wunsche nachkommend, die Herausgabe seiner Vermächtnisschrift annahm.
In jahrelangem geistigen Austausch mit seinem sprühenden Einfallsreichtum und seinem gründlichen Wissen um die seelischen Urgründe Indiens habe ich viel wertvolle Anregung von ihm empfangen. Seine Besuche in der Schweiz wurden stets zu Anlässen fruchtbaren Gedankenaustausches auch mit einem engern und weitern Kreis geistig interessierter Menschen. Im Psychologischen Club Zürich und Basel hat er uns eine Reihe schöner und tiefer Vorträge geschenkt und sich zahlreiche Freunde erworben. Im Juni dieses Jahres wurde sein Andenken im Zürcher Club durch eine Gedächtnisfeier geehrt, bei welcher auch Proben aus diesem seinem letzten Buche, aus dem Leben und der Lehre des Shrî Ramana Maharshi, vorgelesen wurden. Der Nachruf, den der Zürcher Indologe Prof. Emil ABEGG auf den Verstorbenen am 25. März dieses Jahres in der »Neuen Zürcher Zeitung« veröffentlichte, ist mit seiner freundlichen Erlaubnis hier als Geleitwort abgedruckt und soll ebenfalls Zeugenschaft von der geistigen Verbundenheit, die er hier zurückließ, geben.
Ich danke nochmals Herrn Prof. ABEGG für die freundliche Prüfung und Korrektur des Manuskriptes in bezug auf alles Fachliche, sowie Frl. T. WOLFF, die das Manuskript durchgesehen und Frau Dr. phil. J. JACOBI, welche die Korrektur der Druckbogen besorgt und die Drucklegung überwacht hat. Sie haben in dankenswerter Weise dazu beigetragen, daß das vorliegende Werk noch in diesem Jahre der Öffentlichkeit vorgelegt werden konnte.
Küsnacht, im Herbst 1943.
Der Herausgeber.
Worte des Nachrufs
von Emil Abegg
In dem kürzlich in Amerika verstorbenen Indologen Heinrich Zimmer ist ein Gelehrter dahingegangen, dessen Wirken weit über sein enges Fachgebiet hinausreichte und ihn im Geistesleben unserer Zeit eine bedeutende Stelle einnehmen ließ. Denn für ihn war die Deutung des indischen Geistes kein bloß fachwissenschaftliches Anliegen, sondern strahlte tief in alle geistigen Bezirke hinein und ließ ihre Probleme in Indiens Zauberspiegel in neuem, ungeahntem Licht aufleuchten. Schon seine einzigartige Übersetzungskunst wies ihm unter allen, die für die Erschließung indischen Schrifttums wirkten, den höchsten Rang an. Noch nie war es gelungen, Werke indischer Literatur schon durch die bloße sprachliche Übertragung uns so nahe zu rücken und ihren Sinn so restlos auszuschöpfen, wie dies Zimmer in seinem buddhistischen Legendenkranz »Karma« und in der Wiedergabe einer der Bhagavad-Gîta verwandten religiösen Dichtung gelang, die er unter dem Titel »Anbetung Mir« veröffentlichte. Solche Übersetzungskunst war nur möglich aus einer ganz neuen, alle Tiefen des indischen Denkens erschließenden Schau heraus, vor allem durch eine bisher noch nie erreichte psychologische Einfühlung. Es kam Zimmer dabei die Berührung mit der Psychologie C. G. Jungs zustatten, der seinerseits deijenige unter den heutigen Psychologen ist, der sich am nachhaltigsten mit dem indischen Geist alter und neuer Zeit und mit seinem Träger, dem indischen Menschen, beschäftigt hat. Doch hat man bei Zimmer nie das Gefühl, daß diese psychologischen Erkenntnisse von außen an die Tatsachen herangetragen werden oder gar sie umzubiegen drohen; er scheint vielmehr auf Grund seiner eigenen Vertiefung in indisches Wesen zu Auffassungen gelangt zu sein, in denen er mit C. G. Jung zusammentraf und die dort ihre Bestätigung fanden. So was das Zusammenwirken des Indologen und des Psychologen für beide gleich fruchtbringend und hat unbestreitbar zu einem tieferen Verständnis indischen Denkens beigetragen.
Schon in dem Buche »Kunstform und Yoga im indischen Kultbild« (1926) sind diese psychologischen Einsichten für die Aufhellung eines zentralen Problems der indischen Kunst und Religion fruchtbar geworden. Das indische Kultbild kann in seiner Bedeutung für den Verehrer nur verstanden werden auf Grund der Yoga-Lehre, daß der Gläubige bei der mystischen Versenkung ins Kultbild im Wesen der Gottheit aufgehe, sich in der Kontemplation zu ihr erhebe. Von da aus erschließt sich Zimmer auch das Verständnis jener eigentümlichen, das Kultbild im Hinduismus und Buddhismus oft ersetzenden mystischen Diagramme und der Sprüche und Laute, die sich mit ihnen verbinden, und es erhellt sich ihm so mit einem Schlage ein vielgestaltiges Problem indischer Gottesverehrung. – In dem Büchlein »Ewiges Indien« sind dann alle Grundmotive indischen Denkens von ganz neuen Gesichtspunkten aus beleuchtet: das Verhältnis der Einzelseele zur Allseele, ihre Wanderung im Kreislauf der Geburten und die fortwirkende Macht der Tat, die sie dabei leitet; die Beziehung der empirischen Form zum übersinnlichen Weltgrund als beherrschendes Problem der Metaphysik; die Lehre von der geistigen Zucht, die durch Erreichung höherer Bewußtseinszustände zu übersinnlicher Freiheit führt; die Vollkommenheit der Erkenntnis, die im Geiste eines Buddha aufleuchtet, und schließlich die Tantralehre, die Mann und Weib, Gott und Welt zusammen als das eine Göttliche in seinen einander bedingenden Aspekten offenbart. Schon hier zeigt sich, wie Zimmers Indienschau weit hinausgreift über ihren nächsten Zweck, in den oft abgrundtiefen Gedanken und Ahnungen, die in verschwenderischer Fülle ausgestreut werden. Die »Indischen Sphären« (1935) werden eröffnet und beherrscht durch eine Betrachtung über den Mythos, die zum Besten gehört, was darüber gesagt worden ist. Was die romantische Mythendeutung eines Creuzer und Görres anstrebte, aber sowohl wegen mangelhafter Kenntnis der Überlieferung als auch der Unzulänglichkeit der psychologischen Voraussetzungen nicht zu schaffen vermochte, das ist hier zur Vollendung gebracht, und fand dann seine Bewährung in der schon im nächsten Jahre erschienenen »Maya«, wo zum erstenmal eine Gesamtdarstellung des indischen Mythos gegeben wurde, die über das bloß Tatsächliche hinausgeht und die wirkenden Kräfte aufzuzeigen sucht, die dieser bunten Welt zu Grunde liegen. Hier sind auf Grund einer wortgetreuen Wiedergabe der großen Mythensammlungen des Hinduismus, in der sich Zimmers Übersetzungskunst aufs neue glänzend bewährt, die Leitmotive mythischen Denkens vorgeführt und von tief eindringenden psychologischen Analysen durchsetzt. Der Mythos erscheint dabei nicht nur als Mittel, menschliche Grunderlebnisse und philosophische Erkenntnis in sinnliche Bilder zu kleiden, sondern auch als eine Macht der Seelenführung, wobei ihm der Ritus ergänzend zur Seite tritt.
Zimmers Werke können leicht den Eindruck erwecken, als handelte es sich in ihnen nur um geistreiches Spiel, das sich in blendenden und paradoxen Formulierungen gefällt. Wer aber die Tatsachen der indischen Überlieferung genau vergleicht, auf die er sich gründet, überzeugt sich mit immer neuem Staunen, wie treu er ihnen folgt und welch tiefgründiges Wissen diesem scheinbar freien Spiel des Geistes zugrunde liegt. Es ist sozusagen verkappte Wissenschaftlichkeit, die Zimmer darbietet. Wohl möglich, daß das gedankenlose Schlagwort von der Krisis der Wissenschaft – Wissenschaft ist etwa Ewiges und kann deshalb keiner Krisis unterliegen – in diesen Büchern scheinbar Nahrung findet, aber nur bei denen, die nicht ermessen können, wie viel ernst erarbeitetes Wissen sich hinter dieser spielenden Form verbirgt.
Es wird sich niemand vermessen, zu sagen oder auch nur zu vermuten, was dieser hohe Geist, wäre es ihm vergönnt gewesen, länger zu wirken, uns noch geschenkt hätte. Vielleicht wäre er im realistischen Klima Amerikas dazu gelangt, unter Verzicht auf eine sich doch gelegentlich fast überspitzende Geistigkeit, zu schlichter Wissenschaftlichkeit zurückzufinden: um so schwerer wäre in diesem Falle der Verlust, den für uns sein allzu früher Tod bedeutet.
Über den indischen Heiligen
von C. G. Jung
Schon sein Jahren hatte sich Zimmer für den Maharshi von Tiruvannamalai interessiert, und die erste Frage, die er nach meiner Rückkehr aus Indien an mich richtete, galt diesem neuesten Heiligen und Weisen von Südindien. Ich weiß nicht, ob mein Freund es eine unverzeihliche oder mindestens unverständliche Sünde von mir fand, daß ich Shrî Ramana nicht besucht hatte. Ich hatte das Gefühl, daß er diesen Besuch wohl kaum unterlassen hätte, so warm war seine Anteilnahme am Leben und Denken des Heiligen. Dies war mir um so weniger erstaunlich, als ich wußte, wie tief Zimmer in den Geist Indiens eingedrungen war. Sein sehnlichster Wunsch, Indien in Wirklichkeit zu sehen, ist leider nie in Erfüllung gegangen, und eine Möglichkeit dazu zerschlug sich in letzter Stunde vor dem einbrechenden Weltkrieg. Dafür hatte er eine um so großartigere Vision des geistigen Indiens. Er hat mir bei unserer Zusammenarbeit nicht nur durch seine reichen Fachkenntnisse, sondern vor allem auch durch seine geniale Erfassung des Sinngehaltes der indischem Mythologie unschätzbare Einblicke in die östliche Seele ermöglicht. Leider hat sich an ihm das Wort vom frühsterbenden Geliebten der Götter erfüllt, und uns bleibt die Klage um den Verlust eines Geistes, der die Begrenzung durch das Fach überwand und, an die Menschheit sich wendend, ihr die beglückende Gabe »unsterblicher Früchte« bot.
Der Träger mythologischer und philosophischer Weisheit ist in Indien seit grauer Vorzeit der »Heilige« – welche abendländische Bezeichnung allerdings das Wesen und die Erscheinungsweise der östlichen Parallelfigur nicht ganz wiedergibt. Diese Gestalt verkörpert das geistige Indien und tritt uns in der Literatur ständig entgegen. Kein Wunder daher, daß sich Zimmer für die neueste und beste Inkarnation dieses Typus in der menschlichen Erscheinung in Shrî Ramana leidenschaftlich interessierte. Er sah in diesem Yogin die avatarmäßige Verwirklichung jener durch die Jahrhunderte und die Jahrtausende wandelnden, ebensowohl legendären wie historischen Figur des Rishi, des Sehers und Philosophen.
Wahrscheinlich hätte ich Shrî Ramana doch besuchen sollen. Allein ich fürchte, wenn ich noch einmal nach Indien reiste, um das Versäumte nachzuholen, so ginge es mir wieder gleich: ich könnte mich, trotz der Einmaligkeit und Unwiederholbarkeit dieses zweifellos bedeutenden Menschen, nicht dazu aufraffen, ihn persönlich zu sehen. Ich zweifle nämlich an seiner Einmaligkeit: er ist ein Typus, der war und sein wird. Darum brauchte ich ihn auch nicht aufzusuchen; ich habe ihn in Indien überall gesehen, in Ramakrishna's Bild, in dessen Jüngern, in buddhistischen Mönchen und in unzähligen andern Gestalten des indischen Alltags, und die Worte seiner Weisheit sind das sous-entendu des indischen Seelenlebens. Shrî Ramana ist in diesem Sinne wohl ein »hominum homo«, ein wahrhafter »Menschensohn« der indischen Erde. Er ist »echt«, und darüber hinaus ein »Phänomen«, das, von Europa aus gesehen, Einzigartigkeit beansprucht. Aber in Indien ist er der weißeste Punkt in einer weißen Fläche (deren Weißheit man darum erwähnt, weil es auch ebenso schwarze Flächen gibt). Überhaupt sieht man in Indien so viel, daß man schließlich nur noch weniger sehen möchte, und das ungeheure Vielerlei von Ländern und Menschen erzeugt eine Sehnsucht nach dem ganz Einfachen. Auch dieses Einfache gibt es: es durchdringt wie ein Wohlgeruch oder eine Melodie das seelische Leben Indiens; es ist überall sich selber gleich; aber nie monoton, sondern unendlich variierend. Um es kennen zu lernen, genügt es, eine Upanishad oder ein paar Gespräche des Buddha zu lesen. Was dort klingt, klingt überall, es spricht aus Millionen Augen, es drückt sich in unzähligen Gebärden aus, und es gibt kein Dorf und keine Landstraße, wo sich nicht jener breitästige Baum fände, in dessen Schatten das Ich nach seiner eigenen Aufhebung trachtet, die Welt der vielen Dinge im All und All-Einssein ertränkend. Dieser Ruf war mir in Indien dermaßen vernehmlich, daß ich dessen Überzeugungskraft bald nicht mehr von mir abzuschütteln vermochte. So war ich denn durchaus sicher, daß niemand darüber hinaus zu gelangen vermochte, am wenigsten der indische Weise selber; und sollte Shrî Ramana etwas sagen, das mit dieser Melodie nicht stimmte oder den Anspruch erhöbe, darüber noch hinaus zu wissen, so hätte der Erleuchtete auf alle Fälle unrecht. Diese mühelose, der Hitze Südindiens klimagerechte Argumentation – hat der Heilige Recht, so tönt er Indiens alte Weise wieder und tönt er anders, so hat er Unrecht – vermochte mich, ohne daß ich es bereute, von einem Besuch in Tiruvannamalai abzuhalten. Die Unergründlichkeit Indiens sorgte dafür, daß mir der Heilige doch noch, und zwar in einer mir bekömmlicheren Form entgegentrat, ohne daß ich ihn gesucht hätte: in Trivandrum, der Hauptstadt von Travancore, traf ich auf einen Schüler des Maharshi. Er war ein bescheidener Mann, von sozialem Status das, was wir als einen Primarschullehrer bezeichnen, und erinnerte mich des lebhaftesten an den Schuhmacher von Alexandrien, welcher (in der Darstellung von Anatole France) vom Engel dem Hl. Antonius als Beispiel des noch größeren Heiligen vorgeführt wurde. Wie dieser hatte auch mein kleiner Heiliger das vor dem großen voraus, daß er zahlreiche Kinder zu ernähren hatte und mit besonderer Aufopferung für seinen ältesten Sohn sorgte, damit dieser studieren konnte. (Ich will hier nicht auf die Nebenfrage abschweifen, ob Heilige immer auch weise sind, und umgekehrt alle Weisen unbedingt heilig. Es bestehen in dieser Hinsicht einige Zweifel.) Auf alle Fälle trat mir in diesem bescheidenen, liebenswürdigen, kindlich frommen Gemüt ein Mensch entgegen, der einerseits mit völliger Hingabe die Weisheit des Maharshi in sich aufgesogen hatte und andererseits seinen Meister dadurch überragte, daß er, über alle Klugheit und Heiligkeit hinaus, auch »die Welt gegessen« hatte. Ich anerkenne dieses Zusammentreffen mit großer Dankbarkeit; denn es hätte mir nichts Besseres geschehen können. Der Nur-Weise und Nur-Heilige interessiert mich nämlich ungefähr soviel wie ein seltenes Saurierskelett, das mich aber nicht zu Tränen rührt. Der närrische Widerspruch dagegen, zwischen dem der Mâyâ entrückten Sein im kosmischen Selbst und der liebenden Schwäche, die sich fruchtbar mit vielen Wurzeln der schwarzen Erde einsenkt, um in alle Zukunft das Weben und das Zerreißen des Schleiers als Indiens ewige Melodie zu wiederholen – dieser Widerspruch tut es mir an; denn wie kann man anders das Licht sehen, ohne den Schatten, die Stille vernehmen, ohne den Lärm, die Weisheit erreichen, ohne die Narrheit? Am peinlichsten ist wohl das Erlebnis der Heiligkeit. Mein Mann war – Gott sei Dank – nur ein kleiner Heiliger; kein strahlender Gipfel über finstern Abgründen, kein erschütterndes Spiel der Natur, sondern ein Beispiel, wie Weisheit, Heiligkeit und Menschlichkeit »einträchtiglich beieinander wohnen« können, lehrreich, lieblich, rührend, friedsam und geduldig, ohne Krampf, ohne Absonderlichkeit, unerstaunlich, keineswegs sensationell, kein besonderes Postbureau benötigend, aber auf Urältestem beruhende Kultur unter dem sanften Rauschen im Meerwinde sich fächelnder Kokospalmen, Sinn in der vorüberhuschenden Phantasmagorie des Seins, Erlösung in der Gebundenheit, Sieg in der Niederlage.
Nur-Weisheit und Nur-Heiligkeit, fürchte ich, präsentieren sich am besten in der Literatur, und da soll ihr Ruhm unbestritten sein. Lao-tse liest sich vortrefflich und unübertrefflich im Tao-tê-king; Lao-tse mit seiner Tänzerin auf dem Westabhang des Berges, des Lebens Abend feiernd, ist schon weniger erbaulich. Mit dem vernachlässigten Körper des Nur-Heiligen kann man sich aus leicht ersichtlichen Gründen schon gar nicht abfinden, besonders wenn man nicht anders kann als glauben, daß die Schönheit zum Vornehmsten gehört, das Gott erschaffen.
Das Ziel östlicher Praktik ist dasselbe wie das der westlichen Mystik: der Schwerpunkt wird vom Ich zum Selbst, vom Menschen zu Gott verschoben; was bedeuten will, daß das Ich im Selbst, der Mensch in Gott verschwindet. Es ist evident, daß Shrî Ramana entweder wirklich vom Selbst weitgehend aufgesogen ist, oder doch wenigstens ernstlich und lebenslang danach strebt, sein Ich im Selbst aufzulösen. Ein ähnliches Streben verraten auch die exercitia spiritualia, indem sie den »Eigenbesitz«, das Ichsein in möglichst hohem Maße der Besitznahme durch Christum unterordnen. Der ältere Zeitgenosse Shrî Ramana's, Râmakrishna, hat in Hinsicht auf die Beziehung zum Selbst dieselbe Einstellung wie jener, nur scheint bei ihm das Dilemma zwischen Ich und Selbst etwas deutlicher hervorzutreten. Während Shrî Ramana zwar »verständnisvolle« Duldung mit dem weltlichen Berufe seiner Jünger zeigt, aber doch unmißverständlich die Auflösung des Ich zum eigentlichen Ziel der geistigen Übung erhebt, zeigt Râmakrishna eine etwas mehr zögernde Haltung in dieser Hinsicht. Er sagt zwar: »So lange Ichsucht besteht, sind weder Erkenntnis (jñâna) noch Befreiung (mukti) möglich, und der Geburten und Tode ist kein Ende1.« Aber er muß die fatale Zähigkeit des Ahamkâra doch anerkennen: »Wie wenige vermögen die Einung (samâdhi) zu erlangen und sich von diesem Ich (aham) zu befreien. Es ist selten möglich2. Diskutiere so viel du willst, sondere unaufhörlich – dennoch wird dieses Ich immer zu dir zurückkehren3. Fälle heute die Pappel, und du wirst morgen finden, daß sie von neuem ausschlug4.« Er geht sogar so weit, die Unzerstörbarkeit des Ich mit den Worten anzudeuten: »Wenn ihr schließlich dieses ›Ich‹ nicht zerstören könnt, so behaltet es als ›Ich, der Diener‹5.« Gegenüber dieser Konzession an das Ich ist Shrî Ramana entschieden der Radikalere, resp. im Sinne der indischen Tradition der Konservativere. Der ältere Râmakrishna ist damit der Modernere von beiden, was wohl auf die Tatsache zurückzuführen ist, daß er von der westlichen Geisteshaltung weitaus tiefer und stärker berührt ist, als Shrî Ramana.
»Ich weiß, daß ohne mich
Gott nicht ein Nu kann leben,
Werd' ich zu nicht, er muß
Von Noth den Geist aufgeben.«
Der a priori vorhandene Zielcharakter des Selbst und der Drang, dieses Ziel zu verwirklichen, bestehen, wie schon gesagt, selbst ohne Teilnahme des Bewußtseins. Sie können nicht geleugnet werden, aber ebensowenig kann man des Ichbewußtsein entraten. Auch es meldet seine Forderung unabweisbar an, und zwar sehr oft in lautem oder leisem Gegensatz zur Notwendigkeit der Selbstwerdung. In Wirklichkeit, d. h. Abgesehen von wenigen Ausnahmefällen, besteht die Entelechie des Selbst in einem Wege endloser Kompromisse, wobei Ich und Selbst sich mühsam die Waage halten, wenn alles gut gehen soll. Ein zu großer Ausschlag nach der einen oder anderen Seite bedeutet daher in tieferem Verstande oft nicht mehr als ein Beispiel, wie man es nicht machen sollte. Das heißt nun keineswegs, daß Extreme, wo sie sich natürlicherweise einstellen, eo ipso von Übel wären. Wir machen von ihnen wohl den richtigen Gebrauch, wenn wir ihren Sinn erforschen, wozu sie uns dankenswerterweise reichlich Gelegenheit geben. Ausnahmemenschen, sorgfältig umhegt und eingefangen, bedeuten stets ein Geschenk der Natur, das uns bereichert und den Umfang unseres Bewußtseins vergrößert, dies alles aber nur, wenn unsere Besonnenheit nicht Schiffbruch leidet. Ergriffenheit kann ein wahres Göttergeschenk sein oder eine Ausgeburt der Hölle. Bei der Maßlosigkeit, die ihr anhaftet, fängt das Verderben an, auch wenn die damit verknüpfte Bewußtseinsvernebelung die Erreichung höchster Ziele in scheinbar größte Nähe rückt. Wahrer und haltbarer Gewinn ist nur erhöhte und erweiterte Besonnenheit.
Außer Banalitäten gibt es leider keine philosophischen oder psychologischen Sätze, die nicht sofort auch umgedreht werden müßten. So bedeutet Besinnung als Selbstzweck nichts als Beschränktheit, wenn sie sich nicht im Wirrwarr chaotischer Extreme behauptet, wie auch bloße Dynamik um ihrer selbst willen zur Verblödung führt. Jegliches Ding bedarf zu seiner Existenz seines Gegensatzes, ansonst es bis zum Nichtsein verblaßt. Das Ich bedarf des Selbstes und umgekehrt. Die wechselnden Beziehungen zwischen diesen beiden Größen stellen ein Erfahrungsgebiet dar, welches die introspektive Erkenntnis des Ostens in einem dem westlichen Menschen fast unerreichbaren Maße ausgebeutet hat. Die von der unsern so unendlich verschiedenen Philosophie des Ostens bedeutet für uns ein überaus wertvolles Geschenk, das wir allerdings »erwerben müssen, um es zu besitzen«. Shrî Ramana's Worte, die uns Zimmer als letztes Geschenk seiner Feder in trefflichem Deutsch hinterlassen hat, fassen noch einmal das Vornehmlichste zusammen, was der Geist Indiens im Laufe der Jahrtausende an innerer Schau aufgehäuft hat, und das individuelle Leben und Wirken des Maharshi verdeutlicht noch einmal das innerste Streben der indischen Völker nach dem erlösenden Urgrunde. Ich sage »noch einmal«, denn Indien steht vor dem verhängnisvollen Schritt, zum Staat zu werden und damit in jene Völkergemeinschaft einzutreten, deren leitende Prinzipien alles auf dem Programm haben, nur gerade nicht die »Abgeschiedenheit« und den Frieden der Seele.
Die östlichen Völker sind von einem raschen Verfall ihrer geistigen Güter bedroht, und was an deren Stelle tritt, kann nicht immer zum Besten abendländischen Geistes gerechnet werden. Man kann daher Erscheinungen wie Râmakrishna und Shrî Ramana als moderne Propheten auffassen, denen in Bezug auf ihr Volk die gleiche kompensatorische Rolle zukommt, wie den Propheten des Alten Testamentes in Bezug auf das »abtrünnige« Volk Israel. Sie erinnern nicht nur an die tausendjährige Geisteskultur Indiens, sondern sie verkörpern diese geradezu und bilden damit eine eindrucksvolle Mahnung, über all dem Neuen westlicher Zivilisation und deren materialistisch-technischer und kommerzieller Diesseitigkeit den Anspruch der Seele nicht zu vergessen. Der atemlose Bemächtigungsdrang in politischer, sozialer und geistiger Hinsicht, welcher mit anscheinend unstillbarer Leidenschaft die Seele des Abendländers zerwühlt, breitet sich unaufhaltsam auch im Osten aus und droht, unabsehbare Folgen zu zeitigen. Nicht nur in Indien, sondern auch in China ist Vieles bereits untergegangen, in welchem einstmals die Seele lebte und gedieh. Die Veräußerlichung der Kultur kann zwar einerseits mit vielen Übelständen aufräumen, deren Beseitigung als höchst wünschenswert und vorteilhaft erscheint, aber dieser Fortschritt ist andererseits, wie die Erfahrung zeigt, mit einem Verlust seelischer Kultur nur allzu teuer erkauft. Es ist zwar unzweifelhaft viel komfortabler, in einem wohlgeordneten und hygienisch eingerichteten Haus zu leben, aber damit ist die Frage noch nicht beantwortet, wer der Bewohner dieses Hauses ist, und ob sich seine Seele auch derselben Ordnung und Reinlichkeit erfreut, wie das zum äußern Leben dienende Haus. Erfahrungsgemäß begnügt sich der auf Äußeres eingestellte Mensch ja nie mit dem bloß Notwendigen, sondern strebt stets darüber hinaus nach noch Mehrerem und noch Besserem, das er, seinem Präjudiz getreu, stets im Äußern sucht. Er vergißt dabei völlig, daß er selber, bei allem äußern Erfolg, innerlich derselbe bleibt und sich darum um seiner Armut willen beklagt, wenn er nur ein Automobil besitzt, statt, wie die meisten andern deren zwei. Gewiß erträgt das äußere Leben des Menschen noch viele Verbesserungen und Verschönerungen, aber sie verlieren ihre Bedeutung in dem Maße, als der innere Mensch damit nicht Schritt hält. Die Sättigung mit allem »Notwendigen« ist zweifellos eine nicht zu unterschätzende Glücksquelle, darüber hinaus aber erhebt der innere Mensch seine Forderung, die mit keinen äußern Gütern gestillt werden kann. Und je weniger diese Stimme ob der Jagd nach den Herrlichkeiten dieser Welt gehört wird, desto mehr wird der innere Mensch zur Quelle unerklärlichen Mißgeschickes und unverstandenen Unglückes inmitten von Lebensbedingungen, welche ganz anderes erwarten ließen. Die Veräußerlichung wird zu einem unheilbaren Leiden, weil niemand es verstehen kann, wieso man an sich selbst leiden sollte. Niemand wundert sich über seine Unersättlichkeit, sondern betrachtet sie als sein gutes Recht und denkt nicht daran, daß die Einseitigkeit der seelischen Diät schließlich zu den schwersten Gleichgewichtsstörungen führt. Daran krankt der Abendländer und er ruht nicht, bis er die ganze Welt mit seiner begehrerischen Rastlosigkeit angesteckt hat.
Die Weisheit und die Mystik des Ostens haben daher gerade uns sehr viel zu sagen, wenn schon sie ihre eigene, nicht nachzuahmende Sprache sprechen. Sie sollen uns an das erinnern, was wir in unserer Kultur an Ähnlichem besitzen und schon vergessen haben und unsere Aufmerksamkeit auf das richten, was wir als unerheblich zur Seite schieben, nämlich auf das Schicksal unseres inneren Menschen. Das Leben und die Lehren Shrî Ramana's sind nicht nur für den Inder bedeutsam, sondern auch für den Abendländer. Sie sind nicht ein bloßes »document humain«, sondern eine warnende Botschaft an eine Menschheit, welche sich im Chaos ihrer Unbewußtheit und Unbeherrschtheit zu verlieren droht. Es ist daher wohl, im tiefern Verstande, kein Zufall, wenn Heinrich Zimmer's letzte Schrift wie ein Vermächtnis gerade das Lebenswerk eines modernen indischen Propheten uns übermittelt, welcher so eindrücklich das Problem seelischer Wandlung veranschaulicht.
____________
1 »Worte des Râmakrishna«, herausg. von Emma von Pelet, Zürich 1930, p. 77.
2 von mir gesperrt.
3 von mir gesperrt.
4 l. c. p. 85.
5 l. c. p. 85.
In indischen Wörtern ist:
jñâna spr. dschnâna.
I. EinführungDie Schale der Persönlichkeit
Shrî Ramana Maharshi, der Heilige von Tiruvannamalai, entstammt einer alten Brahmanenfamilie. Er ist aus Tiruchuzhi im Distrikt Râmnâd gebürtig, einem Landflecken von etwa fünfhundert Häusern, überragt von einem alten Shivatempel, dessen Herrn die beiden größten unter den klassischen Sängern seliger Gottesversenkung Südindiens, Sundaramûrti-Svâmin und Mânikka-Vâshagar in begeisterten Hymnen gefeiert haben. Die Seelenluft mittelalterlicher Frömmigkeit des Tamil-Landes, die in ihren Liedern Sprache fand und zu Ende des 11. Jahrhunderts im »Tirumurai«, dem »Heiligen Buch« (auch »Veda in Tamil« genannt), ihre literarische Überlieferung erlangte, ist an diesem weltfernen Flecken noch lebendig: Tiruchuzhi ist etwa 40km von Madura entfernt, dem berühmten Wallfahrtsort Südindiens, Ziel zahlloser Pilger und jährlich erneuter Touristenströme, und liegt 27km abseits der nächsten Bahnstation Virudunagar.
Shrî Ramanas Vater, Sundaram Ayyâr, fing klein an: mit zwölf Jahren lernte er als Dorfschreiber bei zwei Rupee Monatsgehalt (etwa 5 Schweizer Franken) Buchhaltung und Rechnungsführung. Dann etablierte er sich als Rechtskonsulent, verfaßte Eingaben und Gesuche für Klienten und brachte es schließlich zum unstudierten Rechtsanwalt vor örtlichen Behörden. Er muß eine bemerkenswerte Persönlichkeit gewesen sein: hilfreich und tätig, schließlich wohlhabend und voll Gewicht im engen Umkreis seines Lebens. Er wußte sich mit jedermann gut zu stellen; sein gastliches Haus war allen offen, sein Rat ward viel gesucht. Neue Beamte stiegen bei ihm ab, bis sie eine andere Unterkunft gefunden hatten, und bedienten sich seiner gern bei ihren Angelegenheiten. Auch die zweifelhaften Elemente der Gegend mochten ihn, sie schätzten Charakter und Güte an ihm und ließen ihn ungeschoren, wenn er nachts allein über Land fuhr.
Er war keine ausgesprochen religiöse Natur, aber die heilige Überlieferung trug ihn wie seinesgleichen: mit alltäglich-häuslichem Kult vor den kleinen Götteridolen, mit gelegentlichen Wallfahrten zu Tempeln der Umgegend und mit Erbauungsstunden, in denen er und die Seinen dem Vortrag heiliger Schriften und ihrer Auslegung lauschten. Das allumfassende Lebensritual des Hinduismus, verkörpert im Guru, dem geistlichen Lehrer und erblichen Hauspriester der Familie, der zum Vollzug aller Sakramente und vieler Riten unentbehrlich ist, war der fraglose Seelenraum seines Aufstiegs zu irdischem Wohlstand.
Wie der rechte Vater in zahllosen Märchen und Geschichten hatte er drei Söhne: Nâgasvamin, Venkata-Raman und Nâgasundaram. In seiner Familie besprach man den eigentümlichen Zug, daß jeweils ein Glied jeder Generation dem Weltleben entsagt habe und in den geistlichen Stand des Asketen und Yogin getreten sei. Ein Bruder seines Vaters hatte das gelbe Gewand brahmanischer Mönche angelegt und war mit Wanderstab und Bettelnapf ein pilgernder Asket geworden. Sundaram Ayyârs eigener älterer Bruder war eines Tages aus dem Dorf verschwunden und verschollen geblieben: augenscheinlich hatte auch er sich auf die Pilgerfahrt zum Ewigen begeben, war in die Schar der Namenlosen untergetaucht und in den Strom der Wandernden gemündet, die, ohne Besitz und Ich, Erlösung vom Kreislauf der Geburten, Vollendung bei Lebzeiten und Ruhe im Meer des Göttlichen finden wollen.
Dazu erzählte man sich die Geschichte von einem wandernden Bettelasketen, der vor Zeiten ins Haus gekommen sei, aber keine gastliche Aufnahme gefunden habe, ja nicht einmal ein Essen bekam er, wie es in Indien seit unvordenklichen Zeiten jeder Heilige, jeder Brahmane (ja jeder Bettler) erwarten darf, der in die Tür tritt und das Haus durch sein Verweilen heiligt. Er läßt die Hausbewohner an der Segenskraft seines Wesens teilhaben, indem er entgegennimmt, was sie ihm bereitwillig abgeben mögen. Wer ihn aber abweist, schneidet sich von seinem Segen ab und erntet Fluch. So verließ der abgewiesene Bettelasket das ungastliche Haus mit der Verheißung, die seinen Bewohnern eine Verwünschung dünken mochte: daß in jeder Generation eines seiner Glieder ein Asket werden solle wie er, haus- und besitzlos, um Essen bettelnd.
Indes versprach Nâgasvâmin, der älteste Sohn, ein Ebenbild des Vaters zu werden und, von leichteren Anfängen begünstigt, es höher hinaus zu bringen: nach Absolvierung der nötigen Prüfungen zu einem gutbezahlten Posten in der Verwaltung.
Von der Zunkunft des Kleinsten, Nâgasundaram, konnte füglich noch nicht die Rede sein, er hing noch ganz an der Mutter, als die Verheißung des bettelnden Heiligen sich jählings am Mittleren erfüllte, und Venkata-Raman 1896 in seinem siebzehnten Lebensjahre zu seiner Berufung erwachte.
Venkata-Raman ist am 30. Dezember 1879 eine Stunde nach Mitternacht geboren (nach indischer Rechnung: Pramâthi, 16. Mârgali), - in einer heiligen Nacht. Jubel des Volkes erfüllte den Ort: eben beendete Shiva Mahadöh, der Große Gott, den feierlichen Umgang seines Bildes bei nächtlichem Fackelschein durch die geschmückten Straßen von Tiruchuzhi und kehrte, nachdem er sich den Augen aller leibhaftig gezeigt hatte, wieder ins Dämmerdunkel seines Heiligtums zurück, - da schlug das Kind in stiller Kammer zum erstenmal die Augen auf. Ein großer Tag im Jahreslauf war wieder vorüber; seine Heiligkeit beruhte darauf, daß der Gott immer wieder an ihm im Gange der Zeiten großen Heiligen leibhaft erschienen war: Gautama, dem vorzeitlichen vedischen Seher und Stammvater vieler Brahmanengeschlechter, dem »tigerfüßigen« Heiligen Vyâghrapâda epischer Legende, und Patanjali, dem großen Yogalehrer im 2. Jahrhundert vor unserer Zeitrechnung. So stand der Tag für alle im Zeichen, ihn, den Gott, zu schauen: »Rudra«, den Furchtbaren, als »a-Rudra«, den Unfurchtbaren, Gnädigen. Den »Gnädigen zu schauen« (a-Rudra-darshana), war die Losung des Tages mit Wallfahrten zu heiligen Badeteichen voll entsühnenden Wassers, mit Tempelbesuch zu seinem Bilde im Lampendämmer der Cella und mit feierlichem Umgang, indem seine Erscheinung vorüberwandelnd Volk, Häuser und Straßen segnete.
Indien hat eine eigene Ansicht über die Rolle, die dem mittleren von drei Brüdern zufallen kann. Der Älteste ist das zweite Ich des Vaters, seine leibhafte Wiedergeburt, bestimmt, seine Lebenslinie fortzusetzen, wie der Vater selbst die Reihe aller heimgegangenen Ahnen im Licht des Lebens fortsetzt. Er wird dem Vater und allen Vorvätern einst mit Ahnenopfern die Dankesschuld seines Daseins abzahlen, wie dieser es jetzt tut, und damit den Toten die Nahrung spenden, deren sie zu ihrem Fortleben in der Väterwelt bedürfen. Die unsichtbare Verwandtschaft hat in Gestalt ihres greifbaren jüngsten Vertreters, des Vaters, Beschlag auf den Ältesten gelegt. Der Jüngste gehört der Mutter, er hält sich an sie, wie sie ihn umklammert hält, um dieses letzte Stück ihrer selbst zuletzt und spät an die Mächte des Lebens wegzuschenken. Der Mittlere aber ist keinem der Eltern so elementar verbunden, ist dem Bann der Familie, der heischenden Gewalt des Bluts minder untertan. Das bedeutet Freiheit und Preisgegebensein in einem.
Das große Epos Mahâbhârata enthält eine Geschichte, aus der ein Dramatiker (um das 3. Jahrhundert unserer Zeitrechnung) einen rührenden Einakter gesponnen hat: das Abenteuer eines alten Brahmanen mit seinen drei Söhnen. Er hat sich mit ihnen und seiner Frau auf eine Wanderung durch den wilden Wald gewagt, in dem menschenfressende Unholde hausen; aber er denkt, es werde ihm nichts geschehen, da Bhîma, der große Held des Bhâratageschlechts, sich eben in diesem Walde aufhält, um nach zehnjähriger Verbannung sich mit seinen Brüdern zum großen Endkampf mit den feindlichen Vettern zu rüsten, der ihm und den Seinen die Herrschaft über Indien schenken soll. Aber die Familie wird von einem menschenfressenden Unhold angefallen, der ein Opfer für seine Mutter sucht: sie hat gerade ein längeres Fastengelübde erfüllt und ihm aufgetragen, ihr ein Menschenwild zum »breakfast« zu bringen. Der Alte bietet sich selbst zum Opfer an, um Frau und Söhne zu retten; aber der Unhold lehnt ihn ab: er ist zu alt und dürr. Er weist auch die Frau zurück: seine Mutter will kein Weiberfleisch. So muß einer der Söhne daran glauben. Alle drei bieten sich als Opfer an; aber ehe der Dämon noch gewählt hat, ruft der Vater: »Meinen Liebling, den Ältesten, kann ich nicht hergeben«, - worauf die Mutter erwidert: »Willst du den Ältesten behalten, so will ich den Jüngsten für mich.« - Der Mittlere aber, preisgegeben zwischen beiden, spricht: »Beiden Eltern unerwünscht, - wem bin ich lieb? - und der menschenfressende Unhold grinst ihm die Antwort: »Mir gefällst du, komm schnell mit!« Unter Segensworten und Klagen der Seinen will er dem Unhold in den Tod folgen, als eine wunderbare Fügung den Helden Bhîma auf den Plan bringt und alles zum Guten wendet.
Die alten Veden wissen eine vorzeitliche Geschichte mit ähnlichem Sinn, die noch aus der Zeit der Menschenopfer stammt. Ein König hat dem Götterkönig Varuna versprechen müssen, seinen Sohn zu opfern; aber der Sohn ist entflohen, und der Vater sucht einen Ersatz. Denn weil er säumt, hat Varuna, der eidhütende Gott, der in den Wassern wohnt, ihn mit Wassersucht geschlagen. Er findet in der Wildnis einen Brahmanen, der am Verhungern ist und bereit, ihm einen seiner drei Söhne als Opfer zu verkaufen; da packte der Brahmane den Ältesten und rief: »aber nicht diesen!« - »aber auch nicht diesen!« fuhr die Mutter zu und umschlang den Jüngsten. Über den Mittleren wurden sich beide einig und verkauften ihn dem Könige.