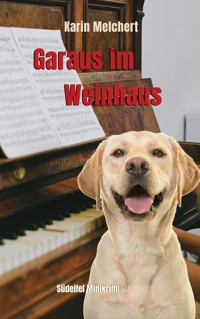Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: epubli
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
»Hätten meine Eltern einen Papagei besessen, wäre jeder Besucher mit einem Solange-du-deine-Füße-unter-meinen-Tisch-Stellst begrüßt worden.« ... Ganz im Sinne ihrer spießigen Eltern landet Anna auf einem Amt in Trier, obwohl sie viel lieber Sängerin geworden wäre. Als sie den bekannten amerikanischen Soulsänger Colin kennenlernt, scheint sie ihrem Ziel näher zu kommen. Dummerweise lässt er sie mitten in der Golfkrise sitzen. Wie Anna trotz Hürden, Liebeskummer und zwiespältigen Gefühlen ihren Traum verfolgt, beschreibt die Autorin in 7 heiteren bis spannenden Episoden und verrät dabei, was nicht in Superstar- und Casting-Shows zu sehen ist und was es heißt, einen Traumberuf zu verwirklichen ... Basierend auf ihrem ersten Roman Solo (nominiert für den Luxemburger Buchpreis 2009) schlägt die Autorin in der Neubearbeitung eine Brücke zwischen Vergangenheit und Gegenwart, teilt ihre Erfahrungen und gibt Tipps an alle, die sich für Stimme, Gesang und Bühne interessieren. Der spritzige Liebesroman über das Musikerleben in den 80ern bietet jedoch auch NichtsängerInnen und MusikerInnen eine unterhaltsame Reise hinter die Kulissen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 301
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Karin Melchert
Der Weg zur Bühne
Vom Eifelkind zur Sängerin
Erfahrungsroman
Impressum
Texte: © 2023 Copyright by Karin Melchert
Umschlag: © 2023 Copyright by Karin Melchert
Verantwortlich
für den Inhalt: Karin Melchert
Berdorf/Luxemburg
Druck: epubli – ein Service der Neopubli GmbH,
Berlin
»Hilf mir, bitte, bitte hilf mir!«
Ob das schweigende Stoßgebet an den Lieben Gott gerichtet ist oder an das kalte, leblose Etwas in meinen Armen, dessen Antlitz glänzt wie das Wachs von Omas Tischkerzen, die an Feiertagen beim Mittagessen angezündet werden, ich weiß es nicht. Ich weiß nur, meine Knie zittern wie Espenlaub und ich fürchte, jeden Moment umzufallen wie Schneewittchen, als sie in den Apfel biss. Kalte Angst windet sich wie eine Pythonschlange um meinen Körper und ich flehe zum Himmel, das Reptil möge mir die Kehle nicht zuschnüren. Denn ich brauche meine Stimme! Und zwar jetzt! Genau in diesem Moment! Also schlucke ich die Angst hinunter und … singe …
»Ach lieber Doktor Pillermann ...«
Ich war sechs Jahre alt und stand mit einer Puppe im Arm und mit einem Kinderlied auf den Lippen vor meinem ersten Publikum. Noch heute habe ich das Lied in den Ohren und sehe das Bild vor mir, als wäre es gestern gewesen. Das Lampenfieber, das ich damals zum ersten Mal in der Form erlebte, verflog nach den ersten Tönen und mit dem Applaus wurde ein anderes Fieber geweckt – ein Fieber, das mich ein Leben lang begleitet hat und noch immer brennt.
»Was darf ich Ihnen bringen?«, unterbricht eine Kellnerin die Gedanken an das Ereignis, das mutmaßlich mein Leben geprägt hat.
»Ein Glas Weißwein bitte, trocken.« Der passt wunderbar zu diesem lauen Sommerabend, an dem ich vorm Bistro Walderdorffs am Domfreihof in Trier sitze, unweit von der Bühne, auf der eine Band mit dem Soundcheck beschäftigt ist. Das Konzert beginnt erst in einer Stunde, folglich habe ich Zeit, weiter meinen Gedanken nachzuhängen. Zeit, gleich ein Gläschen Wein zu genießen. Zeit, nach einem Konzert, das ich heute Nachmittag nach einer coronabedingten Durststrecke für ein enthusiastisches Publikum geben durfte, abzuschalten und mich tierisch darauf zu freuen, gleich eines von lieben Kollegen bewundern zu dürfen, die ich seit Ewigkeiten nicht mehr gesehen habe.
*
Liebe Leserinnen und Leser,
die Idee zur Einleitung von Annas Geschichte kam mir im Jahr 2021, als ich tatsächlich vorm Bistro Walderdorffs am Domfreihof in Trier saß und eine Band beim Soundcheck beobachtete. Auch die Geschichte mit der Puppe im Arm stammt aus meinem eigenen Leben. Ab jetzt lasse ich Anna jedoch ihren eigenen Weg gehen und überlasse der Fantasie die Schreibfeder.
Die Geschichte ist in sieben Episoden eingeteilt. In jeder Episode gibt es nützliche Hinweise, Gesangslektionen und Tipps für Sänger, Sprecher und alle, die sich für die Themen Stimme und Bühne interessieren. Diese sind fettgedruckt. So wie auch gelegentliche Tatsachen und Anmerkungen von meiner Seite.
An die Sprachkritiker unter euch: Weil die Geschichte in den Achtzigerjahren beginnt und ich dem Stil der damaligen Zeit treu bleiben möchte, verzichte ich aufs Gendern.
Und weil ich Sängerin bin, benutze ich das weniger formelle »Du« als Anrede, wie es unter Musikern üblich ist.
Und weil gelegentlich autobiographische Elemente einfließen, können Ähnlichkeiten mit wahren Personen und Begebenheiten nicht ausgeschlossen werden, sind jedoch nicht beabsichtigt.
Und weil ich im letzten Jahrhundert die Schulbank gedrückt habe und ohne politisch korrekte Schreibweisen aufgewachsen … Ach, am besten ich höre jetzt auf mit dem Blablabla, wünsche euch einfach nur gute Unterhaltung und hoffe, ihr nehmt mir meine Schreibweise nicht übel :-)
Eure Karin
1. Episode in der Anna Musiker kennenlernt und ich erkläre, welchen Einfluss Kindheit, Umfeld und ein wenig Glück auf die Karriere haben
Anna, August 1986
»Ich sterbe«, stöhnte Petra. Die unerträgliche Hitze, die endlose Fahrt über mautpflichtige Autobahnen, die zu lang gewordenen Beine, die seit Südfrankreich nur eines wollten: den zurückgelehnten Sitz des Vordermannes nach vorne schieben. Beim Versuch, meine Füße unter demselben auszustrecken, stießen sie gegen eine Reisetasche. Sofort überkam mich das dringende Bedürfnis, sie meinem Vordermann gegen die Hinterbeine zu rammen. Ich besann mich jedoch und wandte mich meiner Sitznachbarin zu: »Wir müssten bereits vor zwei Stunden angekommen sein. Kann nicht mehr lange dauern, bis wir da sind.« Dies war weniger ein Versuch, Petra zu trösten, als vielmehr eine Taktik, mich selbst in Geduld zu üben. Ich konnte es kaum erwarten, in den Swimmingpool zu springen. Strand. Meer. Mein erster Urlaub ohne Eltern. Seit einem Monat volljährig. Als meine äußerst sparsamen Eltern mir zum Geburtstag das Geld für den Urlaub in die Hand gedrückt hatten, war ich sprachlos gewesen. Was war bloß ins sie gefahren? Einen solchen Luxus gönnte man sich in unserem Haus normalerweise nicht. Genauso wenig wie einen Zweitwagen, obwohl ich nun stolze Besitzerin eines Führerscheins geworden war. »Du bist jetzt alt genug und kannst dir das Geld für ein Auto selbst verdienen«, war ihre Antwort auf meine Frage gewesen, ob so ein kleiner Gebrauchter zum gelegentlichen Einkaufen in die Stadt und zum Friseurbesuch im Nachbarort nicht auch in ihrem Sinne wäre. Vielleicht hatte sie das schlechte Gewissen geplagt, weil fast alle Schulkameraden das Geld für den Führerschein nicht vom eigenen Sparkonto bezahlen mussten und manche Eltern den Gymnasialabschluss obendrein mit einem gebrauchten Ford Fiesta, einem alten VW Käfer oder einer Ente belohnten? Auf jeden Fall löste sich das Rätsel, als meine Eltern verkündeten: »Im Urlaub hast du Zeit, dir Gedanken über die Zukunft zu machen.« Studium zum Betriebswirt, eine kaufmännische Ausbildung oder Banklehre – diese Vorschläge hatte das Arbeitsamt gemacht – darüber sollte ich nachdenken. Im Moment war jedoch ein anderer Gedanke vorrangig: unterwegs mit meiner besten Freundin, erster Urlaub ohne Eltern, frei und ungebunden – zwei ganze Wochen lang. Mein aufsteigendes Bedürfnis, einen euphorischen Freudenschrei auszustoßen, wurde von dem Krachen und Fiepen der Buslautsprecher gedämpft, durch die sich quäkend die Stimme der Reiseleiterin drückte: »Alle Hotels vor Ort sind voll. Wir fahren weiter und werden andere Unterkünfte für Sie finden.«
Sofort erhitzten aufgebrachte Stimmen die vom Schweiß ungeduldiger Touristen geschwängerte Luft um mindestens zehn weitere Celsiusgrade: »Was soll das heißen? … Das kann nicht sein! … Aber wir haben unser Zimmer vor einem halben Jahr fest gebucht ...«, gehörten zu den harmlosesten Ausdrucksweisen der Empörung. Nach abermaligem Krachen und Fiepen ertönte Venus in der neu herausgebrachten Version von Bananarama, die den Titel von Shocking Blue in diesem Jahr auf Nummer 1 in sämtliche Hitparaden lancierten. »Was machen wir jetzt?« Die Frage kam von Petras schmalem Hintermann. Seine spitzen Knie rutschten von ihrer Rückenlehne. Petra, die dort sicherlich Beulen vermutete, verdrehte genervt die Augen. Sie ärgerte sich schon während der ganzen Fahrt über das Gezappel.
»Das, was die anderen auch tun. Abwarten!«, antwortete sein leicht untersetzter Sitznachbar, dessen Pfannkuchengesicht strenge Züge annahm. »Und behalte gefälligst deine Gräten bei dir.« Gereizt zog er den Kopfhörer des tragbaren Kassettenrekorders vom Ohr, über dem sich helle Schweinslöckchen kringelten, die im Ansatz auf aschbraune, glatte Haare hindeuteten – das Resultat der damals üblichen Dauerwelle. Der Schmalhans folgte dem Befehl, rutschte vom Sitz und stellte sich davor, dabei stemmte er ein Knie ins Sitzpolster und beobachtete gelangweilt die aufgebrachten Fahrgäste. Petra, die vor Langeweile mindestens zwanzig Kaugummis gekaut hatte, musterte ihn argwöhnisch von oben bis unten, und weil sie nichts Besseres zu tun hatte, fragte sie schließlich: »Habt ihr auch Lloret de Mar gebucht?«
»Ja«, antwortete das Pfannkuchengesicht an seiner Stelle. »Wer weiß, wo wir jetzt landen? Diese blöden Spanier!« Zu seinem Kompagnon sagte er: »Pflanz dich hin. Du gehst mir auf den Keks.«
Der Schmalhans setzte sich murrend, aber nicht ohne dem Pfannkuchengesicht vorher den Kopfhörer aus der Hand zu reißen und ihn selber aufzusetzen. Statt sich über den Verlust aufzuregen, wandte sich der Pfannkuchen plötzlich an uns: »Vielleicht haben wir ja Glück und landen im gleichen Hotel.« Sein frivoler Blick und das schiefe Grinsen ließen Petra genervt in den Sitz zurückfallen. Sie angelte eine Zeitschrift aus ihrer Tasche, ein Zeichen, dass sie nicht gestört werden wollte. Vorsichtshalber kramte ich ebenfalls etwas zum Lesen hervor: Der Stoff, aus dem die Träume sind – ein Roman von J.M. Simmel. Der erschien mir perfekt für den Urlaub; am Strand liegen, die Sonne genießen, träumen von einer erfolgreichen Zukunft und all dem, was das Schicksal mir bescheren und wo es mich hinführen würde ... So blieben wir vorerst von Gesprächen mit unseren Hintermännern verschont. Der Schmalhans schien mittlerweile komplett in der Welt der Musik untergegangen sein. Statt Gezappel und Genörgel ertönten von ihm nur noch leichte Taktschläge aufs Knie – untermalt von gedämpften Basstönen aus den Kopfhörern und gelegentlichem Fingertrommeln auf der Armlehne. Das Pfannkuchengesicht hingegen nutzte jede Haltestation, an der protestierende oder zustimmende Passagiere zu ihren Alternativunterkünften entlassen wurden, um die zurückgebliebenen Fahrgäste über die Unzuverlässigkeit und Unverschämtheit der spanischen Bevölkerung im Allgemeinen und des deutschen Reiseveranstalters im Besonderen zu informieren.
»An eurer Stelle würde ich das Vierbettzimmer nehmen«, empfahl die Reiseleiterin. »Ich glaube nicht, dass ihr um diese Zeit noch ein anderes findet.« Es dämmerte bereits, als sie uns diese Hiobsbotschaft verkündete. Sie wusste nicht, dass die vier Übriggebliebenen (Roland Pfannkuchengesicht, Jörg Schmalhans, Petra und ich) nicht zusammengehörten. Der Plan, die Typen loszuwerden, war hoffnungslos gescheitert. So standen wir nun vor einem Hotel ohne Sterne, ohne Pool und ohne Zimmer mit eigenem Bad. Roland schien das nicht zu stören; er verkündete strahlend: »Ich nehme das untere Bett.« Jörg warf seinen Koffer kommentarlos auf das Hochbett. Petra und ich tauschten argwöhnende Blicke und teilten uns das Doppelbett.
»Wir gehen essen und danach in die nächstbeste Disko. Kommt ihr mit?«, fragte Roland,nachdem wir uns der Reihe nach geduscht und umgezogen hatten. Dabei vernahm ich einen deutlichen Unterton von Warum in die Ferne schweifen, wenn das Gute liegt so nah. Dass Petra und ich die Ansicht in keiner Weise teilten, lag ihm offensichtlich fern. Prompt machte ich mich an meinem Koffer zu schaffen, als hätte ich die Frage nicht gehört. Petra antwortete lapidar: »Ja, ja, geht ihr schon vor. Wir kommen nach.«
Wenig später machten wir einen Bogen um die nächstbeste Disko. Sicherheitshalber auch um die übernächste. In der Dritten setzten wir uns auf die beiden letzten freien Hocker am Tresen. »Was machen wir, wenn die heute Nacht heimkommen, sturzbetrunken und unzurechnungsfähig – du weißt, was ich meine?«, fragte Petra besorgt und bestellte ein großes Bier mit Cola.
»Ich möchte auch so eines«, rief ich dem Barkeeper hinterher und begann zu überlegen. »Hmm … Wir kommen nach ihnen nach Hause oder machen die Nacht durch. Auf jeden Fall bleiben wir nüchtern!« Sofort wendete ich mich wieder an den Barkeeper: »Das Bier bitte mit viel Cola!«
Als Petra und ich nach der ersten, viel zu kurzen Nacht (wir waren zwischen 05.00 und 06.00 Uhr eingetrudelt – ein Rhythmus, an den wir uns gewöhnen sollten) vom Frühstück zurückkehrten, tönte Vamos a la playa von der Italo Gruppe Rhigeira durch die spaltbreitoffene Tür unseres Vierbettzimmers. Ohne uns anzusehen, wussten wir, dass wir den gleichen Gedanken hatten: flüchten! Doch im selben Moment ließ uns der tönende Ghettoblaster erstarren, der im Rahmen erschien; darunter Jörg, auf dessen schmaler Schulter er ruhte, gefolgt von Roland, der nicht weniger mitgenommen aussah, sich aber sofort aufrichtete, als er uns erblickte. »Guten Morgen«, rief er und bemühte sich, ein Gähnen zu unterdrücken, was sein Grinsen ziemlich dämlich aussehen ließ. »Ausgeschlafen die Damen?« Aufgrund der aufgesetzten Sonnenbrillen und den zu Berge stehenden Haaren schlussfolgerten wir, dass die Herren nicht wesentlich früher heimgekehrt waren als wir. Jörg stellte das Gerät auf dem grauen Plastiktisch ab, der auf dem Flur vor dem Zimmer stand, schob eine Kassette rein und setzte sich auf einen der dazugehörigen Plastikstühle. Every Breath You Take ertönte. »Mögt ihr Police?«, waren die ersten zusammenhängenden Worte, die er an uns richtete.
»Ist okay«, antworte Petra, womit sie auch meine Meinung vertrat.
»Bist du Sängerin?«, fragte Jörg, als der Song zu Ende war und guckte mich schief an.
Ich hatte bestimmt schon intelligenter dreingeschaut. »Wieso?« Hatte ich wieder mal …? Von Kindesbeinen an sang ich bei allem mit, was meinen Trommelfellen entgegenschlug, sofern sie es als bekannte Melodie registrierten. Ob Volksmusik, Operette oder aktuelle Radiohits: Ich versuchte mich mit wachsender Begeisterung in allen Stilrichtungen. Wenn ich einmal groß bin, so schwebte mir vor, dann wird meine Stimme über den Äther zu hören und meine Person auf dem Fernsehbildschirm zu sehen sein. Egal ob im Dirndl wie Maria und Margot Hellwig, in langen, glitzernden Roben wie Shirley Bassey oder im adretten Hosenanzug wie Gitte. Bevor ich Zeit hatte, mir eine Erklärung einfallen zu lassen, sagte Jörg: »Wir suchen eine Sängerin für unsere Band.«
Unweigerlich stellten sich meine Ohren auf Empfang, doch ehe ich mein Glück fassen und dem instinktiven Drang, Jörg nach den Details zu fragen, nachgehen konnte, fuhr Roland dazwischen:
»Mensch, Jörg! Jetzt hör doch auf mit so einer bescheuerten Anmache.«
»Nein, wirklich«, beteuerte Jörg, dessen Position auf meiner Sympathieskala urplötzlich steil nach oben geschossen war. »Wir suchen tatsächlich eine Sängerin.«
Roland verdrehte missmutig die Augen und knurrte: »Ich brauche einen Kaffee. Los komm, wir gehen frühstücken.«
Petra und ich schauten uns am gleichen Tag erfolgreich nach einem anderen Zimmer um, und mit ihm ließ ich den einmaligen Zaunpfahl, mit dem das Schicksals gewunken hatte, hinter mir.
»Na, hast du dir überlegt, was du machen willst?«, fragten meine Eltern am ersten Abend nach der Rückkehr. »Nun ja ... Eh ...« Worüber hatte ich im Urlaub nachgedacht? Vor allem wann? Nachts waren Petra und ich vollauf mit der Auskundschaftung von Diskotheken beschäftigt gewesen. Morgens nach dem Frühstück mussten wir uns einen Platz am Strand sichern, mittags den versäumten Schlaf nachholen und beim Abendessen die Kalorien zu uns nehmen, die wir fürs Tanzen in der Disko benötigt hatten. Dazwischen war keine Zeit geblieben, über die Zukunft zu sinnieren. »Ich bin gefragt worden, ob ich Sängerin werden will«, fiel mir ein.
»Das ist doch kein Beruf«, regten sich meine Eltern auf. »Such dir einen anständigen Job. Du willst ja schließlich Geld verdienen.«
*
Erfahrungen der Autorin zum Thema Glück:
Einerseits haben die Roman-Eltern von Anna Recht. Andererseits lässt sich auch mit Musik Geld verdienen. Reich werden jedoch die Aller-Allerwenigsten.
Erst kürzlich las ich die Biografie von Bruce Springsteen »Born to Run«, in der er seinen Weg vom jugendlichen Gitarrenschrubber zum Superstar beschreibt. Natürlich sind meine Erfahrungen nicht vergleichbar, aber unterm Strich steht dieselbe Erkenntnis: Wie Millionen und Abermillionen von Jugendlichen hatten wir die Vision, auf einer Bühne zu stehen. Entgegen einer großen Mehrheit gelang es uns, eine Demokassette herzustellen und auf einer Platte zu landen (und zwar Vinyl – die Buchstabenfolge „CD“, kannte man lediglich aus einer Seifenwerbung, die mit den Worten „An meine Haut lasse ich nur Wasser und ...“ beginnt). Im Gegensatz zu Springsteen erhielt ich keinen Plattenvertrag – ein Schicksal, das die Meisten mit mir teilten. Von den wenigen glücklichen Plattenvertragsinhabern landeten die allerwenigsten einen Hit, hatten eine kurze Karriere oder konnten ihren Lebensunterhalt längerfristig damit bestreiten. Davon hatte wiederum nur ein Bruchteil dauerhaften Erfolg und konnte davon leben. Zwar gibt es heute andere Mittel und Wege, Musik zu veröffentlichen, um damit reich und berühmt zu werden, am Prinzip hat sich jedoch nichts geändert: Die Konkurrenz ist exorbitant, die Arbeit hart und die Chancen, einen Sechser im Lotto zu landen, vergleichbar gering. Vermutlich war die Aussicht zur damaligen Zeit für ein Eifelmädel auf die Art und Weise, wie in der Geschichte beschrieben, mit einem Musiker zufällig in einem Vierbettzimmer in der Nähe von Lloret de Mar zu landen, nicht wesentlich größer, dennoch ist mir im Alter von 18 Jahren genau das passiert.
Im Nachhinein weiß ich: Glück gehabt, denn ich ignorierte den Wink des Schicksals nicht.
Anders als im Roman gehörten beide Jungs einer Band an. Den Namen habe ich leider vergessen. An die Namen der Jungs konnte ich mich auch nicht erinnern, als ich den Roman schrieb. Zufälligerweise – oder spielte das Unterbewusstsein mit? – hieß einer der beiden Musiker tatsächlich Jörg, wie ich vor nicht allzu langer Zeit durch eine zufällige Begegnung herausfand. Woran ich mich noch vage erinnere: Mein kurzes Gastspiel endete, als mich der Keyboarder der besagten Band einem 10-köpfigen Tanzensemble aus Longuich an der Mosel vorstellte, deren Repertoire eher zu meiner Stimme und meinen Vorstellungen passte. Mein Auftritt bei Sound Selection dauerte 15 Jahre. Wieder ein Glücksfall, denn viele Bands brechen oft nach wenigen Jahren auseinander.
Auf meinem weiteren Weg vom Eifelkind zur Sängerin habe ich gelernt, dass Erfolg und die Erfüllung von Träumen keine Produkte von Zufall oder Wünschen ans Universum sind, sondern von Eigeninitiative, Durchhaltevermögen und Arbeit. Denn auch Traumberufe sind knallharte Jobs!
Glück sowie die richtigen Begegnungen zum richtigen Zeitpunkt sind zwar hilfreich, wie ich selbst erleben durfte, aber sie geschehen eher selten. Vor allem nicht, wenn man darauf wartet. Der Schlüssel zum Glück liegt anderswo.
Darüber habe ich ein kleines Lied geschrieben. Ihr findet es auf meinem YouTube Kanal.
Ein kleines Lied vom Glück
Text + Musik: Karin Melchert
Dies ist ein klitzekleines Lied
Übers Glück, das nicht geschieht,
Wenn man´s ständig vor sich herschiebt.
Vom Glück das nicht zufällig passiert,
Nicht von allein multipliziert und kumuliert,
Das stattdessen darauf basiert:
Dass man es selber kreiert und erschafft,
Modelliert, realisiert, dreht, wendet und macht,
Renoviert, sich antrainiert und mal drüber lacht
Und immer wieder aufs Neu entfacht.
Dies ist ein klitzekleines Lied
Übers Glück, das man fühlt,
Wenn man´s ständig hegt und pflegt.
Vom Glück, das man selbst kultiviert,
Mit zwei Tüten Verstand
Und ´ner Prise Talent
Immerzu aufs Neu realisiert.
Das man aktiviert, initiiert und attackiert,
Ungeniert sich engagiert und experimentiert,
Nicht frustriert kapituliert, wenn´s mal nicht funktioniert,
Selbst dann, wenn man sich völlig blamiert.
©
Den Song findet ihr unter anderem auf YouTube
*
Anna
»Wieso gehst du nicht mit Erwin Redlich aus?«, fragte meine Mutter an einem frühen Sonntagnachmittag. Ich war gerade aufgestanden. In der Hand hielt ich ein Marmeladenbrötchen, mit der anderen betätigte ich die Kaffeemaschine. Mit den wenigen Gehirnzellen, die mir nach einer durchzechten Nacht zur Verfügung standen, formulierte ich den Satz: »Weil ich keinen Bock auf seine Kumpels habe, und da, wo er hingeht, ist es langweilig.«
»Aber er ist doch so ein netter Kerl. Er ist zuverlässig, hat eine gut bezahlte Stelle ...«
... arbeitet auf dem Amt und hat eine sichere Rente im Alter, führte ich ihren abgebrochenen Satz in meinem Kopf zu Ende. Die restlichen Gehirnzellen waren aufgewacht und mir dämmerte, woher der Wind wehte. Ich stand kurz vor meinem einundzwanzigsten Geburtstag und befand mich im heiratsfähigen Alter – zumindest war meine Familie dieser Meinung.
»Vergiss es.« Ich ließ den Rest des Kaffees in der Küche stehen, nahm die übrig gebliebene Hälfte des Frühstücksbrötchens und verzog mich in mein frisch mit orangefarbenen Ellipsen und Kreismustern tapeziertes Zimmer unterm Dachboden, um das mich meine beste Freundin Petra zutiefst beneidete. Sie teilte ein Zimmer mit ihrem Bruder, das auf ihrer Hälfte mit Bravopostern und auf seiner mit Comic Helden zugekleistert war. Ich zog einen amerikanischen Liebesroman aus dem weißfurnierten Bücherregal überm Bett. Den hatte sie mir ausgeliehen mit den Worten: »Das Lesen von solchen Schmökern hilft beim Aufbessern der Sprache.« Augenzwinkernd hatte sie ein süffisantes »Und bei anderen Dingen« hinterhergeschoben. Mit den anderen Dingen konnte ich momentan nichts anfangen, und die Gedanken daran halfen kein bisschen, mich aufs Buch zu konzentrieren. Mit Erwin ausgehen wäre das Allerletzte. Erwin war mein Kumpel, mein Arbeitskollege und Chauffeur. Er nahm mich regelmäßig in seinem laubfroschgrünen Kadett mit aufs Amt nach Trier. War er attraktiv? Keine Ahnung. Ich hatte ihn bisher mit demselben Blick bedacht, mit dem ich den Besenschrank in unserer Küche betrachtete. Er fiel mir nicht auf.
Erwin war der typische Durchschnittsmensch: mittlere Größe, mittelmäßige Figur, kastanienbraune bis aschblonde Haare – weder lang noch kurz, mittelmäßig halt – von Frisur keine Spur, und so sah er permanent friseurreif aus. Ich stand auf ausgefallene Typen: langes Haar mit Pferdeschwanz (meinetwegen auch mit Dauerwelle). Andererseits, gegen einen Typ wie Patrick Swayze hätte ich auch nichts einzuwenden – aber wenn, dann bitteschön mit KITT, dem Flitzer aus der Serie Night Rider (mit so einem Auto hätte Erwin vielleicht auch besser ausgesehen?). Diese Sorte war nur leider rar gesät. Zumindest da, wo ich herkam. Konsequenterweise war ich die meiste Zeit single, solo und unbemannt. Dabei mangelte es weder an Gelegenheiten noch an Verehrern. Mit polangen, blonden Haaren, die im Gegensatz zum damaligen Kurzhaarfrisuren-Trend standen, zog ich oft mehr Aufmerksamkeit auf mich, als mir lieb war. Das Dilemma war nur: Die Typen, die sich für mich interessierten, interessierten mich nicht, und die, die mich interessierten waren entweder vergeben oder es gab sie nicht. Mein Auserwählter sollte die zukünftige Villa mit Schwimmbad, die drei Kinder, den Garten, den Hund (einen Dalmatiner) und die Katze (einen Jaguar in der Garage) unterhalten können. Na ja, mit einem kleinen sportlichen Cabriolet würde ich mich auch zufriedengeben. Aufgrund der soeben aufgeführten Konditionen war eine Sache klar: In dem idyllischen Eifeldorf (sofern man bepflasterte Straßen rund um Dorfkirchen und Brunnen, rustikale Landhäuser umringt von Blumengärten und Trauerweiden und daneben alte Bauernhäuser mit Kuh-, Hühner- und Schweineställen idyllisch findet) in dem ich wohnte, sowie im idyllischen Nachbardorf (siehe oben), in dem Erwin wohnte, würde ich zeitlebens vergeblich suchen. Ebenso im Yves, der Disko, in der ich Petra letzte Nacht gewaltsam von einem potentiellen Kandidaten für eine Dreimonatsbeziehung wegreißen musste, nachdem der Wirt Zapfenstreich eingeläutet hatte. Vor derselben stand – neben Rostlauben, Kleinwagen und alten Mittelklassewagen – höchstens mal ein einsamer Porsche, und der gehörte dem Besitzer des Etablissements. Aber es gab Flugzeuge. Und die standen auf den beiden US-Air-Force-Basen in der Nähe. Die dort stationierten amerikanischen Soldaten machten gut die Hälfte der Diskothekenbesucher aus. Die andere Hälfte war deutsch und weiblich. Petra stand total auf Amis. Diese Neigung war so ziemlich das Einzige, was wir nicht teilten. In der Schule hatten wir die Schulbank geteilt, auf dem Schulhof die Pausenbrote, in der Kirche das Gebetbuch, und ab dem letzten Schuljahr den Liebeskummer und die Sorgen. Nur ihren roten Fiesta, den teilten wir auch nicht. Mit dem durfte ich lediglich ein einziges Mal fahren; das war an dem Tag, als ihr Exfreund ein Foto von den Philippinen schickte, auf dem er in schicker blauer Air-Force-Uniform mit einer zierlichen, asiatischen Frau mit Brautkleid unter Palmen posierte. Petra hatte sich an dem Abend besinnungslos betrunken. Was meine Beziehungskisten anging, darin gab es nicht viel zu kramen. Ich lernte durch Petra fast nur Amerikaner kennen und die Konsequenzen einer amourösen Beziehung schreckten mich ab. Vielmehr die damit verbundenen Folgen. Auswandern wollte ich nicht. Einen finanziell nicht abgesicherten und sprachlich unbegabten Ausländer auch nicht, der weder für mich, meine drei Kinder, meine Villa, meinen Hund … Na ja, das hatten wir bereits. Und Erwin? Nein, Erwin war definitiv nicht mein Typ. Genauso wenig wie seine Kumpels aus der Dorfkneipe. Das einzig Interessante an Erwin war die Tatsache, dass er Bass in einer Band spielte, wobei mich auch die nicht interessierte. Eben weil Erwin dabei war. Somit war ich dankbar, dass er nur selten über deren Aktivitäten sprach. Ich vermutete aber, diese vermehrten sich. In letzter Zeit hatte Erwin enorme Schwierigkeiten, morgens pünktlich vor unserer Haustür zu erscheinen. Außerdem litt er unter chronischem Schlafmangel. Neulich ließ er mich tatsächlich ans Steuer – er war nur knapp drei Stunden vorher vom Auftritt heimgekehrt. Kaum saß er auf dem Beifahrersitz, schlummerte er röchelnd vor sich hin, bis ihn schließlich das hässliche Krachen eines abgewürgten Motors weckte. Das geschah nach meinem Versuch, den Wagen hinterm Amt auf seinem Stammplatz rückwärts einzuparken. Auf dem Rückweg war er allerdings hellwach und berichtete enthusiastisch: »Ich habe heute Nachmittag die Zusage bekommen mit den Soulcats eine Silvesterparty in der Nähe von Bitburg zu organisieren.«
»Soulcats?«
»Ja, meine Band. Habe ich den Namen nie erwähnt?«
Hatte er nicht. Dann hätte ich nämlich die Ohren gespitzt. Erst letztens hatte mich Petra gefragt, ob wir uns die Soulcats mal antun sollen, die seien anscheinend ganz gut und erfreuten sich eines stetig wachsenden Fanclubs, mit dem sie mittlerweile ganze Festzelte füllten. Als ihr was dazwischenkam (es hatte zwei Beine und trug Männerunterhosen), spielte ich kurz mit dem Gedanken alleine zu fahren, doch meine Eltern brauchten das Auto, und Erwin fragen kam nicht in die Tüte. Ich hatte ja zu diesem Zeitpunkt nicht geahnt (!Und konnte es noch immer nicht glauben!), dass er Bandleader der Soulcats war.
Die Soulcats befanden sich in der für Tanzbands üblichen 15-Minuten-Pause, die alle 45 Minuten stattfand.
»Hey, Anna!«, rief Erwin, stellte den Bass ab, streckte mir die Hand entgegen und half mir beim Raufklettern auf die Bühnenpodeste. »Anna, das ist Klaus. Klaus, das ist Anna«, stellte er mich dem Keyboarder vor.
Der Kopf des breitschultrigen Blonden hing tief gebeugt über einem Yamaha-DX7-Synthesizer. Das tat seiner Größe jedoch keinen Abbruch. Ich schätzte, in aufrechtem Zustand könnte er mühelos einen Basketball ins Netz befördern. Aus den tiefsten Sphären der synthetischen Soundwelt herausgerissen brummte er »mhm«, ohne dabei von seinem Tasteninstrument aufzuschauen. Den Sorgenfalten auf der Stirn nach zu urteilen, hing der Rest des Abends von einem spezifischen Sound ab. Obwohl ich von jeher auf dunkle Haare stand, fand ich Klaus Bastian auf den ersten Blick gar nicht so übel. Auf den zweiten erinnerte er mich an Dieter Bohlen, der mit Modern Talking gerade seine Glanzzeiten hinter sich hatte. Ich muss gestehen, ich stand eher auf Thomas Anders – der dunklen Haare wegen!
»Hallo!«, sagte Dieter Bohlen plötzlich und musterte mich breit lächelnd von oben bis unten. Scheinbar hatte er den Sound gefunden. Dann reichte er mir die Hand und drückte so fest zu, dass meine Knöchel schmerzten. »Ich bin Klaus.«
Im gleichen Moment rauschte ein bierglas-balancierender Indianer um die Bühnenecke, dicht gefolgt von einer weiteren bierglas-balancierenden Gestalt. So lernte ich Bernie und Wolle kennen. Bernie hörte auf den Spitznamen Winnetou, was zweifelsfrei an der seltenen Kombination von naturschwarzen, langen Haare mit silberseeblauen Augen lag, die denen von Pierre Brice im besagten Film durchaus Konkurrenz machten. Eigentlich waren sie noch bezaubernder. Zumindest in dem kurzen, magischen Moment, in dem sich unsere Blicke kreuzten und ich das lebensgroße Bravo-Starschnitt-Poster meines damaligen Lieblingsschauspielers vor mir sah, das ich tagtäglich auf meiner Zimmertür angehimmelt hatte. Vielleicht hatte ich mir den magischen Blick auch nur eingebildet. Er rannte weiter, als wäre ich aus Luft. Anders reagierte sein Verfolger. »Hallo, ich bin Wolle.« Bürgerlicher Name: Helmut Wollmann. Der stellte hastig die Biergläser ab und streckte mir selbstbewusst die feuchtkalte Hand entgegen. »Ich bin der Sänger der Band, Junggeselle und noch zu haben«, röhrt er wie ein brunftiger Hirsch. »Tschuldige, wenn ich dich allein lasse, aber …« Er verschwand, um drei Meter weiter bei zwei erwartungsfreudigen Tussen stehen zu bleiben, die mindestens um die 30 waren. Wolle war mit seinen 27 Jahren der Senior der Truppe. Er beeindruckte das Publikum in erster Linie mit seinem Saxofon-Gepose und in zweiter Linie mit mittelmäßigem Gesang.
»Möchtest du tanzen?«, hörte ich eine Stimme aus dem Off, ignorierte sie und starrte hypnotisiert zur Bühne. Klaus hüpfte hinterm Keyboard wie ein wild gewordener Massai-Mann, ohne den Blick ein einziges Mal von den Tasten zu heben. Erwin schlug auf die Basssaiten, als ginge es um sein Leben und wippte dabei mit dem Kopf wie der Wackeldackel, der seinerzeit als Dekoration unter der Heckscheibe des ersten Escorts meiner Eltern gethront hatte. Mike, der Drummer, grinste und schickte verliebte Blicke zu seiner Freundin. Der Indianer schrubbte unablässig auf der Gitarre, wobei ihm die kohlrabenschwarze Mähne ins Gesicht fiel. Leider übertrug sich die enthusiastische Stimmung der Musiker nur langsam auf das zähe Publikum.
»Möchtest du tanzen?« Jetzt erst bemerkte ich, dass die Aufforderung an mich gerichtet war. Neben mir stand der Träger einer viel zu weiten Jeanshose, die oberhalb des Bauchnabels von einem speckigen Wildledergürtel gehalten wurde. Darin steckte ein Typ mit rot-weiß-kariertem Flanellhemd, dem nur noch die Zipfelmütze fehlte, um sich in Miniaturform nahtlos in die Reihe von Nachbars Gartenzwergen einzufügen. Weil mir, im Gegensatz zu meiner Freundin Petra, das Talent fehlte, aus solchen Situationen nonchalant mit einem »Tut mir leid, aber ich leide gegenwärtig unter einem prämenstruellen Syndrom« herauszukommen, hoffte ich inständig, dass mein Kopfschütteln ausreichen würde, ihn zu vertreiben. Tatsächlich erinnerte mich eine peinliche Sekunde später nur noch ein leichter Stallgeruch an den Gartenzwerg. Der Blick zur Bühne war wieder frei. Was es wohl für ein Gefühl wäre, auf den Brettern zu stehen, die die Welt bedeuten? Irgendetwas kribbelte in der Magengegend. Und es war nicht das Dröhnen der Bassbox. Auch nicht der Titel Moviestar von Harpo, bei dem sich die Tanzfläche bis zum Bersten füllte – fast wäre ich von meinem luftschlangendekorierten Holzpfeiler, der sich zum Gegenlehnen anbot und einen ungestörten Blick zu Bühne bot, verdrängt worden.
In der Pause deutete Klaus auf seine Armbanduhr. »Noch eine Viertelstunde bis Mitternacht. Will jemand eine letzte Zigarette mit mir rauchen?«
»Nein, danke«, erwiderte Erwin als überzeugter Nichtraucher, »aber es freut mich zu hören, dass du mit dem Rauchen aufhörst.«
»Na, dann schmeiß ich halt den Rest des Päckchens weg.«
»Moment!«, intervenierte die Gelegenheitsraucherin in mir. »Ich möchte eine retten.«
Erfreut streckte Klaus mir das Feuerzeug entgegen. Lieber hätte ich mit Winnetou eine Friedenspfeife geraucht, aber von dem war weit und breit nichts zu sehen. »Wo steckt denn euer Gitarrist?«, fragte ich, um eine gleichgültige Miene bemüht.
»Bestimmt wieder am Saufen«, antwortete Klaus, genüsslich an seiner Zigarette ziehend. Den o-förmigen Lippen entwich eine gelungene Ringelwolke, die am Holzpfeiler zerschellte, den ich während des ganzen Abends tapfer verteidigt hatte. Klaus lehnte sich auf der anderen Seite dagegen und blies eine zweite Ringelwolke in die Luft. Er schaute ihr hinterher, bis sie an der Decke verpuffte, dann sagte er: »Erwin, guck doch mal nach. Nicht, dass er uns nachher von der Bühne kippt.«
»Wieso immer ich?«, maulte Erwin.
»Weil du der Einzige bist, von dem Bernie sich was sagen lässt.«
Wenige Minuten später hatte Erwin den Winnetou im Schlepptau.
»Das ist Anna, eine Arbeitskollegin von mir«, stellte Erwin mich vor.
»Ich bin Anna, eine Arbeitskollegin von Erwin«, wiederholte ich, wie ein seniler Kakadu! Peinliche Röte stieg mir ins Gesicht, doch zum Glück war der Indianer damit beschäftigt, eine Zigarette anzuzünden, ohne sie auch nur eine einzige Sekunde aus den Augen zu lassen. Leider hielt er seinen Glimmstängel auch noch im Blick, als er das Feuerzeug zurück in die Hosentasche gleiten ließ und die Hitze in meinem Gesicht nachgelassen hatte. Im Anschluss begutachtete er intensiv seine Schuhe. Schade! Ich hätte soooo gerne seine blauen Augen bewundert.
»Ich lass euch mal kurz allein. Der Veranstalter ist gerade aufgetaucht, und ich muss dringend etwas mit ihm besprechen«, rief Erwin und überließ Winnetou das Wort, der prompt rot anlief und stotterte: »Ehm, ich bin Bernd, ehm, aber alle sagen Bernie zu mir.« Kaum hatte er den Satz beendet, inhalierte er zwei kräftige Züge und fuhr fort: »Du, ehm, arbeitest also auf dem Amt?«
»Ja. Seit etwa zwei Jahren.« Mehr fiel mir nicht ein und so schwiegen wir den Rest der Pause verlegen nebeneinander her. Als Bernie wieder auf der Bühne stand, versuchte ich vergeblich mich in sein Sichtfeld zu schieben. Jedes Mal, wenn sich unsere Augen begegneten, wechselte er schnell die Blickrichtung.
Kurz vor Mitternacht schauten die meisten Leute auf ihre Uhren. »30, 34, 32«, »nein, 28, 27 …« Die einzelnen, nichtsynchronen Rufe wuchsen zu einem Chor und pendelten sich bei »10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1« ein. PENG! BUMM! KORKENKNALLER! PROST NEUJAHR! Irgendjemand schloss einen alten Plattenspieler an die Anlage der Band an und legte Sinatra auf. Erwin zog mich auf die Bühne. Wolle versuchte, eine geschüttelte Flasche Sekt vom Korken zu befreien – in sicherem Abstand von den Instrumenten versteht sich. Mike knutschte seine Freundin. Klaus fiel mir um den Hals und drückte mich so fest, dass mir die Luft wegblieb. Und Bernie? Bernie fummelte nervös an der Gitarre, während ich mich, über Kabel und Fußpedale stolpernd, an ihm vorbei in Richtung Bühnentreppe schob und ein »Prost Neujahr« murmelte, was er ebenso scheu erwiderte. Sinatra croonte seit gefühlten zehn Minuten NEW YOOOORK, OOOORK, OOOORK, OOO … Sehr wahrscheinlich war jemand gegen den Plattenspieler gestoßen.
Zeit, das Ruder wieder in die Hand zu nehmen, beschloss die Band. Beim Rocking all Over the World von Status Quo rockte der ganze Saal.
Im letzten Set passierte etwas Außergewöhnliches: Klaus schaute öfter von seinem Keyboard auf. Vermutlich hätte ich es nicht bemerkt, wäre sein Blick nicht jedes Mal an mir hängen geblieben. Was mir auch auffiel: Hinter Bernie stand eine Kiste Bier, aus der im Laufe der nächsten Stunde mehrere Flaschen verschwanden. Dadurch endete der Abend für einige Anwesende frustrierend: Die Band war frustriert, weil Bernie ab 01:00 Uhr die Finger kaum rund bekam. Bernie war frustriert, weil die Band mit ihm frustriert war. Ich war frustriert, weil Bernie – der sich endlich traute meine Blicke selig lächelnd zu erwidern – zu viel getrunken hatte. Klaus war frustriert, weil ich nach Hause fuhr. Und Erwin war frustriert, weil Klaus nach meiner Abfahrt wieder mit dem Rauchen anfing. Damit war sein Traum eines raucherfreien Proberaumes geplatzt!
»Wohin geht die Reise?«, rief meine Mutter an jenem Sonntagnachmittag aus der Küche, als sie mich – dick eingepackt in Anorak und Handschuhen – zur Haustür schleichen sah. Eigentlich hatte ich gehofft, unbemerkt aus dem Haus zu gelangen.
»Zu Erwin!«, rief ich zurück, was nur die halbe Wahrheit war.
»Mit dem Fahrrad?«
Ich bejahte, denn ich hatte mich nicht getraut, nach dem Autoschlüssel zu fragen, weil ich befürchtet hatte, die Diskussion, die darauf üblicherweise folgte, würde dazu führen, mit dem wahren Grund der Reise herausrücken zu müssen. Der spielte nämlich Gitarre, hatte betörend blaue Augen, lange schwarze Indianerhaare und befand sich in einer Bandprobe. Sichtlich erfreut und wahrscheinlich der Meinung, ich hätte mir die Sache mit Erwin anders überlegt, rief sie:
»Nimm doch unser Auto. Wir brauchen es heute Abend nicht.«
Nicht wenig perplex nahm ich das Angebot an, und so stand ich zehn Minuten später vor einer antiken Massivholztür eines bescheidenen Herrenhauses, die beim Öffnen krächzend über den Kachelboden schleifte.
»Rechts, über den Hof, immer nur dem Krach nach«, grummelte Erwins Mutter miesepetrig. Sie schien vom Hobby ihres Sohnes nicht sonderlich angetan zu sein.
Quietschend öffnete sich die hölzerne Pforte eines Anwesens, das längst verstorbenen Nutztiergenerationen als Stall gedient hatte. Auf der rechten Seite befand sich ein nachträglich eingebautes Kabuff mit einer schmalen Holztür, die sich nur gewaltsam und durch mehrfaches Schulterrammen öffnen ließ. Die Jungs waren voll in Aktion – so auch die beiden Marshall-Türme und die Hochtöner hinterm Keyboard. Anklopfen sinnlos. Der akustische Schalldruckpegel im eierkarton-lärmgedämmten Proberaum grenzte an Körperverletzung. Vorsichtig trat ich ein. Prompt unterlag Und es war Sommer von Peter Maffay einer kurzzeitigen Temposchwankung, die der Drummer nach zwei Takten im Griff hatte.
Nach der Probe diskutierten die Jungs über bevorstehende Gigs. Bis zu diesem Tag hatte ich keine Ahnung, was das Wort bedeutete. Ich lernte, dass es sich um Auftritte handelte. Davon standen einige an der Mosel, in Luxemburg, im Saarland und Hunsrück an.
»Nehmt ihr Tramper mit?«, fragte ich. Das wäre für mich die