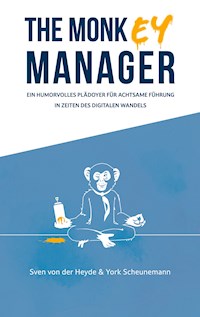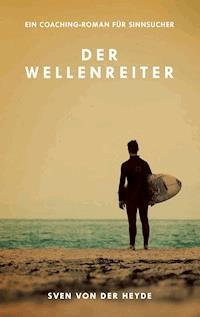
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Der 29-jährige Workaholic Felix fühlt sich ausgebrannt und leer. Er begibt sich auf eine Reise an den Ozean, um neue Kraft zu schöpfen. In der surreal anmutenden Atmosphäre einer einsamen Bucht trifft er auf den charismatischen Surf-Guru Bodhi – eine Begegnung, die sein Leben nachhaltig verändern wird. Gemeinsam finden die beiden Antworten auf die Fragen, die Felix den Weg zu seinem persönlichen Glück weisen: Wer bin ich und wofür stehe ich? Welche Werte leiten mein Denken und Handeln? Was treibt mich an? Diese wunderbare Geschichte ist eine Liebeserklärung an das Wellenreiten und regt uns auf spielerische Weise dazu an, über mehr Sinnhaftigkeit, Erfüllung und Flow in unserem eigenen Leben nachzudenken.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 129
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Danke für dein Engagement!
Jedes Jahr landen mehrere Millionen Tonnen Plastikmüll in unseren Meeren und Ozeanen.
Gemeinsam können wir unseren Beitrag dazu leisten, etwas zu verändern.
Mit dem Kauf dieses Buches unterstützt du gemeinnützige Organisationen, die sich für den Schutz und die nachhaltige Nutzung unserer Meere, Wellen und Küsten einsetzen. So fließen 50 Prozent der Autorenerlöse direkt an die Surfrider Foundation Europe und das Clean Ocean Project.
www.surfrider.eu
www.cleanoceanproject.org
Für Jannes
Ich lag auf dem Boden meines Badezimmers. Vor meinen Augen verschwammen die schwarzen Kacheln an der Wand wie Mosaiksteine, die ich vergeblich versuchte, zu einem stimmigen Gesamtbild zusammenzufügen. Je mehr ich mich darauf konzentrierte, klar zu sehen, desto stärker schmerzte mein Kopf. Mein Körper war unglaublich schwer und träge. Es war, als ob mich jemand in Blei gegossen hätte. Neben mir auf dem kalten Boden lag, eine Armlänge entfernt, mein Handy, auf dem gefühlt jede Sekunde eine neue Nachricht einging. Das ununterbrochene Aufblinken des Bildschirms trieb mich fast in den Wahnsinn.
So sammelte ich meine letzte Kraft und erreichte schließlich in Schildkrötengeschwindigkeit das Gerät, das mich 24 Stunden am Tag mit meiner Außenwelt in Verbindung hielt. Es war zum wichtigsten Gegenstand in meinem Leben geworden und auch jetzt hatte ich die Hoffnung, dass es mich aus dieser scheinbar ausweglosen Situation befreien würde.
Doch dazu musste ich ja zumindest eine Tastenkombination wählen und wissen, wen ich um Hilfe bitten wollte. Zwei Rettungssanitäter, die mich auf einer Trage aus meiner Yuppie-Wohnung im Frankfurter Westend zum Krankenwagen schleppen würden? Meine Mutter, bei der ich mich seit über einem Monat nicht gemeldet hatte? Meine Freunde, von denen keiner in dieser Stadt wohnte? All diese Optionen brachten mich in Erklärungsnöte und bereiteten mir schon jetzt ein schlechtes Gewissen.
Also rief ich die Person an, von der ich wusste, dass sie um zwei Uhr nachts genauso wie ich immer noch erreichbar war. Es klingelte drei Mal, bevor Paul den Anruf entgegennahm.
Wir hatten uns beim BWL-Studium in St. Gallen kennengelernt und vor drei Jahren bei einer renommierten Unternehmensberatung begonnen. Unsere Arbeitswoche hatte häufig 90 Stunden. Nachtschichten gehörten für uns zur Normalität. Das Tageslicht hatten wir lange nicht mehr gesehen und an Urlaub war momentan nicht zu denken. Natürlich sagten wir immer, dass wir dieses Pensum nur eine gewisse Zeit durchziehen würden, um uns in zehn Jahren zurückzulehnen und Mojitos im Sonnenuntergang zu trinken. Doch wenn ich mir jetzt vorstellte, dieses Tempo nur noch einen einzigen Tag durchhalten zu müssen, schnürte es mir die Kehle zu.
»Hi Felix, wie sieht's aus?«, fragte Paul. Dabei klang seine Stimme zwar freundlich, doch zugleich ließ er keinen Zweifel daran, dass er möglichst schnell zum Business übergehen wollte. In unserer Welt gab es keinen Platz für belanglose Einblicke in unsere Gefühlswelt, wir waren auf Effizienz getrimmt.
»Ich glaub, ich hab ein Burn-out«, erwiderte ich.
»Kenn ich«, antwortete er lachend, »hab ich seit unserem ersten Semester in St. Gallen. Wie weit bist du mit der Präsentation?«
Bis vor fünf Minuten hatte ich auf Hochtouren daran gearbeitet.
»Paul«, versuchte ich es erneut, »ich lieg hier auf dem Badezimmerboden und kann mich nicht bewegen.«
»Bist du in der Badewanne ausgerutscht oder was?«, fragte er fast herausfordernd.
Wenn ich bei einem Projekt unter besonders großem zeitlichen Druck stand, ging ich manchmal nachts vom Schreibtisch direkt ins Bad, sprang unter die Dusche und tat so, als ob ich geschlafen hätte. Es war ein mentaler Trick, um dem Körper einige Stunden erholsamen Schlaf vorzugaukeln.
Paul schien den Ernst der Situation jedoch nicht zu begreifen. Für ihn – und bis vor ein paar Minuten auch für mich – musste es einen einwandfreien und sichtbaren Grund geben, warum kurzfristig einer von uns beiden außer Gefecht gesetzt war. Dazu zählten zum Beispiel eine Haiattacke, ein Terroranschlag und vielleicht ein gebrochenes Bein nach einem Badewannenunfall. Eine körperliche Lähmung, die durch einen mentalen Erschöpfungszustand verursacht wurde, passte nicht in unser Selbstbild.
Also sagte ich schließlich: »Ja, Mann, ich hab mir ein Bein gebrochen, komm mal rüber!«
***
15 Minuten später schloss Paul mit meinem Zweitschlüssel die Wohnungstür auf. Vor einigen Wochen hatte ihn seine Freundin verlassen und so hatte er zahlreiche Nächte auf meiner Couch verbracht. Den Schlüssel besaß er zum Glück immer noch. Als er mich auf dem Boden liegen sah, schüttelte er nur den Kopf.
»Das sieht erbärmlich aus, Alter! Versuch, dich mal irgendwie hochzuziehen!«
»Wenn ich das schaffen würde, hätte ich dich wohl kaum angerufen«, brach es aus mir heraus.
Paul machte keine Anstalten, mir zu helfen, und setzte sich stattdessen neben mich auf die Kloschüssel. Seine kräftigen schwarzen Haare waren ein wenig zerzaust, doch wirkte er überhaupt nicht müde. Er gehörte zu den beneidenswerten Menschen, die trotz hoher Arbeitsbelastung immer topfit aussahen. Als er nach kurzer Zeit merkte, dass ich unser gewohntes Spiel von coolen Sprüchen und halb spielerisch, halb ernst gemeintem verbalen Kräftemessen nicht mitspielte, verstand er, wie es um mich bestellt war.
»Vielleicht hast du recht«, sagte er schließlich sichtlich betroffen. »Und es ist tatsächlich ein Burn-out.«
Ich wusste nicht, ob ich erleichtert darüber sein sollte, dass er es endlich verstanden hatte, oder niedergeschlagen, weil meine laienhafte Diagnose von ihm bestätigt worden war.
»Aber dein Bein«, fügte er hinzu, »scheint in Ordnung zu sein. Du fliegst jetzt für eine Woche in das Haus meiner Eltern nach Südspanien in die Sonne und lädst die Akkus auf. Zu deinem 30. Geburtstag am nächsten Freitag bist du wieder hier. Wir schmeißen eine dicke Party und am Montag starten wir wieder durch.«
So tickten wir Berater. Wenn jemand anderes ein Problem hatte, fanden wir innerhalb kürzester Zeit eine Lösung. Noch bevor ich etwas erwidern konnte, hatte sich Paul bereits meinen Laptop geschnappt und suchte nach passenden Flügen für mich.
***
Nur 18 Stunden später saß ich am Frankfurter Flughafen. Nicht, wie gewöhnlich, im frisch gereinigten Anzug, sondern leger gekleidet zwischen gut gelaunten Touristen. Paul hatte mich in der Nacht wie ein kleines Kind in mein Bett getragen und dann am nächsten Morgen weitere Details meiner Reise geplant. Als ich am Nachmittag aus meinem komatösen Schlaf erwacht war, hatte er bereits meinen Koffer gepackt und ein kleines Dossier mit allen wichtigen Reiseunterlagen in meine Laptoptasche gesteckt. Mit leichtem, wohlwollenden Zwang hatte er mich in ein Taxi verfrachtet und so war mir nichts anderes übrig geblieben, als mich zu fügen. Der Schlaf hatte mir ein wenig Energie zurückgebracht und so konnte ich mich zumindest wieder im Schneckentempo bewegen und ein Bein vor das andere setzen.
Ich verspürte jedoch eine große innere Leere und auf meine Mitmenschen musste ich ein ziemlich jämmerliches Bild abgeben. Apathisch und noch leicht benommen stand ich erst von meinem Sitz auf, als die Stewardess zum dritten Mal die Fluggäste darauf aufmerksam machte, dass das Flugzeug nach Jerez de la Frontera nun zum Einsteigen bereit sei.
Als mich die Schubkraft der Turbinen beim Start in den Sitz drückte und ich realisierte, dass ich in diesem Zustand alleine eine Reise antreten sollte, erfasste mich ein Gefühl der panischen Hilflosigkeit. Meine Sitznachbarin, eine ältere, sehr elegant gekleidete Dame, bemerkte meine Panikattacke und fragte mich einfühlsam, ob ich an Flugangst leide. So, wie ich Paul erzählt hatte, dass ich mir ein Bein gebrochen hätte, wählte ich auch in dieser Situation den einfachsten Weg und bejahte ihre Frage. Auf diese Weise konnte ich wenigstens noch mein Gesicht wahren. Doch als mir einige Minuten später die Tränen über die Wangen liefen, war auch ihr klar, dass es sich in meinem Fall um mehr als Flugangst handeln müsste.
»Junger Mann«, sagte sie mit ihrer sanften Stimme, »ich weiß zwar nicht, warum es Ihnen so schlecht geht und es geht mich auch eigentlich nichts an. Aber lassen Sie mich Ihnen einen Rat geben. Suchen Sie sich Hilfe! Es gibt Momente im Leben, in denen selbst die Stärksten von uns jemanden an ihrer Seite benötigen. Jemanden, der uns auf den rechten Weg zurückführt und uns hilft, die eigenen Heilungskräfte zu aktivieren.«
Mit ihren weisen Augen blickte sie mich dabei liebevoll an und drückte meine Hand. Sie erinnerte mich an meine verstorbene Großmutter. Ich fühlte mich in eine ferne Zeit zurückversetzt und ich hätte schwören können, dass der liebliche Geruch von Pfannkuchen für einen winzigen Augenblick durch das Flugzeug zog. Wenn es mir als kleines Kind schlecht ging, hatte meine Großmutter immer gesagt, dass Schlaf die beste Medizin sei und so ließ ich mir von der Stewardess einen Whiskey bringen und schloss die Augen.
Ich wachte erst wieder auf, als mich meine Sitznachbarin am Ärmel zupfte und auf die leeren Sitzreihen vor und hinter uns verwies.
»Wir sind da«, sagte sie. »Ich wünsche Ihnen eine gute Reise. Und denken Sie an meinen Rat!«
Während ich am Gepäckband auf meinen Koffer wartete, blickte ich in die Reiseunterlagen, die mir Paul mitgegeben hatte. Er hatte einen Mietwagen reserviert und mir die Wegbeschreibung zum Haus seiner Eltern ausgedruckt. Es lagen noch zwei Stunden Autofahrt vor mir und es war bereits elf Uhr abends. Also holte ich mir einen starken spanischen Kaffee und verließ eine halbe Stunde später den Flughafen in meinem Mietwagen gen Norden.
Bereits nach 50 Kilometern merkte ich, wie ich zu blinzeln begann. Doch auch der Energydrink, den ich mir daraufhin an einer Tankstelle kaufte, ließ in seiner Wirkung relativ bald nach. Wie in Trance steuerte ich auf die nächste Ausfahrt zu. Ich war so müde, dass ich nicht mehr in der Lage war, die Schrift auf den Schildern zu entziffern. Nur das Wort Playa konnte ich noch erkennen.
Wie ein verdurstender Reisender in der Wüste mit letzter Kraft eine Oase erreicht, gelangte ich schließlich an einen kleinen, verlassenen Parkplatz am Strand. Ich stolperte aus dem Auto und sog die frische Meeresluft ein. Wie lange hatte ich nicht mehr das Rauschen des Ozeans gehört? Auf einem kleinen Weg taumelte ich zum Strand und ließ mich in den Sand fallen. Die Sterne funkelten am Himmel und mein letzter Gedanke, bevor ich die Augen schloss, war, dass meine Sorgen im Vergleich zu den unendlichen Weiten des Universums ziemlich unbedeutend sein mussten.
Mit den ersten Sonnenstrahlen am Morgen erwachte ich aus meinem Albtraum. Ich hatte in einem Schlafanzug in einem Büroraum gestanden und einen zusammenhangslosen Wust an Zahlen vor edel gekleideten Klienten präsentiert. Am Ende meiner Präsentation hatte der Mann mit Nickelbrille gesagt: »Das war die schlechteste Performance, die ich je gesehen habe! Sie können jetzt gehen.«
Es war ein immer wiederkehrender Albtraum, der in den vergangenen Wochen zu meinem treuen Begleiter in der Nacht geworden war. Mein Rezept gegen diesen Quälgeist waren noch weniger Schlaf und Tabletten gewesen. Es hatte offensichtlich keine positive Wirkung gezeigt.
Ich schüttelte mich kurz und blickte aufs Meer. Nebelschwaden verhüllten die Sicht und erzeugten eine fast surreale Stimmung. Die Wellen waren bestimmt dreieinhalb Meter hoch und glichen geraden Linien, die in gleichmäßigen Abständen in die Bucht rollten. Der Wind wehte sanft vom Land und sorgte dafür, dass die Wellen sich steil auftürmten und erst sehr nah am Strand brachen. Einige Vögel flogen knapp über der Wasseroberfläche entlang und verschwanden schließlich aus meinem Blickfeld. Es war ein paradiesisch anmutender Ort, dessen Schönheit mich sofort ergriff und meinen Albtraum durch einen Tagtraum ersetzte.
Plötzlich schoss aus einem Wellentunnel nicht weit entfernt von mir eine Gestalt heraus. Ich rieb mir verwundert die Augen. Es war ein Wellenreiter, der auf seinem Surfboard scheinbar mühelos diese Berge aus Wasser abritt. Doch wo war er auf einmal hergekommen und wie konnte es sein, dass ich ihn bisher nicht wahrgenommen hatte? Neugierig fokussierte ich meinen Blick auf den Surfer, der nun wieder aufs Meer hinaus paddelte. Sein wasserstoffblondes Haar war auch von Weitem zu erkennen. Mit seinem Brett tauchte er unter den heranrollenden Wellen hindurch, nur um kurz darauf die nächste Welle zu surfen. Er schien eins zu sein mit dem Element Wasser. Es war ein fantastischer Anblick und ich hätte ihm stundenlang nur zuschauen können.
Mit einem besonders gewagten Manöver surfte er seine letzte Welle bis zum Strand, klemmte sich sein Brett unter den Arm und kam auf mich zu. Er hatte einen durchtrainierten Körper und nur die Falten um seine leuchtenden Augen verrieten sein fortgeschrittenes Alter. Er wirkte wie eine Lichtgestalt, die den Fluten entsteigt und den Zuschauer allein durch seine inspirierende Ausstrahlung dazu ermutigt, eine bessere Version seiner selbst zu sein.
»Ein herrlicher Morgen«, sagte er mit einer tiefen, sanften Stimme und ließ sich dabei neben mir im Sand nieder. Mit seinen ozeanblauen Augen schaute er mich an und fragte: »Wer bist du?«
Hätte mir eine andere Person diese Frage gestellt, hätte ich wahrscheinlich routinierten Smalltalk betrieben und etwas Belangloses geantwortet. Doch etwas in der Stimme und im Blick des Wellenreiters ließ mich erahnen, dass er keine schnelle und oberflächliche Antwort auf seine Frage erwartete. Demonstrativ richtete er seinen Blick von mir zum Meer und gab mir Zeit zum Überlegen.
»Ich bin Felix«, brachte ich endlich heraus. »Ich weiß momentan, um ehrlich zu sein, weder, wer ich bin, noch, wer ich sein möchte.«
Meine Ehrlichkeit überraschte mich selbst. Wie kam ich dazu, mich einem Fremden so zu offenbaren?
Weise lächelnd entgegnete er: »Das sind sehr gute Voraussetzungen.«
Verständnislos blickte ich ihn an.
»Selbsterkenntnis, so sagten schon die alten Griechen, ist der erste Schritt zur Entfaltung der eigenen Persönlichkeit. Wenn du weißt, dass du nichts weißt, bist du schon wesentlich weiter als die Mehrheit der Menschen.«
Der Surfer schien nicht nur ein Meister in den Wellen zu sein, sondern auch ein Philosoph. »Und wer bist du?«, fragte ich ihn neugierig.
»Die Leute in der Region nennen mich Bodhi.«
Ich musste unweigerlich an den Film Gefährliche Brandung denken, der mich als Jugendlicher sehr beeindruckt hatte. In dem Film geht es um einen spirituell angehauchten Surf-Guru namens Bodhi, der nebenbei Banken ausraubt und so seinen Lebensstil finanziert. Bodhi steht für die Kurzform des sanskritischen Namens Bodhisattwa, der Erleuchtete. Ich konnte verstehen, warum man den Wellenreiter, der neben mir im Sand saß, so nannte.
»Warum bist du hier?«, fragte er.
Wieder hatte ich das Gefühl, dass es ihm nicht nur um die Geschichte der vergangenen 48 Stunden, sondern um eine Erklärung von größerer Bedeutung ging. Warum bin ich auf dieser Erde, hat mein Leben sogar so etwas wie einen übergeordneten Sinn?
Als ich wieder mit meiner Antwort zögerte, fügte er hinzu: »Weißt du, diese Bucht ist ein magischer Ort. Er zieht Sinnsucher wie dich auf unerklärliche Weise an und lässt sie meistens erst gehen, wenn sie für sich stimmige Antworten auf diese Fragen gefunden haben.«
Das war mir nun doch ein wenig zu dick aufgetragen. Nicht nur er selbst sollte quasi ein Heiliger sein, auch die Bucht sei nun angeblich mit einer speziellen Energie aufgeladen. Auf einmal erfasste mich wieder diese innere Unruhe, die ich nur allzu gut kannte. Am Strand herumzusitzen und unproduktiv über das Leben zu philosophieren, war nicht mein Ding. Schließlich musste ich ja auch noch zu meinem Zielort weiterfahren. Nervös spielte ich mit meinen Füßen im Sand.
Bodhi brauchte keine Sekunde, um mein plötzlich aufkommendes Unbehagen zu deuten, und sagte: »Tut mir leid, dass ich dich hier am frühen Morgen so überfallen habe. Es hat mich sehr gefreut, dich kennenzulernen.«
Noch bevor ich etwas entgegnen konnte, war er bereits auf dem Weg zum Meer und stürzte sich mit seinem Brett erneut in die Wellen. Verwirrt stand ich auf und ging den kleinen Weg zum Parkplatz hinauf. Was für eine seltsame Begegnung, dachte ich.