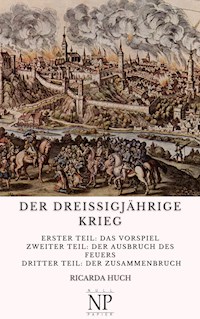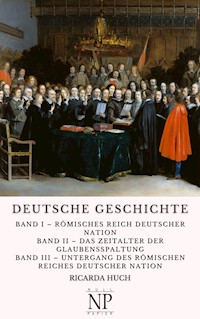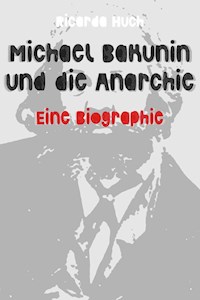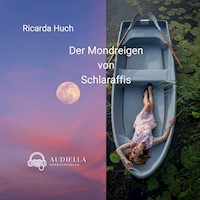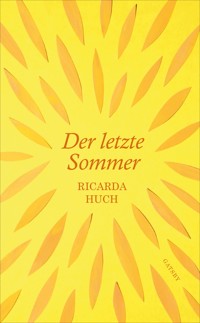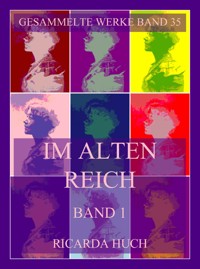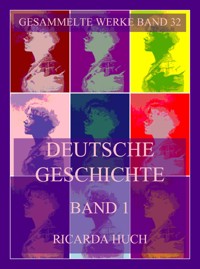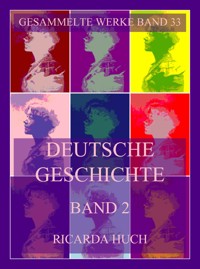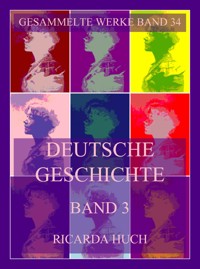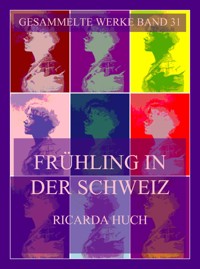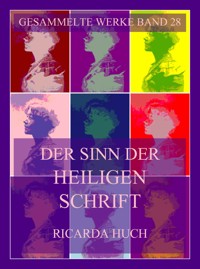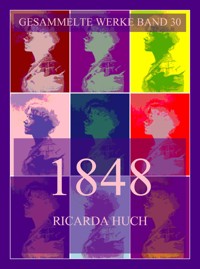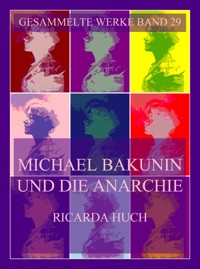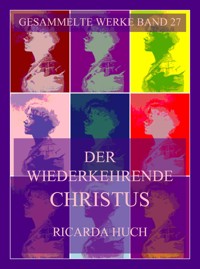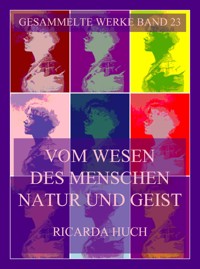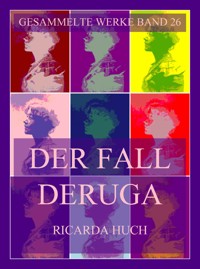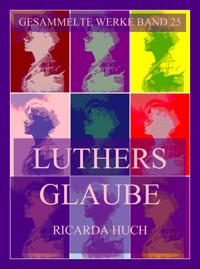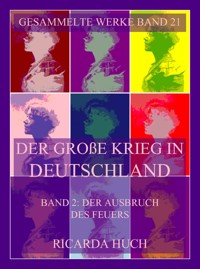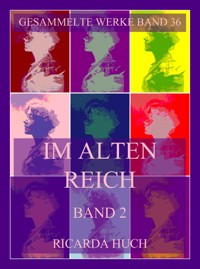
7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Jazzybee Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Die deutschen Städte – pulsierende Zentren des Handels, Schauplätze religiöser Kämpfe, Wiegen bürgerlicher Freiheit und künstlerischer Blüte. In ihrem monumentalen Werk mit fast 70 Bildern dieser Städte erweckt Ricarda Huch das urbane Leben unserer Heimat zu neuem Leben. Mit der Kunst einer großen Erzählerin und dem Scharfsinn einer brillanten Historikerin führt uns Huch durch die Gassen und über die Marktplätze von Nürnberg, Augsburg, Lübeck, oder Köln, und uns teilhaben am Alltag der Handwerker und Kaufleute, an den Intrigen der Ratsherren, an den Konflikten zwischen Zünften und Patriziern. Wir erleben die Städte als Orte, wo sich die großen Umwälzungen der Zeit – Reformation, Glaubenskriege, wirtschaftlicher Wandel – im konkreten Leben der Menschen widerspiegeln. Aber Huchs "Lebensbilder" sind weit mehr als historische Darstellung: Sie sind literarische Porträts voller Atmosphäre und psychologischer Tiefe, die uns die Vergangenheit unmittelbar erfahrbar machen. Ob sie von den stolzen Hanseaten erzählt, von den kunstsinnigen Augsburger Fuggern oder vom freiheitsliebenden Geist der Reichsstädte – stets verbindet sie historische Präzision mit erzählerischer Lebendigkeit. Ein unvergleichliches Panorama deutschen Stadtlebens zwischen Mittelalter und Neuzeit – geschrieben von einer Autorin, die wie keine andere Geschichte zum Leben erwecken konnte. In dieser zweibändigen Ausgabe finden sich auch die Beschreibungen, die sonst typischerweuse nicht beinhaltet sind. Dies ist Band 2 mit 35 Bildern.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 543
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Im alten Reich
Lebensbilder deutscher Städte, Band 2
RICARDA HUCH
Im alten Reich, Band 2, R. Huch
Jazzybee Verlag Jürgen Beck
86450 Altenmünster, Loschberg 9
Deutschland
ISBN: 9783988682536
www.jazzybee-verlag.de
INHALT:
Gelnhausen. 1
Friedberg in Hessen. 7
Limburg. 16
Wetzlar22
Hersfeld. 33
Marburg. 40
Fritzlar48
Hannoversch-Münden. 52
Erfurt58
Halle. 72
Zerbst85
Bautzen. 90
Görlitz. 96
Breslau. 108
Überlingen. 115
Die Reichenau. 120
Freiburg im Breisgau. 124
Würzburg. 134
Wertheim... 142
Schwäbisch Hall146
Schwäbisch Gmünd. 157
Ochsenfurt165
Maulbronn. 169
Esslingen. 175
Rottweil183
Dinkelsbühl191
Nördlingen. 197
Amberg. 212
Regensburg. 218
Straubing. 231
Innsbruck. 237
Hall in Tirol245
Bern. 251
Luzern. 262
Estavayer273
Gelnhausen
Kaiser Barbarossa hatte bei der alten Reichsstadt Gelnhausen eine Pfalz, wo er sich gern aufhielt, von einer wunderschönen Geliebten, die Godula hieß, gefesselt. Nah bei der Pfalz war damals ein kleiner See, von Erlen und Birken umgeben, der voll bunter Fische war; sie schimmerten wie Edelsteine milchweiß, silbern, bläulich und rosenrot. Das Volk getraute sich nicht, sie zu fangen, weil ein Nöck im See hauste: der stieg oft aus dem Wasser, setzte sich ans Ufer und spielte auf seiner Harfe. Er hatte langes, schilfiges Haar und grüne Augen und tat niemandem etwas zuleide. Die schöne Godula hatte große Freude an den Fischen und belustigte sich damit, ihnen Brot zuzuwerfen und zuzusehen, wie sie danach schnappten; besonders einen roten, der wie eine Feuerflamme durch das Wasser zuckte, gewann sie lieb, und wenn sie ihn einen Tag lang nicht gesehen hatte, wurde sie traurig. Da, eines Tages, als er langsam, langsam ans Ufer geschwommen kam, sah sie, dass Blutstropfen aus seinen Schuppen quollen, und nach einigen Minuten war er tot und versank in die Tiefe. Die schöne Godula verfiel in Traurigkeit und starb nach drei Tagen; seitdem mochte Kaiser Barbarossa nicht mehr in der Pfalz verweilen, ritt hinweg und kam nie wieder nach Gelnhausen.
Diese seltsame Sage raunt von der dämonischen Macht der Elemente und der elementarischen Leidenschaften über das, was der bewusste Mensch hervorbringt. Unaufhörlich ringen sie mit ihm um sein Werk, das sie lieben und an dem sie Anteil haben; Feuer und Wasser wühlen und nagen daran, der Sturm erschüttert es und die Erde wächst darüber hin. Gras und Blumen dringen aus der geborstenen Mauer, das Moos kriecht daran herauf, der Purpur des Efeu umhüllt sie. Nicht mehr widerhallt sie vom Klirren der Waffen oder vom Gebet der Mönche oder vom Sausen des Spinnrads, nicht mehr begrüßt das Horn des Wächters den Morgen von der Zinne; aber die Musen rauschen daran vorüber mit unsterblichen Gesängen.
In früherer Zeit ließen die Menschen gebrochene Burgen, abgebrannte Klöster und Kirchen verfallen und in die Erde verbröckeln, wenn sie nicht etwas Neues darüber errichteten oder die brauchbaren Trümmer zu anderen Bauwerken verwendeten. So ging es auch mit der alten Pfalz von Gelnhausen; wer in der Stadt etwas baute, holte sich das Material dazu aus der herrenlosen Burg, wo es nichts kostete. Dem machte die preußische Regierung ein Ende: das denkwürdige Gebäude wurde gesäubert und instand gesetzt, wissenschaftlich untersucht und angeordnet, der Zugang versperrt und die Besichtigung nur in Begleitung eines Aufsehers gestattet. Das war dankenswert und notwendig, wenn überhaupt noch die Ruine erhalten bleiben sollte; aber schöner muss es damals gewesen sein, als noch der Zauber der Insel ungehindert in die verfallende Pfalz hineinwuchs, als das Gestrüpp die klagenden Figuren verschlang, die einst Säule und Gesims schmückten, und ein Klang von Harfe oder Tränen über das Wasser rieselte.
Auch die aufgeräumte Pfalz ist noch herrlich und ergreifend, ein Stück Vergangenheit, das der Kinzigfluss und ein Dickicht von Schwarzpappeln und Wasserweiden von der rastlos veränderlichen Zeit abtrennen. Die Welt bleibt hinter einem zurück, wie wenn man eine Kirche betritt, obwohl man ihr Walten hier wie dort spürt. In der Vorhalle werden besonders wertvolle Trümmerstücke aufbewahrt, und es finden sich da Adler als Schmuck an Säulenkapitellen, die mit überraschender Kunstfertigkeit und Sorgfalt gearbeitet sind. Den Hauptteil des Erhaltenen bildet der Festsaal, zu dem man über eine Treppe hinaufsteigt, wo der mächtigste Fürst des Abendlandes seine Gäste versammelte, mit dem Bogenfenster, wo er und seine Gattin Beatrix von Burgund standen und die Bürger von Gelnhausen grüßten. Es befinden sich dort die Reste eines Kamins mit orientalischem Muster, wie es die Kreuzzüge nach dem Westen gebracht hatten. Orientalisch mutet auch das rätselhafte Haupt mit dem langen geflochtenen Bart an, das jetzt außen über dem Portal des Pallas angebracht ist, und das Schenkendorf als das des großen Friedrich besang. Von dem übriggebliebenen Turm überblickt man die Stadt und das wellige Land und den Büdinger Forst, der als Jagdgrund die Gegend dem Kaiser lieb machte.
Lange vor den Hohenstaufen, schon zur Zeit der Merowinger, soll sich da, wo jetzt Gelnhausen liegt, ein Dorf befunden haben und auch eine Burg, die den Grafen von Gelnhausen gehörte. Erst Barbarossa jedoch erhob die alte Siedlung zur Stadt, errichtete eine neue Burg, besetzte sie mit Burgmannen und unterstellte sie einem Burggrafen, den er belehnte. Den Burggrafen als Vögten des Büdinger Waldes waren erblich belehnte Forstmeister beigegeben; aus ihnen ging die Familie derer von Forstmeister hervor, die eine Wolfsangel im Wappen führten, eine Erinnerung an die Zeit, wo Wölfe im Büdinger Forst gejagt wurden. Für den Kaiser, der bisweilen, um zu jagen, in die Burg kam, musste der Forstmeister einen weißen Bracken mit herabhängenden Ohren bereithalten, der auf einem seidenen Kissen liegen sollte; auch sein Leitseil sollte von Seide, sein Halsband von vergoldetem Silber sein. Ferner musste für den Dienst des Kaisers ein weißes Rossa da sein, eine Armbrust aus, Ebenholz und ein Pfeil mit silberner Spitze, befiedert mit Straußen- und Pfauenfedern. Im Jahre 1180 wurde in Gelnhausen auf sehr besuchtem Reichstag die Acht über Heinrich den Löwen ausgesprochen; anwesend waren die Erzbischöfe von Magdeburg, Köln, Trier und Salzburg, Landgraf Ludwig von Thüringen, Markgraf Otto von Brandenburg, die Äbte von Fulda und Hersfeld, viele Bischöfe und der älteste Sohn des Kaisers, Herzog Friedrich von Schwaben, dessen Verlobung mit einer Tochter des Königs von Ungarn damals gefeiert sein soll. Fünfzehn Jahre später wurde auf einem Reichstag in Gelnhausen über den Kreuzzug beraten, von dem Barbarossa nicht zurückkehrte. Auch die späteren Kaiser haben sich in Gelnhausen aufgehalten: Heinrich VI., Philipp von Schwaben, Friedrich II. und sein Sohn Heinrich, Konrad IV., Rudolf von Habsburg, Albrecht I., Heinrich VII., Ludwig der Bayer und Ruprecht von der Pfalz. Damals jedoch war die Blüte der Stadt bereits vorüber.
Wenn je eine, so war die Wiege der Stadt Gelnhausen mit verheißungsvollen Patengeschenken ausgestattet. Der große Hohenstaufe, der die Zeit Karls des Großen, Ottos I., Heinrichs III. erneuerte, war ihr Gründer, Beschützer und Freund und verlieh ihr wertvolle Freiheiten; er befreite sie von allen Handelszöllen an allen kaiserlichen Plätzen und Zollstellen und bestimmte, dass nur die Kaiser selbst oder kaiserliche Beamte in der Stadt Gericht halten sollten, womit sie zur Reichsstadt erhoben war. Da sie auf Reichsboden entstanden war, hatten ihre Bürger nur dem Kaiser einen Arealzins zu leisten und durften ihre Häuser und Besitzungen ihren Erben überlassen, wenn diese den Zins weiterbezahlten. Die folgenden Kaiser fuhren fort, Gelnhausen mit allerlei Rechten und Freiheiten zu begaben, so dass die Stadt am Ende des 18. Jahrhunderts deren mehr als vierzig besaß. Darunter war ein Privileg Heinrichs VI., das sie von allen Zöllen im Reich befreite, das wichtige Privileg de non evocando von Rudolf von Habsburg, das wichtige von Kaiser Sigismund, es dürfe auf eine Meile Wegs von Gelnhausen keine neue Burg errichtet werden. Sämtliche Privilegien wurden von allen Kaisern bis auf Joseph I. bestätigt. Nicht viele Reichsstädte führten ein ebenso pompöses Siegel: die Brustbilder Kaiser Friedrichs I. und seiner Frau Beatrix in einem Doppelbogen mit der Umschrift: Sigillum sculteti et civium de Gellnhausen. Der Bogen deutet das romanische Fenster in der Burg an, von dem aus das Kaiserpaar auf die erblühende Stadt hinabgesehen hatte.
Die kaiserlichen Gnaden konnten nicht ersetzen, was Natur und Geschichte versagt hatten; hier war kein Strom, kein alter Handelsweg, kein günstig zu verwertendes Erzeugnis, und auch auf diese kleine Schwesterstadt warf Frankfurt einen drückenden Schatten.
Die Verbindung mit der Pfalz wurde für Gelnhausen nicht so verhängnisvoll wie für Friedberg; denn es war zwar mit dem Burggrafenamt ein Reichsgericht über die Umgegend verbunden, aber rechtlichen Einfluss auf die Stadt hatten die Gelnhauser Burgmannen nicht und scheinen ihn auch nicht angestrebt zu haben. Sie bildeten wie auch in Friedberg eine Ganerbenschaft, d. h. eine zusammen lebende und gemeinsam erbende Genossenschaft, und unter standen einem Burggrafen, der vom Kaiser belehnt, in späteren Jahrhunderten von den Burgmannen gewählt wurde. Anfangs wohnte eine Reihe von adeligen Familien in der Stadt, so die von Breidenbach, die von Trimbach, die von Bünau, die von Grimmelshausen, die von Füßchen. Einer aus der Familie von Grimmelshausen hat diesen Namen unsterblich gemacht. In anderer Weise leben die Schelme von Bergen in der Literatur fort: zwei Dichter, Heine und Simrock, haben die Sage von der Herkunft dieses Geschlechtes in reizvollen Romanzen erzählt. In dem maskierten Tänzer, dessen schlanker Wuchs und edle Bewegung alle Augen auf sich zog und die Kaiserin bewog, den ganzen Abend mit ihm zu tanzen, erkennt die Frankfurter Hofgesellschaft, als er auf den bestimmten Wunsch der Herrin die Maske fallen lässt, mit Entsetzen den Scharfrichter von Bergen. Sein Leben scheint verspielt; aber Kaiser Friedrich weiß einen besseren Ausweg und schlägt den Verwegenen, der die Kaiserin zum Tanze geführt hat, als Schelm von Bergen zum Ritter. Eine andere Fassung der Sage ist so, dass Barbarossa eines Tages, als er sich bei der Jagd im kaiserlichen Forst Dreieich bei Frankfurt verirrt hatte, zu einem Karrenführer aufstieg, den er unterwegs als den Scharfrichter von Bergen kennen lernte. Die Schelme führten als Wappen zwei rote Rippen im silbernen Feld und einen roten feuerspeienden Drachen als Helmzierde. Ihre Stammburg lag in Bergen nah bei Frankfurt und dort war auch eine Kirche mit ihrem Erbbegräbnis, die 1600 durch Feuer zerstört und im Anfang des 19. Jahrhunderts ganz niedergelegt wurde. Es gab Schelme von Bergen in Friedberg, Gelnhausen und noch anderen Ganerbenhäusern. Die Bergener Linie starb 1768 aus, von denen von Gelnhausen lebte im Anfang des 19. Jahrhunderts noch Christian, Hauptmann der freien Stadt Frankfurt, der keine Söhne hatte.
Die meisten von diesen Namen verschwanden allmählich aus der Stadt, um unter den Burgmannen wieder zu erscheinen. Insofern also wurde die Stadt Gelnhausen durch die Pfalz beeinträchtigt, als diese ihr die reichen und vornehmen Familien entzog. Eine fast nur aus Bauern und Handwerkern bestehende Stadt war nicht entwicklungsfähig; es bedurfte der Reibung, des Kampfes, mehr noch des Reichtums und vor allen Dingen der größeren Gesichtspunkte und der stärkeren Leidenschaften dieser Familien, ihres Ehrgeizes und ihrer Herrschsucht. Aus irgendeinem Grunde aber müssen wohl die Bewohner von Gelnhausen, Bürger wie Ritter, weniger tätig, weniger unternehmend gewesen sein als z. B. die von Friedberg. Die Anwesenheit der vielen hochgestellten Personen, die die Reichstage herbeizogen, belebten anfangs den Markt und brachten Arbeit und Verdienst mit; seitdem die Kaiser seltener und schließlich gar nicht mehr kamen, trat ein Stillstand ein und begann auch die Pfalz zu verfallen. Bewohnte ein Kaiser die Pfalz, musste für seine Verpflegung und für die Erfüllung der verschiedenen Auflagen gesorgt werden, musste die Pfalz in gutem wohnlichen Stand sein; da die kaiserlichen Besuche wegfielen, hatten die Burgmannen, die die Vorburg, nicht die Burg selbst bewohnten, an ihrer Erhaltung kein Interesse mehr. Schon am Ende des 14. Jahrhunderts beklagte sich König Wenzel über ihren Verfall.
Der Stadt hätte die dauernde Abwesenheit der Kaiser einen Aufschwung bringen können, wie das bei den meisten anderen Reichsstädten der Fall war, deren große Zeit im Interregnum begann. Auch Gelnhausen nahm an den Städtebündnissen teil, wurde insbesondere ein Glied des Bundes der vier wetterauischen Städte. Im Jahre 1285 vereinigten sich Frankfurt, Wetzlar, Friedberg und Gelnhausen zum ersten Male, um dann den Bund von Zeit zu Zeit zu erneuern. Sie wurden als Eidgenossenschaft so anerkannt, dass ihnen meistens gemeinsam von den Kaisern die gleichen Privilegien erteilt wurden. Frankfurt war ihr Vorort, Gelnhausen ihr schwächstes Mitglied. Auch Friedberg und Wetzlar haben dem wirtschaftlichen Aufstiege Frankfurts nicht folgen können, dem seine Sterne eine glanzvolle Zukunft bestimmt hatten. In der Mitte des 13. Jahrhunderts war Frankfurt noch so wenig bedeutend, dass König Wilhelm es mit Gelnhausen zusammen verpfändete; er nahm aber diese von den Städten gefürchtete und gehasste Maßregel zurück, indem er zugleich versprach, sie nicht zu wiederholen. Karl IV. indessen, ein schlechter Mehrer des Reichs, bediente sich mit Vorliebe dieses Mittels, um zu Gelde zu kommen, und verpfändete zuerst Gelnhausen und Friedberg an den Grafen Kraft von Hohenlohe und später Goslar und Nordhausen an den Grafen von Schwarzburg. Den letztgenannten Städten gelang es, sich selbst aus der Pfandschaft zu lösen, nicht so Gelnhausen, bei dem sich mit der wirtschaftlichen Schwäche noch das unkluge und allzu bequeme Vertrauen auf das Versprechen der Wiedereinlösung verband.
Zum Glück für die Stadt verkaufte der Graf von Schwarzburg das Pfand an den Kurfürsten Ludwig von der Pfalz und den Grafen Reinhard von Hanau, von dem es im Jahre 1736 als Erbschaft an den Landgrafen von Hessen-Kassel fiel. Trotz seiner Ohnmacht hielt Gelnhausen unerschütterlich an seinem Charakter als freie Reichsstadt fest. Als kurz vor Beginn des Dreißigjährigen Krieges der damalige Graf von Hanau sich in die inneren Angelegenheiten Gelnhausens einmischte, beschwerte sich die Stadt beim Kaiser Matthias, der es auch nicht an einem gespreizten Urteil fehlen ließ, in dem er der Pfandherrschaft, die sich nicht daran kehrte, aufgab, sich der Vergewaltigungen zu enthalten und der Stadt den erlittenen Schaden zu vergüten. Nach dem Kriege warf sich Leopold I. noch einmal zum Vertreter des Reichs und Herrn der Reichsgüter auf und schickte einen Kommissar zur Entgegennahme der Huldigung nach Gelnhausen. Die Grafen von Hanau verboten bei tausend Gulden Strafe, die Huldigung zu leisten, doch verzweifelten die Gelnhauser nicht an ihrer guten Sache, riefen die Entscheidung des Hofgerichts an und huldigten nach erfolgtem günstigem Spruch. Die Reichszugehörigkeit machte sich nur dadurch bemerkbar, dass Gelnhausen aufgefordert wurde, die Reichssteuer zu leisten, welche dem Kurfürsten von Trier zur Unterhaltung der Reichsfestungen Koblenz und Ehrenbreitstein zugewiesen war. Gelnhausen war bereit, sie als Zeichen seiner Freiheit zu zahlen; aber gegen das Militär des Pfandherrn waren die Stadt sowohl wie der Kaiser machtlos.
Etwa hundert Jahre später unterschrieb eine Anzahl Bürger, nicht alle, eine Urkunde, in der sie versprachen, auf die Fortführung des Prozesses zu verzichten und der Pfandherrschaft den schuldigen Gehorsam zu leisten; aber noch nachdem durch den Reichsdeputationshauptschluss Gelnhausen dem nunmehrigen Kurfürstentum Hessen einverleibt worden war, wagte ein Teil der Bürgerschaft Widerspruch, der durch einrückende hessische Truppen unterdrückt wurde.
Als Simplizissimus während des Dreißigjährigen Krieges nach Gelnhausen kam, fand er die Tore offen, wie wenn es leer wäre, und wo sie durchlöchert waren, mit Mist verschanzt. Er ging ein paar Steinwürfe in die stille Stadt hinein und begegnete niemandem; nur ein paar Tote lagen auf der Straße, von denen einige nackt waren. Da grauste es ihn, und er kehrte um. Von der Befestigung sind noch Mauern, Tore und Türme erhalten.
Der Hexenturm erinnert an die vielen Frauen, die als Hexen in Gelnhausen verbrannt sind. Besonders ein Bürgermeister Koch machte sich durch eifriges Hexenbrennen einen Namen und entsprach damit, wie es scheint, dem Bedürfnis der Bürgerschaft; denn als damit nachgelassen wurde, beschwerten sie sich darüber beim Rat und forderten zu besserer Ausrottung der Zauberer und Hexen auf, die ihnen den Wein, die Baum- und Feldfrüchte verderbten. Die Bewohner von Gelnhausen waren augenscheinlich Ackerbürger, engherzig, abergläubisch, mitleidlos, welches auch sonst ihre Tugenden sein mochten. Der Rat, der willkürlich ohne beisitzende Schöffen richtete, hätte durch scharfe Urteile der Bevölkerung die Empfindlichkeit abgewöhnen können, wenn sie daran gelitten hätte. Im Jahre 1480 ließ er am neuerrichteten Galgen zwei Leute aufhängen, die nicht mehr als ein paar Kittel gestohlen hatten. Zwei Schneider wurden verbrannt, einem Metzger wurden die Augen ausgestochen für Verbrechen, die weit weniger Rohheit kundtaten als die Strafe. Um diese Zeit wurde auch einmal eine Mutter mit zwei Töchtern lebendig begraben. Gela, die eine von den Töchtern, hatte ein uneheliches Kind zur Welt gebracht, und ihre Schwester Eisgen hatte ihr den unheilvollen Rat gegeben, es zu töten. Die siebzigjährige Mutter hatte darum gewusst und wurde deshalb mit den Töchtern zu grausamem Tode verurteilt. Man hatte auch die jüngste Tochter ins Gefängnis geworfen, aber da Mutter und Schwestern sie entschuldigten, dass sie nichts gewusst habe, ließ man sie gehen. Den Vater des getöteten Kindes, einen Knecht aus Wertheim, scheint keine Strafe getroffen zu haben. Wo, ob im Hexenturm oder in einem anderen Verlies, die Unglücklichen verschmachteten, wird nicht berichtet.
Jetzt empfängt Gelnhausen den Wanderer als eine freundliche, stille, halbländliche Stadt, deren Bewohner betrübt und fast beschämt gestehen, dass sie keine Industrie haben. umso besser hört man, wenn man die krummen Straßen hinaufklettert, den Genius dieses Ortes mit Adlerflügeln rauschen. Unsichtbare Schwingen segeln langsam zwischen der Pfalz und der Marienkirche hin und her, unter ihnen schwillt auch das Kleine und Geringe zu mythischer Größe über die enge Stadt hinaus. Das romanische Rathaus, das einzige dieser Art in Deutschland, das früher in ein gotisches Haus verbaut war, hat durch die Wiederherstellung an überzeugendem Leben verloren. Aber man geht an schönen, ansehnlichen Fachwerkbauten vorüber, an einem Portal der Peterskirche sieht man geheimnisvolle Gesichter, Madonnen voll unnahbarer Hoheit schmücken die Altäre der Marienkirche. Dieser herrliche Bau musste der Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche zum Vorbild dienen; aber wohl keiner, der vor einer von beiden steht, denkt an die andere.
Friedberg in Hessen
Wehe dem Schwachen! Wehe dem Armen! Die Welt ist dasjenige Reich, wo, wie Luther sagt, der Stärkere den Schwächeren in den Sack steckt. Das gilt wie für die einzelnen auch für menschliche Gemeinschaften.
In der fruchtbaren Wetterau zwischen Taunus und Vogelsberg, wo einst ein Kastell und eine Ortschaft der Römer nebeneinandergelegen hatten, erstand im Mittelalter Burg und Stadt Friedberg. Man nimmt an, dass die Hohenstaufen sich die Burg erbauten, und dass neben ihren Mauern ein Markt aufblühte; beide waren da, ohne dass sich ihre Entwicklungsgeschichte verfolgen ließe. Von der Stadt ist zum ersten Mal urkundlich die Rede, als König Heinrich, Friedrichs II. Sohn, im Jahre 1232 den Städten Frankfurt, Friedberg, Wetzlar und Gelnhausen das Recht verlieh, dass die Bürger nicht gezwungen werden sollten, ihre Töchter einem von den königlichen Hofleuten zur Ehe zu geben. Ein Fall, der sich in Frankfurt begeben hatte, war der Anlass zu dem Privilegium, das beweist, in welcher abhängigen Stellung die Bewohner jener Städte sich damals befanden. Bald änderte sich das: Frankfurt, Friedberg, Gelnhausen und Wetzlar verbündeten sich, stärkten sich dadurch und errangen Ansehen durch ihre Sorge für den Landfrieden. Auch größeren Bündnissen schlossen sie sich an, fast immer zusammen auftretend und zusammen als die vier Städte der Wetterau genannt. Ihnen zusammen verlieh auch König Richard im Jahre 1257 die Reichsfreiheit.
Kaum hatte sich ein Gefühl der Kraft in der Stadt Friedberg befestigt, so empfand sie, wie hemmend für ihre Entwicklung die Nähe der Burg war. Sie war von Rittern bewohnt, die unter einem aus ihrer Mitte gewählten Burggrafen standen, sich selbst ergänzten und an Selbstgefühl der Stadt nichts nachgaben; der Drang, ihre Macht zu mehren, musste die beiden reichsunmittelbaren Körperschaften in Gegensatz bringen. Verderblich aneinandergekoppelt, standen sich Ritterschaft und Stadtrepublik kampfbereit, drohend und doch zögernd gegenüber; bei gleicher Kraft und gleichem Recht war der Ausgang eines Kampfes ungewiss. Trotzdem kam es zu einem solchen, währenddessen die Burg durch die Städter zerstört wurde. Es geschah zu Kaiser Rudolfs Zeit, der der Stadt verzieh und eine Einigung zwischen den widerwilligen Zwillingen zustande brachte, die erste Versöhnung von den vielen, die sich folgten, um immer wieder durch den unausrottbaren Zwiespalt gebrochen zu werden. Demselben König verdankte Friedberg das Privilegium de non evocando und das Recht, Lehen erwerben zu können; aber trotz dieser Begnadigungen begünstigte er, wie alle Kaiser, die Ritter. Kaiser Albrecht führte den ersten verhängnisvollen Streich gegen Friedberg, indem er dem Burggrafen das Recht verlieh, der Stadt einen Schultheiß zu setzen, und sie dadurch in eine gewisse rechtlich begründete Abhängigkeit von der Burg brachte. Es ist verständlich, dass die Burg, sowie die Stadt sich davon zu befreien suchte, das Recht festhielt und womöglich Folgerungen daraus zu ziehen suchte, wie ihr das dem freien Gericht in der Grafschaft Kaichen gegenüber gelang. Eine bedeutungslose Beziehung, in die sie durch irgendeine Urkunde mit der Grafschaft gebracht worden war, benutzten die Burgmannen, um ein Recht über sie zu erlangen, das der Kaiser ihnen bestätigte, so dass sie zuerst Beschirmer und dann Besitzer derselben wurden. Die Proteste und die Auflehnung der freien Bauern blieben unbeachtet; da sie nichts als ihr Recht hatten und ihre Dienste den herrschenden Klassen unentbehrlich schienen, wurden sie sogar bestraft, wenn sie sich darauf beriefen.
Noch machte sich das Übergewicht der Burg nicht bemerklich; in die erste Hälfte des 14. Jahrhunderts fällt die Blüte der Stadt. Sie erbaute die gotische Liebfrauenkirche, schlicht, aber nicht ohne Größe, und schmückte sie mit reicher Glasmalerei und anderen Kunstwerken. In einem Bündnis, das Friedberg nach alter Gewohnheit mit Frankfurt und Gelnhausen abschloss, war vorgesehen, dass Frankfurt dreizehn, Friedberg zehn, Gelnhausen drei Gewaffnete zu stellen habe; dies Verhältnis stellte Friedberg noch in ziemliche Nähe von Frankfurt. Immer mehr aber machte sich der Vorteil, den seine Lage am Main dem glücklicheren Frankfurt gab, bemerkbar und drückte die benachbarten und befreundeten Wetterauer Städte sicherer und unabwendbarer, als ihre Feinde es konnten. Wohl hatte auch Friedberg eine Messe, aber gegen die von Frankfurt konnte sie nicht aufkommen. Mitten in ihrer Blüte traf die Stadt ein Schlag, mit dem ihr langes Siechtum begann.
Kaiser Karl IV. verpfändete sie an den Grafen von Schwarzburg. Die beginnende Ohnmacht des Reichshaupts, das auf wenig sichere Einnahmen rechnen konnte und auf die Willfährigkeit seiner Großen angewiesen war, entschuldigte einigermaßen den unkaiserlichen Gebrauch, den er einführte. Das Privileg Ludwigs des Bayern, das Friedberg vor Verpfändung sicherstellte, half nichts gegenüber dem Willen der Mächtigen. Andere Städte wussten sich der Gefahr zu entziehen; Friedberg war dazu nicht reich und infolgedessen nicht selbstbewusst und furchtlos genug. Patrizische Geschlechter, die sich ohne Reichtum nicht bilden oder halten, gab es in Friedberg nicht oder nicht mehr; es war in der Hauptsache eine Stadt von Handwerkern und Ackerbürgern, ehrenhaften Leuten, denen der reißende Zahn des Raubtiers fehlte.
Hingegen hatten die Burgmannen nur Gewinn einzuheimsen. Auch sie hatten innerhalb ihrer Mauern eine Kirche, die dem Patron der Ritter, dem heiligen Georg, geweiht war und für welche Johann Wölflein, Maler aus dem Zisterzienserorden zu Ilbenstadt, ein großes Gemälde zu Ehren Gottes malte. Außerdem besaß die Kirche eine hölzerne, bunt bemalte Figur des heiligen Georg und eine Glocke, die Maria hieß, und die ein Glockengießer von Frankfurt gegossen hatte. Graf Adolf von Hessen, den sie, von der Stadt unterstützt, erfolgreich befehdeten und gefangen nahmen, baute ihnen, um sich zu lösen, die hohe Turmsäule, die das nördliche Burgtor bewacht. Ludwig der Bayer verlieh ihnen den ersten Burgfrieden, die Ordnung nämlich, wonach sie untereinander leben sollten. Sie hatten danach das Recht, aus ihrer Mitte einen Burggrafen auf Lebenszeit zu wählen, der mit einer gewissen Zahl von Burgmannen, welche Bauleute hießen, die Regierungsgeschäfte besorgte, ferner das Recht, wenn ein Burgmann gestorben oder seines Amtes entsetzt war oder es freiwillig aufgegeben hatte, einen anderen, Kaiser und Reich dienlichen zu wählen, den der Kaiser bestätigte. Wenn ein Burgmann einen anderen totschlüge, hieß es in der ersten Satzung, so solle er ein Jahr über den Rhein gehen, habe er den anderen nur verwundet, auf ein halbes Jahr nach Frankfurt oder, je nachdem, nach Wetzlar oder Gelnhausen. War dadurch der gebrochene Burgfrieden gesühnt, so blieb noch die Sühne mit den Geschädigten zu vereinbaren. Eine Reise nach Frankfurt oder Wetzlar und vollends eine über den Rhein scheint demnach durchaus nicht als Vergnügen betrachtet worden zu sein.
Die Burg hatte das Recht, durch sechs Burgmannen an den Ratssitzungen teilzunehmen, wohingegen die Stadt von der Burg ausgeschlossen war. Geradezu gegen die Stadt richtete sich ein Privileg Wenzels, wonach die Burg, weil sie groß und weit sei, Beisassen aufnehmen dürfe; denn dadurch wurde sie gleichsam zur Stadt und konnte die Nachbarin noch in anderem Sinne als früher erdrücken.
Im Jahre 1400 kam Kaiser Ruprecht von Gelnhausen her zur Huldigung nach Friedberg. Sechzig bis achtzig Burgmannen holten ihn an der Grenze ein und geleiteten ihn mit entfaltetem Georgsbanner in die Burg. Sie schenkten ihm, altem Herkommen gemäß, drei Rehe und sechzig Fische; die Stadt schenkte ihm ein Fuder Wein, halb neuen und halb firnen, einen silbernen vergoldeten Becher mit 200 Goldgulden und Hafer für die Pferde, wozu noch Geldgeschenke an das Gefolge und eine spätere Leistung von 500 Goldgulden zum Zuge »über Berg nach Lamparten« kam. Von der Burg aus ritt der Kaiser in die Liebfrauenkirche, wo ihm im Chor vom Magistrat gehuldigt wurde. Die Formel lautete: »Wir huldigen unserem gnädigen Herrn, König Ruprechten, gegenwärtig und in guten Treuen, ihm gehorsam, getreu und hold zu sein und zu warten als einem römischen König und zukünftigen Kaiser und als unserm rechten Herrn, doch uns unschädlich an solcher Pfandschaft, als wir unserem Herrn von Schwarzburg von des heiligen Reichs wegen verpfändet sind, und wollen unserem gnädigen Herrn, König Ruprecht, stet und fest halten ohne alle Gefährde, als uns Gott helfe und alle Heiligen.«
Trotz der empfangenen reichen Geschenke stellte sich Ruprecht, wie die anderen Kaiser, auf die Seite der Ritter, indem er der Stadt gebot, die Türme der Liebfrauenkirche, von denen der eine noch kaum begonnen war, nicht höher aufzubauen, als sie gerade wären, und sie auf keinen Fall zu einer Befestigung einzurichten, von welcher aus die Burg beschossen werden könne. Eine solche Absicht lag allerdings den Friedbergern nicht fern, wie denn auch die Katharinenkapelle dicht am südlichen Turm der Burg zugleich den Zweck einer Schanze erfüllte.
Um 1430 war die Stadt Friedberg schon »wüst und vergänglich« geworden und so tief verschuldet, dass der Graf von Schwarzburg die Lust an seinem Pfände verlor und, nachdem er der Stadt das Recht erteilt hatte, sich ungeachtet der Pfandschaft mit anderen Fürsten und Herren einzulassen, sie weiter verpfändete, und zwar an mehrere Teilhaber. Es waren der Erzbischof Diether von Mainz, die Herren von Eppstein, ein Herr von Isenburg und die Stadt Frankfurt, und das Verhältnis der Anteile war so, dass Frankfurt die Hälfte hatte. Vermutlich um den Wert des verpfändeten Gegenstandes zu erhöhen, machte der Erzbischof von Mainz Anstalt, sich Friedbergs gegen die Burg anzunehmen; allein er fand sofort einen Gegner in dem Pfalzgrafen Friedrich dem Siegreichen, der kurz zuvor sich das öffnungsrecht der Burg erkauft hatte und dadurch an ihr interessiert war. Indessen auch die neuen Pfandherren mochten einsehen, dass Friedberg nicht mehr hochzubringen war, und sie traten, zuerst Kurmainz, dann Frankfurt, das Pfandrecht an diejenigen ab, denen am meisten daran gelegen war, es zu besitzen, an die Burgmannen von Friedberg.
Bitterkeit und Groll im Herzen, mussten nun Bürgermeister und Rat dem Burggrafen und den Burgmannen, die an die Stelle der Pfandinhaber, also gewissermaßen an die Stelle des Kaisers getreten waren, schwören, ihnen treu, hold, gehorsam und gewärtig zu sein. Trotz ihrer Verarmung und Entkräftung vergaßen sie ihren ehrenvollen Stand als Reichsstadt nicht, sondern sannen auf Wiederherstellung der ehemaligen Blüte und Würdigkeit. Wie hätten sie das aber aus eigener Kraft vollbringen können? Die Zeit der Städtebünde war vorüber; sie wendeten sich also, eingedenk des vom Grafen von Schwarzburg erlangten Rechtes, sich ungeachtet der Pfandschaft mit anderen Fürsten und Herren einlassen zu können, an den Landgrafen Heinrich III. von Hessen-Marburg, um seine Schutzherrschaft zu erwerben. Dieser Versuch zur Befreiung führte zur vollständigen Entrechtung; denn die erzürnten Burgmannen zwangen der Stadt, als sie von ihrer Eigenmächtigkeit erfuhren, einen Verherrungsrevers ab, in dem sie versprach, sich nie mehr zu verherren; auch musste die Huldigung künftig auf dem Platze vor der Burg vollzogen werden. Als die letzten Anteile des Pfandbesitzes von den Herren von Eppstein und Isenburg auch noch an den Burggrafen fielen, dem die Stadt über 2208 Gulden schuldete, war ihre Unterwerfung unter die Burg vollendet. Trotz ihrer Ohnmacht empörten sich die Bürger noch einmal unter der Führung von Johann Winnecken, aber vergeblich. Zur Strafe für ihre Auflehnung mussten sie die Katharinenkapelle, welche hart an den Toren der Burg lag und die sie als Befestigung zum Angriff benutzt hatten, auf eigene Kosten abbrechen und an anderer Stelle, wo sie nicht gefährlich werden konnte, wieder aufbauen.
Dies geschah in dem sturmvollen Jahre 1525, zu einer Zeit, als beide, Burg und Stadt, schon den neuen Glauben angenommen hatten; die alte Feindschaft war nicht darin untergegangen. In der breiten Straße, die Friedberg repräsentiert, wird ein Haus als dasjenige bezeichnet, das Luther auf seiner Rückreise von Worms bewohnte. Von Friedberg sind drei Briefe datiert, die der Flüchtende von dort schrieb: ein lateinischer an den Kaiser, ein deutscher an die Kurfürsten und Stände und ein Billett an den Freund Spalatin. Ihn begleitete Kaspar Sturm, der, von seiner Persönlichkeit und seinem Wort ergriffen, sein treuer Anhänger wurde. Sturm blieb damals in Friedberg und ließ sich dauernd dort nieder, woraus manche schließen, dass er ein geborener Friedberger gewesen sei. Seine Nachkommen bewahrten das Geleitschwert auf, das er in Worms als Reichsherold Luther vorantrug und das sich jetzt im Museum befindet. Dass Luthers kurze Anwesenheit in Friedberg den evangelischen Gedanken in Friedberg ausgesät oder nur befördert habe, ist nicht anzunehmen; die Bewegung war in den Gemütern so vorbereitet, dass das Auftreten des Reformators sie in ganz Deutschland wie ein erster warmer Frühlingstag aufgehen ließ. Zwar wurde in Burg und Stadt die Reformation erst im Jahre 1552 gesetzlich eingeführt, weil man den Kaiser zu erzürnen fürchtete; aber da war sie von selbst, dadurch, dass das Alte abbröckelte, die Klöster leer wurden, die Priester heirateten und selbst die neue Lehre predigten. Brendel von Homburg war der Burggraf, der die Reformation in der Burg durchführte; in späterer Zeit bekamen die Katholiken mehr Einfluss und setzten durch, dass von den Regimentsburgmannen die Hälfte katholisch sein musste.
Der Umstand, dass Friedberg an der Hauptstraße nach Frankfurt lag, trug ihm viel hohen Besuch ein, der in rühmlich bekannten Gasthäusern gut verpflegt wurde, war aber auch Ursache, dass der Krieg es heimsuchte. Alle Kriege seit dem Dreißigjährigen brausten vernichtend, Hunger und Pest im Gefolge, durch Friedberg. Elf Jahre lang, von 1620-31, war es von den Spaniern besetzt; während dieser Zeit kam es vor, dass der Bürgermeister Volkhard, ein Metzger, aus Lebensüberdruss sich die Kehle durchschnitt. Dann kamen abwechselnd Schweden und Kaiserliche; Belagerung, Erstürmung, Plünderung waren an der Tagesordnung. Schrecklicher und bösartiger noch hausten die Franzosen in den Napoleonischen Kriegen. »Unsere Nachkommenschaft«, schrieb ein Zeitgenosse auf, »wird sich nicht überzeugen können, dass in Gestalt von Menschen Geschöpfe auf dem Erdboden vorhanden gewesen, die alles Menschengefühl ausgezogen und Taten verübt haben, dergleichen in den ältesten und rohesten Zeiten nicht verübt wurden und wahrscheinlich, solange die Welt steht, nicht wieder erlebt werden."
Als nach der Zerstörung Speyers das Reichskammergericht sich eine andere Stätte suchen musste, kamen auch einige Abgeordnete nach Friedberg, das als Reichsstadt in bequemer Lage in Betracht kam, um die dortigen Zustände zu untersuchen. Man fand ein ländliches Städtchen, dessen Bürgerschaft nicht viel über 150 Mann stark war, wozu noch 75 Judenfamilien kamen. Zugunsten der Stadt sprach, dass die Post hindurchgehe, auch ein Arzt und Apotheker vorhanden seien; aber man tadelte sehr, dass in den Häusern keine Brunnen wären, dass die 12 oder 14 Ziehbrunnen, die die Stadt mit Wasser zu versorgen hätten, sehr tief wären, und dass man Strick und Eimer, um Wasser heraufzuwinden, selbst mitbringen müsse. Der Eindruck war im ganzen so kümmerlich, dass man von Friedberg absah.
Man bewundert es, dass das herabgekommene Gemeinwesen im Anfang des 18. Jahrhunderts wieder den Versuch machte, die drückende Abhängigkeit abzuwerfen, indem es die Pfandschaft ablöste. Die Burg ging jedoch nicht darauf ein, die Huldigung musste noch in alter Weise stattfinden. Festessen und Ball, wozu die Burgmannen den Friedberger Magistrat einluden, nahmen dem Akt nichts von seiner Bitterkeit; der Rat fuhr in seinen Bestrebungen fort und hoffte, nun zum Ziel zu kommen, indem er sich, wie schon früher einmal, in den Schutz des Landgrafen von Hessen begab. Die arme Stadt hatte kein Glück: die Folge war, dass sie vom Reichshofrat zu einer Strafe von zehn Mark lötigen Goldes verurteilt wurde. Noch bitterer mögen die Empfindungen der Bauern gewesen sein, welche die Grafschaft Kaichen aus ihrer Mitte nach Wien zum Kaiser abordnete, um an ihre alte, widerrechtlich geraubte Freiheit zu erinnern; es wurde ihnen bedeutet, augenblicklich Wien zu verlassen und sich nie wieder einer solchen Auflehnung zu erdreisten. Der Burggraf betrachtete den nie erlöschenden Widerwillen der Kaicher Bauern gegen seine Herrschaft nicht mit Unrecht, aber missbilligend, als »eine von ihren Voreltern gleichsam anererbte Freiheitssucht«.
Die doppelte Gerechtigkeit zeigte sich auch darin, dass die verschuldete Stadt, der sich niemand angenommen hatte, noch zu Reichsleistungen herangezogen wurde, die sie kaum aufbringen konnte, während die Burgmannen sich stets darauf beriefen, dass sie nur zu freiwilliger Hilfe verpflichtet wären und auch diese nur ungern leisteten. Die zunehmende Verfälschung der Ideen des alten Reichs und die Verknöcherung aller Formen war gerade an den aristokratischen Körperschaften wahrzunehmen, deren Ansprüche sich auf ihre Kaiser und Reich geleistete Schwerthilfe gründeten, die aber längst, entsprechend dem veränderten Charakter der Kriege, außer Übung gekommen war. Da die Ritter im Allgemeinen zu anderen Zwecken nicht gebraucht wurden, waren sie eigentlich überflüssig geworden, genossen aber die althergebrachten Vergünstigungen weiter und trieben ihr Standesbewusstsein höher und höher. Neu aufgenommen in die Burg wurden nur Söhne oder Schwiegersöhne von Burgmannen, und auch diese mussten auf einem Pergament von vorgeschriebener Größe einen Stammbaum beibringen und ihren Adel von 16 Ahnen her beweisen. Zur Zeit der Aufhebung des Instituts waren unter den 91 Burgmannen, die es damals gab, 22 Grafen. Übrigens vernimmt man nicht, dass die Burgmannen ihre Übermacht zu bösartigen Quälereien oder ehrenrührigen Zumutungen missbraucht hätten; aber für die Friedberger Bürgerschaft waren die unvermeidlichen kleinen Übergriffe und Einmischungen und die dauernd spürbare Nähe der triumphierenden Nebenbuhler Pein genug.
Dem vielhundertjährigen Kampfe machte der Reichsdeputationshauptschluss ein Ende, der Stadt und Burg nacheinander dem nunmehrigen Großherzogtum Hessen zusprach. Die beiden Republiken des Heiligen Römischen Reichs mussten aufgehen in dem Territorialfürstentum, das im Anschluss an Frankreich aufgekommen war und das jetzt durch Frankreich zum vollständigen Sieg über das zertrümmerte, entseelte Reich geführt worden war. Französische Offiziere und Soldaten paradierten vor der Burg, als am 12. September 1806 ihre Übergabe an die neue Herrschaft stattfand. Der letzte Burggraf, Graf Clemens August Wilhelm von Westfalen, wurde 12 Jahre später auf dem alten Peterskirchhof in Frankfurt begraben. Nach einigen Jahrzehnten wurden Stadt und Burg zu einer politischen Gemeinde und dann zu einer Pfarrgemeinde vereinigt.
Die Anlage der Stadt Friedberg ist ungewöhnlich; denn sie gruppiert sich nicht um einen Mittelpunkt, wie Kirche oder Schloss oder Rathaus, sondern ihren Mittelpunkt bildet eine fast marktbreite Straße, die auf die Burg zuläuft und zu der von beiden Seiten her Gassen hinaufführen. Ungewöhnlich ist ferner, dass Friedberg nicht, wie die meisten anderen Städte, aus mehreren Dörfern oder Ortschaften zusammengewachsen ist, die alle ihren besonderen Mittelpunkt hatten und ihren besonderen Charakter lange bewahrten; vielleicht beschränkte auch das seine Entwicklungsfähigkeit. Man muss jetzt ein peinliches Stück Bahnhofsvorstadt überwinden, bis man zum alten Friedberg vordringt; hat man aber einmal die Breite Straße erreicht, fühlt man sich umfangen von einer wie eine Kindheitserinnerung lieben Welt. Da stehen sie dicht aneinandergedrängt, die spitzen Giebel der Straße zugewendet, die Bürgerhäuser, meist mit Schiefer gedeckt, keins wie das andere, obwohl von gleichem Stil, eins schmaler, eins stattlicher, eins geschmückter, eins breitspuriger, alle noch von der mäßigen Größe, dass man sie als zweites, weiteres Kleid der Familie betrachten kann, die sie bewohnt. Von den alten Gasthäusern dem Ochsen, dem Schwan, den drei Schwertern -, wo die Fürsten und Herren abstiegen, sind noch mehrere erhalten; aber es fehlen die Brunnen, über deren Tiefe die Kommission des Reichskammergerichts klagte, ohne ihre Wohlgestalt zu beachten. Nahe der Burg steht das barocke Rathaus mit dem gekrönten Doppeladler, das um 1738 an der Stelle des alten erstand; gegenüber lag das Haus zum Ritter, das der Familie Goethe gehörte. Nachdem am Ende des 16. Jahrhunderts ein Thilemann Goethe Syndikus der Burg gewesen war, tauchte der uns teure Name im 18. Jahrhundert wieder auf, als Johann Christian Goethe, ein Vetter vom Vater des Dichters, jenes Haus kaufte. Der Vater Goethes hatte Geld auf dem Hause stehen, das viel Sorge machte. Er und seine Frau starben in zerrütteten Vermögensverhältnissen, und das Haus zum Ritter wurde dann verkauft. Nicht nur steht Friedberg durch den Namen Goethe zu Frankfurt in Beziehung, sondern es hat einen bedeutenden Schatz bürgerlicher Tüchtigkeit an die glücklichere Schwesterstadt abgegeben. Die Grunelius, die Zwickewolf, die Frank von Lichtenstein, die Senckenberg, Weisel und Lotichius, bekannte Frankfurter Familien, sind meist im 17. Jahrhundert aus Friedberg eingewandert. Die Zwickewolf haben von 1501-1712 sechzehnmal das Bürgermeisteramt in Friedberg bekleidet, auch die Grunelius und Senckenberg einige Male.
Auf der Freiheit vor der Burg stand einst die Katharinenkapelle, von welcher aus zum letzten Mal mit den Waffen um die Freiheit der Stadt gekämpft worden war. Dann steht man vor dem von zwei Türmen flankierten südlichen Tore der Burg; unter dem Spitzbogen des Durchgangs prangt der Reichsadler mit dem Burgwappen, darunter ist ein aus einem jetzt abgebrochenen Turme stammender Stein angebracht mit der Inschrift: frid sy by üch. 1493. Eine andere Welt, als draußen war, umgibt uns jenseits des Tores, stolz und machtbewusst, wenn auch mit der neuen Zeit allerhand ausdruckslose Nutzbauten und Anstalten eingedrungen sind. Die Wachthäuser und das Schloss stammen zum Teil aus der Barockzeit; barock ist auch der wundervolle St. Georgsbrunnen, den die Kastanien zur Blütezeit feierlich wie gestirnte Globen umgeben. Der mittelalterliche Heilige in Harnisch und Helm und flatterndem Gewand hebt seine Lanze gegen den sich aufbäumenden Lindwurm, seiner anmutigen Hoheit bewusst und seines Sieges sicher. Den steinernen Rand des eckigen Brunnenbeckens schmücken die Wappen von Burgmannen: von Bettendorf mit den Brömser von Rüdesheim geviertelt, Rau von Holzhausen, Diede zum Fürstenstein, von Ingelheim, Kämmerer von Worms genannt von Dalberg, von Breidenbach genannt von Breidenstein, von Stockheim, von Weiteishausen genannt von Schrautenbach, Löw von und zu Steinfurt, von Frankenstein. Das sehr alte Geschlecht Löw zu Steinfurt hat fünf Burggrafen gestellt, und die letzten überlebenden Burgmannen waren zwei Löw zu Steinfurt. Auch ihr Haus mit ihrem Wappen, dem silbernen Kranich im blauen Felde, ist mit ein paar anderen Burgmannenhäusern, schlichten Fachwerkbauten, noch vorhanden. An Stelle der alten Georgskirche steht die nüchterne neue Burgkirche aus dem Anfang des neunzehnten Jahrhunderts mit dem Wappen des vorletzten Burggrafen, Grafen Wallbott von Bassenheim. Ein paar alte, zum Teil zertrümmerte Grabsteine aus der abgebrochenen Kirche, auf deren einem noch der Schelm von Bergen sich entziffern lässt, stehen jetzt auf dem Burggraben, von wo der Blick aus diesem fest umzirkten Raum in die Weite schweift, bis ihn der Taunus und der ferne Vogelsberg festhalten. Jenseits des nördlichen Tores wendet sich die Straße im Bogen schluchtartig abwärts nach der Stadt zurück durch eine Wildnis von Grün, das sich ungestüm in die alten Gräben stürzt, unter den basaltenen Felsen, auf die schon die Römer bauten. Die starken Befestigungen, mit denen sich die Ritter gegen die Außenwelt sicherten, sind gefallen wie auch die der Stadt; wo nicht neues Menschenwerk sie hemmt, dringt Natur urkräftig ein, um das Alte zu verschlingen.
Limburg
Limpurg ein edle Stad
Im Land die schönste Kirche had.
Glorreich thront sie, verschmolzen mit der Burg, ein vollendetes Menschenwerk zwischen den Elementen; dienend trägt sie der Fels, schützend umrauscht sie der Strom, Winde und Gestirne kränzen sie. Von der alten steinernen Lahnbrücke hinaufblickend, nimmt das Auge sie auf wie Musik: der Stein wird Mauer, die Mauer wird Gestalt, die Gestalt Harmonie. Die sieben Türme der Kathedrale sollen die sieben Sakramente bedeuten; der große Turm über der Vierung, heißt es, stelle den Mittelpunkt des Glaubens, das Sakrament des Abendmahls dar. So schweben die ewigen Mysterien des Lebens als ein triumphierender Akkord zwischen Himmel und Erde.
Über zwei untergegangenen Kirchen erhebt sich der Dom als die dritte, die Burg, wie die Sage will, über den Trümmern eines römischen, von Drusus errichteten Kastells. Die Grafen des Niederlahngaus, die die Burg bewohnten, waren die jeweiligen Gründer der Kirchen, von denen die erste in der ersten Hälfte des neunten Jahrhunderts durch den Erzbischof Hatto von Trier dem heiligen Georg geweiht wurde. Die zweite gründete hundert Jahre später, mit einem Stift sie verbindend, der Gaugraf Konrad Kurzbold, dessen Grabmal der Dom bewahrt. Es ist so außerordentlich schön, dass man, indem man es betrachtet, den Dom für einen Schrein halten möchte, aufgebaut, um diese Reliquie einzufassen. Die steinerne Bahre, auf der der Tote liegt, ist von leichter Anmut, dem Jugendbild angemessen, das sie trägt. Das Antlitz des Gaugrafen ist schmal und hat einen strengen, fast asketischen Zug bei aller Lieblichkeit; das Antlitz eines vornehmen Jünglings, der um hoher Ziele willen nicht ohne Schmerz und Selbstüberwindung viel verzichtet hat.
Aus sehr edlem Geschlecht stammt Kurzbold, denn er war der Vetter Konrads L, der zwischen den Karolingern und den Ludolfingern regierte. Sein Vater hieß Eberhard, seine Mutter Wiltrud. Er genoss nicht nur die Gunst seines königlichen Vetters, sondern auch Ottos L, und verdiente sie durch seine Treue und seine Taten. Für diesen Kaiser kämpfte er gegen die rebellischen Herzöge Eberhard von Franken und Giselbert von Lothringen, bis jener bei Andernach fiel und dieser ertrank. Von Kurzbolds Stärke werden Wunder berichtet; er soll einen Löwen, der aus dem Käfig entsprungen war und auf Kaiser Otto eindrang, mit einem Schwerthieb getötet und einen riesigen Slawen, der ihn herausforderte, mit der Lanze durchbohrt haben. Die Überlieferung, die ihm den Beinamen Sapiens, der Weise, gab, beweist, dass seine Geisteskraft der des Körpers nicht nachstand. Er war unverheiratet und soll Frauen und Apfel, die süßen Dinge, gemieden haben; es besteht ja der Glaube, dass außerordentliche Kräfte Keuschheit zur Voraussetzung haben. Es ist nicht wahrscheinlich, dass der Gaugraf Kurzbold so ausgesehen hat, wie das Grabmal, ein Werk des 13. Jahrhunderts, ihn aufgefasst hat; so aber sahen die späteren Generationen ihre Helden, in solcher Form stellte sich ihnen adlige Tugend ihres Volkes dar.
Die dritte Kirche gründete ein Isenburg aus der Familie, die im 12. Jahrhundert das Grafenamt im Niederlahngau hatte, und die vielleicht mit den Konradinern verwandt war. Sie waren Dynasten von Limburg bis zum Ende des 14. Jahrhunderts, die Blütezeit der Stadt hindurch, die neben Kirche und Burg als dritte selbständige Macht entstanden war. Reichsfrei im eigentlichen Sinn war die Stadt allerdings nicht, wenigstens nur zu einem Drittel, während die beiden andern Drittel den Isenburgern unterstanden, so jedoch, dass Mainz und Hessen daran Mitbesitz hatten. Die Landesherrschaft bedeutete indessen nicht Untertänigkeit; denn mit der hohen Gerichtsbarkeit, die ausschlaggebend war, verhielt es sich so, dass die Isenburger zwar den Blutbann besaßen, die Stadt aber das Urteil fällte, die Dynasten also nur das Urteil der Stadt vollstrecken konnten. Die Stadt hatte ihr eigenes Siegel, drei Türme mit der Umschrift Sigillum civium in Limburch. Juste judicate. Dicht an die Stadt grenzte das Gebiet der Grafen von Diez, eine Nachbarschaft, aus der sich häufig Schwierigkeiten ergaben. Sie wurden endlich dadurch beigelegt, dass die Stadt und die Grafen ein Schutz- und Trutz-Bündnis abschlossen, wobei die Stadt die Isenburger Grafen, die Grafen von Diez den Kaiser ausnahmen. Auf das Isenburger Grafengeschlecht fiel unverhoffter Glanz dadurch, dass Adolf von Nassau, der Gatte der Imagina, Tochter des Grafen Gerlach L, nach dem Tode Rudolfs von Habsburg zum römischen König gewählt wurde. Adolf war weniger Staatsmann als Ritterkönig, untadelig tapfer in der Schlacht, nach Abenteuern dürstend und nach Ruhm. Imagina war, wie es scheint, zur Nonne bestimmt und soll vom Grafen Adolf aus dem Kloster entführt worden sein. Ihr Bruder Johann, später der blinde Herr genannt, kämpfte an Adolfs Seite in der Schlacht bei Worringen, wo der Erzbischof von Köln dem Herzog von Brabant unterlag.
Eine Ritterschlacht war auch die von Göllheim, die Adolf von Nassau den Tod und seinem Gegner Albrecht von Habsburg den Sieg und die unbestrittene Krone brachte. Das Heer des Königs zog in die Schlacht mit dem Gesang: »In Gottes Namen fahren wir, Seiner Gnade geren wir«; das des Herzogs sang: »Sant Maria Mutter und Magd, All unsere Not sei dir geklagt.« Die beiden Könige suchten einander im Getümmel, Adolf von Nassau verriet sein weithin glänzender goldener Harnisch. Wie unzweckmäßig die schweren Rüstungen waren, zeigte sich in dieser Schlacht, wo sowohl der Bannerträger des Königs, einer von Isenburg, wie der des Herzogs, einer von Ochsenbeim, in ihren Harnischen erstickten. Das Pferd des von Ochsenbeim stürmte mit der Leiche des Reiters, der noch fest im Sattel saß und die Sturmfahne in der erstarrten Faust hielt, durch die Reihen der Kämpfenden. Beide Heere führten die gleiche Sturmfahne des Reichs, ein weißes Kreuz auf rotem Grunde.
Wie König Adolf sich vornehm erwiesen hatte, indem er mit Gnadenbeweisen gegen seine Verwandten, die treu zu ihm hielten, sparsam war, so sein Gegner Albrecht, indem er sich ihnen gnädig zeigte. Als er sich mit seiner Frau Elisabeth in Nürnberg aufhielt, wo sie gekrönt wurde, erschien dort Imagina, die Witwe des gefallenen Königs. Im Trauergewand kniete sie vor der geschmückten Königin nieder und ersuchte sie, bei ihrem Manne Fürbitte zu tun, damit er ihren bei Göllheim gefangenen Sohn Ruprecht freigebe, eine Bitte, die Albrecht nicht erfüllen konnte, weil der Königssohn dem Erzbischof von Mainz überlassen war. Er starb einige Jahre später in der Gefangenschaft. Imagina und Elisabeth sollten sich nach wenig Jahren noch einmal wiedersehen, als König Heinrich VII. die Leichen seiner beiden Vorgänger in Speyer feierlich beisetzen ließ. Die Albrechts kam den Rhein herunter, die Adolfs war bis dahin im Kloster Rosenthal verwahrt. Sie wurden unter dem Gesang: »Quomodo ceciderunt inclyti« Was sind doch die Starken! in die Gruft versenkt, wobei Heinrich VII. selbst Hand angelegt haben soll. Die Anhänger Adolfs fanden Genugtuung in der Tatsache, dass die Gegner ihres Königs eines üblen Todes gestorben wären: Albrecht ermordet, ein anderer sei rasend geworden, ein anderer ertrunken, der Erzbischof von Mainz auf seinem Stuhle sitzend tot aufgefunden, also allein, ohne Menschentrost gestorben.
Stift und Stadt Limburg standen damals, wie der Chronist es ausdrückt, in Ehren und Seligkeit. Mit dem Geschlecht der Isenburg neigt es sich dem Ende zu, obwohl es noch in täuschen der Blüte prangte. Gerlach II. war Anhänger Friedrichs des Schönen und befreundet mit dem Erzbischof Baldewin von Trier, einem Bruder Heinrichs VII., von dem der Chronist sagt, dass er ein kleiner Mann sei und doch große Werke tue. Mit Baldewin, mit den Grafen von Nassau und Sayn und mit Giso von Molsberg schloss Gerlach einen Landfrieden, der dem Kaufmann sicheres Geleit verschaffen sollte. Gerlach war ein Dichter, der Klügste nach des Chronisten Meinung, in allen deutschen Landen. Er hätte auch, rühmt derselbe, nicht um hundert Gulden eines armen Mannes Hammel gegessen, ohne ihn bezahlt zu haben. »Er hatte gekoren und auserwählt die Tugend, die da heißt Gerechtigkeit, die für alle Tugenden geht, die war seine Handgetreue und Testamentierer.« Dichter und Heilige sind selten gute Staatsmänner; während Baldewin von Trier durch Fehden und Kriege sich bereicherte und mit dem Reichtum mehr und mehr Lehensleute an sich zog, nahm die Geldnot der Isenburger beständig zu und wurde schließlich so dringend, dass Gerlach sich im Jahre 1344 entschloss, die Hälfte von Limburg dem Erzbischof um 28 000 alte kleine Gulden zu verpfänden. Er verpfändete Limburg mit Zustimmung der Bürgerschaft mit »herrschaften, gerichten, dorfern, luden, juden, gülden, gevellen«. Die Bürger wurden verpflichtet, dem Erzbischof beizustehen gegen alle »ussgenommen ane allein daz römische riche, den stift von Mentze und den Landgraven von Hessen«, die, wie erwähnt, Mitbesitzer zweier Drittel der Stadt waren.
Stadt Limburg, obwohl nicht auf Handel, sondern auf Ackerbau eingestellt, war ein Gemeinwesen voll Kraft und Selbstbewusstsein. Einmal baute Philipp von Isenburg, Glied einer anderen Linie, eine Burg, die der Stadt für ihre Ruhe und Freiheit zu nahe schien, worauf sie sich mit Kuno von Falkenstein, der damals Domherr zu Mainz und Coadjutor von Trier war, verbündete, um die unbequeme Feste zu brechen. Als es zum Sturm kam, verlangte ein Amtmann des Erzbischofs von Trier von den Limburgern, sie sollten vorangehen. Da sagte der Bürgermeister von Limburg, Johann Boppe, sie wären da, um zu stürmen, aber die Gräben sollten nicht mit denen von Limburg allein gefüllt werden; sie wollten mit den Rittern und Knechten zugleich stürmen und würden nicht die Letzten sein. Das machten sie wahr, als man tat, wie sie verlangten.
Aus der verschütteten Geschichte von Limburg ragt der Name Johann Boppe wie ein Turm. Es ereignete sich einmal, dass der Erzbischof von Trier, Kuno von Falkenstein, und Johann II., letzter Graf von Limburg, einen Schöffen der Stadt, der Johann Hartleib hieß und aus Nauheim war, gerichtlich belangen wollten. Offenbar war ihnen viel daran gelegen, sich des Mannes zu bemächtigen, denn sie kamen mit starkem Geleit in die Stadt, darunter der Erzbischof von Köln, die Grafen von Sayn, Reinhold von Westerburg, Dietrich zu Runkel und andere Ritter. Einer von diesen, Herr Dietrich zu Walpod, begann die Verhandlung, indem er die versammelten Schöffen fragte, wofür sie die Herren hielten, und welches nach ihrer Meinung ihre Herrschaft, ihre Freiheit und ihr Recht wäre. Die Schöffen gingen hinaus, berieten sich, kamen wieder herein und antworteten durch den Mund ihres Worthalters, Johann Boppe, der mit Würde und Festigkeit folgendermaßen sprach: »Wir bekennen, dass unser Herr von Trier ist unser gekaufter Herr nach Laut und Anweisung solcher Briefe, die darüber gegeben und gesiegelt sind. Wir bekennen und halten unsern Jungherrn von Limburg für unseren rechten geborenen Herrn, der zu der Herrschaft von seinen Eltern, unseren Herren seligen, geboren ist.« Nachdem er so der gestellten Falle mit seiner Antwort begegnet war, die, nett und rund das Rechtsverhältnis bestimmend, keine Handhabe zum Angriff bot, wurde eine weitere Frage gestellt, auf die nach der üblichen Beratung Johann Boppe den Bescheid gab: die Herren hätten das Gericht über Hals und Haupt, aber sie dürften keinen Bürger von Limburg greifen, wenn die Schöffen nicht zuvor darüber geurteilt hätten. Die nächste Frage war, ob die Herren einen, der zu Limburg Gewalt brauchte, nicht greifen dürften, damit er nicht flüchtig werde, bis die Schöffen sich versammelt hätten. Die Antwort Johann Boppes lautete: Nein, zuvor müssten die Schöffen urteilen. Nun wiederholten die Herren ihre Frage so: wenn man einen verdächtigte, dass er Gewalt begangen hätte, was der den Herren schuldig wäre? Johann Boppe antwortete: »Liebe Herren, wir, die Schöffen zu Limburg, erkennen und sprechen kein Urteil auf Gedanken.« »Und nit mehr sagt«, fügt der Chronist, der den Vorfall berichtet hat, stolz hinzu. Unter den Schöffen waren außer Johann Boppe und jenem bedrohten Johann Hartleib ein Holzhusen, ein Borgenit, ein Knappe, ein Priol, ein Mulich, ein Wisse, ein auf der Schoppen und der alte Johann Sibolt.
Deutlich treten hier die von der späteren Zeit so verschiedenen mittelalterlichen Verhältnisse hervor, die auf erworbenen Rechten und gegenseitigen Verpflichtungen beruhten. Der mächtige Erzbischof von Trier und der angestammte Landesherr von Limburg getrauten sich nicht, einen Limburger Bürger, der offenbar einem der Ihrigen, vielleicht einem Ritter, vielleicht in gerechter Gegenwehr, Gewalt angetan hatte, zu verhaften, um sich an ihm zu rächen, und als die Schöffen es geschickt vermieden hatten, sich durch unbesonnene Äußerungen eine Blöße zu geben, die etwa gerechtfertigten Anlass zu einem Eingriff gegeben hätte, traten sie sehr verwundert über die Klugheit der Bürger den Rückzug an. Sie sahen sich an, berichtet der Chronist, als wollten sie sagen: »Der Has ist uns entgangen, den wir wähnten han gefangen.« Ebenso wenig würden sie damals gewagt haben, eine nicht bewilligte Geldabgabe anders als bittweise zu verlangen.
Sein Hervortreten als worthaltender Schöffe ist das letzte, was von Johann Boppe erzählt wird; vielleicht ist er nicht lange danach gestorben. Er hatte einen Sohn und eine Tochter, die ihrerseits drei Töchter hatte. Als sie Witwe geworden war, verheiratete sie sich wieder mit Heinrich von Staffeln, dessen drei Söhne die drei Töchter seiner zweiten Frau heimführten. Über dieser seltenen Familienverbindung stand kein guter Stern, denn alle drei Ehen wurden bis auf die des jüngsten Paares nach kurzer Zeit durch den Tod getrennt. Daraus, dass das Vermögen Johann Boppes an die von Staffeln fiel, ist zu schließen, dass männliche Erben nicht übrigblieben. Die Tochter des Sohnes wurde die Frau des Tilemann Elken voni Wolfenhagen, eines Klerikers des Mainzer Bistums, der Stadtschreiber in Limburg wurde. Da er die höchsten Weihen nicht empfangen hatte, konnte er sich verheiraten.
Es schickt sich gut, dass ein Ort von solcher Monumentalität wie Limburg bedeutende Chronisten hervorgebracht hat. Von hier blickte Tilemann Elken wie von einem Adlerhorst in die weite deutsche Welt, und er sah, als hätte er eines Adlers Augen, das ihm Verwandte, das Große und Herrenmäßige. Seine Schilderungen von Menschen sind erstaunlich, besonders wenn man sie mit denen anderer geistlicher Geschichtsschreiber vergleicht, für die Anhänglichkeit an die Kirche der einzige Maßstab der Größe war. Bei Tilemann ist fabulierende Lust an auffallenden Begebenheiten, Interesse für ausgeprägte Charaktere und Charakterköpfe und Sinn für Poesie. Neben dem Großvater seiner Frau, von dem er mit zärtlicher Verehrung sprach, bewunderte er den Erzbischof von Trier, Kuno von Falkenstein, mit dem vereint die Limburger manche Ritterburg brachen. Er schildert ihn ausführlich als einen herrlichen, großen und starken, wohlproportionierten Mann mit einem großen Kopf voll krausen Haars, mit breitem Gesicht, dicken Lippen, einer breiten, in der Mitte eingedrückten Nase, hoher Stirn und großem Kinn. »Und stund auf seinen Beinen«, schrieb er, »als ein Löwe und hatte gütliche Geberde zu seinen Freunden. Und wann dass er zornig war, so paußten und flodderten ihm seine Backen und stunden ihm herrlich und weislich und nit übel. Dann der Meister Aristoteles spricht: non irasci in quibus oportet insipientis esse.«
Von seinem Landesherrn Gerlach III. rühmte er, dass er scharf in Reden und Rat, rasch und heiter sei. Mit Wohlgefallen beschrieb er die jeweils üblichen Kleidermoden und zeichnete die Lieder auf, die gerade gesungen wurden. Die besten Lieder der Welt in Wort und Melodie, denen keine anderen gleichkämen, habe ein aussätziger Barfüßermönch gemacht, der auf einer Insel im Main gelebt habe, und er führt seine Verse an: »Mai, Mai, Mai, du wonnigliche Zeit Männiglichen Freude gibt ohne mir; was meinet das?"
Nach Tilemann Elken schrieben in Limburg Johann Gensbein, Georg Emmel und Johann Mechtel Chroniken. Der letztere war zu Pfalzel bei Trier geboren, wurde in Eltz bei Limburg Pfarrer und hatte um das Ende des 16. Jahrhunderts eine Kanonikerstelle im Limburger Georgenstift, wo er Musse fand, seiner Lieblingsbeschäftigung, historischen Studien, nachzugehen. Er schrieb nicht wie Tilemann Elken zu einer Zeit, wo Burg, Stift und Stadt in Freuden und Ehren standen, sondern zur Zeit des Niedergangs, der Verarmung und verminderten Selbständigkeit. Nachdem der braune, schwarzlockige Gerlach III. gestorben war, dem seine kinderlose Frau drei Wochen später in den Tod folgte, musste sein jüngerer Bruder Johann, der für den geistlichen Stand bestimmt und Domherr von Köln und Trier war, sich entschließen, die Herrschaft zu übernehmen, wozu die Erlaubnis des Papstes glücklich erwirkt wurde. Er war seinem dunklen und raschen Bruder ganz ungleich, sein Haar war gelb wie Goldfäden, so berichtet Tilemann, er war gütlich im Sprechen und in Scherz und Ernst weise. Erst nach zwanzig Jahren entschloss er sich, zu heiraten, blieb aber kinderlos, so dass nach seinem Tode das ganze Limburger Gebiet an Trier fiel.
Einst hatte die Stadt als eine ebenbürtige Macht sich mit den Erzbischöfen verbündet, um Friedensstörer oder beeinträchtigende Gegner zu bekämpfen. Viele Fehden hatte die Stadt allein geführt, so mit dem Ritter Johann von dem Stein, mit dem Ritter Emerich Rudel von Reiffenberg, mit dem Knappen Rüdiger von Wanscheid, mit dem Grafen Gerhard VI. von Diez. Rasch und roh war die Bevölkerung, aber voll Kraft. Corz Noide, Bürgermeister von Limburg, führte einst einen Dieb auf der Mauer zum Katzenturm. Bei der Dietzer Pforte sprang der Dieb, den Bürgermeister mit sich reißend, die Mauer hinunter. Der Bürgermeister starb nach acht Tagen, der Dieb wurde sofort gehängt, weil er sonst ehrlich gestorben wäre. Warum, fragte sich oft der nachdenkliche Schilderet seiner Zeit, Johannes Mechtel, ist die blühende Stadt so sehr herabgekommen? Es möchte sein, dass das Stift zu einem Teil den städtischen Reichtum aufgesogen habe, da die Patrizier nicht müde wurden, es mit Altären und Stiftungen zu begaben; dann sei der Adel nach dem Aussterben der Isenburger weggezogen und habe der Stadt Limburg ihre verfallenden Mauern und die Namen ihrer Höfe überlassen. Er führt den Westerburger, den Ottensteiner Garten an, die Gärten der Spechten von Bubenheim, der Diez, der von Staffel, der Reiffenberger, der Kronberger, der Wanscheid, der Walderdorff: leere Häuser, verwilderte Stätten. Die Sage bildete sich, dass angesehene Geschlechter nach Frankfurt gezogen wären und dadurch den Aufschwung Frankfurts bewirkt hätten, wovon noch das Haus Lympurg in Frankfurt, das Gesellschaftsbaus der vornehmen Frankfurter, neben dem Römer, Zeugnis ablege. Andere Familien wären verarmt und unter die Bürger gesunken; aber doch, wenn der Chronist die Menge der einst in Limburg blühenden reichen Geschlechter bedenkt, so kann er nicht fassen, wohin sie alle mit Gut und Blut gekommen sein sollen. Er führt noch viele Namen von altem edlem Klange an; ist es wahr, wie man sagt, dass sie nach einem großen Brande ausgewandert sind? Es will ihn bedünken, dass es damit nach dem Laufe der Natur oder nach dem Worte der Schrift gegangen sei, dass der Mensch aufgehe und hinfalle wie eine Blume; so wären auch diese gestorben und verdorben. »Vor Zeiten waren sie an Stamm und Namen, von Ehren und Gut berumt und weit bekant, jetzo seint nit wol die malzeiten irer haus und hof zu finden.«
Wetzlar
Seit dem Jahre 1495 waltete das Reichskammergericht in Speyer, das bestimmt war, auf dem Wege gerichtlichen Prozesses zu schlichten, was bis dahin mit dem Schwerte ausgemacht wurde.
Nicht mehr heftete der Ritter, dessen Knecht eine Stadt abgefangen und in den Turm gelegt hatte, den Fehdebrief an ihre Tore; die Reichsstände, die beide auf das gleiche Gebiet Erbansprüche zu haben behaupteten, überzogen sich nicht mehr mit Krieg, sondern warteten auf die Entscheidung des Kammergerichts, meist sehr lange. Als die französischen Raubkriege am Ende des 17. Jahrhunderts die Pfalz bedrohten und schließlich verwüsteten, sah sich das erschreckte Reichskammergericht nach einer anderen Stätte um, wo es sich niederlassen könnte und wo es gesichert wäre. Es eignete sich dazu nur eine Reichsstadt, und zwar eine von Frankreichs Grenze hinreichend entfernte; man wies darauf hin, dass im 15. Jahrhundert, als man Speyer bezog, Lothringen, Elsass, die Freigrafschaft und sogar das Erzbistum Besançon, damals Bisonz, noch zum Reich gehörten und die Pfalz deckten. Die Städte, an welche man zunächst dachte, verlockte die Aussicht, das Kammergericht zu beherbergen, durchaus nicht; denn sie fürchteten die Einmischung der hochgeborenen Herren, die demselben vorstanden, in ihr Regiment. Frankfurt, Schweinfurt, Augsburg, Memmingen widersetzten sich nachdrücklichst; in Mühlhausen in Thüringen und Dinkelsbühl war die Bürgerschaft dem Plane geneigt, nicht aber der Rat. In Friedberg und Wetzlar lagen die Dinge anders; da war kein hochmütiges Patriziat, auf nichts als auf seine Alleinherrschaft bedacht, da bestand der Rat aus kleinen Kaufleuten und Handwerkern, welche froh waren, durch den Zuzug vieler wohlhabender Familien ihre Einnahmequellen zu vermehren. Die verschiedenen Kommissionen, welche Wetzlar in Augenschein nahmen, stellten fest, dass die Bürgerschaft 400 Mann stark sei, worunter nicht über 20 Katholiken wären; die Nahrung der Bürger sei Ackerbau, Viehzucht und Tabaksbau, das übliche Getränk Bier, Wein werde wenig getrunken. Sie lobten Luft und Wasser als gesund, die wohlfeilen Preise und die Obst- und Gemüsegärten, welche die Stadt umgäben, auch drei Apotheken und zwei Ärzte gebe es. Dagegen wären die Häuser mit Stecken geflochten und mit Lehm übertüncht, meist mit Stroh bedeckt und ohne Brandmauern, was Feuersgefahr bedeute, und das Wasser müsste bei Feuersbrünsten von der Lahn heraufgeschafft werden. Nur wenige Häuser wären aus Stein oder hätten steinernes Erdgeschoß, auch hätten sie nicht einmal rechte Küchen und gemauerte Schornsteine. Da die meisten Zimmer der Erdgeschosse zu ebener Erde wären, herrschte Feuchtigkeit, und wegen der Pferde, Rinder und Schweine, die die meisten Bürger hielten, übler Geruch. Die Straßen wären teils gar nicht, teils schlecht gepflastert und sehr unflätig. Es sei ferner keine Post vorhanden, die Briefe müssten zur Beförderung nach Gießen getragen werden, mit der Kaufmannschaft sehe es schlecht aus, es mangle an geschickten Handwerkern und an allerlei Gewerbe. Die Schulen wären so schlecht, dass man die Kinder schon im zarten Alter auf auswärtige Schulen würde schicken müssen. Die Stadt liege an einem Abhang, so dass das Fahren in Kutschen beschwerlich und bei Schnee und Glatteis auch das Gehen für nicht wohlgeübte Fußgänger gefährlich sein würde. Kurz, Wetzlar sei, obwohl eine Reichsstadt, so gar unansehnlich, dass das Kammergericht ohne Verminderung der ihm gebührenden Achtung und selbst ohne Nachteil der Hoheit des Heiligen Römischen Reichs darin nicht wohnen könne. Niemand erwähnte die liebliche Lage der hügelumgebenen Stadt, die uns so anzieht; ein Kammergerichts-Prokurator schilderte Wetzlar »als einen bergigten, nahe an einem unfreundlichen Himmel gelegenen Ort, als einen nicht durch den Geist ihrer Bürger, sondern durch die Beschaffenheit eines von der Natur stiefmütterlich behandelten Bodens fast unwirtlichen Aufenthalt, des verjagten höchsten Reichsgerichts letztes Los und rauer Wohnsitz«.
Es scheint indessen, dass diese schonungslosen Urteile etwas übertrieben und von Katholiken ausgegangen waren, die ein Missfallen an der wesentlich protestantischen Richtung der Stadt hatten; denn als der Stadtrat sich bereit erklärte, den Franziskanern mehr Platz anzuweisen, ihnen das Almosensammeln zu gestatten, öffentliche Prozessionen in wie vor der Stadt zu erlauben, ja sogar die Jesuiten aufzunehmen, milderte sich der Widerstand sichtlich, und als der beflissene Magistrat außerdem noch Abschaffung der Strohdächer und Reinhaltung der Straßen und Plätze versprach, kam es zur Einigung. Eine dringende Einladung von Seiten Dinkelsbühls führte nur zu einem Wechsel von Schmähschriften zwischen den beiden Städten. Im Jahre 1693 konnte das Kammergericht in Wetzlar feierlich eröffnet werden, wobei der Erzbischof von Trier vom Thron herab eine Rede hielt. Anstatt jedoch die Streitigkeiten anderer zu entwirren, gerieten die Herren untereinander in schwere Misshelligkeiten, die durch die Willkür und den Hochmut des älteren Präsidenten, Freiherrn von Ingelheim, genährt wurden. Es bildeten sich zwei Parteien, deren Mittelpunkt auf der einen Seite Ingelheim, auf der anderen der jüngere Präsident, Reichsgraf von Solms-Laubach, war. Während Ingelheim beschuldigt wurde, den Lauf der Gerechtigkeit zu hindern, klagte Graf Nytz von Wartenberg, ein Anhänger des Ingelheim, den Grafen Solms der Parteilichkeit an. Ingelheim drohte, einem Herrn von Pyrk den Degen in den Leib zu stoßen, und Nytz ging so weit, zu erklären, dass Pyrk von seiner Hand sterben müsse, sei es auch in der Kirche. Kam es dazu auch“ nicht, so beschlagnahmte doch die Ingelheimsche Partei die Besoldung des besonders verhassten Pyrk. Dieser scheint allerdings ein sehr bissiger, dabei nicht unwitziger Mann gewesen zu sein; er ließ das kaiserliche Reskript, das zu seinen Gunsten sprach, drucken und setzte ihm als Motto den Vers aus den Psalmen vor: »Große Farren haben mich umgeben, fette Ochsen haben mich umringt, ihre Rachen sperren sie auf wider mich wie ein reißender und brüllender Löwe.« Er nannte ferner den Kammergerichts-Prokurator Flender, der zur Ingelheimschen Partei gehörte, vor Zeugen einen Schelmen und galgenwürdigen Gaudieb. Schelm und Dieb waren offenbar die damals unter Kavalieren üblichen Schimpfworte. Flender schob die von Pyrk gegen ihn ausgestoßenen Beschimpfungen zurück und erklärte, ihn so lange für einen galgenwürdigen Schelmen halten zu wollen, bis Pyrk entweder ihm ein galgenmäßiges Schelmenstück nachweise oder die ausgestoßene Beleidigung widerrufe. Pyrk unterließ beides. Inzwischen war vollständiger Gerichtsstillstand eingetreten, und die ruhigen Elemente verlangten nach einer außerordentlichen Visitation, die der Sache ein Ende mache.
Es begab sich um diese Zeit, dass ein marktschreierischer Zahnarzt mit einer Truppe von Gauklern und Seiltänzern nach Wetzlar kam und seine Bühne auf dem Marktplatz, dem alten Rathause gegenüber, aufschlug, welches der entgegenkommende Rat dem Kammergericht abgetreten hatte. Die Gaukler führten eine Posse auf, worin als Hauptperson ein Richter figurierte, der, feierlich mit dem Zepter in der Hand, auftrat, um einen Prozess zu führen, aber der Bestechung zugänglich war und zuletzt offener Verhöhnung anheimfiel, indem der Hanswurst die Kleider mit ihm tauschte und sich statt seiner auf den Richterstuhl setzte. Graf Solms-Laubach, der als Biedermann geschildert wird, sah die Posse für eine heillose Satire an, die das Kammergericht verspotte, und beschuldigte den älteren Präsidenten, Freiherrn von Ingelheim, der Aufführung mit Wohlgefallen zugesehen und sogar die Gaukler beschenkt zu haben. Mit Hilfe des Kaisers setzte er durch, dass der Schauspieldirektor und Zahnarzt, es war Joh. Eisenbart, seine Bühne vor dem Rathause abbrechen und an einer anderen Stelle aufrichten musste.
Inzwischen hatte Herr von Pyrk verschiedene Streitschriften drucken lassen mit langen Titeln, von denen der eine anfing »Gedämpftes Ehrengift«, der andere »Pyrkisches Echo oder Widerhall, d. i. abgedrungene Retorsion und Ehrenrettung«; er erklärte in der letzteren die ganze Ingelheimsche Partei für galgenmäßige Schelme. Die Kammergerichts-Visitation, die endlich in Wetzlar eintraf, verlangte zuerst von allen, die einander beschimpft hatten, die Beschimpfungen zu beweisen; das veranlasste neue Schriften, über deren Verfassen und Drucken wieder lange Zeit hinging. Die Untersuchung schloss damit, dass Ingelheim und Nytz freigesprochen wurden, Pyrk dagegen wurde seiner Stelle entsetzt, und seine Schmähschriften wurden vor seinen Augen durch den Kammergerichts-Pedellen zerrissen und ihm vor die Füße geworfen. Es war eine für die Sieger vielleicht nicht ganz so befriedigende, aber für das Opfer leidlichere Rache, als wenn man ihm, wie es vor 100 Jahren wohl geschah, das Herz aus dem Leibe gerissen und ins Gesicht geschmissen hätte. Übrigens hatten die Visitatoren wohl den Auftrag gehabt, den Freiherrn von Ingelheim zu schonen; denn Pyrk wurde bald darauf »wegen seiner beim Reichskammergericht bewiesenen Treue und nützlichen Dienste und im Hinblick auf seine bekannten guten Eigenschaften« zu einem böhmischen Oberappellationsrat auf der Herrenbank ernannt. Im Jahre 1711 wurde nach siebenjährigem Stillstand das Gericht wieder eröffnet. Fast wäre der Streit sofort aufs Neue ausgebrochen, weil die Abgeordneten des gräflich wetterauischen Collegii und des Collegii der Prälaten in einem mit 6 Pferden bespannten Wagen zu fahren beanspruchten wie die Abgeordneten der Reichsfürsten; aber es gelang, den Unfrieden im Keime zu ersticken. Seit die Fehden im Reich nicht mehr mit dem Schwert, sondern mit dem Wort ausgefochten wurden, waren ihrer nicht weniger geworden, und der Verzicht auf die Selbsthilfe hatte die Menschen zwar äußerlich gesitteter, aber weichlicher, kleinlicher und würdeloser gemacht; man begreift, dass ein Jerusalem in dieser Umgebung zum Selbstmord kam und dass der Freiherr vom Stein ihr angewidert den Rücken wandte.