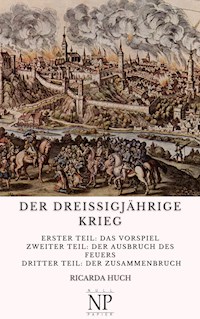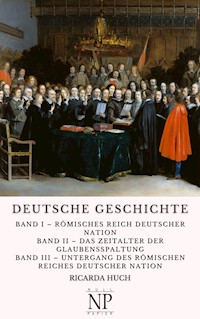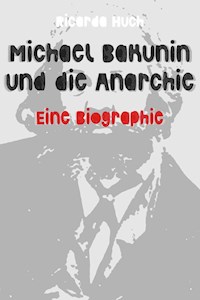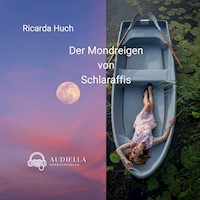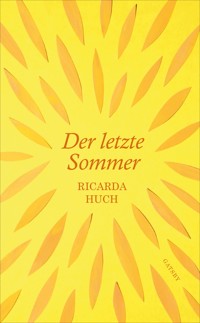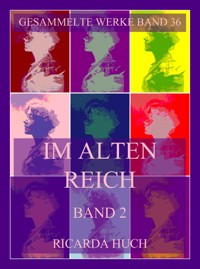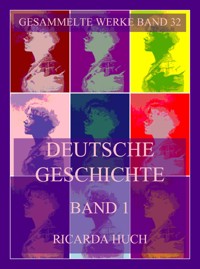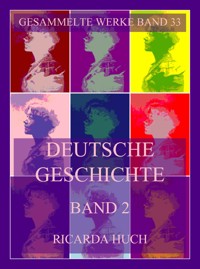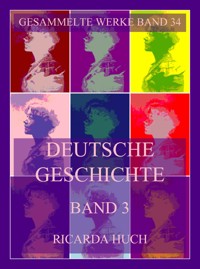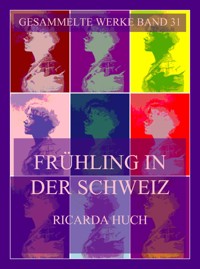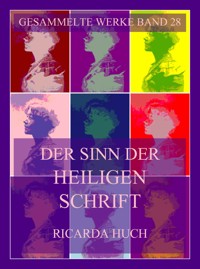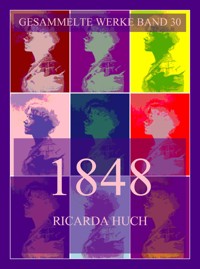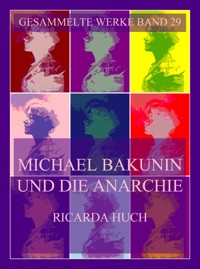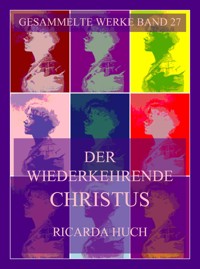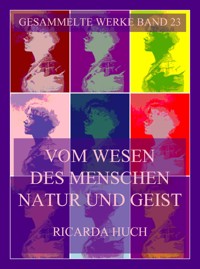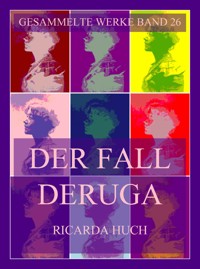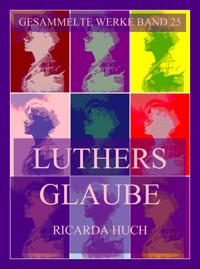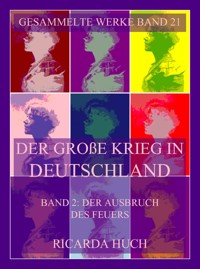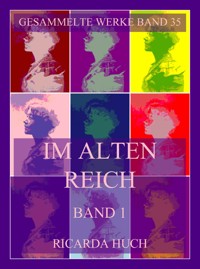
7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Jazzybee Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Die deutschen Städte – pulsierende Zentren des Handels, Schauplätze religiöser Kämpfe, Wiegen bürgerlicher Freiheit und künstlerischer Blüte. In ihrem monumentalen Werk mit fast 70 Bildern dieser Städte erweckt Ricarda Huch das urbane Leben unserer Heimat zu neuem Leben. Mit der Kunst einer großen Erzählerin und dem Scharfsinn einer brillanten Historikerin führt uns Huch durch die Gassen und über die Marktplätze von Nürnberg, Augsburg, Lübeck, oder Köln, und uns teilhaben am Alltag der Handwerker und Kaufleute, an den Intrigen der Ratsherren, an den Konflikten zwischen Zünften und Patriziern. Wir erleben die Städte als Orte, wo sich die großen Umwälzungen der Zeit – Reformation, Glaubenskriege, wirtschaftlicher Wandel – im konkreten Leben der Menschen widerspiegeln. Aber Huchs "Lebensbilder" sind weit mehr als historische Darstellung: Sie sind literarische Porträts voller Atmosphäre und psychologischer Tiefe, die uns die Vergangenheit unmittelbar erfahrbar machen. Ob sie von den stolzen Hanseaten erzählt, von den kunstsinnigen Augsburger Fuggern oder vom freiheitsliebenden Geist der Reichsstädte – stets verbindet sie historische Präzision mit erzählerischer Lebendigkeit. Ein unvergleichliches Panorama deutschen Stadtlebens zwischen Mittelalter und Neuzeit – geschrieben von einer Autorin, die wie keine andere Geschichte zum Leben erwecken konnte. In dieser zweibändigen Ausgabe finden sich auch die Beschreibungen, die sonst typischerweuse nicht beinhaltet sind. Dies ist Band 1 mit 34 Bildern.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 547
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Im alten Reich
Lebensbilder deutscher Städte, Band 1
RICARDA HUCH
Im alten Reich, Band 1, R. Huch
Jazzybee Verlag Jürgen Beck
86450 Altenmünster, Loschberg 9
Deutschland
ISBN: 9783988682529
www.jazzybee-verlag.de
INHALT:
Münster1
Osnabrück. 15
Enger in Westfalen. 23
Paderborn. 26
Lemgo. 36
Soest41
Dortmund. 55
Xanten. 62
Hameln. 67
Goslar76
Hildesheim... 88
Braunschweig. 102
Halberstadt112
Quedelinburg. 122
Lüneburg. 129
Stendal139
Tangermünde. 148
Lübeck. 156
Wismar169
Neubrandenburg. 174
Prenzlau. 178
Güstrow.. 181
Stralsund. 190
Ratzeburg. 200
Rostock. 205
Aachen. 214
Köln. 221
Manderscheid. 232
Trier235
Oberwesel246
Bacharach. 251
Mainz. 256
Oppenheim... 267
Frankfurt am Main. 272
Münster
Die Sachsen nahmen endlich, weniger dem Zwange sich fügend, als weil sie sich mit dem neuen Glauben befreundeten, das Christentum an, das sie nicht hinderte, kriegerisch, furchtlos, stolz, trotzig und freiheitsliebend den Menschen gegenüber zu sein. Besonders die Westfalen bewahrten ihren Charakter. Hier gab es, als im Reich das Land fast ganz versklavt war, noch freie Bauern, die sich der Würde ihres Standes bewusst waren und ihre alten Knechte hüteten. Hier ist eigensinnig leidenschaftliches Festhalten am alten Glauben; aber von hier gingen auch zu jeder Zeit Vorkämpfer neu zu erobernder Freiheit aus, unbeugsame und gelassene.
Von allen Städten Westfalens ist Münster die vornehmste, ja in ganz Deutschland gibt es keine, die ihr darin gleichkommt. Den Panzer der Mauern und Türme hat sie abgeworfen; nur zwei Zeugen mittelalterlicher Wehrhaftigkeit sind noch vorhanden: der Buddenturm, ein Gespenst alter Zeit inmitten neuerer Straßen, und der Zwinger, ein prachtvoller zyklopischer Rundbau, den ein Wappen, ein paar Fenster und eine Treppe beleben, und dem ein bequemes Ziegeldach eine Wendung ins Gemütliche gibt. Das häusliche Gewand jedoch, das die Stadt jetzt trägt, hat noch etwas von einer Rüstung: es ist streng im Schnitt, und die Juwelen, die es schmücken, drängen sich dem Blick nicht auf. Die Häuser sind im Allgemeinen schlicht, aber auch die ärmlichen sind nicht schäbig oder ordinär, und auch die reichen sind zurückhaltend.
Da, wo das Ganze zum Ausdruck kommen soll, wird Pracht entfaltet, aber die Noblesse der Linie kühlt sie. Hat der Giebel des Rathauses etwas Flammendes, so hat er auch das Unnahbare dieses Elements; der Farbenton des Backsteins, der vielfach zur Verwendung kommt, ist eine burgunderdunkle Glut, ein Feuer, das Stolz gedämpft hat. Wo irgend Überschwang erscheint, wirkt er nicht als Sichgehenlassen, sondern als eine Schönheitsfülle, zu der Adel und Reichtum verpflichten. Münster ist eine Stadt, in deren Wappen man die Worte schreiben möchte, die im Gildensaale des Krämeramtshauses über dem Kamine stehen: Ehr is dwang nog (Ehre ist Zwang genug). Der Freie, und das ist nach der damaligen Auffassung der Edle, erträgt keinen Zwang; aber er zwingt sich selbst.
Wäre es möglich, dass dieser Wahlspruch beständig wirkte, würden die Ordnungen des Lebens nicht durchbrochen werden; aber überall, auch in den Beherrschten, sind unterirdische Kräfte verborgen, die darauf warten, ihre Fesseln titanisch zu brechen. Nicht nur die oft fehlerhaften, verwerflichen Einrichtungen der Welt werden bald mit Recht, bald widerrechtlich umgeworfen, auch der harmonische Kosmos, der uns trägt, ist wilden, zerstörenden Kräften abgerungen und immer durch sie bedroht. Jähe Ausbrüche solcher Art, wo sich ideale Feindseligkeit gegen schlechte weltliche Ordnungen mit der Feindseligkeit gegen ordnende Vernunft überhaupt verbindet, erscheinen da am grellsten, wo beharrende Gesinnung und gemessenes Wesen landesüblich ist; zugleich sind sie da am leichtesten zu erklären.
Der alte Name für die Stätte am Münster war Mimigerneford, das heißt Furt am Hügel des Mime. Die Furt bezieht sich auf das Flüsschen Aa, dessen alter Name Ahwa Wasser bedeutet, und Mime hieß wahrscheinlich der Gott, der auf der Anhöhe angebetet wurde. Die erste Besiedelung der Gegend bestand aus vier großen Höfen, die Karl der Große bei der Gründung des Bistums dem Bischof schenkte. Sie hatten freien Bauern gehört, die in den Sachsenkriegen gefallen oder vertrieben sein mochten.
Im elften Jahrhundert verschwand der altgermanische Name Mimigerneford vor dem Namen Münster, der ursprünglich nur für das Monasterium galt, sei es nun, dass die erste klösterliche Niederlassung des heiligen Ludger oder das Kloster Überwasser, jenseits der Aa, damit gemeint war.
Nach dem Tode Karls des Großen bildeten sich die großen Herzogtümer auf der Grundlage der Stämme, und das Bistum Münster wurde Glied des sächsischen, trotz persönlicher Anhänglichkeit der Bischöfe an die jeweiligen Kaiser wenig hineingezogen in die allgemeinen Angelegenheiten des Reichs. Das änderte sich, als infolge des Sturzes Heinrichs des Löwen das Herzogtum Sachsen zerschlagen wurde und, da es dem Erzbischof nicht gelang, sich in Besitz des Ganzen zu bringen, eine Anzahl einzelner Gewalten entstand, von denen jede aus der großen Beute so viel wie möglich an sich riss. Die Bischöfe von Münster wurden selbständige Landesherren und breiteten sich nach Kräften aus, wobei sie auch innerhalb des Gewonnenen auf Widerstand stießen. Ging auch die Gerichtsgewalt des Herzogs zum Teil auf sie über, so blieben doch immer einige Freigerichte, die ursprünglich nur vom König, dann vom Herzog von Sachsen abhingen, der sie erblich zu belehnen pflegte. Der Umstand, dass die freien Gerichte vor Unterwerfung auf der Hut sein mussten, bewirkte, dass sie sich in das Dunkel des Geheimnisses zurückzogen und schließlich zu einem Geheimbunde wurden, der den Namen Feme führte. Im Anschluss an den Erzbischof von Köln als obersten Stuhlherrn erhielt die Feme kaiserliche Bestätigung und trat mit dem Anspruch auf, für die Freien im ganzen Reich zuständig zu sein. So erhielt sich auf altsächsischem Boden das alte germanische Recht, in dunkle Bräuche vermummt, von Edelleuten und Freien getragen, halb heilig, halb verbrecherisch, so wie überwundene Götter zu schreckenden Dämonen werden. Auch die Stadt Münster war Inhaberin einer Freigrafschaft, was umso wichtiger war, als zur Zeit der Landfriedensbündnisse hauptsächlich den Freigrafen und Freischöffen die Ausübung der Landfriedensgerichte zugewiesen war.
Das Weichbild Münsters, das um den alten ummauerten Domhügel herum erwachsen war, erhielt gerade um die Zeit, als die neuen Verhältnisse sich ausbildeten, Mauern und Stadtrecht. Ihr Recht nahmen sie von dem älteren Soest. Es begann ein rascher Aufstieg durch Handel und im Anschluss an die Hanse. Nach dem fernen Osten hatten Bürger von Münster früh Beziehungen; in Riga hieß das Versammlungshaus der Kaufmannsgilde »Die Stube von Münster«. Zum Schutz der Märkte und der reisenden Kaufleute verbündete sich Münster zuerst mit dem nahen Osnabrück, dann auch mit Soest, Dortmund, Lippstadt, den bedeutendsten westfälischen Handelsstädten. Aus den Handelsbündnissen wurden solche zu Schutz und Trutz; ein mit dem Domkapitel zu gegenseitiger Aufrechterhaltung ihrer Rechte geschlossenes wendet sich sogar gegen den Bischof, von dem sich das Kapitel ziemlich unabhängig gemacht hatte. In dem großen Landfriedensbunde von 1298, an dessen Spitze der Erzbischof von Köln stand, waren auch die drei Städte Münster, Soest und Dortmund vertreten. Zu dem den Vorsitz führenden Friedensgericht entsendete Münster seine Bürger Heinrich Rike und Bernhard Kerkering als Abgeordnete. Bischof Ludwig II., ein Landgraf von Hessen, verbrauchte zu kriegerischen Unternehmungen so viel Geld, dass er sich genötigt sah, einem Bürger von Münster, Bernhard von Cleyhorst, die weltliche Gerichtsbarkeit auf beiden Seiten der Aa zu verpfänden.
Das Regiment der Stadt lag im 13. und 14. Jahrhundert unbeschränkt in den Händen einiger Familien, sogenannter Erbmänner, die sich adliger Abkunft rühmten und wohl größtenteils im Dienst des Bischofs heraufgekommen waren. Es waren die Grael, die Nysing, Rike, Kerkernitz, Schenking, Cleyhorst, Bischopink, Droste, Aldebrandink, Schevenink, Deckenbroch, Tilbeck, von Wyk und andere, die als Bürgermeister und Schöffen immer wieder begegnen.
Das Domkapitel, das im Jahre 1392 beschlossen hatte, nur Leute von mindestens ritterbürtigem Stande aufzunehmen, lehnte im 16. Jahrhundert einen Schenking ab, was die Erbmännerfamilien zu dem Versuch bewog, ihre Ritterbürtigkeit zu beweisen. Nach langen Verhandlungen, die erst vor dem päpstlichen Gerichtshof von Rom, dann vor dem Reichskammergericht in Speyer geführt wurden, erklärte Kaiser Leopold I. die Erbmänner für rittermäßig und mit dem Landadel gleichberechtigt, welches Urteil nochmals angefochten und 1709 nochmals bestätigt wurde. Diese Unsicherheit erklärt sich daraus, dass der Adel sich erst im späteren Mittelalter als Stand abschloss, als die Handwerker eine Macht wurden. In Münster waren Münster die in Gilden zusammengeschlossenen Handwerker von demselben freiheitstolzen und unbeugsamen Geiste beseelt wie der Adel. In der Mitte des 15. Jahrhunderts erlangten die Gilden das Recht, die Beschlüsse des Rates zu genehmigen; damals ließ sich ein Graf von Hoya, der seinen Bruder auf den Bischofssitz bringen wollte, in die Schmiedezunft aufnehmen, weil er durch den Beistand der Gilden eher zum Ziele zu kommen hoffte. Die zweite Hälfte des 15. Jahrhunderts, wo die Individualitäten, welche Münster bildeten, der Bischof, das Domkapitel, die Erbmänner oder der Stadtadel und die Gilden, gleich kräftig sich entfalteten, war für die Stadt die Zeit der Blüte. Mehrere auf Universitäten gebildete Männer hatten die neuen, humanistischen Ideen aufgenommen und machten Münster zu einem Mittelpunkt des geistigen Lebens. Ihr Führer war Rudolf von Langen, der in Italien studiert hatte, und dessen lateinische Dichtungen in einer Buchdruckerei erschienen, die der Buchdrucker Johann Limburg aus Trier in Münster errichtete. Alexander Hegius und Anton Liber aus Soest waren in der Wissenschaft bekannte Namen. Ein Freund Huttens und eine ihm verwandte Natur war Hermann von dem Busche, der mit jenem zusammen an den Dunkelmännerbriefen gearbeitet hat. Sie fanden zum Glück Verständnis bei dem Bischof Konrad von Rietberg, so dass eine Neugründung der alten Domschule im humanistischen Sinne von ihm nicht gehindert wurde. Die Schule, an der die griechische Sprache gelehrt wurde, genoss solchen Ruf in Deutschland; dass sich zeitweise 4000 Studenten in Münster aufgehalten haben sollen. Ebenso wie die Wissenschaft wurden die bildenden Künste gepflegt. Die herrlichen Giebelhäuser am Prinzipalmarkt tragen das Gepräge gesicherten Wohlstandes und begründeten Selbstbewusstseins. Die reiche Ausstattung der Gotteshäuser, des weihevoll dämmrigen Doms, der glänzenden Lambertikirche, haben die Wiedertäufer entfernt. Eine Anzahl neuerdings ausgegrabener Sandsteinfiguren, die ihnen als Fundament von Bastionen dienen mussten, befinden sich jetzt im Museum; nicht ohne Grauen geht man an den toten, heimatlosen, verstümmelten Gestalten vorüber. Drei Glasgemälde von besonderer Schönheit bilden die größte Zierde des Dominnern: die Kreuzigung, die Abnahme vom Kreuz, die Grablegung und Kreuztragung. Das Braun des Mantels Christi auf der Kreuztragung und das tiefe Rot des andern, der auf dem Kreuzigungsbilde unter dem Kreuze liegt, durchdringen die tragischen Darstellungen mit überirdischer Glut. Sie sind gezeichnet von einem Gliede der Malerfamilie to Ring, die im 16. Jahrhundert arbeitete und deren Werke in Auffassung und Farbengebung durch ernste, vornehme Haltung charakterisiert sind.
In dies Gebäude einer Kultur, die vorzüglich das Schöne pflegte, schlugen plötzlich aus einer Tiefe, von deren Dasein die Glücklichen der Welt für gewöhnlich nichts spüren, Flammen. Unterhalb der Ordnung, die ein Volk sich gegeben hat, die ein Geschlecht dem andern überliefert und die von Siegern und ihren Erben getragen wird, hausen im Dunkel die, welche unterlagen, sei es durch Schwäche oder durch Torheit oder durch Krankheit und Schicksal. Sie nehmen nicht teil an dem Glanze, der Üppigkeit, den edlen oder schlechten, nützlichen oder überflüssigen Bestrebungen der Oberwelt, sie brüten wirre, schwärmerische, tiefe Gedanken aus, die am Lichte wunderlich wie Gedanken von Narren erscheinen. Was kümmern sie die kunstvollen Gemälde, die droben mit Gold aufgewogen werden, die Gesetze der hebräischen Sprache, die griechischen und römischen Versmaße? Sie wollen einfache Dinge: Brot, Licht, Gesundheit, Gerechtigkeit. Sie hassen die Welt, die sie ausstößt und mit Füßen tritt; sie wollen sie zerstören und eine gute, reine, göttliche aufbauen, so wie sie in der Glücksferne sie sich geträumt haben. Ihnen kommen Gute und Gerechte mit offener Hand entgegen, ihnen gesellen sich diejenigen, die von der Grausamkeit, der Hohlheit, der Unzulänglichkeit, der Verderbtheit in der herrschenden Welt angeekelt sind und diejenigen, die den Boden unter sich wanken fühlen und hoffen, bei einem allgemeinen Erdbeben, wo sich alles verschiebt, wieder hinaufzukommen und festen Platz zu gewinnen.
Einer Gesellschaft, deren obere Schichten im Allgemeinen entweder sinnlichen Genuss oder ästhetischen Genuss für das höchste Gut hielten, rief Luther mit dem vollen Klang des Glaubens und der Entrüstung das Wort Gottes zu, warf er ein Buch hin wie ein Schwert, die Bibel. Wie überall nahmen auch in Münster einige Geistliche die lutherische Lehre an; aber es gelang den Gegnern ihre Vertreibung durchzusetzen, und auch ein Überfall des Volkes auf verschiedene Klöster, die durch den Betrieb von Gewerbe, der nur den städtischen Gilden zustand, die Eifersucht der Handwerker gereizt hatten, blieb unter der Vermittlung des Erzbischofs von Köln ohne Folgen. Indessen war der neue Glaube einmal unter der Bürgerschaft verbreitet; als ein Bürger namens Anton Kruse deswegen vor ein bischöfliches Gericht gezogen wurde, befreite ihn ein Volksauflauf. An der Spitze desselben stand ein den besseren Kreisen angehöriger Mann, der Tuchhändler Bernhard Knipperdolling, dessen Haus mit gotischem Giebel am Markte noch steht. Seine Vermögensverhältnisse waren in Unordnung geraten, vielleicht infolge einer gewissen Untüchtigkeit und Zerfahrenheit, die ihn zu beharrlicher Arbeit untauglich machten. Er war dreist, furchtlos und witzig und liebte es, sich von unruhig bewegten Lebenswogen tragen zu lassen. Seine Verspottung des regierenden Bischofs Friedrich von Wied, der dazu viel Anlass gab, fand freudigen Beifall im Volke, das überhaupt den Geistlichen, die in Münster so zahlreich waren und sich so viele Blößen gaben, von jeher abgeneigt war. Bischof und Stadtrat hielten zur Aufrechterhaltung der Ordnung noch zusammen: Anton Kruse wurde vom Rat aus der Stadt gewiesen, Knipperdolling vom Bischof in Haft genommen, aber einige Jahre später wieder entlassen. Die Lutherye, wie man die neue Lehre nannte, nahm trotzdem zu. Im Jahre 1529 wurde an der Mauritzkirche ein Mann von verhängnisvoller Wirksamkeit angestellt, Bernd Rothmann, der Sohn eines Schmiedes aus Stadtlohn, klug, energisch, von hinreißender Beredsamkeit. Er verstand es, die Massen zu führen, wohin er wollte; dadurch entstand vielleicht das Gerücht, er habe im Elternhause die Zauberei erlernt.
In feineres Gedankengeflecht verlor er sich nicht, für die Widersprüche des Lebens hatte er keinen Sinn, er ging mitten durch bis aufs Äußerste und wurde darum so gut vom Volke verstanden. In Wittenberg wurde er mit Luther und Melanchthon bekannt; wie verschieden er von beiden war, fiel damals, wo er noch wesentlich aufnehmend war, nicht auf. Inzwischen war der Bischof von Wied gestorben, und der neue, Franz von Waldeck, ein problematischer Charakter, verlangte Abstellung der Neuerungen vom Rat. Im Einverständnis mit Knipperdolling trat eine Versammlung der Gilden im Schuhhaus am alten Fischmarkt zusammen, dem Hause der Gesamtgilden, wo Heinrich Modersohn, der Gildenmeister der Metzger, und Heinrich Redeker von der Pelzergilde den Beschluss tatkräftigen Widerstandes durchsetzten. Die Haltung des Rats war stets durch das städtische Streben, sich vom Bischof möglichst unabhängig zu machen, bestimmt; sonst hätte er dem Drängen der Handwerker fester gegenübergestanden. Er entschloss sich nun, die bisherigen Geistlichen an allen Kirchen abzusetzen und evangelische zu berufen, Rothmann an die Lambertikirche, ferner den Münsterer Johann Glaudorp und den aus Kleve verwiesenen Brixius ton Norden. Nachdem die »Lutherye« in Münster eingerichtet war, verließen der Klerus und verschiedene Erbmännerfamilien die Stadt und nahmen in dem nahen Telgte Aufenthalt. Ein gelungener städtischer Überfall auf den Sitz der Emigranten führte zu einem Vergleich, in dem der Bischof der Stadt Religions- und Gewissensfreiheit zugestand, und beide Teile versprachen, einander weder in Worten noch in Taten anzufeinden.
Das war jedoch mehr, als Rothmann halten konnte; er wurde in seinen Ansichten und Zielen immer radikaler, sogar wiedertäuferischen Ideen sich zuneigend, die in Deutschland umgingen und namentlich im nahen Holland verbreitet waren. Der Gedanke, dass nur Erwachsene darüber entscheiden können, ob sie Christen sein wollen, leuchtet dem Verstand ein und findet deshalb Anhänger; er verkennt, dass die Kindertaufe ein Band der Gesamtheit ist, durch welches jedes neue Glied der christlichen Gesellschaft ohne weiteres angeschlossen wird, während die Wiedertaufe das Bestehen von den Entscheidungen der einzelnen abhängig macht und darum in Frage stellt. Erschüttern und auflösen wollten ja aber auch viele diese Gesellschaft, diese Weltanschauung, deren Mängel ersichtlich waren, und an deren guten Willen zu besseren sie nicht glaubten. Die erbarmungslose Verfolgung, die die Wiedertäufer überall erlitten, weil man das Auflösende ihrer Lehre spürte, schärfte die Erbitterung; nach einem Asyl suchend, wo sie nicht ersäuft oder verbrannt würden, fiel ihnen Münster auf als ein Ort, wo das Evangelium rein gelehrt würde. Von Holland, das mancherlei Einfluss auf Münster ausgeübt hat, sendete das Haupt der niedersächsischen Wiedertäufergemeinde, der Bäcker Johann Matthysson, Vertraute nach Münster, die die Gelegenheit auskundschaften und den Boden bereiten sollten. Matthysson gehörte zu den fanatischen, unklaren, erregbaren und erregenden, in Starrsinn und Verbohrtheit an Wahnsinn streifenden Menschen, deren viele in der Dunkelheit verborgen sind und die außergewöhnliche Vorfälle hervorlocken. Der brausende Geist der Bibel, die er auswendig wusste, hatte ihn berauscht; er fühlte sich als der Prophet, der berufen ist, die beleidigte Gerechtigkeit Gottes zu rächen. Was in Münster durch Rothmann schon entzündet war, fiel ihm zu, nicht nur niederes Volk, sondern auch Patrizier, darunter der eine der Bürgermeister, Hermann Tylbeck. Besonders Frauen ergriffen die neue Lehre mit Leidenschaft und traten unbedingt für sie ein. Unter den Abgesandten des holländischen Propheten war ein durch allerlei Gaben auffallender dreiundzwanzigjähriger junger Mann, Jan Bockeissohn, der uneheliche Sohn einer münsterschen Magd, Aleke, und des holländischen Schulten Bockei Geritsohn. Nach dem Tode beider Eltern wurde er von den Verwandten des Vaters aufgezogen, die ihn, vermutlich wegen seiner unehelichen Geburt auf einen höheren Beruf verzichtend, Schneider werden ließen. Ihm genügte das nicht; er erinnert an den im 19. Jahrhundert lebenden Schneider Weitling, den Sohn eines deutschen Mädchens aus dem Volke und eines französischen Offizier, schriftstellerisch begabt und von anziehender Persönlichkeit, der wie Jan Bockeissohn kommunistische Ideen lehrte und vertrat. Jan Bockeissohn, bekannt unter dem Namen Jan van Leyden, muss nicht ohne Mittel gewesen sein, denn er reiste in Frankreich, England, Deutschland, Portugal, erwarb sich Kenntnisse und trat unter anderem als Schauspieler auf. Vermutlich war ihm die Kunst angeboren, öffentlich aufzutreten und sich wirkungsvoll darzustellen. Seine Schönheit empfahl ihn den Menschen und besonders den Frauen; er war elegant gewachsen und das Bild, das der Maler Aldegrever von Soest im Auftrage des Bischofs von ihm herstellte, bevor er in den Kerker geworfen wurde, zeigt ein nicht nur schönes, sondern auch kluges Gesicht mit festem, kühlem Blick der Augen und einem reizvoll sinnlichen Munde, auf dem ein Zug von Überlegenheit und Verachtung liegt. Anfänglich blieb er im Hintergründe; Matthysson der Prophet und neben ihm Rothmann und Knipperdolling bemächtigten sich der Leitung der Stadt. Der Energie ihres Angriffs wusste der Rat keine gleichwertigen Mittel entgegenzusetzen; die Bewegung war wie Feuer, das, nicht sofort erstickt, um sich greift und unversehens so stark ist, dass man es nicht mehr löschen kann. Das Domkapitel, der Bischof, die Mehrzahl des Rats, viele Familien verließen die Stadt, dagegen zogen Wiedertäufer von Osnabrück, Soest, Wesel zu. Vor dem Rathause taufte Pfarrer Rothmann die zuströmenden Menschen, auch den Bürgermeister Tylbeck und zwei Angehörige der Erbmännerfamilie Krechting. Es galt nun das Gottesreich zu gründen, dessen Nähe gelehrt und geglaubt wurde, das Reich der Gerechtigkeit, in dem die Güter gleichmäßig an alle verteilt sind. Um jeden Widerstand auszuschalten, wollte der Prophet den Tod über alle verhängen, die sich nicht zum Zweck der Wiedertaufe beim Bürgermeister anmeldeten. Knipperdolling, der von weicherer Art war, rettete das Leben der Betroffenen, die anstatt dessen mitten im Winter, Ende Februar im Jahre 1534, bei schneidender Kälte aus der Stadt getrieben wurden. Ein Knabe befand sich unter ihnen, der später die Geschichte dieser grausigen und fabelhaften Ereignisse geschrieben hat.
Es gelang dem Bischof, ein Heer zur Bekämpfung der abgefallenen Stadt zusammenzubringen; denn nichts vereinigt Menschen aller Art so sehr zu gemeinsamem Hass, wie das Wort Gütergemeinschaft. Es zeigte sich aber nun, welche Kraft die Begeisterung für eine Idee in den Menschen erzeugen kann. Die Einwohnerschaft von Münster wurde zum Zwecke der Verteidigung organisiert: Schmuck und Kostbarkeiten wurden abgegeben und von dazu angestellten Beamten verwaltet, Lebensmittel möglichst sparsam verteilt, alle zu Wehr und Arbeit herangezogen. Gottesdienst und gemeinsames Bibellesen wurde eifrig betrieben, zum Teil mit aufrichtiger Frömmigkeit. Mehrere Ausfälle wurden mit Glück unternommen; bei einem derselben fand Matthyssen tapfer kämpfend den Tod. Das plötzliche Fehlen einer solchen Energie würde die schlimmsten Folgen gehabt haben, wenn nicht Jan van Leyden sich an die Stelle des Propheten geschwungen hätte. Er nahm die Witwe des Verstorbenen, die schöne Differe von Haarlem, zur Frau und drängte Rothmann und Knipperdolling, die ebenso ehrgeizig, aber weniger geschickt und geistesgegenwärtig waren, zur Seite. Wenn er, wie Matthysson, Träume und Visionen als Ausgangspunkte seines Willens hinstellte, so war bei ihm politische Berechnung, was bei jenem Schwärmerei gewesen war. Das Wichtigste war jetzt die Instandsetzung der Festungswerke, die so vorzüglich ausgeführt wurden, dass später der Frankfurter Patrizier Holzhausen, nachdem er sie in Augenschein genommen hatte, seinem Rat empfahl »das Ewer Fürsichtigen Weisen meister Casparn den baumeister alhier senten, der stat befestigung zu besehen. Derglichen nit vil gefunden werden mit solicher wehr, als diese stat ist.« Eine besonders mächtige Schanze, noch lange nach ihrem Erbauer, dem Gildebruder Johann Kerkering, gerufen Uldan, die Uldanschanze genannt, die das Ludgeritor schützen sollte, findet sich in der jetzigen Engelschanze wieder. Man schreibt Jan van Leyden den Hauptanteil an diesen Anlagen zu; jedenfalls war er unermüdlich gegenwärtig, um die Arbeiten zu überwachen. Das Material wurde aus den Kirchen genommen; Jan van Leyden nannte den Dom de groote steenkule, den alten Dom de olde steenkule, die Kapellen am Dom de lütten steenkulen. Vieles, was wir als Zerstörungslust und Vandalismus auffassen, erklärt sich zum Teil aus Hass und Geringschätzung des Kirchlichen. Die religiöse Erregung des Volkes klug berechnend, ließ Jan van Leyden die Kirchturmspitzen unter dem Vorwande abtragen, dass das Hohe erniedrigt und das Niedrige erhöht werden müsse, während es ihm darauf ankam, die Kirchtürme, wie das im Mittelalter oft geschah, als Bastion zu benützen. Nachdem die Empörung von Andersdenkenden, die es immerhin noch gab, blutig unterdrückt und ein Sturm des Belagerungsheeres ruhmvoll abgeschlagen war, machte sich Jan van Leyden, gestützt auf den Goldschmied Dusentschu, zum König. Er hatte inzwischen, der Verführung erliegend, die die Hingebung der Frauen auf ihn ausübte, die Vielweiberei eingeführt, was ihm eine Reihe von Anhängern entfremdete. Es wird berichtet, er habe siebzehn Frauen gehabt, unter denen außer der schönen Differe, der Königin, Elisabeth Wandscherer, Klara Knipperdolling, Angele Kerkering und Anna Kippenbroich waren. Er staffierte sich nun mit goldenen Ketten und allerlei Schmuck aus, genoss die Liebe der Frauen und den Gehorsam des Volks, aber hart am Abgrund und die bittere Neige schon auf der Lippe. Vielleicht, dass alle in solcher Lage sich das Denken verbieten, die Augen schließen und auf ein Wunder jenseits aller Möglichkeit hoffen. Die Wiedertäufer schickten Apostel aus, die, nachdem sie das Abendmahl genommen hatten, die schützenden Mauern verließen und so oder so umgebracht wurden. Heldenmütig wurde ein neuer Sturm unter großem Verlust der Bischöflichen abgeschlagen. Diese unerschütterliche Haltung mochte den Feinden imponieren; von Seiten der Hansestädte und von selten des Reichs wurden Vermittlungsvorschläge gemacht, die nicht am Bischof, sondern an den Wiedertäufern scheiterten. Sie hatten sich vielleicht in ein altbiblisches Heldentum hineingelebt, wo es nichts gibt zwischen Sieg und Untergang. Einen gewissen Respekt bekundete auch der Landgraf Philipp von Hessen, indem er sich mit dem König in einen Briefwechsel einließ, wo einer den andern von der Richtigkeit seiner Auffassung zu überzeugen suchte.
Zuletzt fehlte es an Lebensmitteln; im April 1535 wurden die überflüssigen Esser, Greise, Frauen, Kinder fortgeschickt und kamen fast alle draußen um. Wie Gefahr und Not zunahmen, wurde Jan herrischer und gereizter; eine seiner Frauen, Elisabeth Wandscherer, die sich gegen seinen Despotismus auflehnte, enthauptete er mit eigener Hand. Kurze Zeit danach fiel die Stadt durch Verrat in die Hände der Belagerer; vielleicht hätte sie sonst noch länger widerstanden. Bei der Erstürmung fielen eine Menge Wiedertäufer im Kampfe, auch Hermann Tylbeck und Krechting, glücklicher als die Gefangenen. Dem einziehenden Bischof überreichte der Droste Meerveldt die Kroninsignien des besiegten Königs.
Jan van Leyden blieb hohen Sinnes; es wird erzählt, er habe, als der Bischof ihn höhnisch angeredet habe: »Bist du ein König?« die Gegenfrage gestellt: »Bist du ein Bischof?« Mit Bezug darauf, dass Waldeck die bischöfliche Weihe nicht empfangen hatte. Auch hier zeigte sich, dass legitime Sieger grausamer sind als Rebellen, die in der Notwehr und in der Aufwallung töten, aber selten besondere Martern ersinnen, um sich an den Qualen der Gestürzten zu weiden. Von Justiz war nicht die Rede, sondern von Rache. Ein Ritter wurde mit Rücksicht auf seinen Adel begnadigt, nachdem er der Wiedertäuferei abgeschworen hatte, Kerkering gewährte man aus demselben Grunde den verhältnismäßig leichten und ehrenvollen Tod durch Enthauptung. Die Kinder Heinrich Krechtings, der entkam, erhielten sogar einen Teil ihrer väterlichen Besitzungen zurück und wanderten mit verändertem Namen nach Bremen aus.
Was aus Rothmann wurde, hat niemand erfahren. Sein Leichnam wurde nicht gefunden, und alle Nachforschungen nach seinem Verbleib waren vergebens. Der Überlieferung nach hätte er als Lehrer bei einem Adligen in Verborgenheit bis zu seinem Tode gelebt. Jan van Leyden, Knipperdolling und Bernd Krechting, die das Unglück hatten, lebend in die Hände der Feinde zu fallen, erlitten einen qualvollen Tod mit bewundernswerter Standhaftigkeit, ohne von ihrer Überzeugung zu weichen. Der Bischof sah dem fürchterlichen Schauspiel zu. Die übrige Bevölkerung fand Gnade gegen Widerruf; aber die schöne vierundzwanzigjährige Differe von Haarlem und die Frau, Tochter und Schwiegermutter Knipperdollings hielten sich dazu zu gut und zogen den Tod vor; sie wurden auf dem Domhof enthauptet.
Der Stadt war die Erhaltung ihrer Rechte und Religionsfreiheit zugestanden; aber der Bischof kehrte sich nicht daran, sondern machte den Rat zu einer abhängigen Behörde; die Gilden wurden aufgehoben, der Protestantismus beseitigt. Dies unrechtmäßige Vorgehen war mehr als dem Bischof selbst dem Einfluss des Adels zuzuschreiben, von dessen Beteiligung am Aufstande nicht die Rede war. Allein kaum hatte Waldeck die Stadt gefesselt und gedemütigt, als er, um den Adel nicht zu mächtig werden zu lassen, sich ihr wieder näherte und ihr nach und nach alle Rechte zurückgab. Seine schon früher gehegte Hinneigung zum Protestantismus erneuerte er in so weitgehendem Maße, dass er seinen Ständen den Vorschlag machte, das Stift nach den Grundsätzen des Augsburgischen Bekenntnisses zu reformieren. Trotz heftigen Widerstandes der Domherren trat er dem Schmalkaldischen Bunde bei; den Spruch, auf den einst die Rebellen sich berufen hatten, man müsse Gott mehr gehorchen als den Menschen, führte er nun selbst im Munde. Was ihn lockte, war eigentlich die Umwandlung des Bistums in ein weltliches Fürstentum; das konnte er doch nicht durchführen. Er starb als ein vielfach enttäuschter alter Mann.
Damals stand die Waage für Katholizismus und Protestantismus in Münster noch gleich. Als bei einer der nächsten Bischofswahlen ein Herzog von Bayern und einer von Sachsen-Lauenburg gegenüberstanden, war der Augenblick der Entscheidung: sie fiel auf das Haus Wittelsbach, womit der Weg zu systematischer Katholisierung beschritten war. Mit den Bayern, deren zwei aufeinanderfolgten, kamen die Jesuiten und die Spanier nach Münster, sodann die Kapuziner, Franziskaner und Klarissinnen; eine Bigotterie wurde herrschend, die sehr von dem weitläufigen Hansegeist der alten Stadt abstach. Die uns überlieferten Äußerungen des Rats, als der Bischof einem des Protestantismus verdächtigen verstorbenen Bürger das Begräbnis verweigerte, atmen Billigkeit und Einsicht und eine durchdachte Duldsamkeit und wirken umso tiefer, als sie mit überlegener Zurückhaltung vorgetragen sind. Gegen den Fanatismus der neuen Gewalthaber kam jedoch die Stadt nicht auf; sie musste Schritt für Schritt zurückweichen.
Während der fünf Jahre, die der Friedenskongress in Münster und Osnabrück tagte, wurden die beiden Städte neutralisiert und genossen volle Umschlägigkeit. Dieser Umstand und der andere, dass Münster zu den bevorzugten Plätzen gehörte, die während des Dreißigjährigen Krieges wenig gelitten hatten und sich eines damals seltenen Wohlstandes erfreuten, mag das Selbstgefühl seiner Regenten gehoben und sie zu dem Entschluss angespornt haben, sich von den Fesseln, die die letzten Bischöfe der Stadt angelegt hatten, zu befreien, was nur durch den Erwerb der Reichsfreiheit geschehen konnte. Förmlich hatte Münster dieselbe nie besessen, so wenig wie die Bischöfe die volle Herrschergewalt über Münster besaßen. Die Rechte und Besitzverhältnisse änderten sich damals je nach der Kraft, der Einsicht, dem Glück der Beteiligten; hatten abhängige Städte die wichtigsten Rechte an sich zu bringen gewusst, so standen sie endlich tatsächlich frei da, und die Bestätigung des Kaisers war wie der Kranz, den man dem erfolgreichen Kämpfer aufsetzt. Münster hatte sich in weitgehendem Maße unabhängig vom Landesherrn gemacht, ihm aber doch bisher als solchem gehuldigt; diese schwankende Rechtslage ertrugen beide Teile unwillig, seit weltliche und geistliche, katholische und protestantische Fürsten danach trachteten, ihre zerstreuten Gebiete und Rechte zu einem Staat zusammenzuballen, in dem sie unbedingt herrschten. Ein hervorragender Träger dieser Richtung war Christoph Bernhard von Galen, der Schatzmeister des Kapitels, den die Domherren gleich nach dem Westfälischen Frieden, im Jahre 1650, zum Bischof wählten. Von den Wittelsbachern absehend, hatten die Herren damals vorgezogen, einen Mann aus ihrer Mitte zur Herrschaft zu bringen. Wie die Domherren schlechtweg Adlige, waren die Bischöfe im Allgemeinen schlechtweg Fürsten; selten kehrte einer den Geistlichen hervor. Bischof Heinrich von Schwarzburg hatte einmal Karl den Kühnen von Burgund zum Zweikampf gefordert, weil seine Truppen bei der Belagerung von Neuß das münstersche Lager schmählicherweise während des Waffenstillstandes überfallen hatten. Neu war an Christian Bernhard von Galen nur die Skrupellosigkeit, mit der er seine Ziele verfolgte und Bündnisse zum Schaden des Reichs schloss; aber das entsprach den Gesinnungen der Fürsten nach dem Dreißigjährigen Kriege. Galen war fünfzig Jahre alt, als er die Regierung antrat; er trat auf, als hätte er seine Jugendkraft bisher zurückgehalten und wolle sie nun rückhaltlos in den paar übrigen Jahrzehnten verschwenden. Er war begabt, tüchtig und tatkräftig in jeder Beziehung, hatte auf mehreren Universitäten studiert und sich auf Gesandtschaftsreisen politische Gewandtheit geholt. Er trat der Entartung des Klerus entgegen, er wusste die feindlichen Besatzungen, die noch in Münster waren, zu entfernen, so dass der Verkehr sich belebte, er sammelte ein Heer und schloss Bündnisse mit den katholischen Fürsten von Mainz, Köln, Trier und Pfalz-Neuburg. Ihrerseits schloss die Stadt Münster, im Gefühl, dass die Entscheidung bevorstehe, ein Bündnis mit den Holländern, Galens gehasstesten Feinden. Zwischen Kämpfen und Vermittlungen wagte die Stadt, den Kaiser um Bestätigung ihres Besatzungsrechtes und um die Reichsfreiheit zu bitten; der Kaiser schlug das letzte Gesuch ab und verlangte hinsichtlich des Besatzungsrechtes Beibringung von Beweisen. Es folgte Eroberung der Stadt und Übergabe an den Bischof, aber auf Einschreiten der Ritterschaft Amnestie. Obwohl der Kaiser die Stadt zur Unterwerfung unter die Hoheit des Bischofs aufforderte, gab sie nicht nach; auf den Beistand der Hansestädte und Hollands hoffend, forderte sie den Bischof dadurch heraus, dass sie von den bisher steuerfreien Geistlichen Steuern erhob. Indessen musste sie, von allen im Stich gelassen, bei einer nochmaligen Belagerung sich beugen; im Jahre 1661 verlor sie alle ihre Freiheitsrechte und wurde zu einer bischöflichen Untertanenstadt. Eine ungeheure Kriegsentschädigung, die ihr auferlegt wurde, sorgte für ihre Entkräftung, die den Handel lahmlegte und sie dauernd wehrlos machte. Da, wo jetzt das Schloss liegt, errichtete der Bischof eine Zwingburg, während das Rathaus, der edle Zeuge städtischer Freiheit, den Bürgern zum Hohn zur Hauptwache gemacht wurde. Nachdem alle Gilden aufgehoben waren, ließ der Bischof auf das Schuhhaus am alten Fischmarkt die Inschrift setzen: Schuster, bleib bei deinem Leisten. Das strenge, verwitterte Gebäude, jetzt ein Lagerhaus, steht da wie ein erstarrtes Denkmal erduldeter Schmach.
Nachdem das selbständige Leben der Stadt gebrochen war, gaben ihr die Sieger, Bischof und Adel, das Gepräge. Zur Zeit der Wiedertäufer hatte der Erbmänneradel die Mauern verlassen und sich auf seine Wasserburgen draußen zurückgezogen. Viele starben aus; jetzt gibt es an vollbürtigen Erbmännern nur noch die Droste-Hülshoff und die Kerkering zu Borg. Damals bildete sich aus zurückkehrenden Erbmännern und später Geadelten eine Aristokratie, die sich um den bischöflichen Hof scharte; der einstige Gegensatz zwischen Bischof und Ritterschaft, der zeitweilig so weit gegangen war, dass Ritterschaft und Stadt sich gegen den Bischof verbündeten, fiel fort. Im Bilde der Stadt kam etwas Neues auf: neben die schmalen, straffen Giebel, die fest und gelassen schreitenden Lauben, die beherzte Geschlechter sich erbauten und in einem wundervoll geschwungenen Bogen um den Mittelpunkt des Verkehrs reihten, stellten sich die zum Genuss eines reichen, sorglosen Daseins bestimmten Adelshöfe.
Wie stark aber der Klang anschwillt, den sie geben, sie übertönen die alten Stadthäuser nicht: es ist die durch und durch westfälische Eigenart, die sie verwandt ineinanderfügt. Trotz ihrer Pracht haben auch die Adelshöfe etwas Verhaltenes, in sich Zurückgezogenes, wie es den Bauern Westfalens eigen ist. Die Anlage der Höfe und Kurien war gewöhnlich so, dass an einen Mittelbau sich zwei Flügel anschlossen, dass ein hufeisenförmiger Grundriss entstand; der dadurch gebildete Hof wurde nach der Straße hin durch ein eisernes Gitter abgeschlossen. Die Pfeiler zwischen dem reichverzierten Schmiedewerk wurden etwa mit Sphinxen geschmückt, die die Wappen des Geschlechts hielten. Zu dem Reiz der barocken Formen tritt die Farbigkeit des Materials. Der dunkle Purpur des münsterschen Backsteins wird durch den gelblichen Sandstein gehoben, der oft die Fenster umrandet, und das Rot der Ziegel des Walmdaches, das tiefe Grün alter Bäume, der Linden auf dem Domhof, der Kastanien und Gebüsche in den Gärten fließt mit tausend herabhängenden Zweigen um die glühenden Mauern. Wohltuend wirkt es, dass die kleinen, bescheidenen Bürgerhäuser der letzten Jahrhunderte sich sehr wohl neben den Adelshöfen halten; ihre schmucklosen Wände machen auf ihre Art denselben Eindruck vornehmer Abgeschlossenheit und sich selbst genügender Sicherheit.
In einer Zeit, wo das naturgemäße Mit- und Gegeneinanderwirken der verschiedenen Glieder eines Volkes zugunsten der verbündeten Fürsten- und Adelsmacht aufgehoben war, gab es in Münster immer noch einen Zusammenhang. Wenn die Bischöfe oft als ein fremdes Element in das Münsterland eingezogen sind, denn außer Christian Bernhard von Galen, einigen Herren von Holtum und ein paar anderen stammten die meisten und besonders die späteren nicht aus dem einheimischen Adel, so vertraten die Erbmänner, die Domherren, die Bürger, die Bauern die westfälische Art und waren nicht so verschieden voneinander, wie die Verhältnisse sie erscheinen ließen. Namentlich aber die großen Baumeister, die im 17. und 18. Jahrhundert an der Stadt bildeten, und die neben den Fürstbischöfen wie eine andere Reihe von Dynasten stehen, die eigentlichen Herren der Stadt, die sie prägten, sie schufen auch im Dienst der Freude aus heimischer Natur und heimischer Gesinnung heraus. Peter Pictorius, Lambert von Corfey, Gottfried Laurenz Pictorius und endlich des letzteren Schüler Johann Konrad Schlaun errichteten Wohnhäuser, Schlösser und Kirchen, die dem Stil des triumphierenden Fürstentums entsprachen, aber von allem Aufgeblasenen, Prahlerischen, Ausposaunenden, was der barocken Architektur und Plastik leicht einen Beigeschmack des Unechten und Komischen gibt, frei sind.
Das Wohnhaus, das sich Schlaun in der Hollenbecker Straße baute, zeigt, wie sich die Grandezza der Adelshöfe auf ein Gebäude bürgerlicher Art anwenden ließ. Wie die Tür mit der kleinen Freitreppe und dem Fenster im ersten Stock mit dem schmiedeeisernen Balkon in eine Nische gerückt und durch einen Rundbogen eingefasst sind, das gibt der schlanken Front zusammen mit dem Rot des Backsteins so viel Schwung und Würde, dass man einen Blick in die Seele des Baumeisters zu tun glaubt, der sich seiner Macht gleicherweise wie seiner dienstlichen Stellung bewusst war. Was ist merkwürdiger, als dass das zweiflügelige Zuchthaus, der erste große Bau, den Schlaun in Münster ausführte, trotz seiner strengen Einfachheit und düsteren Bestimmung Verwandtschaft mit den Palästen des Adels zeigt? Besonders ergriffen stehen wir vor dem Landhause Rüschhaus, das sich Schlaun eine Stunde von Münster baute, und nach welchem der Generalmajor und Kommandant der Artillerie sich Herr zu Rüschhaus nennen durfte. Da liegt zwischen dunklen Eichen, zwischen Wiesen und Hecken ein altes, langgestrecktes westfälisches Bauernhaus mit breitem Torweg, geräumiger Diele und umfangendem Dach, 20 Münster durch einige wohlangebrachte geschweifte Linien mit dem Gepräge des Erbauers versehen und in die Region durchdachter Kunst gehoben. Es ist ein schönes Zusammentreffen, dass das Haus des genialen Architekten, der am liebsten westfälischen Dialekt sprach, später von der großen westfälischen Dichterin Annette von Droste-Hülshoff bewohnt wurde. Das zarte Fräulein mit den Nixenaugen, das in Münster im alten Drostehaus am Krummen Timpen abstieg, der Straße mit den verschwiegenen, bröckelnden Palästen, ließ in ihren Dichtungen noch einmal erstehen, was der Heimat ihrer Väter eigentümlich war: die zusammengebende Form voll gebändigten Feuers, das zuweilen in stolzer Flamme hervorschlägt, das Aroma von Weihrauch und Lindenduft, die Melancholie und der Hochmut des Adels, der verpflichtet, und die dämonischen Gestalten, die durch die dämmernde Heide schwanken, aus der Mimigerneford, der Hügel des Heiligtums, schicksalsvoll aufsteigt.
Osnabrück
Wie die Russen ihr Land Mütterchen Russland, so könnten die Westfalen ihr Haus Mütterchen Haus nennen; so liebreich umfangend, so unerschütterlich festgewurzelt, in geduldiger Güte seiner Kinder wartend, liegt es da. Es erinnert an die Zeit, wo das Haus die Heimat war, wo an seinem Herde Geschlechter aufwuchsen und vergingen, die unveränderlich die gleiche Tracht trugen und an den gleichen Sitten festhielten, wo auf dem Lande die Bauart des Hauses, wenn sie auch in den Städten wechselte, nicht angetastet wurde. Von solchen alten Häusern finden sich in den Dörfern Westfalens noch viele, mit dem hohen, behütenden Dach, auf dem hie und da Moos wächst, mit dem herrschaftlich breiten Tor, in dessen helle Umrandung ein Bibelspruch und die Namen der Eheleute, die das Haus bauten, eingegraben sind. Den alten Häusern von Osnabrück sieht man es an, dass sie sich aus diesem Typus entwickelt haben; hier besonders spürt man die alte sächsische Bauernsiedlung, deren Keime in unerforschte Waldgründe der Vergangenheit zurückführen. Schon der Name rührt an die Urzeit: die Silbe s soll auf die Asen deuten, das Göttergeschlecht, das die heidnischen Germanen verehrten. Osnabrück hieß eine Bauernschaft an der Hase, die vielleicht schon lange bestand, bevor Karl der Große im Jahre 783 in dieser Gegend in dreitägiger Schlacht die Sachsen unter Wittekind und Albion besiegte. Er gründete besitzergreifend und als Ausgangspunkt der Bekehrung eine christliche Kirche, aus der der Dom von Osnabrück hervorgegangen ist.
Die Gaugrafschaften, in die der Kaiser sein großes Reich einteilte, umfassten eine Anzahl von Oberhöfen, wie ein solcher zu Osnabrück war, und diese wieder mehrere Unterhöfe, die auch gemeine Erben genannt wurden. Auf ein Zeichen der Buerglocke versammelten sich die Hofgenossen, um ihre gemeinsamen Angelegenheiten zu erledigen und die Willküren zu machen, nach denen sie sich regierten. Als der Freiherr vom Stein Ende des 18. Jahrhunderts nach Westfalen kam, war er entzückt, freie Bauern zu finden, bei denen sich die alte Verfassung erhalten hatte.
Nach dem Tode Karls des Großen löste sich die von ihm geschaffene Einteilung allmählich auf, und die Bischöfe brachten die Rechte der Gaugrafen an sich. Die mit der Gaugrafschaft verbundenen Gerichte wurden von einem Gografen verwaltet, der im Bistum Osnabrück nunmehr vom Bischof abhing; seine Macht war dadurch beschränkt, dass das Urteil nicht von ihm, sondern von den vom Volke gewählten Schöffen gefunden wurde. Von dem städtischen Buergericht veräußerte Bischof Engelbrecht im Jahre 1225 die Hälfte an die Bürgerschaft um eine Geldsumme, die andere Hälfte verpfändete hundert Jahre später ein Bischof an die Bürger Blome und Serke und deren Erben. Von der Witwe des letzten Serke erwarb die Bürgerschaft das Pfand, das nie wieder ausgelöst wurde. Seit der ersten Verpfändung verfiel jedoch das Ansehen des Stadtrichters, und es stieg das der Schöffen, die sich seitdem Ratsmänner nannten. Der erste Schöffe, früher Schöffenmeister oder Obmann genannt, wurde Bürgermeister. Die Gografen schwuren den Diensteid nicht nur dem Bischof, sondern auch der Stadt.
Ein anderes eigentümliches Überbleibsel des alten karolingischen Grafengerichts war das Frei- oder Femgericht, für das der Erzbischof von Köln oberster Stuhlherr war. Bischof und Stadt Osnabrück waren Stuhlherren über drei Freistühle; da wo der Freistuhl von Sündelbeck war, befand sich bis ins 18. Jahrhundert eine steinerne Bank, und im 19. Jahrhundert hieß der Ort noch Im freien Stuhl. Der Freigraf Hermann Budde lud dort 1488 einen Mann vor, der falsche Pfennige ins Land gebracht haben sollte. In späterer Zeit standen alle Freistühle der Stadt allein zu, deren Ratsmänner sämtlich Freischöffen waren. Der letzte von der Stadt Osnabrück ernannte Freigraf hieß Konrad Vette und starb im Jahre 1617.
Schon König Arnulf hatte dem Bischof Egilmar die Markt-, Zoll- und Münzgerechtigkeit für seine Stadt verliehen; aber erst im 13. Jahrhundert begannen sie sich Selbständigkeit zu erringen. Gemeinsam mit dem Bischof befehdete sie die Grafen von Tecklenburg, welche die Vogtei über die Osnabrücker Kirche hatten. Den Anlass dazu gab die Ermordung des Erzbischofs Engelbrecht von Köln durch den Grafen von Isenburg im Jahre 1225. Die beiden Brüder des Mörders, Dietrich, Bischof von Münster, und Engelbrecht, vorgeschlagener Bischof von Osnabrück, wurden der Mitschuld angeklagt und konnten, als sie den Reinigungseid ablegen wollten, die sieben bischöflichen Eideshelfer nicht auftreiben, die zu ihrer Entlastung notwendig waren. Infolgedessen wurde der eine abgesetzt, der andere nicht bestätigt. Die Osnabrücker zogen vor das Schloss Tecklenburg und verlangten vom Grafen Otto, der dem Mörder Zuflucht gewährt hatte, dessen Auslieferung; anstatt dessen verhalf er seinem fluchbeladenen Gast zur Flucht, weswegen der Papst den Kirchenbann über ihn verhängte. Mit dem neuen Bischof vereint, brachten es die Osnabrücker in langer Fehde endlich dahin, dass Graf Otto auf die Vogtei verzichtete.
Diesen Kampf hatte die Altstadt Osnabrück allein ausgefochten; die später entstandene Neustadt war noch ganz vom Bischof abhängig. Sie war entstanden durch Ansiedlung von Handwerkern und Bauern um die vom Bischof Dietmar gegründete Kirche Sankt Johann in der Wüste. Nachdem sie sich Ende des 13. Jahrhunderts unabhängig gemacht hatte, vereinigte sie sich mit der Altstadt, die ihr durch die Tecklenburger Fehde gestiegenes Ansehen außerdem durch den Beitritt zur Hanse und durch Bündnisse mit verschiedenen westfälischen Städten vermehrte.
Es gab in Osnabrück ritterbürtige Familien, zuerst die Eyflor, die Barneflor, von Leden und von Dunstorf, später die von dem Busche, Düvel, Snetlage, von Haren, Korff, Gogreve, von der Horst, von der Strythorst, von Plettenberg und von Meppen; aber ein eigentliches Patriziat mit Vorrechten vor der Bürgerschaft gab es nicht. Der Reichtum der Bürger beruhte auf der Tuchweberei und dem Tuchhandel, dem Handwerk und der Landwirtschaft. Es scheint, dass der Charakter der westfälischen Sachsen sich seit Wittekinds Zeit wenig verändert hatte.
Die fränkische Kultur und das römisch-katholische Kirchenwesen blieb ihnen zuwider; waren mehr oder weniger alle Städte im Reich der Geistlichkeit nicht gewogen, so äußerte sich doch die Feindseligkeit nirgends so furchtbar und trotzig wie in Osnabrück, wurde selten so wenig durch andere Strömungen gemildert. Das Fehlen eines Patriziats trug vielleicht mit dazu bei. Im Jahre 1241 wurde die Stadt von dem Papst in den Bann getan, weil sie verordnet hatte, dass bei Haltung eines Totenamtes nur zwei Messen im Dom und nur zu einer in den anderen Kirchen Gaben gebracht werden dürften. Nicht geschreckt durch die päpstliche Strafe, erließ sie am Ende desselben Jahrhunderts Verordnungen gegen die tote Hand: Geistliche durften bürgerliche Güter nicht ohne Genehmigung der Bürgerschaft erwerben. Das Gertrudenkloster, das Bischof Benno im Jahre 1070 außerhalb der Stadt auf einem Hügel gegründet hatte, wo in heidnischer Zeit ein heiliger Hain gewesen war, ließ die Stadt verbrennen; um den Bann loszuwerden, musste sie sich dazu verstehen, Kirche und Kloster wieder aufzubauen und den Schaden zu ersetzen. Ein Ratsherr wollte die Verehrung der Bilder nicht dulden und ließ ein Bild des Gekreuzigten, das auf dem großen Altar zu St. Johann gestanden hatte, auf offener Straße zerbrechen. Man möchte aus solchen Vorgängen schließen, dass der Protestantismus ein erneuter Ausbruch germanisch-heidnischer Abneigung gegen Kirche und Bilderverehrung war, die jahrhundertelang, teils durch Zwang, teils durch Gewohnheit, niedergehalten war. Den Ratsherrn Werner von Bocklo hatte der Klerus im Verdacht, er habe es auf die Vertilgung der gesamten Geistlichkeit abgesehen. Sehr ungern sah man, dass die Geistlichen ihr Vermögen in Renten auf bürgerliche Häuser und Grundstücke anlegten. Anfangs des 15. Jahrhunderts verordnete der Rat die Ablöslichkeit aller ewigen Renten; auch sollten Renten von städtischen Grundstücken nur an Bürger, nicht mehr an Geistliche verkauft werden. Sogar an der Bischofswahl behauptete die Stadt ein Mitwirkungsrecht und wusste es in drastischer Weise auszuüben. Bei Gelegenheit der Wahl eines Edlen von Diepholz suchte das Kapitel die Einmischung der Stadt zu umgehen, indem es ihr mit der vollendeten Tatsache zuvorkam. Als die beiden Bürgermeister, Hermann von Melle und Johann von Tole, mit einigen Begleitern sich dem Dome näherten, um ihr Wahlrecht auszuüben, tönte ihnen aus der Kirche unter Posaunenschall und Glockengeläut der Ambrosianische Lobgesang entgegen, ein Zeichen, dass der neue Bischof schon auf das Chor gesetzt worden war. Geistesgegenwärtig verschlossen die Bürgermeister die Kirchentür und riefen die Bürgerschaft mit der Ratsglocke zu den Waffen, dann legten sie sich, eine regelmäßige Belagerung eröffnend, mit Geschützen vor den Dom. Auf die, welche sich an den Kirchenfenstern zeigten, wurde geschossen. Die Behauptung der Geistlichen, ihnen allein stehe die Wahl des Bischofs zu, soll Hermann von Melle mit dem Vers beantwortet haben: Hebbe Jy den Koer das ist die Wahl — so hebbe wy de Sloettels to der Doer! Um die Osnabrücker zu unterstützen, erschienen bald in Harnisch und Waffen die Bürger von Quakenbrück, und es blieb den Belagerten nichts übrig, als sich zu fügen. Ein Vergleich kam zustande, in dem das Wahlrecht der Stadt anerkannt wurde, und in dem der Bischof versprechen musste, aus Macht und Gebot keine Juden mehr in Osnabrück zu dulden. Das Kapitel beruhigte sich nicht bei diesem ertrotzten Friedensschluss, sondern wandte sich klagend an den Papst. Wenn dieser die Osnabrücker für Hussiten und Wiklifiten erklärte, so hatte er nicht unrecht, insofern sie geborene Protestanten waren; er befahl, die Ketzergesetze gegen sie in Anwendung zu bringen, und der Erzbischof von Köln tat sie in den Kirchenbann. Die Lossprechung erlangte die Stadt durch Vermittlung des Bischofs, mit dem sie in gutem Einvernehmen blieb, wie denn überhaupt ihre Feindseligkeit gegen die Kirche nicht durchaus den Bischof einbegriff.
Da das Stift weder groß noch reich war und sich fehdelustiger Nachbarn zu erwehren hatte, bedurfte der Bischof der Hilfe der Bürger, die ihm auch bereitwillig geleistet wurde, wenn er ihre Unabhängigkeit und ihre Freiheiten respektierte, wozu auch gehörte, dass er ohne ihre Einwilligung keinen Krieg anfangen durfte. Nach der großen Tecklenburger Fehde kämpften sie siegreich zusammen mit dem tapferen Bischof Ludwig, einem Grafen von Ravensburg. Zuerst befehdeten sie den Grafen Simon von der Lippe, nahmen ihn gefangen und hielten ihn sechs Jahre im Bocksturm eingeschlossen, bis er sich zu dem ihm vorgeschriebenen Frieden bequemte. Er musste unter anderem seine Burg in Enger niederlegen. Sodann ging es gegen den Bischof von Münster, der den von Osnabrück nicht anerkennen wollte. Am linken Ufer der Hase fand eine furchtbare Schlacht statt, in der Bischof Ludwig, ein weißleinenes Kleid über dem Harnisch, rüstig mitfocht und irrtümlich von seinem eigenen Diener erstochen Osnabrück wurde. Die Osnabrücker, obwohl geringer an Zahl als der Feind, trugen den teuer erkauften Sieg davon; noch lange behielt der Fluss den Namen Blutstrom.
Um 1500 machte sich ein Umschwung aller Verhältnisse und ein Sinken der schäumenden Jugendkraft bemerkbar, auf der das reiche Leben des Mittelalters beruht hatte. Charakteristisch für diese Veränderung war in Osnabrück der Bürgermeister Erwin Erdmann, ein Mann von Talent und Tatkraft, aber wesentlich verschieden von einem Hermann von Melle und anderen Bürgermeistern früherer Zeit. Erwin Erdmann war ein Vertreter des römischen Rechts, das er auf italienischen Schulen studiert hatte, und als solcher ohne Verständnis für die naturhaft gewachsenen mittelalterlichen Verhältnisse, inmitten welcher er lebte, die aber schon von neuen Tendenzen beiseitegeschoben und dadurch verwirrt wurden. Als Syndikus des Kapitels und Ratgeber verschiedener westfälischer Fürsten und Herren war er brauchbar und am Platze; ein guter Bürgermeister von Osnabrück konnte er nicht sein, weil er keinen Sinn für die aus erworbenen und ertrotzten Freiheiten bestehende Selbständigkeit der Stadt hatte. Er legte an alle Lebensverhältnisse den Maßstab des Systems, der Regel, der Logik an, und deshalb sagte ihm die neu aufkommende, zentralisierte Fürstenmacht zu, für welche die Ordnung ein Mittel zu herrschen und Steuern einzutreiben war. Es kam hinzu, dass er von niederem Stande war und gegen die alten Ratmännerfamilien eine Abneigung hatte, welche sie erwiderten. Als Fürstendiener tauglich, konnte er als Bürgermeister nur eine zweideutige Rolle spielen. An der Spitze einer gegen die Geistlichkeit und zugleich auch gegen Erdmann, den Rechtsbeistand des Kapitels, gerichteten Bewegung stand der Schneidermeister Johann Lenethun, seit längerer Zeit im Kirchenbann und offener Feind des Klerus. Unterstützt wurde sie durch mehrere hochgestellte Bürger, Ludolf von Horsten und Hermann und Hinrich von Leden aus einer vornehmen Familie, die Friedrich III. und Maximilian I. wegen ihrer bei der Belagerung von Neuß geleisteten Dienste mit besonderen Freiheiten bezahlt hatten. Mit der Ergreifung und Hinrichtung Lenethuns endete der Aufstand. Erwin Erdmann starb im Jahre 1506 vor dem Beginne der Reformation, die von den Osnabrückern als etwas Selbstverständliches, längst Vorbereitetes begrüßt wurde. Schon im Jahre 1521 predigte Dr. Gerhard Hecker, der in Erfurt Luthers Lehrer gewesen war und dann sein Schüler wurde, im Augustinerkloster die neue Lehre, dann Lukas von Horsten im Dominikanerkloster. In Privathäusern lehrte der junge Adolf Clarenbach aus Lennep, der, nachdem er Osnabrück hatte verlassen müssen, als Märtyrer in Köln starb, wo er beschuldigt wurde, mit seiner Lehre die Schweißseuche veranlasst zu haben. Der Hass gegen die Geistlichkeit äußerte sich in Plünderungen und allerlei aufrührerischen Handlungen; nach längeren Kämpfen einigten sich Stadt und Kapitel dahin, dass die Stadt die gefürchteten deutschen Gesänge verbot, die Geistlichkeit dagegen versprach, die bürgerlichen Lasten zu teilen und keine bürgerlichen Gewerbe zu betreiben. In diese ungewissen Verhältnisse passte der neue Bischof, Franz von Waldeck, der zugleich Bischof von Münster war, mit seinem ebenso undeutlichen Charakter. Er war ein schöner, liebenswürdiger Mann, dessen weltliche Neigungen einen gewissen Geschmack am Protestantismus, den er aus Überzeugung haben mochte, unterstützten. Er hatte ein Liebesverhältnis mit der schönen Anna Polmann und ließ sich durch persönlichen Hass gegen den erzkatholischen Herzog Heinrich von Braunschweig bestimmen, sich den protestantischen Fürsten anzuschließen, die Heinrich vertrieben. Er ließ es geschehen, dass die Stadt durch einen Lübecker das Kirchenwesen reformieren ließ, dass in allen Kirchen protestantisch gepredigt wurde, dass ein Protestant das Rektorat der Ratsschule bekam. Als nach dem Tode Kaiser Rudolfs II. die Wahl des Mathias bevorstand, fasste der Rat von Osnabrück einen bedeutenden Plan, der, wenn er zustande gekommen wäre, der Entwicklung in Westfalen eine andere Richtung gegeben hätte; es sollten nämlich alle norddeutschen Städte darauf dringen, dass ihnen der Religionsfriede bestätigt und allen bischöflichen Städten Freiheit vom Religionsrecht ihrer Bischöfe erteilt werden sollte. Der Bischof von Osnabrück trat dem Plan bei, ebenso die Städte Münster und Hildesheim, und der Schirmherr der letzteren Stadt, Herzog Heinrich Julius von Braunschweig, versprach, den Plan im Fürstenrat zu vertreten. Da der Herzog starb, zerfiel das Bündnis: man hatte wohl einen großen und kühnen Gedanken fassen können, aber ihn auszuführen, fehlte die Kraft.
Im Jahre 1556 sagte ein Bürgermeister von Osnabrück kurz vor seinem Tode: Ich fürchte — Gott gebe, dass ich daran unwahr sage, aber denket an mich Osnabrück ist auf seinem höchsten Preise all gewesen. Der Sterbende fühlte das Sterben der Stadtseele, die keine Widerstandskraft, keine Aufschwungskraft mehr hatte, nur noch Unabwendbares über sich ergehen ließ.
Es ist merkwürdig, dass in mehreren Städten zerstörende Feuersbrünste die Katastrophe des Dreißigjährigen Krieges vorverkündeten. Im Jahre 1613 verheerte Osnabrück ein Brand, der nur die Ratsschule und ein kleines Haus unberührt ließ, in dem ein alter Mann die ganze Zeit, während das Feuer wütete, gebetet hatte. Allgemeine Verarmung war die Folge davon, die die Hilfe wohlhabender Familien, wie der von dem Busche und der Ledebur, nur wenig mildern konnte. Junker von dem Busche zu Hünefeld schenkte die erste Glocke zum Ersatz für die zerstörten. Wurde Osnabrück vom Kriege selbst nicht übermäßig heimgesucht, so wurden innere Unruhen dadurch entzündet, dass im Jahre 1625 Franz Wilhelm, Graf von Wartenberg, ein Sohn des Herzogs von Bayern aus morganatischer Ehe, zum Bischof gewählt wurde. Von Bayern und Österreich ging die Gegenreformation aus, bayrische Prinzen haben einen großen Teil des westlichen Deutschlands mit Hilfe der Jesuiten zum Katholizismus zurückgebracht.
Trotz der schrecklichen Quälereien, durch die der Bischof sein Ziel zu erreichen suchte, fanden zunächst nur wenige Übertritte statt, dann brachten die Schweden Befreiung. Osnabrück musste einem natürlichen Sohne Gustav Adolfs, dem Grafen Gustav Gustavson, huldigen, der, auf den Namen seines Vaters pochend, ohne dessen Genie geerbt zu haben, die Ratsherren durch seine leidenschaftliche Haltlosigkeit quälte. Unter seiner Regierung führten die Hexenprozesse zu tragischen Verwicklungen, bei denen sich neben dem Wahn auch die Gerechtigkeitsliebe, die Unerschrockenheit, die Gewissenhaftigkeit und Treue der Männer, die Tapferkeit und Herzensgüte der Frauen offenbarten. Kaum sind anderswo die Männer so energisch für die Frauen eingetreten, haben die Geistlichen so furchtlos und einsichtig gegen die Sinnlosigkeit und Grausamkeit der Prozessführung gekämpft, waren selbst die Vertreter des Wahns so ernstlich um Wahrheit und Gerechtigkeit bemüht.
Bevor Gustav Gustavson Osnabrück verließ, erklärte er die Stadt, die wie Münster Sitz der Friedensverhandlungen werden sollte, für neutral und übergab dem Bürgermeister die Schlüssel. Ähnlich wie Münster fühlte Osnabrück sich frei und hoffte zuversichtlich, die Reichsunmittelbarkeit zu erlangen. Diese hatte zwar Osnabrück nicht eigentlich besessen, aber es war doch zur Zeit seiner größten Blüte und Unabhängigkeit von Kaiser Sigismund auf die Reichstage berufen, und auch später hatten sich die Kaiser ihrem Wunsch nicht abgeneigt gezeigt. Indessen die Zeit war vorbei, wo Ansprüche der Städte schwer in die Waage fielen; die Fürsten, und namentlich die katholischen und geistlichen, triumphierten. Die Verteilung der Gesandtschaften in den beiden Städten zeigte von vornherein an, wie verschieden sie gewertet wurden: die katholischen Städte, der Kaiser, der Papst, Frankreich, Spanien waren in Münster, die protestantischen in Osnabrück vertreten. Allerdings konnte sich Osnabrück, damals schon wesentlich eine Ackerstadt, mit der Ansehnlichkeit Münsters nicht messen. Jetzt, wo die herrlichen Adelshöfe des 18. Jahrhunderts die Schönheit Münsters vollendet haben, wo die herrschaftlichen Giebelhäuser am Osnabrücker Marktplatz verschwunden sind, tritt der Unterschied zwischen den beiden Städten noch stärker hervor. Münster erscheint als eine Stadt des Adels und patrizischer Kaufleute, Osnabrück als eine Bauernstadt. Das Rathaus von Osnabrück, das der Bürgermeister Erwin Erdmann um 1500 errichten ließ, ist ein schlichtes, burgähnliches Wohnhaus, das von Münster ein Prunkstück architektonischer Phantasie. Nichts ist in Osnabrück von dem gedämpften Feuer, der stolzen Repräsentation, der gelassenen Großartigkeit Münsters; dagegen gewinnt es durch seine würdige Schlichtheit, sein unaufdringliches Selbstbewusstsein. Es gibt einige alte Fachwerkhäuser in Osnabrück, reich mit farbigem und vergoldetem Schnitzwerk verziert, die wie ein Bild des Adels und der Freiheit altsächsischer Bauern anmuten, auf denen, obwohl sie nur von Holz sind, das stolze Motto geschrieben stehen könnte: Mein Haus ist meine Burg. Sie blieben ein Ausdruck auf gesammelter Kraft beruhenden Wohlstandes, als beides, Kraft und Wohlstand, ganz zu verschwinden drohte.
Johannes Oxenstjern Axelson, wie Gustav Gustavson der schwächere Sohn eines bedeutenden Vaters, zog mit großer Pracht in Osnabrück ein, die in der verarmten Stadt sehr auffiel, und wo keine Gesandtschaft war, die es ihm hätte gleichtun können. Er trat, wie es versprochen war, für die Freiheit Osnabrücks ein, mit ihm ein ausgezeichneter Vertreter der Stadt, Dr. Gerhard Schepeler von Nienburg. Er war Schwiegersohn des Bürgermeisters Grave, der der Religion wegen nach Flamburg ausgewandert war, und kam im Jahre 1645 nach Osnabrück, um geschäftliche Angelegenheiten für seinen Schwiegervater zu betreiben. Der zweiunddreißigjährige Fremde erwarb sich sofort so sehr die Sympathien und das Vertrauen der Stadt, dass er in den Rat und bald darauf zum Bürgermeister gewählt wurde. Als solcher kämpfte er klug und kräftig für seine neue Heimat, konnte aber nicht einmal das abwenden, was die Osnabrücker am meisten fürchteten, nämlich die Rückkehr des Bischofs von Wartenberg. Schepeler überzeugte sich, dass nur durch verschwenderische Bestechung in Münster etwas auszurichten war, und dazu war Osnabrück zu arm, seine Politik vielleicht auch zu wenig kühn. Die Reichsfreiheit betreffend, wurde mit Hohn gesagt, man könne nicht zugeben, dass eine Stadt, wo Handwerker regierten, die freie Kriminalexekution besitzen solle. Kaum wurde so viel erreicht, dass Osnabrück unter die Evangelischen gezählt wurde; aber der bayrische Bischof setzte durch, dass nicht nur er selbst bis an das Ende seines Lebens die Regierung fortführen könne, sondern dass künftig katholische und evangelische Bischöfe abwechselnd regieren sollten. Wie wenig Vorteil die Stadt daraus zog, zeigte sich zur Zeit des evangelischen Bischofs Ernst August von Hannover, unter dem ein Jesuitenkollegium in Osnabrück entstand. Der Handel ging mit der Hanse zugrunde, das Tuchgewerbe, das den Grund zum Wohlstand gelegt hatte, wurde aufgegeben, einzig die Leinenbereitung erhielt sich noch in bescheidenem Maße. Erst gegen das Ende des 18. Jahrhunderts hob sich die herabgekommene Stadt wieder etwas durch den Geist und die Tüchtigkeit eines ihrer Bürger, Justus Mösers, der seit 1764 an der Spitze der Verwaltung stand. Justus Möser brachte in seiner Persönlichkeit, seiner Tätigkeit und seinen Werken noch einmal die Kräfte zur Erscheinung, die dies Gemeinwesen hatten erblühen lassen: Freiheitsliebe, Redlichkeit, Sitte, Bürgerstolz und die besonnene Denk- und Gemütsart des die Erde bearbeitenden und mit der Erde verbundenen Menschen. Mösers Art zu urteilen machte auf Goethe Eindruck, und in unseres größten Dichters Werken findet sich dieselbe im deutschen Mittelalter wurzelnde Anschauungsweise, die damals den Ideen der Französischen Revolution gelassen, wenn auch vergebens entgegentrat.
Enger in Westfalen
Mitten in einem unscheinbaren, abseits gelegenen Städtchen, das in eine hügelige Landschaft von bescheidener Anmut eingebettet liegt, erhebt sich eine mächtige romanische Kirche. Altertümlich steht ein Glockenturm daneben, und die Einheitlichkeit im Stil zeigt an, dass nicht fortwachsendes Leben des Gemeinwesens nach jeweiligem Geschmack und Bedürfnis das Gotteshaus verändert hat. Einsam unter weitem Himmel liegt das Denkmal da, das die Gebeine eines sagenhaften Helden, Wittekinds, des Sachsenherzogs, umschließt. Im Süden und Westen Deutschlands knüpfen die alten Ortschaften ihr Dasein gern an den geheiligten Namen Karls des Großen; in Westfalen außerdem an den Wittekinds, seines stolzen, endlich versöhnten Gegners. Im Gedächtnis seines Volkes, das noch lange nach der gewaltsamen Unterwerfung und Bekehrung dem Glauben der Väter anhing, mag sich sein Bild hauptsächlich als das des angestammten Führers, des unbeugsamen Kämpfers und Verteidigers der alten Götter erhalten haben. Er und das weiße Sachsenross waren die Symbole germanischer Freiheit: waldumrauschter, einsamer Höfe, im Winde sausender Eichen, flüsternder Quellen, und es ist sinnvoll, dass sein Andenken im Allgemeinen mehr mit Wald, Strom und Heide als mit Domen und Burgen verbunden ist. Erst allmählich, wie der neue Glaube eingewurzelt war, feierte man ihn mehr als den bekehrten Christen, wo man ihn nicht vergaß. Auch das alte Enger hat die Natur wieder an sich gezogen; es hat sich, wer weiß warum, nicht zur betriebsamen Stadt entwickelt, obwohl die Anlage dazu gegeben war. Nachdem Wittekind die Taufe über sich hatte ergehen lassen, dem siegreichen Gott der Franken sich beugend, und seine Besitzungen ihm infolgedessen zurückgegeben worden waren, ließ er sich in Enger nieder. Warum er es seinem Heimatort Wildeshausen vorzog, ist nicht bekannt; vielleicht, dass er das neue Leben in neuer Umgebung beginnen wollte. Enger wird als Angaria urkundlich zuerst zur Zeit Karls des Großen genannt; aber in der Sage hat es ältere Spuren hinterlassen.
Leute von Enger sollen unter Armin dem Befreier gefochten haben, und Leute von Enger sollen mit den Angelsachsen nach England übergesetzt sein. In der Nähe von Enger, da, wo jetzt der Hingesthof ist, soll Hengist, einer der Anführer des denkwürdigen Zuges, die Scharen, die ihn begleiten wollten, versammelt haben.
Vermutlich gab es in Enger, als Wittekind sich dort niederließ, nur einzelne Höfe, kaum eine Burg; Wittekind gründete, seinen neuen Glauben betätigend, im Jahre 789 eine kleine Kirche oder Kapelle mit einer Wohnung für die ihr zugeordneten Priester. Hatte er den Glauben gewechselt, blieb er doch seinen Ahnen treu; er ließ ihre in Wildeshausen bestatteten Gebeine ausgraben, nach Enger bringen und dort in Urnen in einem Grabe beisetzen, das er als Ruhestätte für sich selbst hatte herstellen lassen. In den Urnen fanden sich, als sie 1870 geöffnet wurden, verbrannte Knochen. Wie er es gewollt hatte, bettete man den toten Sachsenherzog enger neben seine Väter; später aber, als man anfing, ihn als Heiligen zu verehren, wurden seine Gebeine gehoben und in die Stiftskirche versetzt, wo sie sich noch in einem Seitenaltärchen befinden. Als Kaiser Karl IV. sich in Bielefeld aufhielt, erfuhr er dort, dass nicht weit entfernt sich das Grab Wittekinds befinde. Der Sammler von Reliquien hatte so viel Interesse für Heilige und wohl auch für die Altertümer seines Reichs, dass er Enger aufsuchte und befahl, es solle eine würdiges Grabmal für den Helden errichtet werden. Das Grabmal befindet sich im Chor der Stiftskirche; auf einer reichverzierten Tumba liegt der jugendliche König mit Krone und langem Mantel, der mit Edelsteinen verziert war. Merkwürdig ist es, dass die rechte emporgehobene Hand des Bildes den gekrümmten Mittelfinger zeigt, an dem man, wie erzählt wird, den Herzog erkannte; sonst ist an keine Ähnlichkeit zu denken.
Als ein stummer Gefährte Wittekinds stand lange noch in Enger eine Eiche, neben der er einen Wartturm zur Rundschau errichtet haben soll. Ihre Stelle vertrat später eine Buche von besonderer Schönheit; sie verzweigte sich dicht über der Erde in sieben mächtigen Schäften, und ihre Krone, heißt es, sei so dicht und stark gewesen, dass man darauf habe stehen können. Zwei von den Schäften wurden in den zwanziger Jahren des 19. Jahrhunderts durch Blitz und Feuer zerstört, nachher verschwanden auch die anderen. Das Andenken Wittekinds jedoch hat sich in dem weltfernen Winkel, an dem noch nicht lange eine kleine Lokalbahn vorüberführt, überraschend erhalten. Das Gefolge des Herzogs bildete eine Anzahl von Familien, welche die Sattelmeier genannt wurden, und die vielleicht schon in der Gegend von Enger ansässig waren, bevor er sich dort niederließ. Sie begleiteten Wittekind zu Pferde, mussten je einen berittenen Mann zum Kriege stellen und waren sonst zu verschiedenen Diensten verpflichtet, wie denn einer den Marstall unter sich hatte. Zwölf solcher Sattelmeierfamilien gibt es noch jetzt, und zwar wohnen fünf in unmittelbarer Nähe von Enger, die übrigen in der Umgegend. Die fünf im Kirchspiel Enger heißen Nordmeier, Ebmeier, Meier Johann, Barmeier und Ringsmeier. Sie genießen noch jetzt besondere Rechte, die in altüblicher feierlicher Form vollzogen werden. Wenn sie sterben, wird am Tage vor ihrem Begräbnis in der Königsstunde, von 12 bis 1 Uhr, geläutet, und ihre Leichen werden auf einem mit sechs Pferden bespannten Erntewagen, dem ein gesatteltes Pferd folgt, in die Kirche, von dort erst auf den Friedhof geführt.
Wittekinds Frau Gewa, eine dänische Prinzessin, war der Sage nach vor seiner Bekehrung als Heidin gestorben. Sein Sohn Wigbert kehrte nach Wildeshausen zurück, später jedoch lebte die Familie wieder in Enger, vermutlich ihrem Stande gemäß auf einer Burg. Ein Enkel seines Urenkels, Graf Thidericus, vermählte sich mit einer Frau aus edlem Geschlecht, Reinhilde, deren Vater ein Friese, deren Mutter eine Dänin war. Diesem nordischen Paar entstammte ein wundervolles Kind, eine Tochter namens Mathilde, die Wittekinds, des Überwundenen Geschlecht zu spätem Sieg führen sollte. Sie wurde die Frau Heinrichs I. und Mutter Ottos des Großen, der die Herrschaft der Sachsen über das Reich befestigte und verherrlichte. Sie selbst glänzte durch Liebe, Güte und Opferwilligkeit, Tugenden, die sie schon den Zeitgenossen als Heilige erscheinen ließen. Ähnlich wie man von der edlen Frau von Stein erzählt, einer Vorfahrin des großen Freiherrn, dass sie von ihrem Schloss hinabstieg und sich in der unbekannten Menge verlor, um dem Schicksal zu opfern, das sie und ihre Kinder allzu reich begnadet hatte, fühlte sich Königin Mathilde gedrängt, den Überfluss an Glück, den sie empfangen, mit vollen Händen anderen auszuteilen. Da ihre Söhne mit ihrer verschwenderischen Wohltätigkeit nicht einverstanden waren, zog sie sich in ihre Heimat Enger in das dortige Stift zurück und blieb auch dort, nachdem durch Vermittlung der jungen Königin Edith eine Versöhnung mit Otto zustande gekommen war. Der Kaiser bedachte das dem heil. Dionysius geweihte Stift mit vielen Gütern und schenkte es nach dem Tode seiner Mutter auf Veranlassung des damaligen Papstes dem Mauritiusstift in Magdeburg, das er später zum Erzbistum erhob.
Durch Heinrich den Löwen, zu dessen Allodialbesitz Enger gehörte, kamen Burg und Stadt an den Grafen Bernhard III. von der Lippe, einen seiner Vasallen. Dessen Nachkomme enger Simon III. wurde in einer großen Fehde mit den verbündeten Bischöfen von Osnabrück, Paderborn und Minden und dem Grafen von Ravensberg besiegt und so lange von seinen Gegnern gefangen gehalten, bis er zugab, dass seine Burg geschleift werde, und versprach, sie nicht wiederaufzubauen. Auch die Mauer mit den sieben Toren, die Enger umgab, wurde damals, es war im Jahre 1305, abgebrochen, so dass der vormals starke blühende Ort zu offener Stadt wurde. Als Enger kanalisiert wurde, stieß man auf den Burggraben und fand darin Steine, die augenscheinlich von der niedergelegten Burg herrührten.
Mit diesen Ereignissen begann der Rückgang der Stadt Enger; er nahm so zu, dass ein Jahrhundert später die Stiftsherren in dem verödeten Ort nicht bleiben mochten und beim Papst durchsetzten, dass ihr Stift nach dem nahen Herford verlegt und an die dortige Johanniskirche angeschlossen wurde. Als die Abgabepflichtigen erklärten, dass sie nur am Grabe des Herzogs zahlen würden, ließen die Stiftsherren die Gruft öffnen und die Gebeine nach Herford bringen, wohin sie auch den Kirchenschatz mitgenommen hatten. Nachdem im Anfang des 19. Jahrhunderts das Stift säkularisiert war, erstattete König Friedrich Wilhelm III. von Preußen der alten Begräbnisstätte die Gebeine des Herzogs zurück. Die Sattelmeier holten die teure Reliquie ab und führten sie unter Glockengeläut in die Heimat.
Paderborn
Unterhalb des Domberges wo unter überhängendem Gebüsch die silberne Pader fließt, träumt die Vergangenheit. Eins von diesen kleinen Häusern mit den schützenden Dächern konnte das Wohnhaus des unglücklichen Bürgermeisters Liborius Wichart gewesen sein, unter dem eine Paderquelle hervorfloß, die eines unheilvollen Tages so seltsam rot gefärbt war, dass alle sich entsetzten. Das war vor dreihundert Jahren; aber noch 850 Jahre früher, als der große Kaiser Karl zuerst in diese Gegend kam, da sah es noch ganz anders aus: da rauschten weithin Wälder von Eichen, und die Straße, die sie durchschnitt, wurde selten von Reisenden begangen.
Begegnete ihnen die reine Quelle nicht wie eine gastliche Nymphe, aus kristallener Schale Erquickung spendend? Hatte sie göttlich waltend die Sitten der sächsischen Bauern, die wer weiß wie lange schon auf wohlbestellten Höfen hier angesiedelt waren, gemildert? Irgendein menschliches Dasein muss wohl die Wildnis am Quell beseelt und den Frankenkönig angehaucht haben, dass er hier seinem Gott eine Kirche und damit einen Mittelpunkt sich ansammelnden Lebens zu gründen beschloss. Solchen Klang hatte der Name des germanischen Helden, dass er an das namenlose Wasser im deutschen Walde arabische Gesandte aus Saragossa lockte, die Hilfe gegen den Kalifen von Córdova suchten, dass er von Italien den Papst herführte, den die Römer vertrieben hatten. Damals waren die Deutschen das auserwählte Volk und ihr Führer der Herr des Abendlandes. Es war im Sommer des Jahres 799, zweiundzwanzig Jahre nachdem Karl das erste Mal an der Pader Hof gehalten hatte, dass Leo III. ihn dort aufsuchte und Gespräche mit ihm führte, in denen, so nimmt man an, der Gedanke des durch die Deutschen zu erneuernden Römischen Reiches zuerst ausgesprochen wurde. Im folgenden Jahre empfing Karl in Rom die Kaiserkrone.