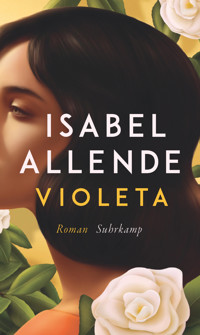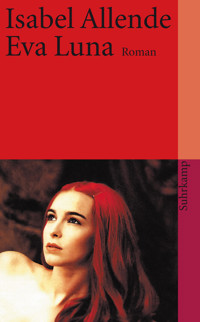13,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 13,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 13,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Suhrkamp Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Wien, 1938. Samuel Adler ist sechs Jahre alt, als sein Vater und die Familie alles verlieren. In ihrer Verzweiflung verschafft Samuels Mutter ihrem Sohn einen Platz in einem Kindertransport, aus dem von den Nazis besetzten Österreich nach England. Samuel macht sich allein auf die Reise, außer einer Garnitur Wechselkleidung und seiner Geige hat er nichts bei sich – die Last der Einsamkeit und Ungewissheit wird ihn ein Leben lang begleiten.
Arizona, 2019. Acht Jahrzehnte später steigen Anita Díaz und ihre Mutter in den Zug, um der Gewalt in El Salvador zu entkommen und in den Vereinigten Staaten Zuflucht zu finden. Doch ihre Ankunft fällt mit der neuen brutalen Einwanderungspolitik zusammen: Die siebenjährige Anita wird an der Grenze von ihrer Mutter getrennt und landet in einem Lager. Allein und verängstigt, weit weg von allem, was ihr vertraut ist, sucht sie Zuflucht in Azabahar, einer magischen Welt, die nur in ihrer Fantasie existiert. Wie aber soll sie zurückfinden zur Mutter?
Isabel Allende hat eine fulminante historische Saga geschrieben, die miteinander verwobenen Geschichten zweier junger Menschen, die auf der Suche nach Familie und Heimat sind. Sie erzählt von den Opfern, die Eltern bringen, und es ist ein Liebesbrief an die Kinder, die unvorstellbare Widrigkeiten überleben - und die niemals aufhören zu träumen und zu hoffen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 383
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Cover
Titel
Isabel Allende
Der Wind kennt meinen Namen
Roman
Aus dem Spanischen von Svenja Becker
Suhrkamp Verlag
Impressum
Zur optimalen Darstellung dieses eBook wird empfohlen, in den Einstellungen Verlagsschrift auszuwählen.
Die Wiedergabe von Gestaltungselementen, Farbigkeit sowie von Trennungen und Seitenumbrüchen ist abhängig vom jeweiligen Lesegerät und kann vom Verlag nicht beeinflusst werden.
Um Fehlermeldungen auf den Lesegeräten zu vermeiden werden inaktive Hyperlinks deaktiviert.
Die Originalausgabe erschien 2023 unter dem TitelEl viento conoce mi nombre bei Plaza & Janés, Barcelona.
eBook Suhrkamp Verlag Berlin 2024
Der vorliegende Text folgt der 2. Auflage der deutschen Erstausgabe, 2024.
© der deutschsprachigen Ausgabe Suhrkamp Verlag AG, Berlin, 2024© Isabel Allende, 2023
Der Inhalt dieses eBooks ist urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte vorbehalten. Wir behalten uns auch eine Nutzung des Werks für Text und Data Mining im Sinne von § 44b UrhG vor.Für Inhalte von Webseiten Dritter, auf die in diesem Werk verwiesen wird, ist stets der jeweilige Anbieter oder Betreiber verantwortlich, wir übernehmen dafür keine Gewähr. Rechtswidrige Inhalte waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Umschlaggestaltung: Rothfos & Gabler, Hamburg, nach Entwürfen von bij Barbara, Wereldbibliotheek/Park Uitgevers, Amsterdam. Umschlagillustration: Pierre Mornet
eISBN 978-3-518-77999-6
www.suhrkamp.de
Widmung
Lori Barra und Sarah Hillesheim für ihr tiefes Mitgefühl
Motto
Hier mein Geheimnis. Es ist ganz einfach: man sieht nur mit dem Herzen gut. Das Wesentliche ist für die Augen unsichtbar.
Antoine de Saint-Exupéry,
Der kleine Prinz
Es gibt einen Stern, wo die Menschen und die Tiere alle glücklich sind, und er ist besser als der Himmel, weil man nicht sterben muss, um hinzukommen.
Anita Díaz
Übersicht
Cover
Titel
Impressum
Widmung
Inhalt
Informationen zum Buch
Cover
Titel
Impressum
Widmung
Motto
Die Adlers
Der Geiger
Samuel
Leticia
Selena
Anita
Samuel
Anita
Selena
Anita
Leticia
Anita
Mr. Bogart
Anita
Selena und Samuel
Epilog
Ich danke
Informationen zum Buch
Der Wind kennt meinen Namen
Die Adlers
Wien, November 1938
Ein Unglück lag in der Luft. Seit dem frühen Morgen fegte der Wind unstet durch die Straßen, pfiff um die Häuser und drang durch die Ritzen von Türen und Fenstern. »Es wird eben Winter«, redete Rudolf Adler sich gut zu, doch die Beklemmung, die ihm seit Monaten die Brust eng machte, konnte er schwerlich dem Wetter oder der Jahreszeit anlasten.
Die Angst war ein Gestank von Rost und Unrat, der ihm beständig in der Nase hing. Weder sein Pfeifentabak noch der Zitrusduft seines Rasierwassers vermochte ihn zu überdecken. Von den Böen aufgewirbelt, nahm ihm dieser Angstgestank jetzt am Nachmittag den Atem, ihm war schwindelig und übel. Deshalb beschloss er, die letzten Patienten im Wartezimmer fortzuschicken und die Praxis vorzeitig zu schließen. Seine Sprechstundenhilfe fragte besorgt, ob er krank sei. Sie arbeitete seit elf Jahren bei ihm, und in all der Zeit hatte er seine Pflichten niemals vernachlässigt. Dr. Adler war ein gewissenhafter und pünktlicher Mensch. »Nichts Ernstes, nur eine Verkühlung, Frau Goldberg«, sagte er. »Ich gehe nach Hause.« Sie brachten noch gemeinsam das Sprechzimmer in Ordnung, desinfizierten die Instrumente und verabschiedeten sich wie jeden Tag an der Tür, ohne zu ahnen, dass sie einander nie wiedersehen würden. Frau Goldberg bog ab zur Tramhaltestelle, und Rudolf Adler zog den Kopf zwischen die Schultern, hielt mit der einen Hand seinen Hut, mit der anderen die Arzttasche fest und ging schnellen Schrittes zur nahe gelegenen Apotheke. Das Pflaster war feucht, und der Himmel hing tief. Es musste genieselt haben, dachte er, und sicher würde später einer dieser Herbstschauer niedergehen, die ihn immer ohne Schirm antrafen. Tausende Male war er durch diese Straßen gegangen, er hätte den Weg mit geschlossenen Augen gefunden und staunte doch stets aufs Neue über seine Stadt, die eine der schönsten der Welt war, bewunderte ihre barocken Häuserzeilen und Jugendstilfassaden, ihre majestätischen Bäume, die langsam die Blätter verloren, den Platz in seinem Viertel mit dem Reiterstandbild, das Schaufenster der Konditorei mit den süßen Verlockungen und den Antiquitätenladen voller rarer Fundstücke. Doch heute hob er den Blick nicht vom Boden. Er trug das Gewicht der Welt auf seinen Schultern.
Die bedrohlichen Gerüchte hatten am Morgen mit der Nachricht von einem Attentat in Paris begonnen: Ein deutscher Diplomat war von einem jüdischen Jungen aus Polen mit fünf Schüssen getötet worden. Die Lautsprecher des Dritten Reichs plärrten nach Rache.
Seit sich Deutschland im März Österreich einverleibt hatte und die Wehrmacht, unter dem Jubel der Massen, mit militärischem Pomp in Wien aufmarschiert war, lebte Rudolf Adler in Angst. Seine Unruhe reichte Jahre zurück und war in dem Maß gewachsen, in dem die Nazis im Land, von Hitler mit Geld und Waffen versorgt, stärker wurden. Sie benutzten den Terror als politische Waffe, schürten den Unmut, vor allem der Jugend, über die wirtschaftliche Misere, die sich seit der Weltwirtschaftskrise von 1929 hinzog, und das Gefühl der Demütigung nach der Niederlage im Ersten Weltkrieg. 1934 hatten sie Bundeskanzler Dollfuss bei einem gescheiterten Putschversuch getötet und seitdem weitere achthundert Menschen durch Attentate ermordet. Sie schüchterten ihre politischen Gegner ein, zettelten Straßenunruhen an und drohten mit Bürgerkrieg. Zu Beginn des Jahres 1938 geriet die Gewalt im Land außer Kontrolle, und zugleich drängte Deutschland von jenseits der Grenze auf den Anschluss Österreichs. Obwohl die Regierung den Deutschen Zugeständnisse machte, befahl Hitler schließlich den Einmarsch. Die österreichischen Nationalsozialisten hatten den Boden bereitet, und die Wehrmachtsverbände trafen nicht auf Widerstand, ja, wurden von einer Mehrheit der Bevölkerung sogar mit Applaus empfangen. Die Regierung dankte ab, und zwei Tage später zog Hitler selbst triumphal in Wien ein. Die Nazis brachten das Land umfassend unter ihre Kontrolle. Jede Opposition wurde verboten. Unverzüglich traten die deutschen Gesetze in Kraft, wurde der Unterdrückungsapparat aus Gestapo und SS mit seinem fanatischen Judenhass auf Österreich ausgeweitet.
Rudolf war klar, dass auch seine Frau Rachel, die früher so überlegt und tüchtig gewesen war und nie zu Schwarzseherei geneigt hatte, inzwischen wie gelähmt war vor Angst und ihren Alltag nur noch mit Hilfe von Medikamenten bewältigen konnte. Beide bemühten sich, ihren Sohn Samuel von allem abzuschirmen, aber mit seinen bald sechs Jahren war der Junge fast schon reif wie ein Erwachsener: Er beobachtete, hörte zu und verstand, ohne Fragen zu stellen. Am Anfang hatte Rudolf seiner Frau dieselben Beruhigungsmittel gegeben, die er auch einigen seiner Patienten verschrieb, doch als sie zusehends ohne Wirkung blieben, stellte er die Behandlung auf starke Tropfen um, die er in dunklen Flakons ohne Etikett bekam. Er selbst hätte sie genauso nötig gehabt wie seine Frau, durfte sie aber nicht nehmen, weil sie seine Berufsausübung beeinträchtigt hätten.
Die Tropfen bekam er unter der Hand von Peter Steiner, dem Apotheker, mit dem er seit vielen Jahren befreundet war. Adler war der einzige Arzt, dem Steiner die eigene Gesundheit und die seiner Familie anvertraute. Kein Gesetz, das Beziehungen zwischen Ariern und Juden unter Strafe stellte, hätte an der Wertschätzung, die sie füreinander empfanden, etwas ändern können. In den letzten Monaten musste Steiner es jedoch vermeiden, mit seinem Freund gesehen zu werden, weil er sich keinen Ärger mit der Naziverwaltung im Bezirk leisten konnte. Früher hatten sie unzählige Partien Poker und Schach miteinander gespielt, Bücher und Zeitschriften getauscht und Ausflüge in die Berge oder zum Angeln unternommen, um ihren Ehefrauen zu entfliehen, wie sie lachend sagten, und in Steiners Fall auch einem Stall voll Kindern. Jetzt nahm Adler an den Pokerrunden in Steiners Hinterzimmer nicht mehr teil. Der Apotheker empfing ihn am Hintereingang und gab ihm die Tropfen, ohne das in seiner Buchhaltung zu vermerken.
Vor der Machtübernahme hatte sich Peter Steiner nie Gedanken über die Herkunft der Adlers gemacht, für ihn waren sie Österreicher wie er selbst. Dass sie, wie rund 200 000 weitere Einwohner des Landes, Juden waren, spielte für ihn keine Rolle. Er war Agnostiker, fand den christlichen Glauben, mit dem er selbst aufgewachsen war, genauso vernunftwidrig wie jede andere Religion und wusste, dass es Rudolf nicht anders ging, auch wenn der seiner Frau zuliebe bei einigen Gebräuchen seine Rolle wahrnahm. Rachel legte Wert darauf, ihrem Sohn Samuel in der Tradition und der jüdischen Gemeinschaft einen Halt zu geben. Die Steiners waren am Freitagabend zumeist zur Schabbatfeier bei den Adlers. Rachel und ihre Schwägerin Leah bereiteten immer alles liebevoll vor: das feine Tischzeug, neue Kerzen, den Fisch nach einem Rezept der Großmutter, das Brot und den Wein. Rachel und ihre Schwägerin standen sich sehr nah. Leah war jung Witwe geworden, sie hatte keine eigenen Kinder und sich der kleinen Familie ihres Bruders Rudolf angeschlossen. Rachels Drängen, doch zu ihnen zu ziehen, gab sie zwar nicht nach und wohnte weiter allein, aber sie kam oft zu Besuch. Sie war gern unter Menschen und engagierte sich in der Synagoge bei verschiedenen Hilfsangeboten für bedürftige Gemeindemitglieder. Von ihren beiden Brüdern war ihr nur Rudolf geblieben, seit der jüngere nach Palästina in einen Kibbuz ausgewandert war, und Samuel war ihr einziger Neffe. Am Schabbatabend saß Rudolf der Tafel vor, wie es vom Familienvater erwartet wurde. Er hielt die Hände über Samuels Kopf und bat um Gottes Segen und Schutz, um seine Gnade und um Frieden. Mehr als einmal ertappte Rachel ihn dabei, dass er gleichzeitig seinem Freund Peter zuzwinkerte. Sie ließ ihm das durchgehen und verstand es nicht als Spott, sondern bloß als Geste der Verbundenheit zwischen diesen beiden Ungläubigen.
Die Adlers gehörten zum säkularen und gebildeten Bürgertum, waren typische Vertreter der besseren Wiener Gesellschaft allgemein und insbesondere der jüdischen. Rudolf hatte Peter erklärt, dass seine Leute wegen der jahrhundertelangen Diskriminierung, Verfolgung und Vertreibung überall auf der Welt erheblich mehr Wert auf Bildung als auf Besitz legten. Der konnte ihnen genommen werden, wie es ja im Lauf der Geschichte immer wieder geschehen war, doch konnte sie niemand ihrer geistigen Schätze berauben. Ein Doktortitel wurde daher weit höher geschätzt als ein Vermögen auf der Bank. Rudolf stammte aus einer Handwerkerfamilie, die stolz darauf war, dass einer von ihnen es zum Arzt gebracht hatte. Mit dem Beruf gingen Anerkennung und Autorität einher, was in seinem Fall jedoch nicht gleichbedeutend war mit Geld. Rudolf Adler war keiner der berühmten Chirurgen seiner Zeit und auch nicht Professor an der renommierten Universität Wien, er war ein fähiger und hingebungsvoller Hausarzt, der die Hälfte seiner Patienten gratis behandelte.
Die Freundschaft zwischen Rudolf Adler und Peter Steiner gründete auf gemeinsamen Neigungen und Wertvorstellungen: Beide hegten eine unstillbare Neugier auf alles Wissenschaftliche, sie liebten klassische Musik, waren unersättliche Leser und sympathisierten mit der Kommunistischen Partei, die seit 1933 verboten war. Auch verband sie eine tiefe Abneigung gegen den Nationalsozialismus. Seit Adolf Hitler sich vom Kanzler zum Diktator mit absoluter Machtbefugnis erklärt hatte, ereiferten sich die beiden im Hinterzimmer der Apotheke über den Zustand der Welt und des Jahrhunderts, in dem sie leben mussten, und trösteten sich mit einem Brandy, der dazu getaugt hätte, Metall zu verätzen. Der Apotheker destillierte ihn selbst in seinem Keller, einem kühlen Gewölbe, wo er auch fein säuberlich geordnet all das lagerte, was er für die Herstellung und Abfüllung von etlichen Arzneimitteln benötigte, die er in seiner Apotheke verkaufte. Manchmal brachte Adler seinen Sohn Samuel mit in diese Unterwelt, um mit Steiner zu »arbeiten«. Der Junge vertiefte sich für Stunden darin, Pülverchen und verschiedenfarbige Flüssigkeiten, die der Apotheker ihm reichte, zu mischen und abzufüllen. Keins der Apothekerkinder durfte diese verantwortungsvolle Aufgabe übernehmen.
Jedes Gesetz, das seinen Freund weiter seiner Würde beraubte, tat Steiner in der Seele weh. Er hatte Rudolf zum Schein die Praxisräume und die Wohnung abgekauft, um zu verhindern, dass sie beschlagnahmt wurden. Die Praxis war ausgezeichnet gelegen im Parterre eines Bürgerhauses, und Adler wohnte mit seiner Familie im Stockwerk darüber. In Praxis und Wohnung hatte der Arzt sein gesamtes Vermögen gesteckt, und sie auf einen anderen Namen zu überschreiben, und sei es der seines Freundes Peter, war eine Notmaßnahme, die er ohne Rücksprache mit seiner Frau getroffen hatte. Rachel hätte dem niemals zugestimmt.
Rudolf Adler versuchte sich einzureden, die judenfeindliche Hysterie werde bald abflauen, in Wien, der gebildetsten Stadt Europas, sei dafür kein Platz, schließlich waren von den vielen großen Musikern, Philosophen und Wissenschaftlern, die hier geboren worden waren, etliche Juden. In Hitlers Hetzreden, deren Ton mit den Jahren immer schärfer geworden war, wollte er nur eine weitere Ausprägung des Rassismus sehen, den schon seine Vorfahren ertragen mussten, was sie nicht daran gehindert hatte, mit ihren Nachbarn in Frieden zu leben und es zu etwas zu bringen. Vorsichtshalber hatte er seinen Namen von der Praxistür entfernt, was wenig Auswirkungen hatte, da er seit vielen Jahren in diesen Räumen praktizierte und weithin bekannt war. Sein Patientenstamm war geschrumpft, weil die »Arier« nicht mehr kommen durften, aber bestimmt würden sie zurückkehren, sobald sich die Gemüter in der Stadt beruhigten. Er vertraute auf seine beruflichen Fähigkeiten und sein wohlverdientes Renommee. Und dennoch, mit jedem Tag wurde die Lage angespannter und dachte er ernsthafter darüber nach, das Land zu verlassen und dem Sturm zu entfliehen, den die Nazis entfacht hatten.
Rachel Adler schob sich eine Tablette in den Mund und schluckte sie trocken, während sie in der Bäckerei auf ihr Wechselgeld wartete. Sie trug modisches Beige und Bordeauxrot, ihren Herbstmantel mit einem Gürtel um die Taille gerafft, den Hut leicht schräg aufgesetzt und dazu Seidenstrümpfe und hohe Schuhe. Sie war hübsch und noch keine dreißig, doch machte ihr ernster Gesichtsausdruck sie um Jahre älter. Sie verbarg ihre zitternden Hände in den Mantelaufschlägen und bemühte sich, in unbeschwertem Ton auf das zu antworten, was der Bäcker über das Attentat in Paris daherredete:
»Was hat sich dieser Bazi nur dabei gedacht? Einen Diplomaten erschießen! Das kann nur einem Polen einfallen!«
Sie kam von ihrer letzten Stunde bei ihrem besten Schüler, einem Fünfzehnjährigen, dem sie Klavierunterricht gegeben hatte, seit er sieben war, einer der wenigen, die es ernst meinten mit der Musik. »Verzeihen Sie, Frau Adler, Sie werden sicher verstehen …«, hatte die Mutter des Jungen zum Abschied verschämt gesagt. Sie hatte ihr das Dreifache der Klavierstunde bezahlt und Anstalten gemacht, sie in die Arme zu schließen, es dann aber gelassen, weil sie ihr wohl nicht zu nahe treten wollte. Ja, Rachel verstand das. Sie war der Frau dankbar, sie hatte sie etliche Monate länger beschäftigt als ratsam. Rachel kämpfte gegen ihre Tränen an, um erhobenen Hauptes zu gehen, sie mochte den Jungen und sah es ihm nach, dass er stolz für »Blut und Ehre« die kurze schwarze Hose und das braune Hemd der Hitlerjugend trug. Alle Jugendlichen waren Teil der Bewegung, es blieb ihnen kaum etwas anderes übrig.
»In was für eine Gefahr uns dieser Polenbengel gebracht hat! Haben Sie gehört, was im Radio gesagt wird, Frau Adler?«, redete der Bäcker immer weiter.
»Hoffen wir, dass es bei Drohungen bleibt«, sagte sie.
»Schauen Sie, dass Sie nach Hause kommen. In den Straßen wimmelt es von randalierenden Jugendlichen. Sie sollten nicht allein draußen sein. Es wird bald dunkel.«
»Auf Wiederschauen und bis morgen«, murmelte Rachel, während sie Brot und Wechselgeld in ihre Tasche schob.
Draußen sog sie tief die kühle Luft ein und versuchte, die bösen Vorahnungen zu vertreiben, die sie schon im Morgengrauen befallen hatten, lange bevor sie die Meldungen im Radio und die bedrohlichen Gerüchte gehört hatte, die im Viertel die Runde machten. Sie dachte, dass die dunklen Wolken nach Regen aussahen, und konzentrierte sich auf das, was noch zu erledigen war. Wein und Kerzen kaufen für Freitag, wie immer würden ihre Schwägerin und auch die Steiners mit ihren Kindern zur Schabbatfeier kommen. Sie spürte, dass ihre Nerven sie trotz der eben geschluckten Tablette mitten auf der Straße im Stich zu lassen drohten – sie brauchte ihre Tropfen –, und beschloss, die Einkäufe auf den nächsten Tag zu verschieben. Zwei Straßen weiter sah sie das Haus, in dem sie wohnten, erbaut zum Ende des 19. Jahrhunderts als eins der ersten reinen Jugendstilgebäude der Stadt. Als ihr Mann die Räume im Parterre für seine Praxis und die darüberliegende Wohnung für die Familie erwarb, hatten die naturhaften Linien, die geschwungenen Fenstersprossen und Balkone und die Scheiben mit ihren stilisierten Blumen in der konservativen, an barocke Eleganz gewöhnten Wiener Gesellschaft noch Missfallen erregt, aber der Jugendstil hatte sich durchgesetzt, und das Gebäude war binnen kurzer Zeit zu einem Vorzeigeobjekt in der Stadt geworden.
Kurz war Rachel versucht, bei ihrem Mann in der Praxis vorbeizugehen, verwarf den Gedanken aber gleich wieder. Rudolf hatte genug eigene Sorgen, sie musste ihn nicht auch noch mit ihren belasten. Außerdem war Samuel seit dem Morgen bei seiner Tante und wartete sicher auf sie. Leah war Lehrerin und hatte sich erboten, einer Gruppe von Volksschulkindern Unterricht zu geben. Samuel war zwei Jahre jünger als die anderen, kam aber gut mit. Jüdische Kinder durften seit März die öffentlichen Schulen nicht mehr besuchen, deshalb hatten sich die Mütter der Gemeinde zusammengetan und beschulten die Kleineren jetzt privat, während die Größeren Unterricht in der Synagoge bekamen. Vorübergehend, dachten sie. Rachel ging weiter, und es fiel ihr nicht auf, dass die Praxis ihres Mannes so ungewöhnlich früh schon geschlossen war. Unter der Woche empfing Rudolf seine Patienten bis um sechs am Abend, nur am Freitag schloss er früher, damit er zum Abendessen vor Sonnenuntergang zu Hause war.
Leahs Wohnung war bescheiden, aber gut gelegen, verfügte über zwei mit gebrauchten Möbeln ausgestattete Zimmer und war mit gerahmten Fotografien des früh verstorbenen Ehemanns und mit Erinnerungsstücken von den Reisen dekoriert, die sie noch gemeinsam hatten unternehmen können. An den Tagen, wenn ihre Schulkinder kamen, duftete es hier nach frischgebackenen Keksen. Rachel Adler traf weitere Mütter an, die ihre Kinder hatten abholen wollen, auf einen Tee geblieben waren und gerade Samuel lauschten, der die Ode an die Freude spielte. Es war anrührend, wie der Junge dastand, so klein und dünn, mit seinen verschrammten Knien und den verwuschelten Haaren, wie er sich hochkonzentriert zum Spiel seiner Geige wiegte und gar nicht mitbekam, was für einen Eindruck er machte. Mit den letzten Tönen brachen Applaus und Jubel los. Samuel brauchte einen Moment, bis er aus seiner Versunkenheit erwachte und zurückfand in den Kreis der Mütter und Kinder. Er bedankte sich mit einer knappen Verbeugung, seine Tante eilte zu ihm und gab ihm einen Kuss, und seine Mutter verkniff sich ein zufriedenes Lächeln. Das Stück war vergleichsweise einfach, Samuel hatte es in weniger als einer Woche gelernt, aber Beethoven verfehlte seine Wirkung nie. Rachel wusste, dass ihr Sohn ein Wunderkind war, aber weil ihr jede Form von Angeberei widerstrebte, verlor sie nie ein Wort darüber und wartete lieber, dass andere es taten. Sie half Samuel, seinen Mantel anzuziehen und die Geige in den Kasten zu legen, verabschiedete sich eilig von ihrer Schwägerin und den anderen Frauen und dachte auf dem Heimweg, dass der Braten fürs Abendessen noch eben rechtzeitig ins Rohr kommen würde. Sie hatte keine Haushaltshilfe mehr, weil die Ungarin, die jahrelang bei ihr gearbeitet hatte, vor zwei Monaten deportiert worden war und sie es nicht über sich brachte, nach einem Ersatz zu suchen.
Mutter und Sohn gingen geradewegs an der Praxistür vorbei in die große Eingangshalle. Die Buntglaslampen mit den Seerosenmotiven waren eingeschaltet und tauchten den Raum in Grün- und Blautöne. Im Vorübergehen grüßten sie die Hausbesorgerin, die von früh bis spät in ihrem Glaskasten saß, und gelangten über die zweiflüglige Treppe in die erste Etage. Die Frau hatte ihren Gruß nicht erwidert. Das tat sie fast nie.
Die Wohnung der Adlers war weitläufig und behaglich, eingerichtet mit wuchtigen Mahagonimöbeln, die dazu gemacht waren, ein Leben lang zu halten, und die in die leichte und verspielte Architektur nicht recht passten. Rachels Großvater hatte mit Antiquitäten gehandelt und seinen Nachkommen Bilder, Teppiche und Ziergegenstände von erlesener Güte hinterlassen, die inzwischen etwas aus der Mode gekommen waren. Rachel stammte aus einer kultivierten Familie und bemühte sich, diesen Lebensstil aufrechtzuerhalten, auch wenn das, was ihr Mann mit seiner Praxis und sie mit ihren Musikstunden verdiente, bei weitem nicht an das Einkommen ihrer Großeltern heranreichte. Sie pflegte eine zurückhaltende Eleganz, da ihr alles Protzige genauso zuwider war wie Angeberei. Von klein auf hatte man ihr beigebracht, dass es riskant war, den Neid der Mitmenschen zu wecken.
In einer Ecke des Salons, nah am Fenster zur Straße, stand der Blüthner-Flügel, der seit drei Generationen im Besitz der Familie war. Er diente ihr als Arbeitsinstrument, auf dem sie die meisten ihrer Schüler unterrichtete, und war ihr Trost in einsamen Stunden. Schon als Kind hatte sie versiert darauf gespielt, als Heranwachsende jedoch einsehen müssen, dass ihr Talent für eine Karriere als Konzertpianistin nicht ausreichen würde, und sich damit begnügt, zu unterrichten. Sie war eine gute Lehrerin. Ihr Sohn hingegen besaß eine musikalische Begabung, wie sie nur selten vorkommt. Schon mit drei Jahren hatte Samuel sich ans Klavier gesetzt und konnte jede Melodie nachspielen, die er einmal gehört hatte, doch bevorzugte er die Geige, weil er die, wie er sagte, überallhin mitnehmen konnte. Rachel hatte nach ihm keine Kinder mehr bekommen können und überschüttete Samuel mit ihrer ungeteilten Mutterliebe. Sie vergötterte ihn und musste ihn einfach verwöhnen, denn er war ein so unkompliziertes Kind, freundlich, brav und lernbegierig.
Eine halbe Stunde später hörte Rachel einen Tumult auf der Straße und trat ans Fenster. Es dunkelte. Sie sah eine Handvoll Jugendliche, die offenbar betrunken waren, Parolen und Schmähungen gegen Juden brüllten – »Blutsauger! Gesindel! Mörder!« –, dieselben vielfach gehörten und in der Presse und auf den Flugzetteln der Nazis wiederholten Beleidigungen. Einer der Randalierer trug eine Fackel, und die anderen waren mit Knüppeln, Hämmern und Metallrohren bewaffnet. Rachel schob ihr Kind vom Fenster weg, zog die Vorhänge zu und wollte hinuntergehen, um ihren Mann zu holen, aber Samuel krallte sich an ihren Rock. Der Bub war es gewohnt, allein zu bleiben, wirkte jedoch gerade so eingeschüchtert, dass Rachel beschloss, lieber auf ihren Mann zu warten. Draußen wurde es leiser, also war die Meute offenbar weitergezogen. Sie holte den Braten aus dem Rohr und deckte den Tisch. Das Radio mochte sie nicht anschalten. Die Nachrichten waren immer nur schlimm.
Peter Steiner hatte seinen Freund ins Hinterzimmer der Apotheke gebeten, wo die am Vorabend begonnene Schachpartie und die halb geleerte Flasche Brandy auf sie warteten. Die bekannte Steiner'sche Apotheke befand sich seit 1830, den Zeiten des Urgroßvaters, im Familienbesitz, und jede Generation hatte sie bestmöglich zu erhalten versucht. Die eingebauten Schränke und Verkaufstische aus Mahagoni waren noch tadellos, ebenso die aus Frankreich stammenden Bronzemörser und ein Dutzend alter Kristallflakons, um die sich schon mehr als ein Sammler bemüht hatte und die laut ihrem Besitzer ein Vermögen wert waren. Die Schaufenster zur Straße waren mit bunten Blumengirlanden gerahmt, der Fußboden aus portugiesischen Kacheln nach über einem Jahrhundert leicht abgetreten, und eine Traube silberner Glöckchen über der Tür machte auf eintretende Kunden aufmerksam. Die Steiner'sche Apotheke war malerisch und wurde von Touristen besucht, seit mehrere Zeitungsartikel und Fotos in einem Bildband sie zu einer Sehenswürdigkeit der Stadt gemacht hatten.
Peter Steiner wunderte sich, dass sein Freund Rudolf unter der Woche so früh bei ihm vorbeikam.
»Ist etwas mit dir?«, fragte er.
»Ich weiß nicht, ich bekomme keine Luft. Es muss das Herz sein.«
»Na, sicher nicht, dafür bist du noch zu jung. Das sind die Nerven, du hast zu viel Druck. Da, trink, der hilft gegen alles«, sagte Peter und schenkte ihm einen doppelten Brandy ein.
»Uns wird das Leben in diesem Land unmöglich gemacht, Peter. Die Nazis belagern uns. Sie ziehen die Schlinge immer enger. Wir dürfen viele Restaurants und Geschäfte nicht mehr betreten, unsere Kinder nicht mit Nichtjuden in die Schule schicken, in öffentlichen Ämtern verlieren alle Juden ihre Anstellung, unsere Geschäfte und unsere Vermögen werden beschlagnahmt, wir dürfen unsere Berufe nicht mehr ausüben und keine Nichtjuden mehr lieben.«
»Auf Dauer kann das ja nicht so bleiben, bestimmt wird es bald wieder besser«, sagte Peter, klang aber wenig überzeugt.
»Schön wär's. Es wird alles immer schlimmer. Man braucht Scheuklappen, um sich einzureden, wir Juden könnten noch ein halbwegs normales Leben führen. Die Gewalt ist überall. Jeden Tag gibt es neue Erlässe.«
»Mir tut das so leid! Kann ich denn irgendwas für dich tun?«
»Du hast schon so viel für mich getan, aber auch du kannst mich nicht beschützen. Für die Nazis sind wir ein ›Krebsgeschwür‹, das sie rausschneiden müssen aus ihrem ›Volkskörper‹. Meine Familie lebt seit sechs Generationen hier! Die Demütigungen hören nicht auf. Was nehmen sie uns als Nächstes? Das Leben, mehr bleibt uns bald nicht mehr.«
»Deinen Doktortitel und dein Vermögen kann dir niemand nehmen. Zum Glück hast du die Praxis und die Wohnung auf mich überschreiben lassen.«
»Danke, Peter. Du bist der Bruder, den ich mir immer gewünscht hätte. Ich mache mir solche Sorgen. Hier werden die niedersten Instinkte geschürt. Hitler lässt so schnell nicht von der Macht und wird versuchen, ganz Europa zu beherrschen. Er treibt uns in den Krieg. Kannst du dir vorstellen, was uns dann blüht?«
»Ein neuer Krieg? Aber nein, das wäre kollektiver Selbstmord. Wir haben unsere Lektion doch gelernt. Erinner dich an den letzten, was für ein Grauen, die Niederlage …«
»Wir Juden sind der Sündenbock. Die Hälfte meiner Bekannten versucht zu fliehen. Ich muss Rachel dazu bringen, dass wir weggehen.«
»Weggehen? Wohin?«, fragte Peter erschrocken.
»Am besten nach England oder in die USA, aber dort ein Visum zu bekommen ist so gut wie unmöglich. Ich weiß von ein paar Leuten, die nach Südamerika gegangen sind.«
»Du kannst doch nicht einfach weg! Was soll ich ohne dich anfangen?«
»Es wäre ja wohl nur vorübergehend. Und richtig entschieden bin ich auch noch nicht, ich muss erst Rachel überzeugen. Das wird schwierig genug, wir haben Jahre gebraucht, uns das Leben hier aufzubauen, und sie hat ja auch ihren Vater und ihren Bruder hier. Meine Schwester Leah muss ich auch dazu bringen, ich kann sie nicht hierlassen.«
»Das wäre ein drastischer Schritt, Rudy.«
»Ich muss an Samuel denken. Mein Sohn darf doch nicht als Aussätziger aufwachsen.«
»Ich hoffe, dass du bleibst, Rudy, aber falls nicht, sorge ich für deine Sachen. Wenn du wiederkommst, erwartet dich alles, wie du es verlassen hast.«
Sie waren beim zweiten Glas, da hörten sie draußen Lärm. Als sie die Tür öffneten, sahen sie eine Meute die Straße heraufkommen, Männer, Jungen und auch ein paar Frauen, die Schmähungen und Parteiparolen schrien und Hämmer, Knüppel und anderes Schlagwerkzeug schwangen. »Zur Synagoge! Zum Judenpack!«, brüllten die Vorderen. Steine flogen, gleich darauf das unverkennbare Geräusch splitternder Scheiben, begleitet von Feixen. Die Menge war ein wildes, in Mordlust entbranntes Tier.
»Hilf mir, ich muss die Apotheke zusperren!«, rief Peter, aber Rudolf war schon draußen und rannte nach Hause.
Der Terror nahm die Nacht in Besitz. Rachel Adler wurde die Tragweite dessen, was vor sich ging, nicht gleich klar, denn sie hatte die Vorhänge geschlossen, und der Aufruhr von der Straße drang nur gedämpft zu ihr herauf. Sie dachte, die Gruppe von Jugendlichen, die sie zuvor gesehen hatte, sei noch einmal zurückgekehrt. Um Samuel abzulenken, bat sie ihn, ihr etwas vorzuspielen, aber der Junge war wie gelähmt, als würde er all das kommen sehen, vor dem sie noch die Augen verschloss. Plötzlich traf etwas das Fenster, und die Scheibe zerbarst auf dem Parkett in tausend Splitter. Unwillkürlich schoss ihr durch den Kopf, wie teuer es sein würde, das geschwungene, geschliffene Glas zu ersetzen. Da traf ein zweiter Stein das nächste Fenster, der Vorhang rutschte aus der Führung und baumelte lose an einer Ecke herab. Durch die klaffende Öffnung sah sie ein Stück orangefarbenen Himmels, und der Geruch von Rauch und Angesengtem stieg ihr in die Nase. Wüstes Geschrei wehte in die Wohnung, und endlich begriff sie, dass das hier weit bedrohlicher war als eine Horde betrunkener Halbwüchsiger. Unter das fortgesetzte Klirren splitternder Scheiben mischten sich wütende Schreie und panische. »Rudolf!«, schrie sie entsetzt. Sie packte Samuel am Arm und zog ihn zur Tür. Der Junge schaffte es noch eben, nach seinem Geigenkasten zu greifen.
Zwischen Wohnung und Praxis lag nur die breite Marmorstiege mit ihrem Handlauf aus Holz und Bronze, aber Rachel schaffte es nicht hinunter. Theobald Volker, ihr Nachbar aus dem zweiten Stock, ein Kriegsveteran, mit dem sie bisher kaum ein Wort gewechselt hatte, war bereits im Stiegenhaus, trat ihr in den Weg und hielt sie fest. Sie fand sich gegen die breite Brust des bärbeißigen Alten gedrückt, der unverständlich auf sie einredete, während sie sich wand und nach ihrem Mann rief. Sie brauchte bestimmt eine Minute, bis sie begriff, dass Volker sie davon abhalten wollte, hinunterzugehen, weil die Eingangstür des Gebäudes mit ihren Glaskassetten bereits eingetreten worden war und sich jemand in der Halle befand.
»Sie kommen mit mir, Frau Adler!«, sagte ihr Nachbar mit einer Stimme, die das Befehlen gewohnt war.
»Mein Mann!«
»Sie können da nicht runter! Denken Sie an Ihr Kind!« Und er schob sie die Treppe hinauf in seine Wohnung, in die Rachel noch nie einen Fuß gesetzt hatte.
Die Wohnung war genauso geschnitten wie die der Adlers, wirkte aber nicht hell und elegant, sondern düster und zugig mit ihrem spärlichen Mobiliar und zwei Fotografien auf einem Sims als einzigem Schmuck. Widerstrebend ließ sich Rachel in die Küche führen, während Samuel, der seine Geige umklammerte, stumm hinterherkam. Volker öffnete die schmale Tür zur Speisekammer und forderte sie auf, sich dort zu verstecken und leise zu sein, bis er sie holen käme. Er schloss die Tür hinter ihnen, und sie standen da in dem stockdunklen, engen Kabuff und hielten einander fest. Sie hörten, dass Volker ein schweres Möbelstück verrückte.
»Was passiert da, Mama?«
»Ich weiß nicht, mein Schatz, sei still und rühr dich nicht«, flüsterte Rachel.
»Hier findet uns Papa nicht, wenn er kommt«, sagte Samuel, ebenfalls flüsternd.
»Wir bleiben nicht lang. Da sind ein paar gefährliche Männer im Haus, aber die gehen bald wieder.«
»Das sind Nazis, oder?«
»Ja.«
»Sind alle Nazis böse, Mama?«
»Ich weiß nicht, mein Schatz. Bestimmt gibt es gute und böse.«
»Aber mehr böse, glaube ich.«
Theobald Volker blickte bereits auf eine Laufbahn beim Militär zurück, als er 1914 das Kaiserreich Österreich-Ungarn verteidigen sollte. Er stammte aus einer Bauernfamilie ohne militärische Tradition, hatte es in der Armee aber zu etwas gebracht. Er maß fast einen Meter neunzig, war körperlich stark und charakterlich diszipliniert und schien damit wie gemacht für seinen Beruf, doch insgeheim schrieb er Gedichte und sehnte sich nach einem friedvollen Leben auf dem Land, wo er zusammen mit der Frau, die er schon als junger Mann geliebt hatte, die Felder bestellen und das Vieh versorgen wollte. Die vier Kriegsjahre nahmen ihm alles, was seinem Leben einen Sinn gegeben hatte: seinen einzigen Sohn, der mit neunzehn auf dem Schlachtfeld starb, seine geliebte Frau, die sich vor Kummer das Leben nahm, und seinen Glauben an das Vaterland, das doch nichts weiter war als ein Hirngespinst und eine Fahne.
Als der Krieg endete, war er zweiundfünfzig, zum Oberst befördert und seelisch schwer verwundet. Er wusste nicht mehr, wofür er gekämpft hatte. Nach der Niederlage wurde er von den zwanzig Millionen Toten heimgesucht. Er fand keinen Platz für sich in diesem in Trümmern liegenden Europa, wo die Leichen von Soldaten, Frauen, Kindern, Maultieren und Pferden gemeinsam in Massengräbern verrotteten. Einige Jahre hielt er sich mit Hilfsarbeiten über Wasser und ertrug das harte Los der Besiegten, bis das Alter und seine Gebrechen ihn zur Untätigkeit zwangen. Er lebte allein, verbrachte seine Zeit mit Lesen, Radio Hören und Dichten. Nur einmal am Tag ging er nach draußen, kaufte die Zeitung und etwas fürs Mittagessen. Seine Tapferkeitsorden hingen noch an seiner alten Uniform, und einmal jährlich, zum Tag des Waffenstillstands, mit dem die Auflösung des Kaiserreichs besiegelt worden war, für das er vier grauenhafte Jahre hindurch gekämpft hatte, zog er sie an. Zuvor bürstete er sie aus und ging mit dem Bügeleisen darüber, polierte seine Orden und reinigte seine Waffen. Dann öffnete er eine Flasche Aquavit, betrank sich zielstrebig und verfluchte seine Einsamkeit. Er gehörte zu den wenigen Bewohnern Wiens, die am Tag des Anschlusses nicht auf die Straße gegangen waren, um die deutsche Wehrmacht mit Jubel zu begrüßen, denn er hatte nichts gemein mit diesen im Stechschritt marschierenden Männern. Aus Erfahrung misstraute er jedem patriotischen Eifer.
Die Erwachsenen im Haus machten einen Bogen um den Oberst, der häufig ihren Gruß nicht erwiderte, und die Kinder hatten Angst vor ihm. Die Ausnahme war Samuel. Dessen Eltern waren häufig den ganzen Tag mit ihrer Arbeit beschäftigt, und die Haushaltshilfe war immer nachmittags um drei gegangen. Wenn er nicht bei seiner Tante Leah war, verbrachte der Junge einige Stunden allein, kümmerte sich um seine Schularbeiten und seine Musik. Ihm war schnell aufgefallen, dass sein Nachbar, wenn er Geige oder Klavier übte, mit einem Stuhl die Stiege hinabkam und sich in den Gang setzte, um zu lauschen. Unaufgefordert ließ Samuel irgendwann die Tür offen stehen. Er strengte sich an und spielte so gut er konnte für dieses Ein-Mann-Publikum, das ihm in respektvoller Stille zuhörte. Die beiden sprachen nie miteinander, und wenn sie sich im Haus oder auf der Straße begegneten, nickten sie einander nur unauffällig zu, so dass Rachel von der taktvollen Beziehung zwischen ihrem Sohn und Oberst Volker nichts mitbekommen hatte.
Nachdem er seine Nachbarin und das Kind eingeschlossen und den Tisch vor die Tür zur Speisekammer geschoben hatte, legte der Oberst rasch die graue Uniform mit den goldenen Epauletten und seiner Sammlung von Orden an, band sich das Holster mit seiner in die Jahre gekommenen, aber noch brauchbaren Luger um und bezog an der Wohnungstür Stellung.
Peter Steiner musste noch rasch das Schaufenster der Apotheke mit der Holzjalousie sichern und das Metallgitter vor dem Eingang herunterlassen. Dann streifte er seinen Mantel über und eilte durch die Hintertür nach draußen, um seinen Freund Rudolf einzuholen, aber selbst in der schmalen Seitengasse waren lautstarke Krawallmacher unterwegs. Er verbarg sich vor einer Gruppe im Schatten eines Hauseingangs und wartete, bis sie um die Ecke verschwunden waren, dann lief er weiter. Steiner war ein beleibter Mann mit rötlicher Haut, blondem, störrischem, bürstenkurzem Haar, Augen, die so hell waren, dass sie wie bewölkt aussahen, und Gewichthebermuskeln, mit denen er jedes Armdrücken gewann. Abgesehen von seiner Frau konnte niemand ihn einschüchtern, dennoch entschied er, um diese unberechenbare Meute einen Bogen zu machen, und hoffte inständig, dass Rudolf das auch getan hatte. Doch binnen Minuten musste er einsehen, dass das gesamte Viertel von dem Aufruhr erfasst war und er ihm, wenn er zur Praxis seines Freundes gelangen wollte, nicht würde ausweichen können. Er überlegte nicht lange, drängte sich in die Menge, entriss einem Jungen, der nicht zu protestieren wagte, eine Parteifahne und ließ sich, die Fahne schwenkend, von dem Menschenstrom mitnehmen.
Auf dem kurzen Weg bis zum Haus seines Freundes wurde Peter Steiner gewahr, welche Hölle in seinem sonst so ruhigen Viertel losgebrochen war, in dem traditionell ein Teil der jüdischen Bevölkerung der Stadt lebte und arbeitete. Nicht eine einzige Schaufensterscheibe war mehr heil, überall loderten Feuer, in die die Aufrührer warfen, was sie aus Wohnungen und Büros herbeischleppten, von Büchern bis zu Möbelstücken. Die Synagoge brannte lichterloh, die Feuerwehr stand tatenlos da und rührte sich erst, als die Flammen zum Nachbargebäude hinüberleckten. Er sah, wie ein Rabbiner an den Füßen übers Pflaster geschleift wurde, sein blutender Kopf auf die Steine schlug, sah, wie Männer niedergeprügelt, wie einer Frau die Kleider vom Leib und büschelweise Haare vom Kopf gerissen wurden, sah, wie zwei Kinder geohrfeigt und ein Grüppchen alter Leute angepinkelt wurde. Auf einigen Balkonen standen Schaulustige und feuerten die Angreifer an, und in einem offenen Fenster reckte einer den rechten Arm und schwenkte in der Linken eine Sektflasche, aber an den meisten Häusern waren die Türen geschlossen und die Vorhänge zugezogen.
Fassungslos über sich selbst spürte der Apotheker, dass der Taumel der Menschenmasse um ihn herum ansteckend und befreiend wirkte, dass er selbst Lust bekam, alles zu Klump zu treten, in Brand zu stecken und sich die Seele aus dem Leib zu brüllen, dass er zu einem Monster wurde. Keuchend und schwitzend, mit trockenem Mund und adrenalinprickelnder Haut, kauerte er sich hinter einen Baum und versuchte, wieder zu Atem und zur Besinnung zu kommen. »Rudy … Rudy …«, beschwor er sich leise und dann lauter, bis der Name seines Freundes ihn zur Vernunft brachte. Dann richtete er sich auf und ging unbehelligt weiter, geschützt durch die Fahne und sein Aussehen eines Bilderbuchariers.
Wie er befürchtet hatte, lag Rudolfs Praxis in Trümmern, die Tür hing in den Angeln, alle Fensterscheiben waren eingeschlagen und die Wände mit Schmähungen und Hakenkreuzen beschmiert. Möbel, Wandregale, Lampen, medizinische Instrumente, Arzneimittel, die gesamte Praxiseinrichtung war auf der Straße verstreut. Von seinem Freund fehlte jede Spur.
Oberst Theobald Volker empfing die ersten Angreifer auf der Schwelle zu seiner Wohnung, wo er mit verschränkten Armen stand. Es waren keine fünfzehn Minuten vergangen, seit sie die Eingangstür eingetreten und sich wie die Ratten auf die Stockwerke verteilt hatten. Als er später eine Runde durchs Haus machte, kam dem Oberst der Verdacht, dass die Hausbesorgerin oder irgendein Bewohner die Juden denunziert und womöglich sogar deren Wohnungstüren gekennzeichnet hatte, denn sie waren aufgebrochen und die anderen unversehrt. Die Tür der Adlers war ebenfalls noch intakt, weil sie nur angelehnt gewesen war.
Ein halbes Dutzend gewaltbesoffener Männer und Jungen mit Hakenkreuzbinden tauchte geifernd und Parolen brüllend im Stiegenhaus auf. Einer davon, der den Trupp anzuführen schien, sah sich im Gang dem Oberst gegenüber. Er hielt ein Metallrohr in den Händen und holte schon zum Schlag aus, erstarrte dann aber angesichts des hünenhaften alten Mannes in seiner museumsreifen Uniform, der ihn von oben herab herrisch ansah.
»Jude?«, blaffte er.
»Nein«, sagte Volker, ohne die Stimme zu erheben.
Von unten hörte man lautes Fluchen von denen, die in der Wohnung der Adlers niemanden angetroffen hatten. Zwei etwas ältere Männer kamen die Stiege hoch und auf Volker zu.
»Wie viele Juden wohnen im Haus?«, fragte der eine.
»Das kann ich Ihnen nicht sagen.«
»Zur Seite, wir durchsuchen Ihre Wohnung!«
»Mit welcher Befugnis?«, fragte der Oberst und legte eine Hand ans Holster seiner Luger.
Die Männer besprachen sich kurz und beschlossen, dass es sich nicht lohnte, mit dem Alten Krach anzufangen. Er war genauso arisch wie sie und außerdem bewaffnet. Sie gingen hinunter in die Wohnung der Adlers, zerstörten zusammen mit den anderen vom Geschirr bis zu den Möbeln, was sie nur konnten, und warfen nach Belieben Sachen aus dem Fenster. Zu mehreren zerrten sie den Flügel auf den Balkon und wollten ihn hinunterstürzen, doch weil er ihnen zu schwer war, weideten sie ihn nur aus.
Die Verwüstung dauerte wenige Minuten, aber danach sah es aus, als wäre eine Granate eingeschlagen. Ehe sie gingen, leerten sie den Mülleimer über den Betten aus, schlitzten die Polster der Sitzmöbel auf, packten das Tafelsilber ein, das Rachel wie einen Schatz gehütet hatte, schütteten Benzin auf den Teppich und zündeten ihn an. Dann polterten sie die Stiege hinunter und mischten sich unter die Menschenmenge auf der Straße.
Der Oberst wartete nur so lange, bis er hörte, dass sie draußen waren, und ging dann hinunter in die verwüstete Wohnung der Adlers. Er sah, dass sich das Feuer noch auf den Teppich beschränkte, hob ihn ruhig und überlegt an einer Ecke an und schlug ihn um, so dass die Flammen erstickten. Dann holte er Decken aus dem Schlafzimmer und drückte sie auf den Teppich, bis er sicher war, dass das Feuer nicht weiterschwelte. Er stellte einen der umgeworfenen Sessel auf, setzte sich und rang nach Atem. »Ich bin auch nicht mehr der Jüngste«, murmelte er niedergeschlagen.
Er blieb sitzen, wartete, dass sich das Hämmern in seiner Brust legte, und dachte über die Tragweite dessen nach, was sich hier abspielte. Es war alles viel schlimmer, als er es sich noch Stunden zuvor hätte vorstellen können, als im Radio dazu aufgerufen worden war, gegen die »Verschwörung der Juden« auf die Straße zu gehen. Der deutsche Propagandaminister hatte in Hitlers Namen verkündet, Vergeltungsaktionen für den Mord an dem Diplomaten in Paris würden nicht von der Partei organisiert, aber gebilligt werden. Der »Volkszorn« der Deutschen und Österreicher sei vollkommen gerechtfertigt. Es war eine Einladung zu Zerstörung, Brandschatzung, Mord. Diese Menschen, die auf den ersten Blick wie eine unsortierte, nur auf Gewalt zielende Masse wirkten, hatten offensichtlich nicht spontan gehandelt, sondern waren vorbereitet gewesen, hatten ihr Ziel gekannt und gewusst, dass keine Strafe drohte. Es musste eine Anweisung gegeben haben, das Eigentum von Nichtjuden unangetastet zu lassen, anders war nicht zu erklären, dass im Haus nur die Wohnungen der Adlers, Epsteins und Rosenbergs demoliert worden waren. Die Zivilkleidung dieses Haufens konnte den Oberst nicht täuschen. Er wusste, dass Gruppen aus Naziorganisationen vorn mit dabei gewesen waren, dieselben, die schon seit Jahren Gewalt als Mittel der Politik und seit dem Anschluss Österreichs den Terror als Regierungsweise ansahen.
Er war wieder zu Kräften gekommen, als er Schritte im Gang hörte, und im nächsten Augenblick stürmte ein Besessener auf ihn zu, hielt eine Fahnenstange wie eine Lanze im Anschlag und brüllte: »Adler! Adler!« Etwas schwerfällig stand der Oberst auf und zog seine Luger.
»Wer sind Sie? Was haben Sie hier zu suchen? Das ist die Wohnung von Rudolf Adler!«, schrie der Unbekannte ihn an.
Volker gab keine Antwort. Er rührte sich auch nicht, als die Spitze der Fahne bis auf zwei Zentimeter an seine Nase herankam.
»Wo ist er? Wo ist Adler?«, fragte der Mann wieder.
»Dürfte man vielleicht wissen, wer Sie sind?«, fragte Volker und wischte die Holzstange wie eine Fliege mit dem Handrücken fort.
Da erst fiel Peter Steiner das Alter seines Gegenübers auf und die Uniform aus dem letzten Krieg, und er begriff, dass er keinen Nazioffizier vor sich hatte. Oberst Volker wiederum sah, dass der andere die Fahne losließ und sich verzweifelt mit beiden Händen an den Kopf griff.
»Ich suche meinen Freund, meinen Freund Rudolf. Haben Sie ihn gesehen?«, fragte Steiner mit vom vielen Schreien heiserer Stimme.
»Er war nicht hier, als die Wohnung überfallen wurde. Und ich vermute, er war auch nicht in der Praxis«, sagte Volker.
»Und Rachel? Samuel? Wissen Sie etwas über seine Familie?«
»Sie sind in Sicherheit. Wenn Sie Dr. Adler finden, melden Sie sich bitte bei mir. Ich wohne in der zweiten Etage, in Wohnung Nummer zwanzig. Oberst a. D. Theobald Volker.«
»Peter Steiner. Falls Adler auftaucht, sagen Sie ihm bitte, dass ich ihn suche. Er soll hier auf mich warten, ich komme wieder her. Merken Sie sich meinen Namen: Peter Steiner.«
Der Geiger
Wien, November-Dezember 1938
Rudolf Adler würde nie mehr zurück nach Hause kommen und Rachel und seinen Sohn Samuel nicht mehr wiedersehen. Die Nacht vom 9. auf den 10. November dunkelte nicht. Im Schein der Brände auf den Straßen und in den Synagogen gloste der Himmel bis zum Tagesanbruch.
Peter Steiner hatte sich eine Hakenkreuzbinde beschafft, war mit der schon zerfransten, rußverdreckten Fahne das gesamte Viertel abgelaufen und hatte bei sich eine Bestandsaufnahme der Schäden und Opfer gemacht. Schließlich hörte er gegen drei am Morgen, einige Rettungswagen hätten die Schwerverletzten fortgebracht. Er eilte ins Spital und gab sich als Führer einer SA-Einheit aus, damit man ihn durchließ. Die Opfer drängten sich auf den Gängen, Ärzte und Krankenschwestern kamen mit der Versorgung kaum nach. Der Befehl, Juden abzuweisen oder zu denunzieren, hatte sie nicht erreicht, ein vorbeihastender Krankenpfleger erklärte ihm, die gerade erst Eingelieferten seien noch nicht registriert, er solle am besten selbst in den Sälen und auf den Gängen der Notaufnahme suchen, dort stünden die Tragen dicht an dicht.
Erschöpft lief Steiner einen Saal nach dem anderen ab. Als er schon aufgeben wollte und sich zum Gehen wandte, hörte er die Stimme seines Freundes, der nach ihm rief. Er war an Rudolfs Trage vorbeigegangen, ohne ihn zu erkennen. Rudolf lag auf dem Rücken, um den Kopf einen blutgetränkten Verband, das Gesicht so zerschunden, dass seine Züge unter den Schwellungen, Platzwunden und Hämatomen kaum zu erkennen waren. Er konnte nur mit Mühe sprechen, man hatte ihm mehrere Zähne ausgeschlagen. Steiner musste sein Ohr nah an den Mund seines Freundes halten, um zu verstehen, was er sagte.
»Rachel …«
»Sssch, Rudy, nicht sprechen. Deiner Familie geht es gut. Ruh dich aus, du bist im Spital, du bist hier in Sicherheit«, sagte Steiner, dem vor Erschöpfung, Mitleid und Zorn die Tränen kamen.
Die nächsten Stunden blieb er bei seinem Freund, nickte immer wieder am Boden vor seiner Trage ein, hörte ihn jammern und wirr reden. Zweimal blieb eine Krankenschwester stehen und kontrollierte, dass der Patient noch atmete, aber sie machte keine Anstalten, herauszufinden, um wen es sich handelte oder wer da bei ihm saß. Ein Blick auf die Hakenkreuzbinde, und sie stellte keine Fragen. Als es tagte, stand Peter Steiner ächzend auf, ihm tat alles weh, und er war durstig wie ein Kamel.
»Ich sage Rachel Bescheid, dass ich dich gefunden habe. Ich bin bald wieder hier, und dann bleibe ich, bis sie dich entlassen«, sagte er, bekam aber keine Antwort.
Zu Hause erwartete ihn seine Frau, auch sie hatte die ganze Nacht nicht geschlafen, sie hatte über Stunden die Meldungen im Radio verfolgt, wo es hieß, die Unruhen seien von den Juden ausgegangen. Bei einem starken Kaffee mit Brandy berichtete Peter ihr, was wirklich geschehen war. Nachdem er sich gewaschen und ein frisches Hemd angezogen hatte, machte er sich auf den Weg zum Haus der Adlers. Dort sah er vor dem Eingang mehrere Frauen auf Knien Farbe und Blutspuren vom Pflaster schrubben, bewacht von ein paar Braunhemden und verhöhnt von einem Kreis von Schaulustigen. Er erkannte Frau Rosenberg, sie war Stammkundin in seiner Apotheke. Er wollte schon hingehen, aber dann dachte er, dass Rachel dringend Nachricht brauchte, und drückte sich unauffällig vorbei.
Die Scheiben an der Eingangstür waren zerbrochen und an die Wände waren mit dickem Pinsel schwarze Hakenkreuze gemalt, aber in der Halle wurde bereits gekehrt, und ein Mann nahm Maß, um das Glas zu ersetzen. Beim Hinaufgehen bemerkte Steiner, dass in der ersten Etage die Tür zur Wohnung gegenüber von Adlers aufgebrochen war und nur noch in einer Angel hing. Er warf einen Blick hinein und sah, dass auch dort alles in Trümmern lag. In der Nummer zwanzig im 2. Stock empfing ihn Theobald Volker frisch rasiert und mit feuchten Haaren in seiner Uniform mit den Orden.
»Ich muss mit Frau Adler sprechen«, sagte Steiner.