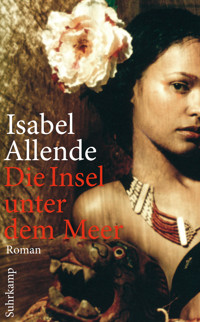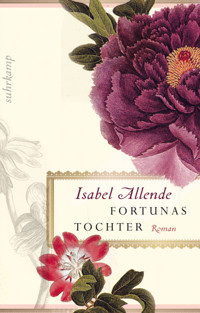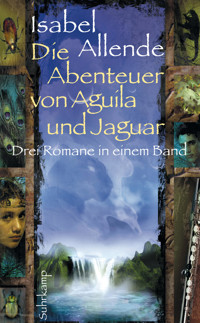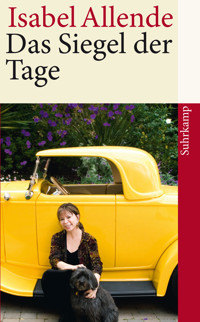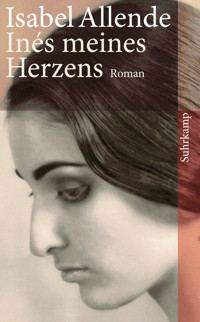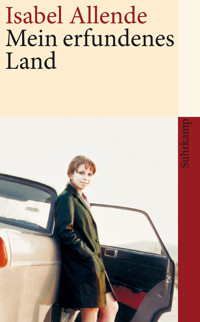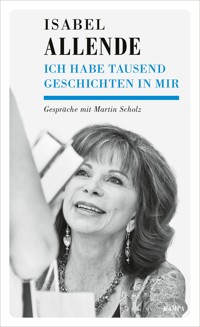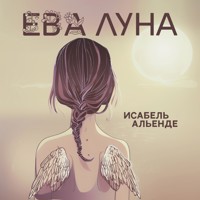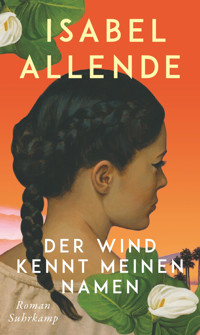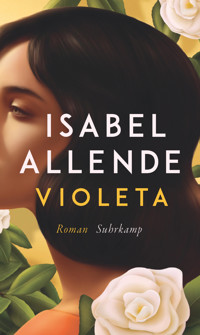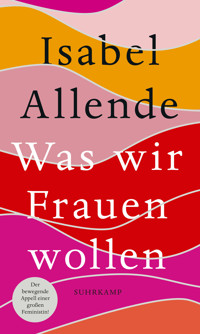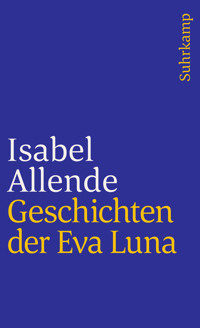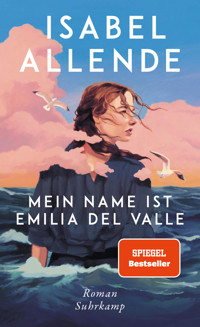
23,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Suhrkamp Verlag
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Eine Frau auf der Suche nach Wahrheit, Liebe und ihren Wurzeln
1866 erblickt Emilia del Valle in San Francisco das Licht der Welt – sie ist die Tochter einer irischen Nonne und eines chilenischen Aristokraten, großgezogen wird sie von ihrem liebevollen Stiefvater, in einem ärmlichen Viertel in San Francisco. Von klein auf eigensinnig, beeindruckt sie wenig, was andere für richtig halten, ihre große Leidenschaft ist das Schreiben. Siebzehnjährig veröffentlicht sie, unter männlichem Pseudonym, erfolgreich Groschenromane, doch das echte Leben findet sie abenteuerlicher und wird Reporterin bei einer Zeitung. Ihr Kollege ist Eric, ein junger Mann mit großer Strahlkraft, und gemeinsam gehen sie nach Chile, in das Land ihrer Vorfahren, über den sich anbahnenden Bürgerkrieg zu berichten. Emilia und Eric kommen sich näher – ist das Liebe? –, und während Emilia immer tiefer in die Geschichte ihres Vaters eintaucht, gerät sie selbst zwischen die Fronten: Sie muss sich nicht nur der Gefahr, sondern auch den drängenden Fragen nach ihrer eigenen Herkunft stellen.
Mein Name ist Emilia del Valle ist die Geschichte einer Frau, die über alle Konventionen hinweg ihren eigenen Weg zu gehen versucht, ein fesselnder historischer Roman über schmerzhafte Liebe und unverbrüchlichen Mut – erzählt von einer der »Meistererzählerinnen unserer Zeit« (Vogue).
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 447
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Cover
Titel
Isabel Allende
Mein Name ist Emilia del Valle
Roman
Aus dem Spanischen von Svenja Becker
Suhrkamp Verlag
Impressum
Zur optimalen Darstellung dieses eBook wird empfohlen, in den Einstellungen Verlagsschrift auszuwählen.
Die Wiedergabe von Gestaltungselementen, Farbigkeit sowie von Trennungen und Seitenumbrüchen ist abhängig vom jeweiligen Lesegerät und kann vom Verlag nicht beeinflusst werden.
Um Fehlermeldungen auf den Lesegeräten zu vermeiden werden inaktive Hyperlinks deaktiviert.
Die Originalausgabe erschien 2025 unter dem Titel Mi nombre es Emilia del Valle bei Plaza & Janés, Barcelona.
eBook Suhrkamp Verlag Berlin 2025
Der vorliegende Text folgt der deutschen Erstausgabe, 2025.
© der deutschsprachigen Ausgabe Suhrkamp Verlag GmbH, Berlin, 2025 © Isabel Allende, 2025
Der Inhalt dieses eBooks ist urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte vorbehalten. Wir behalten uns auch eine Nutzung des Werks für Text und Data Mining im Sinne von § 44b UrhG vor.Für Inhalte von Webseiten Dritter, auf die in diesem Werk verwiesen wird, ist stets der jeweilige Anbieter oder Betreiber verantwortlich, wir übernehmen dafür keine Gewähr. Rechtswidrige Inhalte waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Umschlaggestaltung: Rothfos & Gabler, Hamburg, nach Entwürfen von Elena Giavaldi. Umschlagillustration: David De Las Heras
eISBN 978-3-518-78347-4
www.suhrkamp.de
Widmung
Für Juan Allende, meinen geliebten Bruder
Übersicht
Cover
Titel
Impressum
Widmung
Inhalt
Informationen zum Buch
Cover
Titel
Impressum
Widmung
Erster Teil
1
2
3
4
Zweiter Teil
5
6
7
8
Dritter Teil
9
10
11
12
Vierter Teil
13
14
15
16
Epilog von Eric Whelan
Mein Dank gilt
Informationen zum Buch
Mein Name ist Emilia del Valle
Erster Teil
1
An meinem siebten Geburtstag, am 14. April 1873, zog meine Mutter, Molly Walsh, mir meine Sonntagssachen an und brachte mich zum Union Square, um die einzige Fotografie von mir machen zu lassen, die aus Kindertagen von mir existiert, und weil ich, neben einer Harfe stehend, minutenlang vor einem schwarzen Kasten die Luft anhalten musste und mich der Magnesiumblitz dann zu Tode erschreckte, schaue ich darauf so entsetzt drein wie ein Gehenkter. Ein Instrument spiele ich übrigens nicht, die Harfe gehörte neben Säulen aus Pappmaschee, chinesischen Vasen und einem ausgestopften Pferd zu den verstaubten Requisiten des Fotoateliers.
Der Fotograf war ein kleiner schnauzbärtiger Mann, der aus den Niederlanden stammte und sein Geschäft seit den Tagen des Goldrauschs betrieb. Damals ließen die Schürfer, wenn sie aus den Bergen herabkamen, um ihre Krümel zu den Banken in San Francisco zu tragen, Porträtfotos machen, die sie an ihre fast vergessenen Familien schickten. Als vom Gold nur noch die Erinnerung geblieben war, kamen wohlhabendere Kunden und posierten für die Nachwelt. Meine Mutter und ich gehörten nicht in diese Kategorie, doch hatte meine Mutter ihre Gründe, ein Porträt ihrer Tochter zu beauftragen. Mehr aus Prinzip als aus Geldnot feilschte sie mit dem Künstler um den Preis. Meines Wissens hat sie bei keinem Kauf je auf das Vergnügen verzichtet, um einen Nachlass zu bitten.
»Wo wir schon mal hier sind, schauen wir uns noch den Kopf von Joaquín Murieta an«, sagte sie zu mir, als wir das Atelier des Niederländers verließen.
Auf der gegenüberliegenden Seite des Platzes, über den man ins Chinesische Viertel gelangt, kaufte sie mir ein Zimtteilchen und führte mich dann zu einer üblen Spelunke. Wir bezahlten den Eintritt und folgten einem langen Gang in den hinteren Teil des Lokals, wo ein furchterregender Kerl einen schweren Vorhang zur Seite schob und uns in einen mit dunklen Stoffen ausstaffierten, von Kirchenkerzen beleuchteten Raum einließ. Ganz hinten standen auf einem mit schwarzen Tüchern verhängten Tisch zwei große Glasbehälter. An die übrige Dekoration erinnere ich mich nicht, weil ich starr war vor Angst. Während ich, zitternd, beide Hände in den Rock meiner Mutter krallte, wirkte sie regelrecht aufgekratzt. In dem einen Behälter schwamm in einer gelblichen Flüssigkeit eine menschliche Hand und in dem anderen ein Männerkopf mit zugenähten Augenlidern, geschürzten Lippen, gut sichtbaren Zähnen und gesträubten Haaren.
»Joaquín Murieta war ein Bandit. Genau wie dein Vater. So enden Banditen für gewöhnlich«, erklärte mir meine Mutter.
Unnötig zu erwähnen, dass ich in der Nacht schreckliche Albträume bekam. Ich fieberte, aber meine Mutter vertrat die Ansicht, solange kein Blut fließe, müsse man nichts unternehmen. Am Tag darauf gingen wir, ich wieder in meinem Sonntagskleid und mit diesen schlimmen Stiefeletten, die ich schon seit zwei Jahren besaß und die mir inzwischen zu klein waren, die Fotografie abholen und dann weiter zu Fuß in den eleganten Teil von San Francisco, in dem ich nie zuvor gewesen war. Gepflasterte Straßen, die sich die Hügel hinaufwanden, Herrenhäuser mit Rosengärten und zurechtgestutzten Sträuchern, livrierte Kutscher und glänzende Pferde und weit und breit kein einziger Bettler.
Mein Leben spielte sich im Mission District ab, einem bunten und vielsprachigen Viertel, zwischen deutschen, irischen und italienischen Einwanderern, Mexikanern, die schon immer in Kalifornien gelebt hatten, und einer beachtlichen Anzahl Chilenen, die 1848 mit dem Goldrausch gekommen waren und auch Jahrzehnte später kaum mehr besaßen als bei ihrer Ankunft. Von Gold keine Spur. Sofern sie etwas aus den Minen in den Bergen herausgeholt hatten, wurde es ihnen von den Weißen, die nach ihnen eintrafen, wieder abgenommen. Viele kehrten mit leeren Händen, aber mit sagenhaften Geschichten im Gepäck in ihre Heimat zurück, andere blieben, weil die Reise zu lang und kostspielig war. Bei uns in Mission gab es Fabriken, Werkstätten, Müll, streunende Hunde, dürre Esel, behängte Wäscheleinen im Freien und offene Türen, da bei niemandem etwas zu holen war.
Während dieses Fußmarschs mit meiner Mutter in die unerreichbaren Sphären der Oberschicht schwante mir zum ersten Mal, dass wir arm waren. Nicht so arm, dass wir hungernd zwischen Mäusen hätten hausen müssen, wie das meine irischen Großeltern mütterlicherseits getan hatten, aber eben doch bescheiden lebend von Tag zu Tag. Bis dahin hatte ich nicht mitbekommen, dass es auch Menschen gab, denen es besser ging als uns, ich hatte keine Berührung mit ihnen und sah sie allenfalls aus der Ferne, wenn ich mit meinen Eltern das Stadtzentrum besuchte, was selten vorkam. Die Kutschen mit den glänzenden Pferden, die Damen in überquellenden viktorianischen Rüschenkleidern mit Löckchen und Schleifen im Haar, die Herren mit Zylinder und Gehstock und die Kinder im Matrosenanzug gehörten für mich zu einer anderen Spezies. In unserem Viertel lebte die arbeitende Bevölkerung, wir waren alle mehr oder weniger gleich. Die Häuser dort beherbergten zumeist eine oder zwei Familien mit barfüßigen Kindern, ständig schwangeren Frauen und dauerbetrunkenen Männern, die ihr Auskommen mal hier, mal da als Tagelöhner fanden. Verglichen mit unseren Nachbarn war meine kleine Familie gut situiert. Wie mein ehrwürdiger Stiefvater zu sagen pflegte, hatten wir Arbeit, Liebe und Würde, und mehr brauchten wir nicht. Außerdem besaßen wir ein bescheidenes Heim und hatten keine Schulden.
Ich traute mich nicht, meine Mutter zu fragen, wo wir hingingen, folgte ihr nur hügelauf, hügelab und ertrug die Blasen an meinen Füßen. Molly Walsh war damals eine junge Frau mit engelsgleichem Gesicht, also der frommen Miene einer heiligen Märtyrerin, und ihre Stimme besaß diesen hellen Nachtigallenklang, der auch heute noch trügerisch wirkt, denn sie ist stark und durchsetzungsfähig. In den seltenen Fällen, wenn sie meinen Vater erwähnt, wechselt ihre Stimmlage, der leicht klagende Unterton schwindet, und sie spuckt die Wörter aus. Diesmal hatte sie zwar nichts gesagt, aber ich ahnte doch, dass die schmerzhafte Wanderung in die Wohngegend der Reichen etwas mit ihm zu tun hatte.
Wir kamen keuchend in Nob Hill an, ganz oben auf dem Hügel, wo man einen weiten Blick über die Stadt und die Bucht von San Francisco hat. Vor dem prächtigsten Haus in der Straße blieben wir stehen, besser gesagt vor dem hohen, schmiedeeisernen, mit Pfeilspitzen bewehrten Tor, durch das ich einen traumschönen Garten sehen konnte mit einem Brunnen aus Stein, auf dem ein Fisch Wasser spie. Dahinter erhob sich ein gewaltiges butterfarbenes Gebäude mit einem von Säulen gestützten Vorbau und einer mächtigen, von zwei steinernen Löwen flankierten Eingangstür aus dunklem Holz. Meine Mutter nannte es eine Geschmacklosigkeit von Neureichen, aber mir blieb vor Staunen der Mund offen stehen: So mussten die Paläste aus dem Märchen aussehen. Wir standen einige Minuten vor dem Tor und schöpften Atem, meine Mutter tupfte sich den Schweiß ab und rückte ihren Hut zurecht. Plötzlich, noch ehe sie am Seil der Schelle ziehen konnte, verließ seitlich ein Mann in dunklem Anzug mit gestärktem Kragen das Gebäude, kam über den weiten Vorplatz auf uns zu und sprach meine Mutter an, ohne die Pforte zu öffnen. Obwohl sie sich alle Mühe mit unserem Erscheinungsbild gegeben hatte, erkannte er unsere gesellschaftliche Stellung vermutlich auf den ersten Blick.
»Womit kann ich dienen?«, fragte er blasiert, und wir hatten Mühe, seinen britischen Akzent zu verstehen.
»Wenn ich bitte Herrn Gonzalo Andrés del Valle sprechen könnte«, antwortete meine Mutter und versuchte ebenso hochnäsig zu klingen wie ihr Gegenüber.
»Sind Sie angemeldet?«
»Nein, doch er empfängt mich gewiss.«
»Tut mir leid, Madam, ich fürchte, er ist verreist.«
»Wann kommt er zurück?« Meiner Mutter war aller Wind aus den Segeln genommen.
»Das kann ich nicht sagen.«
Der Mann öffnete die Pforte, bat uns aber nicht herein, sondern ließ uns auf der Straße stehen. Mir war es unbehaglich, wie er uns von Kopf bis Fuß musterte, doch offenbar kam er zu dem Schluss, dass wir weder eine Gefahr noch ein Ärgernis darstellten, denn sein Ton wurde etwas freundlicher.
»Herr del Valle ist bisweilen zu Besuch in San Francisco, aber er lebt in Chile«, erklärte er uns und dass die Familie Besucher nur nach Anmeldung empfange.
»Sagen Sie mir, wohin ich ihm einen Brief schicken kann. Es ist überaus wichtig«, sagte meine Mutter.
»Geben Sie ihn mir, Mrs. …«
»Molly Walsh«, sagte sie und unterschlug ihren Ehenamen Claro.
»Ich kümmere mich persönlich darum, dass er ihn erhält, Mrs. Walsh«, versicherte ihr der Mann.
Sie übergab ihm den Umschlag mit meiner Fotografie und einem Schreiben, in dem sie ihm Emilia vorstellte, seine Tochter. Es sollte nicht der letzte Brief sein, den sie meinem mutmaßlichen Vater schrieb.
Ich wuchs mit der Vorstellung auf, dass mein leiblicher Vater ein steinreicher Chilene war und ich das Recht auf eine Erbschaft hatte, um die mich das Schicksal bislang betrog, die Gottes unermessliche Güte jedoch eines Tages in meine Reichweite befördern würde. Die gegenwärtigen wirtschaftlichen Einschränkungen seien eine Prüfung, die der Himmel mir auferlegte, damit ich Bescheidenheit lernte, doch dereinst würde ich dafür entschädigt werden, sofern ich folgsam und tugendhaft wäre. Tugend wurde in Jungfräulichkeit und Zurückhaltung gemessen, denn nichts erzürnt den Herrgott mehr als ein leichtlebiges und vorlautes Mädchen. In der Messe und beim allabendlichen Beten auf Knien vorm Bett ließ meine Mutter mich Gott darum bitten, dass er unseren Schuldigern in dem Maß vergab, in dem sie ihre Schulden beglichen. Es dauerte Jahre, bis ich begriff, dass diese Spitzfindigkeit auf meinen Vater gemünzt war.
Tatsächlich hätte meine Kindheit nicht besser sein können. Meine Mutter hätschelte mich, hatte aber immer alle Hände voll zu tun und weder die Zeit noch das Verlangen, mich zu überwachen, und mein Stiefvater hielt seine Prinzessin zu keiner Missetat für fähig und überwachte mich ebenfalls nicht. Er hatte recht, ich war ein stilles Kind, aufs Lesen versessen, genügsam und empfindlich, spielte meist allein und machte keine Schwierigkeiten, bis ich im Aufruhr des Heranwachsens zu einem Scheusal wurde. Doch das währte zum Glück nicht lang. Die wirtschaftlichen Einschränkungen, von denen meine Mutter sprach, spielten für mich keine Rolle, da niemand ringsum mehr besaß, und das angebliche Erbe war nur ein Märchen, das ich tunlichst für mich behielt, weil man mich dafür ausgelacht hätte. Mir jagte die Vorstellung Angst ein, dass dieser mysteriöse Chilene, ein Bandit wie Joaquín Murieta, eines Tages auftauchen, mich als seine Tochter einfordern und weit wegbringen könnte, denn der Gedanke, von meiner Mutter getrennt zu sein, entsetzte mich, und mein Vater war Francisco Claro, zu dem ich von jeher Papo gesagt habe, und niemand sonst. Er war damals mein Vater und wird es immer sein, auch wenn wir nicht blutsverwandt sind.
Meine Mutter, Molly Walsh, ist in New York geboren, als Tochter irischer Einwanderer, die vor der Großen Hungersnot geflohen waren. Als er hörte, in Kalifornien sei der Boden mit Gold übersät, schloss sich Mollys Vater mit seiner Familie den Trecks der Pioniere an, die im Jahr 1849 den Kontinent überquerten, um im Westen reich zu werden. Unterwegs starb einer der Söhne und blieb in einem kleinen Grab ohne Namen zurück. Wenige Monate nach ihrer Ankunft in der neu entstehenden, chaotischen Stadt San Francisco starb seine Frau an Entkräftung. Sie, meine Großmutter, hatte wie eine Heldin die harten Monate der Reise überstanden, weil sie die Kinder, die ihr geblieben waren, behüten musste, doch reichten ihr Mut und ihre Entschlossenheit nicht aus für ein Überleben zwischen den rauen und ehrgeizgetriebenen Menschen, unter denen sie in Kalifornien gelandet waren, und während eines ihrer blutigen Hustenanfälle versagte ihr Herz. Der Witwer, mein Großvater, sah sich allein mit den Kindern und begriff, dass er sich unmöglich um sie kümmern und zugleich wie geplant auf die Suche nach Gold gehen konnte. Seinen Ältesten, der bereits zwölf war, nahm er mit in die Berge, brachte den zweiten als unbezahlte Hilfskraft auf einer Farm unter und gab die vierjährige Molly in ein von drei mexikanischen Nonnen gegründetes Waisenhaus mit dem Versprechen, sie abzuholen, sobald er das begehrte Vermögen beisammen hätte. Dazu sollte es nie kommen.
Als Kind war Molly folgsam und fromm und schien Gefallen am Leiden zu finden. Das jedenfalls hat mein Papo erzählt, obwohl es schwer zu glauben ist, wenn man sieht, wie kämpferisch sie heute Straßenproteste anführt oder, bewaffnet mit ihrem Nudelholz, Säufern, Banditen, Polizisten und anderen entgegentritt, die in unserem Viertel Ärger machen. Die kleine Molly verbrachte so viele Stunden auf Knien, fastete derart inbrünstig und ertrug so duldsam den Spott und die bösen Streiche der anderen Mädchen, dass sie den Spitznamen heilige Molly bekam. Die beiden jüngeren Nonnen, zwei schlichte Gemüter, gaben ihr den Vorzug vor den übrigen Waisen und hofften auf das Wunder, in ihrem Schoß eine echte Heilige heranwachsen zu sehen. Mutter Rosario, die der winzigen religiösen Gemeinschaft vorstand, maß Mollys übertriebener Hingabe und der verrückten Hoffnung ihrer beiden Mitschwestern zunächst keine Bedeutung bei. Ihre Schützlinge waren kleine Mädchen, die keine Eltern hatten oder von ihnen verlassen worden waren, und benahmen sich mitunter etwas sonderbar, doch als das Mädchen im Alter von elf Jahren Erscheinungen bekam und anfing Stimmen zu hören, musste sie doch eingreifen. Das ging zu weit. Frömmelei war in Mutter Rosarios Augen etwas für Müßiggängerinnen und in ihrem Waisenhaus unangebracht, denn hier bewies sich die Liebe zu Gott durch Arbeit. Die Grenze zwischen himmlischen Botschaften und Geisteskrankheit schien ihr fließend, und sie war entschlossen, das Kind mit kalten Bädern und Geranienöl von jeder Heiligkeit zu kurieren. Sie zwang Molly zu drei Mahlzeiten am Tag und wachte darüber, dass sie aufaß und sich nicht heimlich erbrach, schickte sie zur Arbeit mit Spaten und Hacke in den Garten, an die Waschtröge und in die Backstube und ließ sie Fußböden schrubben. Mit Hilfe von täglichem Reis mit Gemüse und schweißtreibender Arbeit überstand das Mädchen die schwierigen Jahre des Heranwachsens weitgehend unbeschadet, auch wenn ihr der Hang zur Theatralik erhalten blieb. Da sie nie Nachricht von ihrem Vater oder ihren Brüdern bekam, betrachtete sie die drei Nonnen als ihre einzige Familie. Und auch wenn sie zu beschäftigt war, um den Märtyrern aus dem Kirchenkalender nachzueifern, verspürte sie weiterhin eine religiöse Berufung und bat mit fünfzehn Jahren darum, in den Orden eintreten zu dürfen.
Und so wurde Molly Walsh das große Glück zuteil, dass man ihr die Haare wie einem Sträfling schor und sie in das kratzige weiße Gewand der Novizin kleidete. Sie nahm ihren Platz in der kleinen Gemeinschaft der Frauen ein, bei denen sie aufgewachsen war, und wollte sich mit Leib und Seele der Barmherzigkeit widmen. Noch lieber wäre sie einem geschlossenen Orden beigetreten, wo sie karg und unwirtlich zwischen eisigen Klostermauern leben und ihren Leib im Büßerhemd hätte kasteien dürfen, hätte auf dem nackten Steinboden mit einem Holzklotz als Kopfkissen geschlafen und bis zur Ohnmacht gefastet. Doch sie musste sich mit einem freundlicheren Leben in dem großen Waisenhaus aus Lehmziegeln begnügen, wo auf den gezimmerten Pritschen Matratzen aus Pferdehaar lagen und das Essen zwar schlicht, aber mehr als ausreichend war. Die Mutter Oberin hatte für ihren Appetit, der am Umfang ihrer Taille und an den Polstern auf ihren Hüften auch unter ihrem Habit zu erkennen war, gute Gründe, denn dem Herrn konnte nur dienen, wer bei Kräften und bei Gesundheit war.
Mit siebzehn war Molly so weit, die Aufgaben zu erfüllen, für die man sie ausgebildet hatte: dienen und lehren. Im Waisenhaus gab es genug zu tun, aber Mutter Rosario hielt es für ratsam, dass ihre Schülerin hinaus in die Welt ging, damit sie von ihrer Wolke herunterkäme, ein wenig praktische Vernunft lernte und ihre Berufung auf die Probe gestellt würde. Sie argwöhnte, dass im Innern der Kleinen ein Feuer loderte, das auch durch ein Nonnenhabit nicht einzudämmen sein würde.
Die Welt, auf die sich die Mutter Oberin bezog, beschränkte sich auf den Mission District, der auf die erste Missionsstation der Franziskaner im 18. Jahrhundert zurückgeht. Hier sammelte sich die vielköpfige mexikanische Bevölkerung von San Francisco. Einige Tage vor den ersten Goldfunden war mit Unterzeichnung des schmählichen Vertrags von Guadalupe Hidalgo der Krieg zwischen den USA und Mexiko beendet worden, und Mexiko hatte über die Hälfte seines Territoriums, darunter Kalifornien, an die Vereinigten Staaten abtreten müssen. Die Mehrzahl der mexikanischen Haciendas wurde enteignet, und die Bauern, die dort über Generationen gelebt hatten, verloren ihre Arbeit. Einige von ihnen jagten vergeblich dem Traum vom Gold nach, andere wurden Banditen, und die Übrigen schlugen sich irgendwie durch. Von bestimmten Nachbarn wussten wir, dass sie sich ihren Lebensunterhalt als Straßenräuber verdienten, aber solange sie die Leute aus Mission nicht behelligten, wurden sie von niemandem verpfiffen. Mehr als einmal hatten die Nachbarn sie bei Razzien vor der Polizei versteckt, weil bekannt war, dass ihnen das mit Gefälligkeiten vergolten wurde und sie einem in Notlagen zinslos Geld liehen. Den Banken vertraute niemand, von denen wurde man wirklich ausgeraubt.
In einer kleinen Schule mit dem pompösen Namen »Der Stolz der Azteken« trat Molly Walsh eine Stelle als Lehrerin an. Die Schule bestand aus einem Klassenraum mit Lehmziegelwänden und Strohdach, vollgepackt mit Schülern, durchweg Jungen zwischen sechs und siebzehn Jahren. Unterrichtet wurde auf Spanisch, und die beiden kleinen Iren und der Schwarze, ein Enkel von Sklaven, dessen Familie während des Bürgerkriegs aus Alabama geflohen war, hatten die Sprache rasch gelernt. Als Einrichtung gab es zwei lange Tische und etliche kleine, von den Nachbarn gespendete Schulbänke mit Stühlen, außerdem einen Holzofen in der Ecke, der die Nebelfeuchte vertrieb und auf dem Eier gebraten wurden, einen Schrank mit Unterrichtsmaterial und im Hof eine Latrine. Auch ein Hühnerstall war vorhanden, er lieferte die Eier für das Schulessen, denn einige Kinder kamen morgens mit leerem Magen. In Kalifornien lebten zwar ebenfalls einige wohlhabende spanischsprachige Familien, doch deren Sprösslinge besuchten kirchliche Internate weit entfernt vom Mission District. Die Schüler im »Stolz der Azteken« waren arm.
Der Gründer, Leiter und bis zu Mollys Ankunft einzige Lehrer der Schule war der Mestize Francisco Claro aus Chihuahua, von allen Don Pancho genannt, ein echter Gelehrter, der sein Leben mit Lernen verbrachte, weil er mit messianischem Sendungsbewusstsein bemüht war, das Universum, das Leben und den Tod zu erklären. Nichts entging seiner Neugier oder entglitt seinem Gedächtnis. Sein Wunsch, in seinen Schülern echten Lerneifer zu wecken, zerschellte allerdings an der harten Wirklichkeit, denn sobald die Kinder die Grundzüge von Lesen, Schreiben und Rechnen beherrschten, verließen sie die Schule und suchten sich Arbeit. Fast keins blieb länger als ein oder zwei Jahre. Selbst die Allerkleinsten mussten etwas zum Lebensunterhalt ihrer Familie beitragen.
Don Pancho war dankbar für die junge Novizin und empfing sie mit Respekt. Er brauchte sie. Mit ihr als Unterstützung konnte er die Klasse teilen. Er trennte den Raum mit einem papiernen Wandschirm aus dem Chinesischen Viertel, der mit Reihern und Schwertfischen bemalt war, und übernahm den Unterricht der älteren Schüler, während sich Molly um die jüngeren kümmerte. Außerdem übertrug er ihr die leidige Aufgabe, Spenden für die Schule zu sammeln, was ihr bei ein paar besser gestellten Mexikanern und einigen wohlhabenden Weißen leichtfiel, die ihre von Geldgier verursachten Gewissensbisse lindern wollten. Wer von Molly mit ihrem Engelsgesicht, ihrem sanften Auftreten und ihrer Ordenstracht um eine milde Gabe gebeten wurde, konnte schlecht Nein sagen. Genau wie Mutter Rosario vermutet hatte, öffneten die durchscheinende Haut und die blauen Augen Molly viele Türen, die einer waschechten Mestizin, wie die Mutter Oberin es war, verschlossen blieben.
Schon die ersten Tage änderten das Leben von Molly und Don Pancho grundlegend. Vor ihr taten sich ganz neue Perspektiven auf, und er konnte endlich seine Leidenschaft für den Erwerb und die Weitergabe von Wissen mit jemandem teilen. Sie verbrachten den Tag miteinander, fegten bei Sonnenaufgang den Hof, säuberten die Latrine und den Hühnerstall; gegen Mittag bereiteten sie Tortillas und Rühreier für die Schüler zu; bis um fünf am Nachmittag unterrichteten sie, und wenn die Kinder gegangen waren, blieb Molly noch und lernte unter Anleitung des Schulleiters. So erfuhr sie von den Wundern des Tierreichs, der unendlichen Zahl von Galaxien, von den Bräuchen ferner Völker, von unfehlbarer Mathematik und was ihm sonst noch wesentlich schien. Von der Schlechtigkeit der Welt erfuhr sie hingegen so wenig wie zuvor bei den Nonnen.
Don Pancho hatte zum ersten Mal eine Schülerin mit rascher Auffassungsgabe und Zeit zum Lernen. Er hielt Molly für formbar, für ein weißes und reines, unbeschriebenes Blatt, dem er seinen Stempel würde aufdrücken können. Wie hätte er ahnen sollen, dass sich unter ihrer augenscheinlichen Unbedarftheit ein zäher Wille verbarg. Gut möglich, dass Molly das damals selbst noch nicht wusste. Sehr bald hatten die beiden sich in ihrem Tagesablauf eingerichtet und pflegten ein unschuldig väterlich-töchterliches Miteinander, weshalb Mutter Rosario nicht beunruhigt darüber war, dass ihre Novizin den ganzen Tag allein in Gesellschaft eines Mannes verbrachte. Vom Rektor des »Stolz der Azteken« waren keine Laster bekannt, er trank und spielte nicht, prügelte sich nicht und stieg nicht den Frauen nach. Auch für Männer hatte er anscheinend nichts übrig. Es ging sogar das Gerücht, er habe in der Schlacht von Chapultepec, in der er mit einundzwanzig Jahren gekämpft hatte, seine Männlichkeit eingebüßt, wobei er, wie er selbst sagte, nicht aus patriotischem Eifer dort teilgenommen hatte, sondern weil er mit vorgehaltenem Bajonett zum Heer von General Santa Anna gepresst worden war. In seinen Augen zogen nur mordlüsterne Irre freiwillig in den Krieg.
Mollys Tracht verbarg die Formen ihres Körpers vollständig, nicht jedoch ihr hübsches Gesicht. Meine Mutter besitzt diese weiße Haut, die sich bei jeder Gefühlsregung rötlich färbt und die in jungen Jahren strahlend aussieht, den Anfeindungen der Zeit allerdings schlecht widersteht. Ihre Nase ist gerade wie bei einer römischen Statue, sie hat einen kleinen Mund, kindliche Grübchen in den Wangen, eine Kerbe im Kinn und Augen von einem tiefen Lapislazuliblau, das auch mit dem Alter nicht verblasst ist. Unter dem eng anliegenden Schleier der Novizin lugte keine Haarsträhne hervor, doch ihre Haut und die Augenfarbe ließen vermuten, sie sei blond. Das war sie nicht. Die Haare meiner Mutter waren schwarz und wurden mit der Schere raspelkurz gehalten. Sollte Don Pancho je versucht gewesen sein, ihre Weiblichkeit als solche zu bewundern, verscheuchte er seine Fantasien sofort. Ihr Habit war ein Harnisch, Molly Walsh war unantastbar. Und obgleich Don Pancho ein erbitterter Gegner jeglicher Religion war, schien ihm die junge Frau anbetungswürdig wie die Jungfrau von Guadalupe.
So vergingen die nächsten drei Jahre mit Lernen, Arbeit und Kameradschaft im »Stolz der Azteken«, und der Tag rückte näher, an dem Molly Walsh zur Nonne geweiht werden sollte. Mutter Rosario hatte die Zeremonie für Dezember geplant, denn dann würde ein Wanderbischof zu Besuch sein, der aus Mexiko auf eine Reise durch die Kirchengemeinden und kleinen Pfarreien in Kalifornien geschickt worden war. Dem würdevoll ärmlichen Waisenhaus böte die Weihe Anlass zu einer Feierlichkeit.
Molly Walsh wurde nie zur Nonne, und jede Hoffnung auf Heiligkeit, die sie in ihrer frühen Jugend genährt haben mochte, wurde binnen Tagen zunichtegemacht von einem chilenischen Herrensöhnchen mit erheblichem Vermögen, einnehmendem Äußeren und wenigen Skrupeln. Sein Name war Gonzalo Andrés del Valle. Er war mein Vater. Dieser Mann warf ein Auge auf die Novizin, war von ihrem Gesicht und ihrer anmutigen Haltung beeindruckt und schloss daraus, dass sich unter der scheußlichen Ordenstracht ein appetitlicher Körper verbarg. Ich weiß nicht, wo er sie zum ersten Mal sah, vielleicht klapperte sie die Villen von Nob Hill ab, um mit ihrem Körbchen Spenden für die Schule zu sammeln. Der Chilene, der es gewohnt war, seine Launen ungestraft zu befriedigen, nahm sich vor, sie zu erobern, und der Habit war ihm dabei nicht Hemmnis, sondern Anreiz.
Ich werde nie erfahren, wie es diesem chilenischen Filou gelang, den Widerstand der jungen Frau zu brechen, für die doch fast alles Sünde war und nichts Gottes unerbittlichem Urteil entging, aber Tatsache ist, dass er sie einfing wie ein hypnotisiertes Kaninchen. Es mag aber sein, dass er gar keine ausgefeilten Listen anwenden musste und es schon ausreichte, die Sehnsucht nach Liebe zu wecken, die in ihr ruhte wie in einem schlafenden Vulkan. Ich weiß auch nicht, wo sie den Akt vollzogen, aus dem ich hervorging. Ich rede von einem einzigen, weil ich mir denke, dass del Valle nach dem ersten Mal jedes Interesse an diesem Abenteuer verlor. Natürlich hat meine Mutter mir nichts davon erzählt, aber ich kann es mir leicht vorstellen, denn ich kenne sie gut. Unbekleidet war Molly trotz des grotesk geschorenen Schädels sogar noch schöner, als der Chilene es sich vorgestellt hatte, nur war sie bestimmt extrem schamhaft, überempfindlich und melodramatisch. Kurzum, eine Zumutung. Für erotische Kapriolen war sie nicht zu haben, das Zusammensein glich einer Vergewaltigung, die kurze Lust war sofort verflogen, und zurück blieb der schale Nachgeschmack davon, diese Braut Jesu geschändet zu haben. Ihre Unschuld würde ihm nur das Leben schwermachen, beim besten Willen konnte er keine Hysterikerin brauchen, die sich ihm starr wie eine Leiche überließ und hinterher tränenüberströmt Vaterunser murmelte und Gott um Vergebung anflehte, während er sich die Hose zuknöpfte. Er musste sie loswerden, und das Gnädigste würde sein, die Verbindung mit einem Hieb zu kappen, wie wenn man ein Huhn köpft. Aus der Liebesleidenschaft würde Groll werden, und die Kleine könnte ihn rasch vergessen. Er sorgte dafür, dass er ihr nicht mehr begegnete.
Molly Walsh wusste nichts von den irdischen Aspekten des Daseins, aber auf den Kopf gefallen war sie nicht, und sie begriff schnell, dass sie benutzt und weggeworfen worden war wie ein abgelegtes Kleidungsstück. Durch strenges Fasten, Steinchen in den Schuhen und andere Kasteiungen versuchte sie, für ihre Sünde zu büßen und ihr Verlangen nach Liebe mit Stumpf und Stiel auszureißen. Sie wollte nie mehr an diesen flüchtigen Liebhaber denken, und vielleicht wäre ihr das sogar gelungen, wäre ich nicht gewesen. Mehrere Wochen nach dem hastigen fleischlichen Abenteuer, merkte sie, dass sie schwanger war. Sie sah darin eine Strafe Gottes, so hat sie es mir mehr als einmal gesagt: Ich bin nicht die Frucht der Liebe, nicht einmal die der Lust, ich bin eine Strafe Gottes. Meine Mutter erinnert mich daran, wenn ich mich schlecht benehme, doch das war mir als Kind einerlei, und als Erwachsene lache ich darüber. Zum Glück war Don Pancho zur Stelle und gab mir das nötige Selbstvertrauen, darüber hinwegzusehen. Für ihn bin ich ein Geschenk des Himmels. Wozu also viele Worte darüber verlieren, es hat mir nicht weiter geschadet.
Del Valle antwortete nicht auf die verzweifelten Briefe, die Molly für ihn in der Villa in Nob Hill abgab, aber schließlich gelang es ihr, ihn in der Kathedrale zur Unbefleckten Empfängnis zu stellen, wohin die vornehmen Katholiken sonntags zur Mittagsmesse gingen, um gesehen zu werden. Vom hinteren Teil des Kirchenschiffs aus beobachtete sie, wie er am Beichtstuhl vorbeiging, die Kommunion empfing und auf Knien mit theatralischer Inbrunst betete. Am Ausgang passte sie ihn ab, hängte sich ihm ans Revers und beschimpfte ihn, rot vor Scham. Etliche Personen blieben stehen, um das Schauspiel zu genießen. Nichts geht über einen Skandal in Aristokratenkreisen. Allerdings hatte del Valle recht wenig von einem Aristokraten, wie fast alle Reichen in der Glücksritterstadt San Francisco war auch er neureich. Obendrein war er weder Protestant noch Angelsachse, kam aus einem Land, das kaum jemand auf der Landkarte gefunden hätte, und konnte schon deshalb nicht darauf hoffen, in den USA als Aristokrat durchzugehen.
Das Vermögen, das die Familie del Valle während des Goldrauschs angehäuft hatte, stammte aus dem kuriosen Geschäft, Lebensmittel aus Chile nach Kalifornien zu verschiffen. Die weitsichtige Matriarchin der Familie, Paulina del Valle, hatte die Idee gehabt, den Frachtraum eines Schiffs mit Eisblöcken von einem Gletscher im Süden des Landes auszulegen und darüber Gemüse, Obst, Räucherfleisch, feinste Wurstwaren, frischen Käse und andere Delikatessen zu stapeln. Nach zwei Monaten Fahrt von Valparaíso nach San Francisco verkaufte sie die bestens erhaltene Ware zu Goldpreisen und steuerte auf dem Rückweg Panama an, um das übrig gebliebene Eis loszuschlagen. Diese Fahrten wiederholte sie ein ums andere Mal mit kräftigen Profiten, bis andere, schnellere Schiffe ihr das Geschäft streitig machten. Keiner ihrer Nachkommen verfügte über Doña Paulinas Geschäftstüchtigkeit, und der Unternehmergeist verschwand aus ihrer Familie. Ich erwähne sie hier, weil sich unsere Wege eines Tages kreuzen sollten. Gonzalo Andrés war einer ihrer Neffen, außerdem ihr Patenkind und ein talentloser Taugenichts wie alle seine Cousins und Geschwister.
An diesem Tag in der Kirche packte Gonzalo Andrés Molly am Arm, zog sie unsanft weg von den Gläubigen, die aus der Messe drängten, und behauptete, sie wolle ihm ein Kind anhängen, das nicht von ihm stamme. Welchen Beweis es überhaupt für seine Vaterschaft gebe? Sicher, sie sei Jungfrau gewesen, als sie es taten – und bitte, sie habe es sehr bereitwillig getan –, aber inzwischen seien zwei Monate vergangen, also Zeit genug für weitere Liebhaber. Wenn sie die Ordenstracht nicht daran gehindert habe, es mit ihm zu treiben, dann wohl auch nicht mit anderen, stieß er leise hervor, damit es die Neugierigen, die sich in der Nähe herumdrückten, nicht hörten. Aus einem Impuls heraus, der angesichts ihres bisher so verschüchterten und unterwürfigen Auftretens völlig unerklärlich war, wischte Molly Walsh sich mit dem Handrücken die Tränen weg und drohte ihm mit der grausigen Überzeugtheit und Wortgewalt eines Orakels:
»Keine Frau wird dich je lieben, du wirst keine weiteren Kinder haben und geradewegs in der Hölle landen!«
In diesem Augenblick war die wahre, die mutige und couragierte Molly Walsh zwischen den Falten der Ordenstracht aufgeblitzt, und sie war gekommen, um zu bleiben. Der Verführer nahm die düstere Prophezeiung mit höhnischem Lachen entgegen, wandte sich ab und ging davon. Doch mit der Zeit sollte Gonzalo Andrés del Valle begreifen, dass die Worte ihn bis ins Mark getroffen hatten. Er konnte sie nicht vergessen.
Meine Mutter verbarg ihre Schwangerschaft fünf Monate lang, bis der Dezember kam und sie, anstatt sich auf die Weihe durch den wandernden Bischof vorzubereiten, Mutter Rosario über ihren Zustand in Kenntnis setzen musste. Sie sei keine Braut Jesu mehr, sondern eine künftige unverheiratete Mutter, unmoralisch und sündig, eine weitere Hure Babylons. Die Mutter Oberin entgegnete, Kalifornien sei weit entfernt von Babylon, man müsse der Lage mit Bedacht begegnen. Sie fühlte sich verantwortlich für das, was Molly zugestoßen war, weil sie dieses Unschuldslamm in die Welt geschickt hatte, und brachte es nicht übers Herz, ihr übermäßige Vorwürfe zu machen. Molly war entehrt und sitzengelassen worden, möge Gott sich ihrer erbarmen. Sie gab ihr etwas Geld aus dem Klingelbeutel, einen Rock aus schwarzem Tuch und eine strenge, weiße, hochgeschlossene Bluse mit langem Arm, die sie unter den Kleiderspenden für die Bedürftigen fand. Molly verabschiedete sich von ihr und von den anderen Nonnen und versprach, fortan ein gottgefälliges Leben zu führen und den Jungen oder das Mädchen, das sie zur Welt bringen würde, im Schoß der katholischen Kirche zu erziehen. Dann suchte sie Trost bei ihrem einzigen Freund, dem Schulleiter des »Stolz der Azteken«.
Don Pancho Claro hatte sich in Molly verliebt, kaum dass er sie kennenlernte, hatte die Anziehungskraft aber in kameradschaftliche Gefühle umgemünzt, weil er sich dieser für die Kirche bestimmten jungen Frau nicht für würdig hielt und außerdem doppelt so alt war wie sie. Obwohl er sie seit drei Jahren täglich sah, waren ihm die Veränderungen an ihrem Äußeren entgangen, denn sie war sehr dünn und ihr Bäuchlein unter dem weiten Gewand der Novizin nicht zu sehen. Der Schulleiter erkannte sie nicht sofort in der Frau, die zu unerwarteter Stunde an seine Tür klopfte, und bemerkte ihren Zustand erst, als sie ihm das Drama gestand.
»Lieber wäre ich tot! Nirgends auf der Welt gibt es einen Platz für mich. Was soll ich nur tun?«, schluchzte Molly.
»Fürs Erste gar nichts. Sie können nur abwarten, Molly«, sagte Don Pancho.
»Aber wie denn? Ich kann nicht zurück ins Waisenhaus und die Nonnen mit meiner Sünde beschämen. Ich sitze auf der Straße!«
»Wohnen Sie bei mir. Mein Haus ist klein, aber ich hätte ein Zimmer für Sie. Solche Sachen regeln sich von selbst, lassen Sie sich von mir helfen.«
»Bei Ihnen wohnen? Was sollen die Leute denken!«
»Gerede wird es sowieso geben, Molly, es sei denn, Sie erweisen mir die unermessliche Ehre, meine Frau zu werden«, sagte Don Pancho so schüchtern, dass Molly dachte, sie habe sich verhört, und er es wiederholen musste.
»Ihre Frau werden, Don Pancho? Aber ich liebe Sie nicht.«
»Wir empfinden beide Respekt und Zuneigung füreinander, das ist ein guter Anfang. Ich bilde mir nicht ein, dass ich Sie verdient hätte, Molly, aber vielleicht gewinnen Sie mich mit der Zeit ja ein wenig lieb. Ich werde Sie nicht mit ehelichen Pflichten belästigen. Wir können einander unterstützen und Gesellschaft leisten. Allein zu sein ist sehr hart.«
»Und das da?« Sie zeigte mit einer dramatischen Geste auf ihren Bauch.
»Ich kümmere mich, keine Sorge.«
»Verantwortlich dafür ist ein gewisser Gonzalo Andrés del Valle, und dieses Kind wird seinen Namen tragen«, sagte sie.
»Wozu? Der wäscht seine Hände doch in Unschuld.«
»Weil dem Kind ein Erbe zusteht«, sagte sie.
»Das wird es nicht brauchen, Molly. Vermögend bin ich nicht, aber glauben Sie mir, diesem Jungen oder Mädchen wird es an nichts mangeln.«
Sie heirateten in der Woche darauf. Wegen ihres beschämenden Zustands hätte Molly das gern in aller Stille getan, aber Don Pancho war der Meinung, Gerüchten müsse man entschlossen die Stirn bieten und eine Heirat ohne Feier sei ein Affront für die Nachbarschaft. Er lebte schon viele Jahre in diesem Viertel, alle kannten ihn, die meisten der Kinder waren bei ihm zur Schule gegangen, er diente als Schlichter bei Meinungsverschiedenheiten und als Ratgeber in Lebenskrisen. Eine heimliche Eheschließung würde man ihm nicht verzeihen. Die Nachbarn sperrten die Straße ab, spannten bunte Girlanden und bereiteten Berge von Essen zu. Es gab Mole aus dreißig Zutaten, gefüllte Chilis, gegrilltes Zicklein, Carnitas, Enchiladas und Tacos, Eintopf mit Schweinefleisch und Türme aus Weizen- und Maistortillas. Alle kamen, selbst die Nonnen, die, angeführt von Mutter Rosario, mit Platten voller Kuchen zum Gelage beitrugen. Für die Kleinen gab es Mandelmilch und Fruchtpunsch und für die Erwachsenen unbegrenzte Mengen Sotol, einen Schnaps aus Chihuahua, der bis zu fünfzig Prozent Alkohol enthält und auch als Kakerlakenvernichter und Schmerzmittel bei chirurgischen Eingriffen benutzt wird. Eine Kapelle unterhielt die Hochzeitsgesellschaft mit Rancheras, Jaranas, Walzern und Liedern, zu denen Mexikaner und Eingewanderte aus allen Erdteilen miteinander tanzten. Am Ende war die Straße mit Abfall und glücklich Betrunkenen übersät. Sogar die Nonnen wankten auf ihrem Heimweg ins Waisenhaus.
Zur gegebenen Zeit brachte Molly Walsh ein Mädchen zur Welt – mich –, und niemand freute sich über dieses Ereignis mehr als Don Pancho Claro. »Sie ist genau wie ich!«, rief er angeblich aus, als er mich sah, und damit sollte er recht behalten, denn auch wenn wir uns kein bisschen ähnlich sehen, haben wir doch sehr viel gemeinsam. Ich wurde auf den Namen Emilia del Valle Claro getauft, so stehe ich im Kirchenbuch der Gemeinde. Meine Mutter ließ sich von del Valle nicht abbringen, und Don Pancho setzte den Nachnamen Claro durch, weil ich kein x-beliebiges Kuckuckskind war, sondern die Tochter, die er sich immer gewünscht hatte.
Mir hat die Leerstelle, die mein Erzeuger hinterlassen hat, nie etwas ausgemacht, denn ich hatte einen vortrefflichen Vater, aber der Chilene schwirrte in meiner Kindheit herum wie eine lästige Schmeißfliege. Ohne die heitere Zuneigung meines Stiefvaters wäre das Herz meiner Mutter verbittert vor Groll. Über den erlittenen Verrat kam sie nie hinweg, und dass es mich gab, hat sie, wie mir scheint, zu oft daran erinnert. Auch wenn sie sanft auftrat, ihre Stimme nach einer Heranwachsenden klang und sie manche Allüren aus Novizinnentagen behielt, wurde sie innerlich hart. Möglich, dass diese Härte schon immer in ihr verborgen war und nur durch die Enttäuschung ihrer ersten Liebe nach außen trat. Meine Mutter ist sehr empfindlich, sie nimmt alles persönlich, selbst den Regen und den Wind, und mit den Jahren entwickelte sie allerlei Zipperlein. Ernsthaft krank ist sie nicht, aber sie zeigt die Symptome jedes Leidens, von dem sie erfährt, so hat sie schon unter Ruhr, Cholera und Malaria gelitten, die in Kalifornien so gut wie nie vorkommen, von denen sie aber in einem Artikel über britische Kolonialbeamte in Indien gelesen hatte.
»Bestimmt habt Ihr Lepra, Mama«, sagte ich einmal zu ihr, als sie von einem Spinnenstich eine Quaddel bekam.
»Meine eigene Tochter verhöhnt mich, Gott ist mein Zeuge! Ich bleibe hier sitzen, bis alle Qualen Hiobs über mich kommen!«, rief sie, nicht ohne eine gewisse Selbstironie.
Seitdem erinnern wir sie an Hiob, wenn sie allzu sehr übertreibt. Für gewöhnlich erstickt das ihre Symptome im Keim. Sie leidet unter Kopfschmerzen, die nicht eingebildet sind, und hat wegen des strengen Fastens in ihrer frühen Jugend einen empfindlichen Magen, aber beides mindert weder ihre Tatkraft noch ihre Arbeitswut. Meine Mutter ist unermüdlich. Sie kleidet sich schlicht in gedeckten Farben, trägt keinen Schmuck und auch kein Rouge auf den Wangen, wie es neuerdings Mode ist. Würde sie nicht solche Sorgfalt auf ihre Frisur verwenden, sie sähe aus wie die Nonne, die sie hatte werden wollen. Das Zusammenleben mit Don Pancho, der Agnostiker und Anarchist ist, hat ihren fanatischen Katholizismus etwas gelindert, aber geheilt ist sie nicht davon.
Damals war »Der Stolz der Azteken« die einzige spanischsprachige Schule und das Herz unseres Viertels. In gewissem Sinn ist sie das noch heute. Molly teilte sich mit ihrem Ehemann die Verantwortung für den Unterricht und die Wohltätigkeit und kümmerte sich außerdem um den Haushalt, denn er ist ein Gelehrter und lebt von Ideen und darf nicht mit irdischem Kleinklein belästigt werden, sagt sie. Der wahre Grund ist allerdings, dass er überhaupt keinen Sinn fürs Praktische hat. Wenn er ein paar Eier in die Pfanne hauen soll, steht Don Pancho zehn Minuten vor dem Herd und philosophiert laut über die Frage, ob es das Ei nun vor oder nach der Henne gegeben hat. Molly fehlt für so etwas die Geduld.
Einzelheiten über das Liebesleben meiner Mutter und ihres Ehemanns werde ich nie erfahren, danach zu fragen würde ich nicht wagen, aber ich vermute, dass sie längere Zeit keusch blieben. Zu Beginn standen Mollys seelische Erschütterung, ihre Schwangerschaft und das Neugeborene einer Annäherung im Weg. In den ersten fünf Jahren meines Lebens schlief ich im Bett meiner Mutter im großen Zimmer, während Don Pancho mit einer Pritsche in der Kammer vorliebnahm. Ich glaube nicht, dass sie eine normale Ehe führten, aber sie mochten einander sehr. Für Außenstehende waren sie ein Traumpaar. Don Pancho ist meiner Mutter gegenüber immer sehr zärtlich, nachsichtig und großzügig gewesen, und sie kann im Zusammensein mit ihm kokett und lustig sein. So ernst sie in der Öffentlichkeit auch wirken mag, wenn sie mit ihrem Mann allein ist, wird sie zu einem ausgelassenen Kind. Er hat sie von Anfang an geliebt, und mit der Zeit wurde aus der Freundschaft und Zuneigung, die sie für ihn empfand, wie selbstverständlich Liebe und vielleicht auch Verlangen. Eines Tages verkündeten sie mir, ich sei alt genug, um allein zu schlafen, räumten meine Sachen kurzerhand in Papos Kammer, und er nahm fortan den Platz im Bett meiner Mutter ein. Ich bin sicher, dass das Warten sich gelohnt hat. Obwohl die beiden so verschieden sind, wirken Molly und Don Pancho noch immer verliebt wie ein frischvermähltes Paar. Wie zu erwarten, bekam unsere Familie Zuwachs, und inzwischen habe ich drei Brüder.
Bevor sie ihre weiteren Kinder bekam, machte meine Mutter regelmäßig Besuche bei alten Leuten, kümmerte sich um Kranke und unterstützte Witwen und sitzengelassene Mütter. Noch heute steht sie bei Tagesanbruch auf, um das Brot für die Bedürftigen zu backen und in die Frühmesse zu gehen, ehe sie ihren sonstigen Verpflichtungen nachkommt. Don Panchos bescheidenes Haus, das auf demselben Grundstück steht wie die Schule, hatte ursprünglich nur drei halbleere Räume, aber Molly verwandelte es im Nu in ein behagliches Heim. Sie stieg auf die Leiter und strich die Wände innen und außen, sie häkelte Bettüberwürfe und Gardinen, legte einen Blumengarten an und pflanzte Obstbäume. Sie hatte sich von Beginn an um die Spenden für die Schule gekümmert und übernahm folgerichtig die Finanzverwaltung der Familie. Ihrem Ehemann dient Geld in erster Linie zum Verschenken, deshalb bekommt er von ihr ein Taschengeld, das gerade mal für seine Zigaretten reicht. Mit ihrem Ersparten kaufte sie Möbel und konnte irgendwann eine Küche, ein Wohnzimmer und eine überdachte Veranda anbauen, auf der man am Abend sitzen kann.
Trotz ihrer anspruchsvollen Art, ihrer echten und eingebildeten Wehwehchen, ihrer voreiligen Urteile, ihrer divenhaften Dramatik und ihrer langen Phasen vielsagenden Schweigens wird meine Mutter von ihrem Mann vergöttert, und er ist dankbar für das Glück, sie zur Frau zu haben. In seinen Augen ist Molly unverändert und wird immer die bezaubernde Siebzehnjährige sein, die im »Stolz der Azteken« zu arbeiten begann. Der Altersunterschied von fast zwanzig Jahren fällt inzwischen nicht mehr auf, denn sie ist früh gealtert, und für ihn ist die Zeit stehen geblieben. Ich kann das beweisen, ich besitze ein Hochzeitsfoto von den beiden. Heute, über zwanzig Jahre später, sieht mein Papo unverändert aus, hat noch all seine vom Tabak gelb verfärbten Zähne, sein dichtes Haar, den schwarzen Schnauzbart und diesen fragend schelmischen Blick. Von ihm habe ich meinen Optimismus, aber leider habe ich nur sehr wenig von meiner Mutter. Sie hat mir weder ihr glänzend schwarzes Haar noch ihre perlweiße Haut noch die Lapislazuliaugen vererbt. Nur ihre Körpergröße, die dafür sorgt, dass man nicht auf mich herabsieht. Meine Augen sind dunkel und meine Haare braun.
Ich habe immer gewusst, dass Francisco Claro nicht mein Vater ist, aber dieses Wissen ist so abstrakt wie inhaltsleer, denn tatsächlich ist er mehr als das für mich. Niemand hat mich je so sehr geliebt wie dieser schnauzbärtige, rundliche Schullehrer, mein Papo. Er hat drei Söhne mit meiner Mutter, aber ehe sie zur Welt kamen, war ich über acht Jahre lang seine einzige Tochter, und in dieser Zeit schenkte er mir seine ungeteilte Aufmerksamkeit und Liebe. Ich war immer sein Lieblingskind, sein Augenstern, wie er mich noch heute nennt, wenn er rührselig wird, was ständig passiert. Er sagt, er darf mich verwöhnen wie eine Prinzessin, weil ich seine Kleine bin, während die Jungen eine harte Hand brauchen, damit sie zu rechtschaffenen Männern werden. Er hat nie erlaubt, dass meine Mutter mir mit dem Schlappen eins überbrät, obwohl er die Methode bei der Erziehung meiner Brüder für angebracht hält.
»Du verhätschelst Emilia zu sehr! Sie lässt sich nach Strich und Faden bedienen und kann nichts allein tun. Ich hoffe, sie kriegt die Krätze, damit sie wenigstens lernt, sich selber zu kratzen«, pflegte meine Mutter zu sagen.
2
Die Sprache meiner frühen Kindheit war Spanisch, aber wer in den Vereinigten Staaten aufwächst, lernt früher oder später auch Englisch. Wie die meisten Kinder in unserem Viertel erhielt ich die Grundlagen meiner Bildung im »Stolz der Azteken«, doch meine Umgangsformen und meine Unverfrorenheit wurden in jedem Moment unseres Zusammenlebens von Don Pancho geprägt. Außerdem gab er der unstillbaren Neugier, die mich von klein auf angetrieben hat, stetig neue Nahrung. Für meine Mutter ist Neugier bei einer Frau eine gefährliche Eigenschaft und führt nur ins Unglück. Sie sagt oft, Neugier sei der Katze Tod, und wenn ich irgendwann in ernste Schwierigkeiten geraten sollte, dann wäre mein Papo daran schuld. Meine Neugier hat über die Jahre unterschiedliche Formen angenommen, führt im Kern jedoch immer dazu, dass ich herausfinden will, was hinter der nächsten Ecke oder hinterm Horizont geschieht.
Während andere Kinder gegen Bälle traten oder über Seile sprangen, vertrieb ich mir die Zeit damit, alles zu lernen, was mein Papo mir beibringen wollte, angefangen bei dem, was in Enzyklopädien und Schulbüchern stand, bis hin zu Kartenspielen und zum Tanzen, weil er meinte, dabei würde man Freundschaften schließen. Noch heute, als erwachsene Frau, die ihr eigenes Leben führt, stehe ich ihm sehr nah. Ich erzähle ihm meine Geheimnisse, wir leihen einander Bücher und Zeitschriften, tauschen uns über die stets betrübliche Tagespolitik aus, unternehmen Spaziergänge in der Natur, bei denen wir Pflanzen und Vögel bestimmen, gehen ins Museum, ins Theater und manchmal, wenn es Gastspiele aus New York oder aus Europa gibt, auch in die Oper. Meine Mutter, die mit meinen jüngeren Geschwistern, mit der Hausarbeit und ihren guten Taten beschäftigt ist, leistet uns selten Gesellschaft, es sei denn, bei der Planung von Verbrechen.
Auch wenn mein Papo tatsächlich frei von herkömmlichen Lastern ist, besitzt er eine Schwäche, die er auf mich übertragen hat: Er liest gerne Heftchenromane. Alle kennen diese Büchlein, seit dem Bürgerkrieg sind sie hierzulande überall verbreitet, sie haben meist neunzig bis hundert Seiten, sind in Hosentaschenformat auf billiges Papier gedruckt und erzählen flott geschriebene, leicht zu lesende Geschichten von Indianern, Cowboys, Abenteurern und Soldaten. Nach Ansicht der Literaturkritik sind sie Müll für halbe Analphabeten, dabei bereichern sie den Alltag der einfachen Leute, vor allem der männlichen, denn Frauen sind selten davon angetan, die meisten haben keine Zeit zum Lesen, und die müßigen Oberschichtsdamen bevorzugen Lyrik und Herzschmerzgeschichten. Mein Papo sammelt die Heftchen, und ich habe sie alle verschlungen. Mit siebzehn kam ich dann auf die Idee, selbst zu seiner Sammlung beizutragen.
»Soll ich nicht auch mal so einen Roman schreiben, Papo, was meinen Sie?«
»Wie willst du das anstellen, Prinzessin?«
»Ganz einfach: Morde, Habgier, Grausamkeit, Ehrgeiz, Hass … Sie wissen schon, Papo, genau wie in der Bibel und in der Oper.«
»Dafür bist du noch ein bisschen jung.«
»Einen Versuch ist es wert. Würden Sie mir helfen?«
Ich arbeitete schon seit einigen Jahren mit ihm in der Schule, weil meiner Mutter mit drei kleinen Kindern die Zeit dafür fehlte und ich meinem Papo etwas von der Last mit seinen Schülern abnehmen wollte, aber das Unterrichten liegt mir nicht, mir fehlt die Geduld. Er war dankbar für meine Unterstützung, beharrte aber darauf, dass ich einen Beruf lernen sollte, ehe ein Anwärter, der entschlossener wäre als die bisherigen, mich womöglich dazu brächte zu heiraten. Mit einem Beruf könnte ich für mich selbst sorgen, sagte er, und tun, was ich wollte, ohne von einem Ehemann oder jemand anders abhängig zu sein. Meine Mutter war der Meinung, jede Frau, die arbeitet, um ihren Lebensunterhalt zu verdienen, würde darüber verarmen, weil man sie schlecht bezahlte, und außerdem hätte mein Papo mich sowieso am liebsten unverheiratet, damit ich bei ihm bliebe. Vermutlich stimmte das. Wenn ich eine Ausbildung machen wolle, dann als Krankenschwester, sagte sie, wohingegen er mich zum Medizinstudium drängte. Es gab bereits einige Frauen, die ihren Abschluss an der University of California gemacht hatten, aber Schmerzen, Blut, Verletzungen und Tod, die ich in meinen Romanheften so wirkungsvoll einzusetzen verstand, sind im echten Leben nichts für mich. Damals hätte ich mir nicht vorstellen können, dass das Schicksal eine beachtliche Portion davon für mich bereithielt.
So begann meine schriftstellerische Laufbahn, wenn ich das so nennen darf. Die Romane ermöglichten es mir, über meine begrenzte Wirklichkeit hinauszugehen. Schreibend konnte ich mich an beliebige Orte versetzen und tun, was mir in den Sinn kam. Mein Papo wollte mir zu Beginn helfen, doch erstaunlicherweise war es meine Mutter, die sich die Handlung meines ersten Buchs ausdachte: Eine junge Frau wird von einer Bande von Schurken vergewaltigt, und die bezahlen dafür mit dem Leben. Nicht sehr originell, nur dass die Rache bei mir nicht von einem Helden mit kantigem Unterkiefer und treffsicherem Colt vollzogen wird, sondern von der Frau selbst, die sich als Mann verkleidet und die vier Übeltäter einen nach dem anderen auf überaus brutale Weise zur Strecke bringt.
Wir hatten meine Mutter nie derart begeistert erlebt, je grausiger die Einzelheiten der Blutorgie, desto zufriedener wurde sie. Melodramatik liegt ihr. Den vier Mistkerlen den Garaus zu machen war vermutlich ihre Bestrafung von Gonzalo Andrés del Valle. Sie drängte sogar darauf, dass die junge Frau ihre Vergewaltiger vor der Ermordung kastrierte, aber ich fürchtete, das würde meinen potentiellen männlichen Lesern zu weit gehen. Männer sind an dieser Stelle etwas empfindlich.
Mein Papo gab dem Manuskript den letzten Schliff, ich übersetzte es ins Englische, und dann trug er es zu einem Verleger, denn mir hätte niemand Beachtung geschenkt. Die Rache der Jungfrau, von einem gewissen Brandon J. Price, erschien gleichzeitig auf Englisch und Spanisch, um sich gegen die Hefte zu behaupten, die aus Mexiko kamen.
Unbeschreiblich die Aufregung, mein erstes gedrucktes Buch in Händen zu halten, mit keinem danach ist es mir so ergangen. Als ich die zehn Exemplare, die der Verlag mir geschickt hatte, aus dem Packpapier befreite, fing ich zu weinen an wie ein kleines Kind. Mein Papo hätte am liebsten die Nachbarschaft zusammengetrommelt, um zu feiern, aber ich erinnerte ihn daran, dass wir nicht verraten durften, wer Brandon J. Price war. Wir hatten stundenlang nach dem männlichsten aller Pseudonyme gesucht. Dass ich dahintersteckte, würden sogar meine Brüder, die alle noch keine neun Jahre alt waren, für sich behalten müssen. Da es also kein Fest geben würde, beschloss er, den Anlass mit zwei haltbaren Geschenken zu würdigen: Für meine Mutter fand er Ohrringe aus ziseliertem Silber mit Granatsteinen und für mich ein goldenes Medaillon mit der Jungfrau von Guadalupe, beides unverkennbar mexikanische Schmuckstücke.
Den Sommer über verkauften sich von meinem Roman neuntausend Exemplare der englischen Ausgabe im ganzen Land und zweitausendneunhundert der spanischen in Texas und Kalifornien. Als der Verlag um Nachschub bat, musste er nicht warten, dank der morbiden Fantasie meiner Mutter und meiner Begeisterung für das Schreiben war die Fortsetzung bereits fertig. Sie hieß Eine unanständige Frau, die Hauptfigur war dieselbe wie im ersten Roman und rächte weitere Opfer. Diesem Heft folgten eine ganze Serie und außerdem wöchentliche Fortsetzungsromane in Zeitungen, mit denen Brandon J. Price sich einen Namen machte. Ich versuchte auch, mein Repertoire um Liebesromane für eine weibliche Leserschaft zu erweitern, aber die gelangen mir nicht. Die Handlung dreht sich dort immer um eine Liebe mit Hindernissen zwischen einem braven, armen Mädchen und einem edlen reichen, von der Liebe enttäuschten Mann, aber die Verlage erwarten, dass Tugend und Moral am Ende siegen, und dazu fiel mir nichts ein. Auch meine Mutter hatte keine überzeugenden Ideen, mit Romantik konnte sie noch nie etwas anfangen, nur mit Tragödie.
Die titelgebende »unanständige Frau« war bei uns ein Familienscherz. Von meiner Mutter wurde ich nach strengen katholischen Grundsätzen erzogen, ähnlich wie sie selbst bei den Nonnen aufgewachsen war, also jede Menge Sünde, Buße, Schuld, Himmel, Fegefeuer und Hölle, und wenn ihr Ehemann die Regeln zu meinen Gunsten abmildern wollte, schnitt sie ihm das Wort ab, weil sie schließlich eine anständige Frau aus mir machen müssten. Ende der Debatte. Sie hat nie erklärt, was genau sie damit meinte, herkömmlich versteht man darunter ja ein dummes Huhn, das sich ohne Murren den Regeln anderer unterwirft. Irgendwann brüllte ich in einem Wutausbruch, ich wollte aber eine unanständige Frau sein. Damals war ich sechs. Das ist der einzige Moment kindlicher Meuterei, an den ich mich erinnere, die echten Anfälle von Rebellion kamen erst später, als mir auf den Rippen zwei Hügel und zwischen den Beinen flaumige Haare sprossen. Meine Mutter schaffte es noch, Gott als Zeugen anzurufen und ihren Schlappen zu heben, doch dann fiel mein Papo ihr in den Arm. Mein guter Stiefvater kam immer wieder auf diese Szene zu sprechen, machte sich über ihre Vorstellung von einer anständigen Frau lustig und war damit so überzeugend, dass meine Mutter es mittlerweile in manchen Situationen selbst für angebrachter hält, unanständig zu sein, sofern das diskret geschieht. »Radau muss man keinen machen«, meint sie.
Die Einnahmen aus meinem literarischen Abenteuer, das von Beginn an sehr erfolgreich verlief, flossen in unseren Haushalt und in meine Ersparnisse, die meine Mutter für unerlässlich hält.
»Da du keinen Ehemann hast und, wenn du so weitermachst, auch schwerlich einen findest, musst du für deine Zukunft vorsorgen«, lautet ihr Tenor.
Zusammen kümmern sie und ich uns um den Unterhalt der Familie, ich mit meinen Heftromanen und dem, was ich sonst schreibe, sie mit ihrem Sinn für das Praktische, ihrer Sparsamkeit und ihrer Hände Arbeit. Aus dem Brot für die Bedürftigen, das sie vor Jahren aus Barmherzigkeit zu backen begann, ist inzwischen ein kleines Unternehmen geworden. Sie hat im Hof zwei Lehmöfen bauen lassen und stellt verschiedene süße und salzige Backwaren her, hat zunächst allein gearbeitet und beschäftigt mittlerweile zwei junge Frauen aus dem Viertel. Jeden Morgen, sogar am Sonntag, stehen die Kunden bei ihr Schlange. Und jeden Morgen habe ich beim Aufwachen das belebende Bild meiner Mutter und ihrer beiden Helferinnen vor Augen, wie sie den Teig kneten, und rieche den unvergleichlichen Duft der warmen Brote, die auf der langen Holztheke unter weißen Tüchern ausdampfen. Was am Vormittag nicht verkauft wird, verschenkt die Bäckerin nachmittags an die Bedürftigen, die ihr dafür den Spitznamen heilige Molly verliehen haben, ohne zu ahnen, dass sie schon als Kind so genannt wurde.