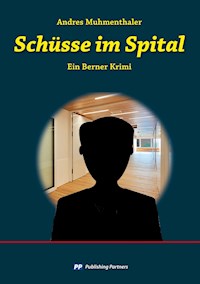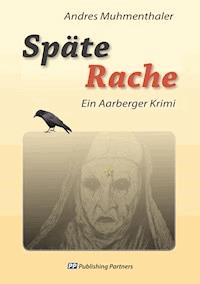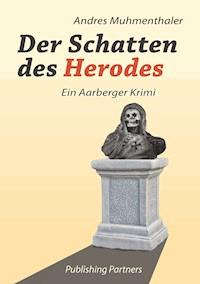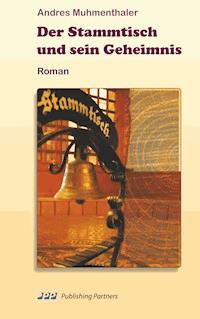Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
IIn der neu eröffneten Psychiatrischen Klinik Aarberg ereignet sich ein Mord. Hauptkommissar Heiri Weber, in der Region als erfolgreicher Fahnder eine lebende Legende, gerät bei der Vernehmung des Hauptverdächtigen emotional außer Kontrolle. Der Fall wird ihm entzogen, und mit seiner Frau Rita fährt er in den Zwangsurlaub. Wie in einem schlechten Traum begegnet er in Südfrankreich dem Mordopfer aus seinem abgegebenen Fall. Unbewaffnet und als Ermittler außer Dienst im Ausland unterwegs, bewegt er sich auf dünnem Eis. Auf der Suche nach der Wahrheit bringt er sich und seine Frau gar in Gefahr. Biel-Bienne: «Eine moderne, aber tragische Kain-und-Abel-Geschichte»
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 181
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Namensgebungen und Ähnlichkeiten
mit in Aarberg und Umgebung wohnhaften
Personen sind rein zufällig.
Inhalt
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Epilog
1
«Nein, nicht hinrichten!», schrie er, als er, begleitet von seiner Frau, seinem Schwager und dem Nachtwächter nachts um drei Uhr die Notaufnahme der Psychiatrischen Klinik in Aarberg betrat. Nichts ließ ihn seit Tagen mehr zur Ruhe kommen. Unablässig ist er wie ein gefangenes Raubtier zu Hause hin und her getigert. Ununterbrochen hat er dazu wirres Zeug geredet: «Die guten ins Töpfchen, die schlechten… Ja, Mama. Hilfe! Der Wolf will mich fressen! Ich bin doch der Gute!»
«Wir müssen ihn möglichst rasch ruhig stellen», erklärte der diensthabende Arzt beim Aufnahmegespräch. «Ich habe von Ihrem Hausarzt soeben ein Begleitschreiben gefaxt bekommen. Sein verändertes Verhalten deutet auf eine Schizophrenie-Attacke hin. Hatte er im letzten halben Jahr ein traumatisches Erlebnis?», fragte der Arzt die völlig verzweifelte und erschöpfte Ehefrau. «Nein, nicht dass ich wüsste», beteuerte diese. «Im vorigen Jahr ist Marcs dominante, immer fordernde Mutter gestorben. Sie war alt und krank. Ich habe sie gepflegt, obwohl sie mich meines Standes wegen immer verachtet hat. Sie war sehr besitzergreifend und hat ihren Lieblingssohn in keinster Phase ihres Lebens mit mir teilen wollen. Obwohl es hart klingen mag, hat ihr Ableben mich sehr entlastet und irgendwie befreit. Frau Flückiger senior hat mir das Leben stets schwer gemacht. Auch für Marc war ihr Tod eine Art Erlösung. Er hat sich sehr schwer damit getan, ihr immer genügen zu müssen. Ihr Mutter-Sohn-Verhältnis würde ich mit dem Begriff Hassliebe umschreiben. Er hat es nicht geschafft, sich von ihr abzunabeln. Aufopfernd kämpft er seit Jahren ums Überleben der kriselnden Druckerei. Marcs Mutter hat ihn davon abgehalten, den Familienbetrieb rechtzeitig zu modernisieren. Aber was erzähle ich Ihnen eigentlich? Kurz gesagt: Ich kann mir nicht vorstellen, dass ihn das Ableben seiner greisen Mutter traumatisiert hat. Im Gegenteil, ich spürte auch bei ihm eine Art Befreiung. Allerdings wurde uns nach ihrem Tod erst richtig bewusst, wie wir zwei uns über die Jahre auseinandergelebt haben. Wir reden heute offen über die Möglichkeit einer Scheidung. Ich glaube jedoch nicht, dass ihn dies nun so plötzlich aus der Bahn geworfen hat. Er schien mir in den Wochen vor seiner Panikattacke viel lockerer und entspannter als in den Jahren zuvor. Ich habe gar den Verdacht, dass er eine andere Frau kennengelernt hat und frisch verliebt ist. In letzter Zeit ist er oft abends ausgegangen. Den Namen seiner Bekanntschaft hat er mir gegenüber hingegen nie erwähnt, geschweige mir die Begehrte gar vorgestellt.»
Immer wieder unterbrachen Marcs Hilferufe und Schreie das Aufnahmegespräch: «Er hat sich verkleidet, er hat Kreide gefressen und seltsame weiße Pfoten, aber er ist es! Hilfe, der Wolf will mich fressen! – Ei, Großmutter, was hast du für große Zähne!», flüsterte er dem verblüfften Arzt ins Ohr. Auch die beruhigenden Worte seines Schwagers zeigten wenig Wirkung. «Ich bin der Falsche! Lasst mich frei! Die Venus kann es beweisen!» Wie ein gejagtes Tier eilte er im Empfangsraum umher, bis er sich schließlich unter die Sitzbank verkroch und sich dort etwas beruhigen konnte.
Weder der Schwager noch seine Frau konnten seine Ausrufe auch nur annähernd interpretieren. Den Namen Venus hatte er offenbar zum ersten Mal in seinem Leben ausgesprochen. Erst nach einer kurzen Stille erinnerte sich seine Frau an die außergewöhnlichen Angstträume, die ihren Mann in ihren ersten Ehejahren geplagt hatten. Darin spielte der böse Wolf immer eine zentrale Rolle. Marc erwachte dann jeweils schweißgebadet und völlig verstört. Diese Träume hatte er jedoch seit vielen Jahren nicht mehr. Deswegen verdrängte Pia diese Gedanken auch gleich wieder. Als Marc erneut zu jammern begann, erwähnte sie dem Arzt gegenüber einzig, dass ihr Mann sich seit jeher vor großen Hunden, insbesondere vor Schäferhunden, den «Wolfern» wie wir in der Umgangssprache sagen, extrem fürchte.
«Okay», sagte der sichtlich in Gedanken versunkene deutsche Aufnahmearzt. «Wir werden ihm jetzt eine Spritze geben. Erfahrungsgemäß wird er dann bis zu einer halben Woche mehr oder weniger schlafen. Sobald er wieder ansprechbar ist, werden wir Sie umgehend benachrichtigen. Bei uns ist er in guten Händen, Frau Flückiger. Sie müssen sich keine Sorgen machen. Versuchen Sie, sich ein bisschen von den Strapazen zu erholen. Eine genaue Prognose können Sie erst in zwei, drei Wochen erwarten», erklärte der Arzt, bevor er sich von der Ehefrau und deren Bruder verabschiedete.
2
Wo bin ich? Was ist geschehen?, fragte sich Marc, als er zwei Tage später aus seinem künstlich herbeigeführten KO-Schlaf erwachte. Als Erstes hörte er seltsame, piepsende Geräusche. Er hatte Mühe, seine Augen auch nur ein ganz klein wenig zu öffnen. Er meinte, durch seine Augenlider eine Lightshow wahrzunehmen. In welchen «Abhäng-Schuppen» bin ich denn hier geraten? Ich muss einen bösen Absturz gehabt haben, war sein nächster Gedanke, denn er fühlte eine noch nie dagewesene Schwere in seinem ganzen Körper. «Ich will weg!», rief er mit brüchiger Stimme. Dann begann in seinem Kopf alles zu drehen. «Sonst bringe ich dich um!», hörte er eine hämische Stimme sagen. «Nein, nein, das kannst du nicht tun! Hilfe!», schrie er verzweifelt. «Verschwinde, du verdammter Teufel!» «Na, na!», antwortete ihm eine sanfte, aber doch dezidierte Stimme. «Beruhige dich, Marc! Wir helfen dir, wieder zu einem klaren Kopf zu kommen. Niemand hier will dich töten oder sterben lassen.»
«Obwohl du es absolut verdient hättest!», meldete sich eine zweite Frauenstimme zu Wort.
Wer bin ich?, fragte er sich. Woher kenne ich diese Frauenstimmen? Befinde ich mich etwa vor dem Jüngsten Gericht? Himmel oder Hölle, ist wohl hier die Frage. «Venus, bin ich tot?», fragte er mit bebender Stimme. Denn die erste Frauenstimme kam ihm sehr bekannt vor. Er sah in ihr einen Engel. Dann müsste die bedrohliche zweite Stimme wohl die des Teufels oder die einer Teufelsdienerin sein. Er begann um Gnade zu flehen: «Ich bin doch unschuldig, glaubt mir doch endlich. Ich kann doch keiner Fliege…», wollte er noch anfügen, doch da unterbrach ihn die Assistentin des Teufels, die niemand anderes war als die Chefärztin, Silvia Möri, schroff: «Stopp jetzt, sonst kann ich für nichts mehr garantieren, du Schweinehund! Wir werden uns bemühen, dich, besser gesagt dein Gehirn, wieder in einen stabilen Zustand zu versetzen, wenn dies bei einem wie dir überhaupt möglich ist. Dann wirst du von uns die letzte Chance kriegen, dein schlechtes Gewissen etwas zu beruhigen. Verzeihen werden wir dir deine Schandtaten aber nie!» Und zur Pflegefrau gewandt fügte sie an: «Alles kommt bekanntlich zurück im Leben, nicht wahr, Wendy?! Ist es nicht eine Fügung des Schicksals, dass er uns nun genauso ausgeliefert ist, wie wir ihm damals. Nun erfährt er all die Ohnmacht, Wut, Angst und Verzweiflung, die wir damals bei seinen sexuellen Übergriffen erleiden mussten. Schade eigentlich, dass wir nicht in der Chirurgie arbeiten. So ein kleiner Fehlgriff da unten wäre bei ihm wohl eher angebracht als der Versuch, sein verkorkstes Hirn wieder in einen weniger triebhaften Normalzustand zurückzuversetzen.»
Marc war nicht in der Lage, diese Andeutungen richtig aufzunehmen. Die Hammerspritze, die ihm beim Eintritt verabreicht worden war, lähmte sein Gehirn und seinen Verstand immer noch. Er fühlte jedoch den Hass und die Verachtung dieser Frau. Die Bedrohung war offensichtlich. Sie erschütterte und beängstigte ihn. Verzweifelt brachte er etwas wie: «Verwechslung…Venus, hilf mir doch!», über die Lippen, bevor er nochmals in einen unruhigen Schlaf fiel.
Erst nach weiteren zwei Stunden gelang es ihm, seine Augen ganz zu öffnen. Der verruchte Disco-Schuppen oder der Saal des Jüngsten Gerichts verwandelte sich in den Aufwachraum einer Klinik. Er war nun allein im Zimmer, aber immer noch an das blinkende und piepsende Überwachungsgerät angeschlossen. Starke Kopfschmerzen befielen ihn, und bald darauf versank er wieder in einen unruhigen Halbschlaf. Darin erlebte er die reinsten Höllenqualen und wähnte sich in einem Horrorfilm. Nahende Schritte suggerierten ihm höchste Gefahr. Er hielt den Atem an und bekam Schweißausbrüche. Wenn er den Mundgeruch, einen Parfumschwall oder sonst eine Ausdünstung einer Pflegeperson in die Nase bekam, geriet er vollends in Panik. Er schrie um Hilfe oder winselte um Gnade. Die Pflegerinnen erschraken manchmal sehr. In seiner langen Aufwachphase nervte er sie dann mit seiner Litanei: «Da, der Wolf. Achtung, der Wolf! Er hat sich verkleidet. Er will mich töten!»
3
Immer weniger Leute verirren sich ins früher so gut funktionierende stolze mittelalterliche Städtchen. Längst hat es die Funktion als Begegnungszentrum verloren. Das Ladensterben hat ein fatales Ausmaß angenommen. Nicht einmal die nötigsten Lebensmittel sind hier noch erhältlich, geschweige denn Schuhe oder Kleider. Mehrere Gasthäuser sind bis auf Weiteres oder für immer geschlossen. Den Hausbesitzern fehlt es zunehmend an Geld und an Innovation. Man hat den Zeitpunkt verpasst, das natürlich gewachsene Ortszentrum weiterzuentwickeln. Zu lange wollte man die Familienbetriebe bewahren. Jetzt fehlt es an interessierten und fachkundigen Nachkommen. Und wer will schon einen großen Teil seines Privatlebens opfern, um rund um die Uhr für die spärlichen Kunden da zu sein?! Längst ist das Städtchen umringt von Einkaufszentren, welche billigere Waren anbieten, längere Öffnungszeiten haben und dank ihren Parkhäusern bequem mit dem Auto zu erreichen sind. So kam es, dass der Ortskern zu einem zwar äußerlich hübschen, aber bald toten, beinahe nur noch musealen Touristenort verkommen ist. Man hat dem Städtchen seine gute alte Seele genommen. Es hat jeglichen Charme eingebüßt und läuft Gefahr, immer mehr zu einer leblosen Kulisse zu verkümmern. Der immense Durchgangsverkehr lädt auch die Touristen nicht mehr zum Verweilen ein. Ihr Aufenthalt dauert höchstens zehn Minuten und nicht wie früher mindestens eine Stunde mit obligatem Kaffeehalt und einer kleinen Shoppingtour. Ein paar Bilder knipsen und Abflug, heißt es heutzutage. Einzig ein paar Alteingesessene treffen sich noch regelmäßig am Stammtisch. Wehmütig erinnern sie einander an die früheren Zeiten, als im «Städtli» echt noch etwas los war. In der Frühe duftete es nach frischem Brot. Die Gerüche weckten die müden Geister. Frische Waren aus dem Seeland wurden an Marktständen und in Lebensmittelläden feilgeboten. Man konnte sich die Haare noch beim alten Schulfreund nebenan schneiden lassen und sich in einem der zahlreichen Restaurants zum Kaffee oder Bier treffen.
«Wir haben längst nichts mehr zu sagen!», ist einer der Sätze, die man an einem selten gewordenen Gespräch unter Einheimischen oft hört. Oder aber: «Hätten sie doch damals nur auf uns gehört!» Doch keiner nennt in diesem Zusammenhang diese «sie» mit Namen. Alle Stammmitglieder wissen um ihre Mitschuld am Untergang. Die meisten von ihnen sind nämlich Leute, die im Ort durchaus etwas zu sagen hatten. Von ehemaligen Gemeinderatsmitgliedern über alteingesessene Burger bis hin zum Kirchgemeindepräsidenten, dem Arzt und dem längst pensionierten Schulleiter. Vieles hatte man der unterschiedlichsten persönlichen Interessen und Meinungen wegen versäumt. Statt rechtzeitig klare Regelungen herauszugeben, wollte man es immer allen recht machen. Nach Jahren der Versäumnis hat man dann irgendeine Kompromisslösung durchgewinkt, die am Ende niemanden wirklich glücklich macht. So kam es, dass zum Beispiel ein Denner-Satellit im Städtchen Einzug halten konnte oder ein billiger Schickimicki-Kleiderladen. Nie hat man sich auf eine schlaue Verkehrsregelung einigen können. Der Ausverkauf und Niedergang des ehemals gesunden Ortes kam schleichend.
Vor gut zwei Jahren kam es dann zum Eklat. Niemand konnte verhindern, dass der Wirt und Hotelbesitzer Bruno Möri seine ganze Liegenschaft der Tochter überschrieb und diese eine Bewilligung erwirkte, um im riesigen Gebäudetrakt eine Klinik für psychisch Kranke unter dem Label Second Chance einzurichten. Die Bekanntmachung wurde zum emotionalen Stein des Anstoßes. Auch von der Presse wurde diese richtiggehend ausgeschlachtet, was wiederum viel böses Blut schuf. Die Schlagzeilen der regionalen Medien lösten unter den Alteingesessenen wütende Reaktionen aus. «Skandal! Der altehrwürdige Gasthof mitten im Städtchen wird zum Irrenhaus umfunktioniert! – Die Hausbesitzer schrecken vor nichts zurück und verkaufen die Seele des Städtchens dem Teufel!» In der Lokalzeitung hagelte von Leserbriefen, und an den Stammtischen wurden vernichtende Urteile gefällt. In Burger- und Bürgerkreisen wurde heftig protestiert und lamentiert. Kritik, hinter vorgehaltener Hand, wie sie vielen, im Grunde gutmütigen und weitsichtigen Seeländern eigen ist, sickerte überall durch. «Die hätten das Städtli besser einem reichen Ausländer verkauft!», munkelte man. «Oder einer Großbank. Die könnten das malerische Städtchen dann als Hotelresort à la Mittelalter vermarkten, mit Treibjagden im Frienisbergwald.» Die Gemüter mochten sich kaum mehr beruhigen.
Ein paar Wochen hielt sich gar das hartnäckige Gerücht, das Städtli würde überdacht und zum geschlossenen Gesundheitstempel für reiche Kurgäste umfunktioniert. Die Infrastruktur sei mit der bestehenden Apotheke, der Physiopraxis und dem praktizierenden Osteopathen in Ansätzen bereits vorhanden. Geplant sei nun ein Wellness-Bereich, in den die Alte Aare zum Kneipen und kühlen Bad nach der Sauna integriert sein werde. Selbstverständlich werde die ganze Anlage nur einem erlesenen Kreis von wohlhabenden Gästen zugänglich sein. Indes würden so über hundert neue Arbeitsplätze geschaffen, und die Steuereinnahmen wären beträchtlich. Ja, der Fantasie über die Zukunft Aarbergs waren auf einmal keine Grenzen mehr gesetzt. Auch die Variante «Lebendiges Heimatmuseum à la Ballenberg» wurde diskutiert: Das Städtli wird tagsüber geöffnet. Den Besuchern wird das Leben im Mittelalter in interaktiven Workshops vorgeführt.
Vielen Aarbergerinnen und Aarbergern wurde erst in dieser Phase die Mitschuld am Untergang eines ehemals so lebendigen und einmaligen Zentrums, dem Herzen eines beachtlichen Teils vom Seeland, bewusst. Aber nun war es definitiv zu spät für eine Revitalisierung. Niemand konnte schließlich verhindern, dass die weitherum bekannte Gaststätte mit Hotel und Konzertsaal zur geplanten Klinik umgebaut wurde. Diese bot rund zwanzig Langzeitpatienten Platz und war innert kürzester Zeit ausgebucht. Die Leitung übernahm das neue, kinderlose und – wie sich später feststellen ließ –, in einer offenen Beziehung lebende Besitzerpaar. Uwe Kepler als geschäftlicher Leiter und die neue Besitzerin Silvia Möri als Chefärztin. Silvia galt schon als Kind als intelligent und sehr ehrgeizig. Sie liebte es, voranzugehen. Dank ihrem sicheren Auftreten und den rötlichen Haaren trug sie in jungen Jahren den Übernahmen «Rote Zora». Ihr Psychologiestudium hatte sie vor Jahren in Berlin mit Auszeichnung abgeschlossen. Uwe, ihr Partner, hat Wirtschaftsökonomie studiert.
Es dauerte mehrere Monate, bis sich die Wogen der Empörung über die «Verschandelung» des Ortskerns etwas geglättet hatten und die heftigsten Kritiken nahezu verstummten. Und dann diese Schlagzeilen:
«Mord in Städtli-Klinik!… Da waren’s nur noch neun!» «Jenseits des Wahnsinns!»
«Pas de Chance» (in Anspielung an den Kliniknamen «Second Chance»).
Die Reaktionen aus den von der SVP wohl als «das Volk» bezeichneten Kreisen blieben nicht aus. Von der «Rache Gottes» bis «Das haben wir nun davon, wenn wir solches Gesindel in unserem Städtli beherbergen» war die Rede. Ja sogar Sätze wie: «Nun bringen sie sich noch gegenseitig um, diese Weicheier und Sozialschmarotzer. Uns soll es recht sein. Wir müssen von morgens bis abends krampfen, und sie lassen sichs da drin von unserem Geld gut gehen!», machten die Runde. Selbstverständlich gab es auch wohlwollendere Meinungen: «Was wollen wir alle psychisch Kranken aus unseren Reihen auf den Hasliberg oder weiß ich wohin schicken. Die Hilfsbedürftigen sind Seeländerinnen und Seeländer wie wir. Niemand von uns ist vor einem Burn-out oder einer Depression gefeit. Nehmen wir doch den ermordeten Marc Flückiger als Exempel. Hat er nicht bis vor drei Wochen den Druckereibetrieb in Lyss geleitet und so gut einem Dutzend Mitmenschen über Jahre hinweg einen Job gesichert?! – Und ehrlich gesagt, wer fühlte sich durch die Inbetriebnahme der Klinik in irgendeiner Form eingeschränkt? Das Gegenteil ist der Fall. Im Raum der Begegnung treffen sich oft auch auswärtige Gäste, denn hier ist ein kleines Kulturaustauschzentrum am Entstehen. Viele Einheimische haben zudem in der Klinik einen neuen, gut bezahlten Job gefunden. Die tüchtige Silvia ist eine große Verfechterin eines gerechten Mindestlohnes. Wer hundert Prozent arbeitet, soll davon seine Familie ernähren können, ist ihre Devise. Vorbildlich, wie sie ihren Laden führt!»
Rund um den zu Tode gekommenen Marc Flückiger zirkulierten innert kürzester Zeit die wildesten Gerüchte: «In dieser Familie Flückiger stimmte doch etwas nicht. Die verstorbene Mutter war ein Drachen. Die Frau des Verstorbenen geht schon lange fremd. Stimmt mit ihm etwas nicht? Warum sind sie kinderlos geblieben? Was oder wer hat Marc in den Wahnsinn getrieben? Hat sein Tod mit seinem zweifelhaften Verhalten in der Jugend zu tun? Hat sich jemand an ihm gerächt? Auch der verdächtige verrostete Kleinbus mit französischem Kennzeichen, welcher vier Wochen vor dem Todestag eine ganze Nacht vor Flückigers Haus stand, machte die Runde. Und dies ausgerechnet am Wochenende, an dem Marcs Frau, Pia, mit dem örtlichen Damenturnverein am Turnfest in der Innerschweiz teilnahm…
4
Zehn Tage nach dem Mord in der Klinik fährt ein auffällig alter, aber gut gepflegter Renault R4 mit den Jahrgangsnummern seiner Insassen, BE 195254 Richtung Mittelmeer. «Herrlich, dieser mediterrane Duft! Findest du nicht auch, Heiri?», schwärmt Rita, nachdem sie ohne seine Zustimmung das Seitenfenster herunter gekurbelt hat. «Hörst du die Zikaden, die uns mit ihrem Sommerkonzert begrüßen? Herrlich, einfach wunderbar! Bald sehen wir das Meer. Wie habe ich es vermisst! Diese Weite! Diese körperliche und psychische Befreiung aus dem engen und bedrückenden Schweizer Alltag. Hier an der Côte d’Azur wirst du sicher die nötige Distanz zu deinem ungelösten Mordfall finden und wieder zu Kräften kommen!»
«Ja, ja», gibt er untypisch rasch und etwas reserviert zur Antwort. Bitte nicht schon wieder diese Masche!, denkt er, im Wissen, dass er sich keiner Diskussion mit seiner Frau über diesen ärgerlichen Zwangsurlaub mehr stellen möchte. Der Frust sitzt zu tief. Erstmals hat man ihm, dem sonst so erfolgreichen Hauptkommissar, nach über fünfundzwanzig Dienstjahren einen Fall entzogen und ihn, wie er zu sagen pflegt, in die Wüste geschickt! Welche Schmach, welche Schande! Was ist nur aus mir geworden? Wie schnell ist man weg vom Fenster! Ein kleiner Fauxpas, und all die Jahre als angeblich bester Fahnder der Kripo Bern sind wie weggeblasen. Warum nur habe ich so unangemessen, unbedacht überreagiert. Immer wieder sieht er die fatale Szene vor sich. Wie konnte ich mich nur von diesem bünzlihaften, engstirnigen, bigotten Nachtwächter, dem Ehemann der Hauptverdächtigen, derart provozieren lassen? Ich habe durch mein affektives Handeln meine Prinzipien geradezu torpediert. Etwas wehmütig erinnert er sich an sein berühmt gewordenes «Webersches» Fahndungskonzept, welches es notabene bis in Polizeilehrbücher geschafft hat. Zitat: «Weber spinnt ein filigranes unsichtbares Netz derart geschickt, dass sich die Täter früher oder später selber darin verfangen. Aufgrund ihrer ausweglosen Situation legen sie dann oft ein Geständnis ab. Weber versteht es dank seiner feinfühligen Ermittlungsart, Vertrauen zu den Tätern aufzubauen. Dies ermöglicht den Schuldigen, sich ihm zu öffnen und ihr schlechtes Gewissen zu entlasten. Fast alle Verbrechen gegen Leib und Seele sind Verzweiflungstaten und werden von ganz normalen Menschen begangen, die im Nachhinein ihre aus dem Affekt begangenen Taten zutiefst bereuen.»
Bla, bla, bla, denkt Heiri bitter. In der Tat hatte er seine Weitsicht, sein überlegtes Handeln diesmal völlig vermissen lassen. Seine Geduld und die Fähigkeit, sich in andere Menschen einzulesen, ebenso. Vor seinem inneren Auge sieht Heiri beim Nachsinnen seinen längst verstorbenen Großvater. Dieser hatte ihm in punkto Lebensweisheit und Sozialkompetenz immer als Vorbild gegolten. Als einfacher, selbstloser Seeland-Bauer lebte er fast ausschließlich als Selbstversorger. Heiri hatte als Kind viele Ferienwochen auf seinem kleinen «Heimet» in Siselen verbracht. Dabei wich er seinem Opa kaum von der Seite. Erst viele Jahre später wurde Heiri freilich bewusst, was ihm dieser einfache, liebenswürdige Mensch und leidenschaftliche Geschichtenerzähler für einen Schatz an vorbildhaften Tugenden mit auf seinen eigenen Lebensweg gegeben hatte. Entschuldige, Opa, ich schäme mich! Diesmal habe ich wahrlich mit Kanonen auf Spatzen geschossen. Ich schaufelte mir mein eigenes Grab. Ein zwar tonloses, aber doch deutlich zu vernehmendes «Verdammte Scheiße!» kommt über seine Lippen, und er gerät immer stärker ins Grübeln. Verzweifelt sucht er nach Erklärungen. Schließlich kommt er zum Schluss: Ich war gesundheitlich zu sehr angeschlagen. Der Anfang des Übels lag im Grunde an dieser verdammten Grippeimpfung im letzten Herbst. Anschließend war ich monatelang nie richtig auf dem Damm. Ärgerlich, dass ich mich von Rita zu dieser Impfung habe überreden lassen. «Bald sind wir beide über sechzig», hatte sie gesagt. «Höchste Zeit, dass wir nun der Empfehlung unseres Hausarztes endlich Folge leisten. Ich will dich nicht schon vor deiner Pensionierung verlieren, mein Lieber!» In zunehmendem Maß hat mich die wochenlange chronische Erkältung geschwächt und mich nervlich destabilisiert. Ich war stets gereizt und ungeduldig und habe meine guten Tugenden, insbesondere die innere Ruhe und die Menschenkenntnis, vermissen lassen. Ich bin meinen Prinzipien untreu geworden und habe erstmals versucht, direkt aufs Ziel loszugehen. Es ging mir einzig darum, den Fall möglichst rasch zu lösen, um dann meine fiebrige Erkältung endlich zu Hause ausheilen zu können. Keine freie Minute im Garten, auf dem Rad oder beim Fischen habe ich mir gegönnt, was mir etwas Distanz zum Fall verschafft hätte. Unverzeihlich! Denn praktisch keinen meiner Ermittlungsfälle habe ich in den letzten fünfundzwanzig Jahren nur durch Verhöre und Ermittlungen vor Ort lösen können. Die essenziellen Einfälle kamen mir immer fernab des Geschehens in der freien Natur. Es ist jedoch müssig, darüber weiter nachzudenken. Trotz allem: Wäre der Scheißkerl von Hemund nicht gewesen und hätte er sich nicht so perfid in den Fall eingemischt, hätte seine Frau bestimmt innert Kürze ein Geständnis abgelegt. Wenn und hätte!
Immer wieder sieht Heiri das hämisch grinsende Gesicht dieses scheinheiligen Sektierers vor sich. Immer wieder hört er diese salbungsvollen bigotten Ausreden und Drohungen: «Wir lassen uns einzig vom Lieben Gott richten, Herr Kommissar! Wir könnten nie einem Mitmenschen etwas Schlechtes antun, denn Gott leitet uns auch in schwierigen Situationen…» In dem Moment geschieht etwas Erstaunliches. Das Gesicht von Hemund verwandelt sich in dasjenige eines Lehrers aus Heiris Kindheit. Mit dieser Fratze von Herrn Münger drängt sich auch gleich eine mit heftigen Emotionen verbundene Kindheitserinnerung in sein Bewusstsein. Heiri sieht sich zurückversetzt in die ohnmächtige Situation von damals. Sein Hass gegen diesen selbstgerechten Lehrer kocht nach über fünfzig Jahren erneut auf. Die vergessen geglaubte Szene im Dorfladen ist ihm sofort präsent. Er musste tatenlos zusehen und zuhören, wie dieses Arschloch seine Mutter, welche als Schülerin ebenfalls fünf Jahre unter ihm gelitten hatte, zur