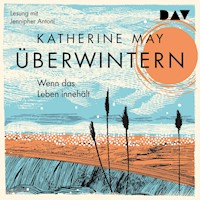11,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Insel Verlag
- Kategorie: Ratgeber
- Sprache: Deutsch
Der Zauber der Welt ist eine Einladung an uns alle, das Leben in seiner sinnlichen Komplexität zu feiern und die Schönheit zu entdecken, die überall um uns herum auf uns wartet.
Gibt es auch eine andere Art, zu leben? Sinnerfüllter, eine Lebensweise, die uns ein stärkeres Gefühl der Verortung schenkt und uns zugleich ausgeruhter und gelassener macht? Erschöpft von den Krisen unserer Zeit und einer Welt in Aufruhr, erkundet Katherine May die heilsame Kraft der Natur. Ihr Weg führt sie in wilde Moore und an heilige Quellen, in die umarmenden Wellen des Meeres und unter überwältigende Sternenhimmel. Im Staunen über die Vielfalt und Schönheit der Welt findet sie Stärkung und Trost.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 252
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Cover
Titel
Katherine May
Der Zauber der Welt
Trost finden in unruhigen Zeiten
Aus dem Englischen von Marieke Heimburger
Insel Verlag
Impressum
Zur optimalen Darstellung dieses eBook wird empfohlen, in den Einstellungen Verlagsschrift auszuwählen.
Die Wiedergabe von Gestaltungselementen, Farbigkeit sowie von Trennungen und Seitenumbrüchen ist abhängig vom jeweiligen Lesegerät und kann vom Verlag nicht beeinflusst werden.
Um Fehlermeldungen auf den Lesegeräten zu vermeiden werden inaktive Hyperlinks deaktiviert.
Die Originalausgabe erschien erstmals 2023 unter dem TitelEnchantment. Reawakening Wonder in an Exhausted Agebei Faber und Faber Ltd., London.
eBook Insel Verlag Berlin 2023
Der vorliegende Text folgt der 1. Auflage der Ausgabe des insel taschenbuchs 5061.
der deutschsprachigen AusgabeInsel Verlag Anton Kippenberg GmbH & Co. KG, Berlin, 2023© Katherine May
Der Inhalt dieses eBooks ist urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte vorbehalten. Wir behalten uns auch eine Nutzung des Werks für Text und Data Mining im Sinne von § 44b UrhG vor.Für Inhalte von Webseiten Dritter, auf die in diesem Werk verwiesen wird, ist stets der jeweilige Anbieter oder Betreiber verantwortlich, wir übernehmen dafür keine Gewähr. Rechtswidrige Inhalte waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Umschlagillustration: David Eldridge, London
eISBN 978-3-458-77803-5
www.insel-verlag.de
Widmung
Für Bertie,
den Jungen, der in seinem Kopf Zweige wachsen lassen kann
Übersicht
Cover
Titel
Impressum
Widmung
Inhalt
Informationen zum Buch
Inhalt
Cover
Titel
Impressum
Widmung
Inhalt
Erde
In letzter Zeit
Stein
Hierophanie
Schuhe ausziehen
Wasser
Umlernen
Gezeiten
Pilgern
Gemeinde
Feuer
Die Nacht, in der die Sterne fielen
Aus der Asche
Deep Play
Die Flammen
Luft
Fliegen
Glorien
Hegen und Pflegen
Die Saat alles Existenten
Epilog: Äther
Dank
Nachweis der verwendeten Zitate
Informationen zum Buch
Erde
In letzter Zeit
In letzter Zeit wache ich nachts auf und weiß ein paar panische Sekunden lang nicht, wo ich bin. Ich weiß, wie ich heiße, das schon, aber ich weiß nicht, mit welcher Version meiner selbst ich es gerade zu tun habe.
Einmal dachte ich, ich würde wieder in meinem alten Bett bei meinen Eltern liegen. Fast meinte ich, das Quietschen der Metallfedern hören zu können, während ich im Geiste meinen Stundenplan durchging: Physik, Geschichte, Kunst. Aber die Illusion war unbeständig und löste sich in Luft auf, und ein paar freischwebende Sekunden lang war ich überhaupt niemand beziehungsweise einfach nur jemand, der sich erinnert, dieses Mädchen gewesen zu sein. Dann war ich wieder ich, das heutige Ich, das in seinem blauen Polsterbett saß, während durchs offene Fenster Meeresluft hereinströmte.
Das war ungewöhnlich. Meistens wenn ich aufwache, bin ich niemand, ich bin dann einfach nur ein Bewusstsein in der Dunkelheit, das versucht, sich einen Reim auf alles zu machen. Es ist ein seltsamer Schwebezustand, in dem das Ich ohne jede Verankerung existiert. Es ist ein Zwischenspiel, wie angehaltener Atem. Dann, endlich, entweicht er, die Lungen füllen sich wieder, die Welt flutet herein. Ein sehr willkommener Fakten-Upload. Ein Neustart. Ich bin wieder da.
*
In letzter Zeit schaffe ich es kaum, eine ganze Seite in einem Buch zu lesen. Die Aufmerksamkeit entgleitet mir, einfach so, ohne jede Reibung. Ich dachte, das würde sich wieder geben, wenn die Lockdowns erst vorbei wären, aber das tat es nicht. Es ist, als kämen in meinem Kopf Schmiermittel zum Einsatz. Ich will eine bestimmte Sache machen, aber mein Unterbewusstsein schiebt mich in eine andere Richtung. Es hat etwas anderes mit mir vor. Ich soll beobachten. Ich soll mich umsehen, nach der nächsten Bedrohung.
Ich kaufe mir trotzdem Bücher. Und mir werden Bücher geschickt. Sie werden zur Gefahr, sie türmen sich auf jedem Tisch im Haus, rotten sich zusammen wie die Entrechteten vor einem Aufstand. Auf dem Stapel neben meinem Bett liegt eine alarmierende Staubschicht.
Ich beschließe, mehr Bücherregale aufzustellen, aber auch das Vorhaben verläuft im Sand. Ich bin viel zu sehr damit beschäftigt, zu beobachten. Dafür brauche ich all meine Aufmerksamkeit, ich kann keinen Funken davon entbehren.
*
In letzter Zeit kribbeln meine Hände, sie wollen beschäftigt werden. Jetzt, da die Schulen wieder geöffnet sind, mache ich mich daran, den Saum von Berts grauer Hose auszulassen. Eine neue Hose zu kaufen wäre sinnlos. In einem Monat wäre sie zu kurz.
Er wächst so schnell. Ich kann ihn nicht mehr einfach auf meinen Schoß ziehen und die Arme um ihn schlingen. Gemeinsam suchen wir nach einer Alternative, aber ständig sind irgendwelche Gliedmaßen im Weg, und für einen von uns wird es unbequem. Wir wollen ihn beide, diesen Körperkontakt, aber wir verlieren dabei das Gleichgewicht. Stattdessen sitzen wir nebeneinander und versuchen uns daran zu erinnern, wie es sich anfühlt.
Ich beschäftige mich also mit Hosensäumen und denke daran zurück, wie ich Nähen gelernt habe. In den sterbenslangweiligen Sommerferien nähten meine übereifrigen kleinen Hände nachmittags Kulturbeutel. Meine Großmutter sah zu und erklärte, Stiche müsse man setzen, nicht ziehen. Ich dürfe nicht zu kräftig ziehen, aber der Faden dürfe auch nicht zu locker bleiben. Vielleicht wären Nadel und Faden die Antwort auf das Umherstreunen meines Geistes. Vielleicht könnte ich mit ein paar sorgfältig gesetzten Heftstichen das ständige Verrutschen verhindern.
*
Das vergangene Jahrzehnt hat viele von uns mit einem wachsenden Gefühl der Unwirklichkeit erfüllt. Schon vor der globalen Pandemie waren wir gefangen in ständigem Wandel, ohne je genügend Zeit zu haben, uns anzupassen. Die ständig neuen Nachrichten, das Geplapper in den Sozialen Medien, die Parteigrenzen, an denen entlang sich unsere Familien spalten: Es ist, als seien wir erst halbiert worden, dann geviertelt und als seien wir jetzt sowas wie ein sozialer Trümmerhaufen.
Wenn es einen Zeitgeist gäbe für diese Ära, dann wäre er der Angst nicht unähnlich. Seit Jahren rennen wir herum wie Kaninchen. Wir sehen irgendwo einen weißen Schwanz aufblitzen, erkennen das Alarmsignal, und schon rennen wir los und lassen unseren eigenen Schwanz weiß aufblitzen. Es ist eine Kettenreaktion, ein Fluss des Schreckens, der uferlos strömt und andere wilde, wachsame Wesen mitreißt, die ihrerseits Alarmsignale aussenden. Es gilt nicht, sich vor einem einzelnen Raubtier in Sicherheit zu bringen, sondern vor vielen. Rennen ist das Gebot der Stunde. Alles ist so furchtbar dringend. Und mit jedem Jahr müssen wir schneller rennen, ob wir wollen oder nicht. Wir können nur rennen und in Panik verfallen und anderen unsere Ängste mitteilen, und die anderen werden uns unsere Ängste spiegeln.
Alles in dieser Zeit verschwört sich gegen uns, gibt uns das Gefühl, klein und unbedeutend zu sein. Als seien die Maßstäbe über uns hinausgewachsen. Das wankende numerische Gewicht der Welt wurde preisgegeben, und es ist, als wären wir direkt mit Gott konfrontiert: Ihre fürchterliche Komplexität, ihre unfassbare Größe hauen uns um. Nichts hätte uns darauf vorbereiten können. Wir arbeiten uns daran ab, die Grundlagen des Überlebens zu sichern. Eine unendliche, undankbare Arbeit. Manchmal könnte man meinen, wir würden den Kessel einer riesigen Maschine anfeuern, die uns am Ende verschlingen wird. Wir sind müde. Wir sind so unendlich müde, wie es Menschen sind, die sich nirgends mehr zu Hause fühlen. Und wir sehen keinen Ausweg.
Gleichzeitig bemerken wir an den Rändern unseres Bewusstseins eine gewisse Abwesenheit. Sie ist nicht einfach in Worte zu fassen, aber sie bringt ihre eigene dunkle Nachtangst mit sich, ihr eigenes Grauen. Nämlich das Gefühl, dass wir keinerlei Verbindung zu Sinnhaftigkeit mehr haben und auch das kaum noch wahrnehmen. Wir spüren das, wenn wir fürchten, unseren Materialismus nicht mehr eindämmen zu können. Wir spüren es, wenn die Anziehungskraft unserer Smartphones sich anfühlt wie eine Abhängigkeit. Wir spüren es, wenn uns klar wird, dass wir unser Leben in klimatisierten Räumen verbringen und eigentlich gar nicht wirklich wissen wollen, wie das Wetter draußen ist.
In alldem manifestiert sich diese Abwesenheit jeden Tag. Doch am deutlichsten spüren wir sie, wenn wir nach Worten der Trauer suchen und nichts als Plattitüden finden, wenn wir die dunkelsten Abfälle unserer Erfahrungen in den Äther schleudern und niemand sie auffangen will. Etwas ist verloren gegangen, ist verschwunden jenseits lebendiger Erinnerung: der Fluss der Erfahrungen, die die Menschheit seit Anbeginn prägen. Wir haben die Übergangsriten aufgegeben, die uns früher von der Geburt bis zum Tod begleiteten, und gleichzeitig haben wir viele unserer Erfahrungen unaussprechlich gemacht. Aber wir durchleben diese Dinge weiterhin, jeder für sich, stumm, isoliert von Freunden und Nachbarn, denen es ganz ähnlich ergeht. Jahrhundertealtes Wissen geht in diesem Schweigen verloren, Generationen der Gemeinschaft. Wir sind permanent von Gesprächen umgeben, und doch sind wir chronisch einsam.
Ich habe mehr und mehr das Gefühl, ein Teil von mir würde fehlen, und zwar der Teil, der die Erschütterungen des Wandels aushalten kann, der sie erspürt und erfährt und annimmt, statt sie einfach nur zu verwalten. Je älter ich werde, desto mehr empfinde ich das als einen gravierenden Mangel. Tief in mir steckt eine Sehnsucht, die ich erst jetzt langsam begreife, ein Verlangen nach metaphysischen Erfahrungen, nach Tiefe, nach Sinn. Nicht nur die Welt muss sich ändern – auch ich muss mich ändern. Ich muss meine eng gesteckten Grenzen empirischen Denkens aufweichen, muss flexibler, offener werden. Ich bin auf der Suche nach dem, was der Dichter John Keats negative Befähigung nannte, jene subtile und intuitive Art des Denkens, die es uns erlaubt, »in Unsicherheiten, in Unerklärlichkeiten, in Zweifeln zu sein, ohne das ärgerliche Ausstrecken nach Faktum und Vernunft«. Der unter der Oberfläche verborgene Zauber der Welt bietet Trost, aber ich weiß nicht, wie ich ihn empfangen soll.
Ich habe grundlegendes Wissen verloren, ganz elementare menschliche Gefühle. Ohne sie fühlt sich die Welt an wie abgestandenes Leitungswasser, fade und chemisch, ohne jedes Leben. Ich bin wie ein Blitz, der in die Erde einschlagen möchte. Ein unangenehmes Kribbeln erfüllt mich, in meinen Gliedern steckt eine Energie, die sich mangels Kontakts nicht entlädt. Stattdessen braut es sich immer mehr in mir zusammen, wie ein Gewitter. Mir fehlen die Worte, um es zu beschreiben, dieses enorme, unbefriedigte Gefühl, als würde ich über die spiegelglatte Oberfläche der Dinge rutschen, stets angsterfüllt, was darunter lauern mag. Ich muss irgendwie anders, besser durchs Leben gehen. Ich möchte mich wieder verzaubern lassen.
Verzauberung, das sind kleine Wunder, die durch ihre Sinnhaftigkeit groß wirken; das ist im Netz von Fabeln und Erinnerung verhedderte Faszination. Sie basiert auf kleinsten, fast homöopathischen Dosen von Ehrfurcht: jenen leisen Spuren von Zauber, die wir nur finden, wenn wir sie suchen. Verzauberung ist das Gefühl, dass wir alle in einem beständigen Strang unserer Existenz und der Elemente, die unsere Erde ausmachen, miteinander verbunden sind und dass irgendwo in dieser Verbindung eine Kraft steckt, ein Kribbeln am Rand unserer Wahrnehmung. Es ist der vergessene Saum in unserer Erdgeschichte, das sich entziehende Teilchen, das unsere instabile Materie zusammenhält: die Fähigkeit, den Zauber im Alltäglichen zu finden, ihn mit Leib und Seele zu spüren, uns von ihm tragen zu lassen.
Ohne ihn habe ich das Gefühl, mir würde ein wichtiger Nährstoff fehlen, ein Vitamin, das man nur findet, wenn man in der eigenen Erde gräbt.
*
Ich bin neun Jahre alt, vielleicht zehn, und ich sitze hinten im Auto meiner Mutter. Wir fahren an den landwirtschaftlichen Flächen vorbei, die da anfangen, wo unser Dorf aufhört, und ich denke: Ist das schön?
Mir kam es jedenfalls schön vor. Wenn man die Reihen identischer Häuser verließ, die alle nach dem Krieg aus vorgefertigten Betonelementen errichtet wurden, öffnete sich die Landschaft, und alles wurde grün. Ja, gut, die Felder lagen tief und standen oft unter Wasser, manche waren mit Kohlköpfen übersät, andere mit Krähen. Ja, sicher, sie boten keine echten Ausblicke bis auf den über die Themse zum Kraftwerk in Tilbury. Aber das war alles, was ich hatte, das war mein offener Himmel.
Manchmal ging ich mit den Mädchen dorthin, auf die meine Mutter nach der Schule aufpasste. Wenn man an der Bücherei und den vielen Läden vorbeiging, kam man irgendwann an einen von Traktorreifen tief zerfurchten Feldweg. Einmal glaubte ich, dort einen Dachs erspäht zu haben, aber nach etwas genauerem Hinsehen und aufgeregtem Heranpirschen entpuppte er sich als eine schwarze Mülltüte, die vom Wind aufgeblasen wurde. Doch da waren auch Spuren, die von einem Dachs hätten stammen können, von denen meine Mutter aber eher annahm, dass sie die eines großen Hundes waren. Das hielt mich nicht davon ab, mit einer Tüte Gips und einer Flasche Wasser wieder hinzupilgern und Abdrücke anzufertigen. Die Ergebnisse waren frustrierend beliebig deutbar. Die Spuren hätten von einem Hund, von einem Dachs oder von einem Yeti stammen können.
War das eine Landschaft, bei deren Anblick einem das Herz aufgehen sollte? Meine Mutter war offenbar dieser Ansicht, zumindest ein bisschen. Manchmal sonntags, wenn wir Zeit hatten, fuhren wir auf dem Weg zu meinen Großeltern durch ebendiese Landschaft, vorbei an Marschen und den sie umgebenden Gräben, und nannten das »die schöne Strecke«. Zählten Gräben überhaupt als Natur? Ich hatte gehört, sie seien voller Aale, und ich wusste, dass in den Marschen Ratten lebten, weil unsere Katze regelmäßig welche anschleppte, mit daumendicken rosa Schwänzen. Das hatte wenig mit der Natur zu tun, die man sonntagabends in Dokumentarfilmen sah. Meine Natur – das, was es um mich herum gab – war etwas, bei dessen Anblick Frauen in Sitcoms anfingen zu kreischen.
Auf dem Kanal in der Nähe der alten British-Uralite-Werke, unserer verlassenen Asbestfabrik, schwammen sogar Schwäne. Aber die Menschen sprachen immer noch lieber über die vielen Arbeitsplätze, die tragischerweise verloren gegangen waren, als darüber, was die Leute, die dort gearbeitet haben, bis heute plagt – nämlich die Krankheit, die die Lungen so vieler Männer hier in der Gegend zerstört hat. Meine Mutter, die sich höchst ungern im Freien aufhielt, hatte aus unerfindlichen Gründen beschlossen, diesen Ort zum Ziel eines Spaziergangs mit uns zu machen, damit wir etwas Natur sähen. Im Frühling gab es dort Froschlaich und riesige Schwanennester, in denen wir Eier zu erspähen versuchten, ohne die Vögel gegen uns aufzubringen. Denn es war ja allgemein bekannt, dass die ganz schön aggressiv werden konnten. Dieser Ort, an dem zwischen rostigem Metall und Stacheldraht wilde Natur gedieh, war ein Kompromiss. Die Natur im Fernsehen war groß und weit und irgendwo ganz anders, nicht in unserer Nähe. Unser Dasein schien so billig und klein im Vergleich zum Rest der Welt.
Es gab andere Orte, bei denen ich mir sicherer war, dass sie schön wären. Zum Beispiel die Kreideklippe am Blue Bell Hill auf dem Weg nach Maidstone, die zu den weißen Klippen von Dover gehörte, aber etwas weiter im Landesinneren gestrandet war. Ich dachte, sie müsste wirklich weltklasseschön sein, so hoch und schroff, wie sie war. Insgeheim fragte ich mich, ob sie wohl berühmt war. Oder der Strand von Greatstone mit seinen grasbewachsenen Dünen und den vielen rosa Tellmuscheln am Wassersaum. Zweimal im Jahr fuhren wir im Konvoi dorthin und sangen auf dem Weg durch die Dörfer von Kent »The Quartermaster’s Store«. Einmal, als wir auf den karierten Decken saßen und meine Mutter Kaffee aus ihrer Thermoskanne trank, sagte ich, wenn ich groß sei, wolle ich am Meer wohnen, und löste damit allgemeines Gelächter aus.
»Dann hättest du ständig Sand im Haus«, sagte meine Mutter.
»Du kämst aus dem Staubsaugen überhaupt nicht mehr heraus«, sagte meine Oma.
Das verwirrte mich, denn meine Oma war ohnehin ständig am Staubsaugen, und das, obwohl es weit und breit keinen Sand gab. Aber ich verstand. Schön war dasselbe wie unpraktisch. Schön war nichts für Normalos wie uns.
Ich fand auch andere Sachen schön, von denen ich ziemlich sicher war, dass andere sie nicht schön fanden. Die Eimer voller braun werdender Rosenblütenblätter, die ich im Versuch, Parfum herzustellen, im Sommer im Garten verteilt hatte. Die nachts von den hohen Schornsteinen auf der anderen Flussseite zu uns herüberblinkenden roten Lichter. Die über meine Bettdecke wandernden Scheinwerferkegel, wenn ich im Gästezimmer bei meinen Großeltern lag, wo wir nach der Scheidung meiner Eltern wohnten. Mir war bewusst, dass das streng genommen nicht schön war, aber für mich lag ein gewisser Zauber darin, wie die Welt draußen vor dem Fenster drinnen durch mein Zimmer geistern konnte.
Das Allerschönste, was ich je gesehen habe, war, als Großvater mich einmal an Silvester mitten in der Nacht wach rüttelte, damit ich mich aus dem weit geöffneten hinteren Schlafzimmerfenster lehnen und das Feuerwerk über London sehen konnte, das gerade so am Horizont zu erkennen war. Am nächsten Morgen war ich mir nicht sicher, ob das wohl nur ein Traum gewesen war, und mochte nicht fragen, für den Fall, dass mir genau das bestätigt würde. Das waren meine heiligen Reliquien, meine Liturgie, die Sammlung einiger Erinnerungen, die ich gut hütete, um sie mir immer wieder durch den Kopf gehen zu lassen. Sie verursachten mir ein Kribbeln im Bauch, als würde etwas unmittelbar bevorstehen, als könnte etwas passieren.
Als Kind habe ich mich so leicht verzaubern lassen, aber ich glaubte fälschlicherweise, das sei irgendwie naiv, dumm und peinlich und etwas, das man auf dem Weg ins Erwachsenenleben schnellstens ablegen sollte. Und jetzt möchte ich es gerne wiederfinden. Später hat sich gezeigt, dass die Verzauberung überhaupt nichts mit Schönheit zu tun hatte – jedenfalls nicht im objektiven Sinne. Wahrscheinlich war sie eher meinem sehr intensiven Verhältnis zu meiner Umwelt entsprungen, einer ganz besonderen, an höchste Aufmerksamkeit geknüpften Erfahrung, dem Gefühl von Verbundenheit, das entsteht, wenn man etwas bemerkt. Ich habe mich sehr angestrengt, all das zu unterdrücken. Ich dachte, das müsste ich tun, um erwachsen zu werden. Viele Jahre habe ich hart daran gearbeitet und mich in aktivem Vergessen geübt, ohne dass mir aufgegangen wäre, was ich dabei verlor.
Aber Verzauberung kann nicht zerstört werden. Wir müssen uns nur erinnern, dass wir sie brauchen. Und jetzt, da ich anfange, nach ihr zu suchen, ist sie da: blass, sporadisch, geduldig auf meine Rückkehr wartend. Ein Aufblitzen des Sonnenlichts hinter Buntglas. Goldenes Glitzern im Schlamm des Flussbetts. Von Laub geflüsterte Wörter.
»Dass ich verschwände«, schrieb Simone Weil in Schwerkraft und Gnade. »Wenn ich irgendwo bin, beflecke ich das Schweigen des Himmels und der Erde durch mein Atmen und das Schlagen meines Herzens.«
Das ist es, wonach ich suche: Eine Gelegenheit, mit der reißenden Strömung der Welt zu verschmelzen, mich überwältigt zu fühlen, mich ihrem Fluss so vollkommen hinzugeben, dass ich mich manchmal selbst vergessen kann.
Aber das ist ein sehr hehres Ziel, solange ich kaum in der Lage bin, meinen Geist in Bewegung zu setzen.
Stein
Wenn ich meinen derzeitigen Gefühlszustand zu beschreiben versuche, dann scheint mir das Wort Tohuwabohu am treffendsten. Genau so ist mein Geisteszustand: wirr, konfus, von der Rolle. Es schwingt darin ein Hauch von Verrückung oder Zerstückelung mit, das Gefühl, dass etwas in Einzelteile zerlegt wurde, die in unterschiedliche Richtungen auseinanderfliegen. Vielleicht verwechsle ich Tohuwabohu mit Kopflosigkeit, wobei Letzteres in mir ein Bild von meinem Kopf evoziert, wie er sich von meinem Körper entfernt. Und genauso fühlt es sich auch an. Nichts ist an seinem Platz. Ein kurioses Wort für einen sehr ernsten Zustand, die freundliche Fassade einer ausgewachsenen existenziellen Krise.
Ich weiß nicht, was mit mir los ist, wirklich nicht. Einerseits wahrscheinlich gar nichts, aber andererseits doch alles. Ich fühle mich seltsam leer, bar jeder Gedanken und Kraft. Ich weiß nicht, wo die Tage bleiben, aber sie vergehen. Alles, was ich tun muss – schon das geringste Anzeichen von Verpflichtung –, lähmt mich. Ich will das alles nicht. Ich will in Ruhe gelassen werden, allein. Ich weiß nicht, was ich mit meiner Zeit anfangen würde, sollte ich jemals den Zustand perfekten Alleinseins erreichen. Ich stelle mir gerne vor, dass ich sehr viel lesen würde, aber wahrscheinlich würde ich einfach nur sehr viel schlafen. Aufs Lesen kann ich mich nicht konzentrieren. Eigentlich kann ich mich auf gar nichts konzentrieren. Ich habe das Gefühl, mein Gehirn ist komplett von mir getrennt. Einerseits ist es leer, andererseits passt nichts mehr rein. Ein nutzloses Organ, das sich permanent weigert, die Dinge wahrzunehmen, von denen ich möchte, dass es sie wahrnimmt. Aber es entzieht sich. Streift nur kurz über alles hinweg, wie ein blasser Lichtstrahl.
Auch die Zeit benimmt sich seltsam. Sie scheint sich wie Schnee auf unser Haus gelegt zu haben, in manchen dunklen Ecken höher, woanders eher sparsam. Sie lastet schwer auf dem Dach und ist regelrecht greifbar, aber ich kann es nicht richtig erklären. Bestimmte Zeitpunkte meines Alltags haben sich so verdichtet, dass sie fast schon ein Dauerzustand sind. Jeden Abend, wenn ich mir das Gesicht wasche, habe ich das Gefühl, seit Monaten an diesem Waschbecken zu stehen. Die Zeit bildet einen Loop, sie überschneidet sich, und manchmal habe ich Angst, ich könnte auf diese Weise hier in meinem Badezimmer um mehrere Jahrzehnte verrutschen, bis ich plötzlich alt bin. In anderen Situationen im Laufe des Tages vergeht die Zeit so langsam, dass ich mir gar nicht vorstellen kann, dass die Welt sich überhaupt noch dreht. Irgendetwas muss stehengeblieben sein.
Vielleicht ich. Vielleicht bin ich depressiv. Aber mein Zustand fühlt sich nicht an wie meine früheren Depressionen. Ich empfinde keinen mich in die Knie zwingenden Selbsthass, keinen Zerstörungsdrang. Ich halte mich ganz gut über Wasser, ja, ich bin sogar seltsam zufrieden. Ich bin einfach nur langsam, das ist alles. Ich bin einfach nur leer. Ich räsoniere, dass das vielleicht eine Art Pandemie-Katerstimmung ist, dass mein Esprit aus Mangel an Stimulation gedämpft ist, dass ich deshalb noch empfindlicher bin als sonst, weil ich zu wenig gefordert wurde. Der soziale Stillstand, den der Lockdown mit sich brachte, gefiel mir eigentlich ganz gut, und gleichzeitig war ich rastlos und langweilte mich. Und da stecke ich irgendwie immer noch fest. Rastlos mich langweilend, mit leerem Kopf und einem körperlichen Widerwillen, etwas dagegen zu tun. Die Bewegungslosigkeit ist mir in Fleisch und Blut übergegangen, und ich weiß nicht, wie ich wieder in Fluss kommen soll.
Und damit bin ich nicht alleine. Die Menschen um mich herum sprechen über dasselbe Gefühl, jeder auf seine Weise. Sie schieben es auf die Anstrengung, die es während der Pandemie mit sich brachte, die Kinder den ganzen Tag zu Hause zu haben und gleichzeitig irgendwie zu arbeiten. Sie sprechen von Einsamkeit und Isolation, davon, wie beides sie wie besessen reagieren lässt auf alles, worauf sie keinen Einfluss haben. Sie reden immer mehr von den Wechseljahren und davon, wie sie ihnen das Gehirn vernebeln. Manche nennen es sogar bei einem Namen: Burnout. Wir alle sind verkohlte Überreste. Von uns bleibt nichts übrig als geschwärzte Knochen.
Das ist ein Zustand, mit dem ich mich sehr gut auskenne. Autistische Menschen wissen zu gut, was ein Burnout ist, vor allem die, die wie ich erst im fortgeschrittenen Erwachsenenalter ihre Diagnose bekamen. Ein Burnout stellt sich ein, wenn man die eigenen Bedürfnisse über einen zu langen Zeitraum ignoriert. Man wird sukzessive krank, Erschöpfung für Erschöpfung, Überforderung für Überforderung. In meinem Fall führte das jahrelange Verstecken meiner sensorischen Überanstrengung und der ständigen sozialen Unangepasstheit im Alltag dazu, dass ich von einem Burnout in den nächsten stolperte. Und jeder Burnout war anders. Mal war ich so unfassbar erschöpft, dass ich kaum noch stehen konnte; mal stellte ich das Sprechen ein; mal entwickelte ich Angst vor allem. Ich habe unzählige Jobs verloren und musste mich mit den Nebenwirkungen herumschlagen, die sich aus der Arbeitslosigkeit ergeben – mit Schulden, mit dem Unvermögen, finanzielle Rücklagen zu bilden, mit dem Verlust des Selbstwertgefühls, mit der Scham. Burnout ist etwas, vor dem ich mich sehr sorgfältig schütze, jetzt, da ich weiß, wie er entsteht. Ich dachte, ich hätte vielleicht gelernt, wie ich ihn komplett vermeiden kann. Aber nein. Da ist er wieder. Ich habe eben nicht alles unter Kontrolle.
Ich sitze am Schreibtisch, um zu arbeiten, doch stattdessen bin ich auf Twitter, dann auf Instagram, dann bei den Nachrichten, bei Twitter, bei den Nachrichten, auf Instagram, bei den Nachrichten, auf Twitter und Instagram, dann wieder bei Twitter und nochmal auf Twitter, wo alle sich aufregen über die Nachrichten und alle genau zu wissen glauben, was zu tun sei, in die eine oder die andere Richtung. Ich kann Stunden damit verbringen, ich kann endlos zwischen den vielen menschlichen Avataren herumflitschen, die mir im Vergleich zu mir selbst so gefestigt vorkommen, so sicher. Sie senden ein beständiges Licht aus, und ich nicht. Mit leerem Blick betrachte ich sie und frage mich, wie sie so viel wissen können, wie sie so sicher werden konnten. Ich soll ja eigentlich schreiben, aber ich bin nicht gefestigt genug. Was habe ich schon zu erzählen?
Gegen Mittag wird mir klar, dass ich etwas tun muss, und ich strenge mich doppelt an, mich zu konzentrieren. Aber das einzige mir bekannte Mittel gegen dieses freie Schweben besteht darin, meine Füße immer wieder auf den Boden aufzusetzen, bis mein Gefühl für die Schwerkraft zurückkehrt. Über meinem Schreibtisch klebt ein Post-it-Zettel, auf den ich letzte Woche in einem Moment großer geistiger Klarheit »Spaziergang machen« schrieb. Ich glaube, ich sollte das beherzigen. Normalerweise schnappe ich mir den Hund und marschiere an der Küste entlang, aber heute reicht mir dieser flache Weg nicht. Ich will das eigene Gewicht auf meinen Beinen spüren, ich will gegen die Erdanziehung ankämpfen. Ich verlasse das Haus und steige auf den aus der Stadt hinausführenden Hügel, vorbei an der alten Windmühle und zwischen den Häusern hindurch, mein Ziel sind die Hinkelsteine von Whitstable.
Überall auf den britischen Inseln und in der Bretagne sind Ansammlungen von Hinkelsteinen zu finden, häufig in Kreisen oder in Reihen angeordnet. Hinkelsteine werden auch Menhire genannt, es handelt sich dabei um in der Jungsteinzeit, also vor vier- bis siebentausend Jahren, von Menschenhand geglättete Felsblöcke, und über ihren ursprünglichen Zweck können wir heute nur rätseln. In Whitstable findet sich nichts, was so alt wäre, keine langen Karren, keine Megalithen, keine Ruinen, die auf längst vergangene Zivilisationen hindeuteten. Unsere Hinkelsteine sind nagelneu. Sie wurden im November 2020 aufgestellt, hoch über der Stadt auf unserer genauso neuen Dorfwiese. Die acht Felsblöcke definieren einen Grünbereich inmitten der neuen Häuser und Wohnungen, die sich im Zuge der Gentrifizierung des Stadtkerns immer weiter in die umliegenden Felder fressen. Die Felsblöcke sind ein Zeichen dafür, dass wir uns verändern, dass wir uns von den Kirchen entfernen, die den Fischern und ihren bangen Familien einst Trost waren, und neutralere Orte suchen, um uns zu besinnen. Sie sind Ausdruck eines Verlangens, von dem wir noch nicht wissen, wie wir es stillen können.
Ich würde lügen, wenn ich behauptete, die Idee mit dem neuen Steinkreis nicht enorm künstlich zu finden. Was sollen sie bedeuten, diese Steinkolosse, die nicht einmal hier aus der Gegend stammen? Was sollen sie symbolisieren? Als sie frisch aufgestellt waren, bin ich hingegangen und habe sie als öde empfunden, wie sie so aus dem kahlen Winterboden ragten, noch ganz staubig. Erst dachte ich, sie seien aus Beton. Und sie lieferten mir den Teil einer Antwort auf eine Frage, die wir noch nicht ganz gelernt haben überhaupt zu stellen: Wie beten wir heute? Wie schaffen wir es, an allem nüchternen Wissen unseres entzauberten Zeitalters vorbeizukommen und zu dem Zauber zurückzukehren, den wir früher überall wahrnehmen konnten? Ich wollte die Steine berühren, ich wollte, dass sich ein über Jahrtausende in ihnen abgelagertes, sinndurchdrungenes Kribbeln auf mich übertrug. Doch sie ließen mich auflaufen.
Such dir selbst einen Sinn, sagten sie. Das können wir dir nicht abnehmen.
Ich habe mal die Bekanntschaft einer Frau gemacht, die Hinkelsteine aus Ton herstellte. Jean Lowe wartete, bis ihr Mann in den Ruhestand gegangen und ihre Kinder alle aus dem Haus waren, dann schrieb sie sich an einer Kunstschule ein und studierte Keramik. Vasen und Becher waren nichts für sie: Sie schuf Gestein. Sie brachte ihren Ton zurück in seine ursprüngliche Form, sie machte aus dem glatten Material wieder etwas Wildes, indem sie es brannte.
Als ich ihr begegnete, war ich eine junge Dichterin mit dem Auftrag, etwas über ihre Arbeit zu schreiben. Sie war damals schon über siebzig und arbeitete in ihrem Atelier in der Nähe eines alten Schilfbettes an einem Nebenfluss des Medway. Sie wuchtete immer noch mit ihren Steinen herum, arbeitete Spitzen heraus und vertiefte Furchen und Mulden, damit sich Regenwasser darin sammeln konnte. Sie hatte nichts dagegen, dass Vögel darin badeten, wollte ihre Werke aber partout nicht als Vogelbäder verstanden wissen. In ihren Augen glichen sie viel eher Menschen, Gestalten, die in der Landschaft herumstanden wie die Menhire, die sie in Carnac und Bodmin gesehen hatte, schaurig und schön zugleich. Jean war irgendwie subversiv angehaucht. Ihr gefiel die Vorstellung, dass ihre seltsamen Steine in aufgeräumten Vorstadt-Vorgärten aufgestellt wurden und so einen Hauch von Andersartigkeit verbreiteten.
Als ich sie das erste Mal besuchte, zeigte sie mir einen Stein, der frisch aus dem Ofen kam. Seine Spitze war gespalten, man konnte in sein hohles Inneres sehen. »Ton vergisst nichts«, erklärte sie. »Egal, wie sorgfältig ich die Teile zusammenfüge. Im Ofen reißen die kleinsten Fugen auf.« Ich fragte sie, was sie nun mit dem gespaltenen Stein tun werde, und sie sagte, sie würde ihn so behalten, wie er ist. Sie war der Überzeugung, die Steine fänden selbst zu ihrer sinnhaften Form und drückten sich durch die Hände der Künstlerin aus. Ich glaube kaum, dass sie es anders hätte haben wollen. Die Risse und Spalten machten ihre Steine zu Schönheiten.
Wie Jean mag auch ich das Gefühl von Stein in meiner Hand. Allerdings bin ich keine Schöpferin, sondern Sammlerin. Wo ich gehe und stehe, wandern Kieselsteine in meine Taschen. Jedes Jahr im Herbst, wenn ich die warmen Mäntel hervorhole, finde ich darin die längst vergessenen Mitbringsel von meinen Spaziergängen im letzten Jahr, und mit jedem ist eine Erinnerung verbunden an einen Ort, einen Moment, einen Gedanken. Sie liegen überall bei mir zu Hause herum, und manchmal muss ich klar Schiff machen, dann befördere ich sie allesamt in den Garten. Aber irgendwann sind sie wieder zurück im Haus. Ich bin versucht zu glauben, dass sie sich heimlich vermehren.
Ich weiß nichts Schöneres als das Gefühl, einen Stein in der Hand zu halten, wenn er die richtige Beschaffenheit und die richtige Größe hat. Steine haben so ein reines Gewicht, als würde sich in ihnen die Schwerkraft konzentrieren. Sie wirken, als würden sie sich beständig nach Kontakt mit der Erde sehnen, als würden sie immer in Richtung des Bodens drängen, der zu ihrer ruhigen Kühle passt. Während ich das hier schreibe, greife ich nach einem und betrachte ihn, wie er auf meiner Handfläche liegt. Zwischen uns entsteht ganz klar eine Verbindung, wir kommunizieren über unsere Dichte, wir wechseln Wärme. Einen Moment lang bin ich wieder verankert.