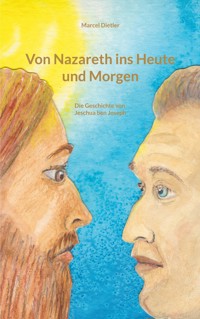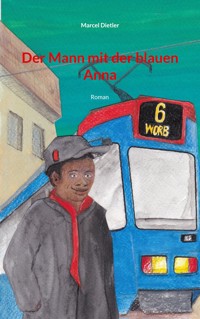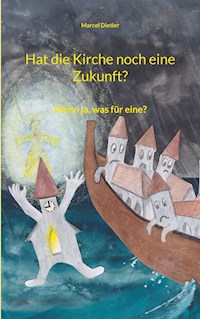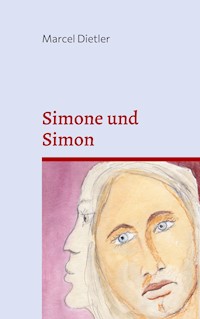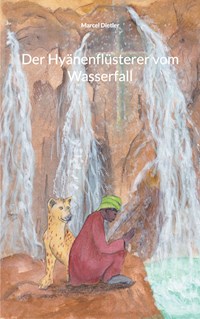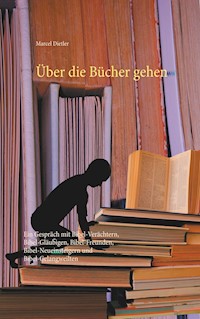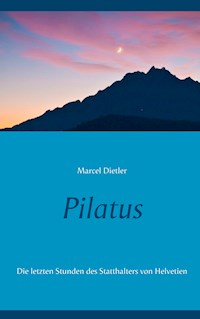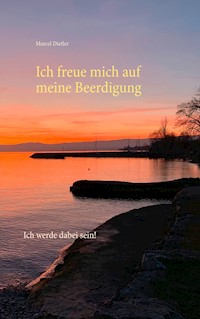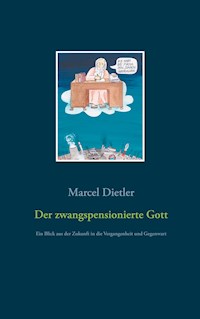
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Von Zeit zu Zeit seh ich den Alten gern. Das ist ein bekanntes Wort aus Goethes Drama Faust. Der Alte war zu Goethes Zeiten offenbar nur teilpensioniert; sein schrittweiser Ausstieg wurde erst vorbereitet. Selbst in meiner Generation erschien er zunächst noch täglich im Betrieb. Er erkundigte sich nach unserem Wohlergehen, hatte ein gutes Wort, brachte ein Geschenk. Die Juniorchefs liessen sich gerne von ihm beraten. Heute ist das anders. Wir haben ihn pensioniert. Er hat sich gewehrt, doch wir haben ihn entmündigt und zur Ruhe gezwungen. Bei einer Taufe laden wir ihn nach wie vor gnädig ein, bei Trauungen immer seltener. Bei Trauerfeiern war er bis vor kurzem noch jedes Mal dabei, doch heute bemühen wir ihn nicht mehr. Was soll er auch an Abschiedsfeiern von Ur-Ur-Urenkeln, die ihn gar nicht gekannt haben?
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 58
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Bild von Sabine Szabo (www.sabine-szabo.ch)
Vorwort
Eigentlich wollte ich nie Bücher schreiben. Kindern und Erwachsenen habe ich gerne Geschichten erzählt, Weihnachtsgeschichten auf Wunsch sogar vervielfältigt – aber Bücher schreiben: Das lass sein! Vielleicht ist mir das Bibelwort eingefahren: Mein Sohn, lass dich warnen! Des vielen Büchermachens ist kein Ende. (Prediger 12,12) Freunde haben mich gedrängt, immer wieder, und schliesslich, im Alter von 82 Jahren, habe ich dem Drängen stattgegeben und daraufhin innerhalb eines Jahres vier Bücher geschrieben. Das fünfte, mein Roman Der Hyänenflüsterer vom Wasserfall, wird 2021 erscheinen. Dieser Titel lässt nicht erahnen, dass der Hyänenflüsterer der im Neuen Testament nur zweimal erwähnte Simon von Kyrene ist, der Mann, der gezwungen wurde, Jesus das Kreuz tragen zu helfen. Der unverdächtige Titel wird möglicherweise einige Leserinnen und Leser, die weder mit der Bibel noch mit Jesus etwas anfangen können, dazu bewegen, nach diesem Buch zu greifen. Der Hyänenflüsterer vom Wasserfall ist meiner Meinung nach das Beste, was ich je geschrieben habe, und so beschloss ich, dieser Roman müsse meine kurze Altersschriftstellerei als Krönung abschliessen.
Es war Herbst 2020, als das Skript fertig war. Schluss mit der Bücher-Schreiberei. Doch im Corona-Jahr wollte ich unseren Verwandten, Freunden und Bekannten wenigstens einen guten Weihnachts-Neujahrsbrief schicken. Am Ende von Vreni und Marcel Dietlers irdischem Leben durfte es jedoch nicht einfach ein Jahresüberblick sein, es sollte ein Brief werden zum Thema einst und jetzt.
Ein Weihnachtsbrief darf nicht mehr als zwei Seiten umfassen, sonst liest ihn niemand. Bei Seite 3 stockte ich, schrieb dann aber weiter. Ich fürchte, damit liegt bereits ein Skript zu einem weiteren Buch vor, zwar nur ein kleines, aber doch auch wieder ein Buch. Ein Weihnachtsgeschenk für unsere Freunde und Bekannten.
Marcel Dietler
Inhalt
Vorwort
Der Chef und die Juniorpartner
Die Kriegsjahre
Lieder gestern und heute
Die lachende Leiche
Die Hand von Bruder Klaus
Hier spricht London! Hier spricht London!
Aujourd'hui ce n'est pas samedi
Immer wieder dieses blöde Kenya
Wunder
Kinderspiele
Tramrestaurants und lauwarmer Kakao
Fliegeralarm und Körperstrafen
Waschfrauen, Diakonissen und das Frauenstimmrecht
Die Sonntagsbeschäftigung
Die Zwangspensionierung Gottes
Der Regenbogen
Nachwort
Bücher von Marcel Dietler
Der Chef und die Juniorpartner
Von Zeit zu Zeit seh’ ich den Alten gern. Das ist ein bekanntes Wort aus Goethes Drama Faust. Der Alte war zu Goethes Zeiten offenbar nur teilpensioniert, sein schrittweiser Ausstieg wurde erst vorbereitet. Selbst in meiner Generation erschien er zunächst noch täglich im Betrieb. Er erkundigte sich nach unserem Wohlergehen, hatte ein gutes Wort, brachte ein Geschenk. Die Juniorchefs liessen sich gerne von ihm beraten. Heute ist das anders. Wir haben ihn pensioniert. Er hat sich gewehrt, doch wir haben ihn entmündigt und zur Ruhe gezwungen. Bei einer Taufe laden wir ihn nach wie vor gnädig ein, bei Trauungen immer seltener. Bei Trauerfeiern war er bis vor kurzem noch jedes Mal dabei, doch heute bemühen wir ihn nicht mehr. Was soll er auch an Abschiedsfeiern von Ur-Ur-Urenkeln, die ihn gar nicht gekannt haben?
Wir Achtzig-, Neunzig- und Hundertjährigen blicken auf ein langes Leben zurück. In dieser langen, aber gleichzeitig auch sehr kurzen Zeit haben sich Veränderungen ereignet, wie sie zuvor in hunderten von Jahren nicht möglich waren. Antike nennt man die Zeit von ca. 600 v.C. bis 600 n.C. im Mittelmeerraum; mehr als tausend Jahre waren die Menschen im Mittelmeerraum dieselben geblieben. Nach der Antike umfasste auch das Mittelalter in ganz Europa wieder gut tausend Jahre. Doch dann ging es auf einmal rasend schnell: Kaum waren die ersten primitiven Fahrräder erfunden worden, landeten die Menschen bereits auf dem Mond. In den Altersheimen und auf den Pflegeabteilungen fütterten nicht mehr Krankenschwestern die Gebrechlichen, und auch nicht Pflegefachfrauen, wie sie später hiessen; die Fütterung und Pflege übernahmen vielmehr Roboter. In Japan jedenfalls ist das bereits der Fall – Roboter, die wie Menschen aussehen und sogar sprechen können. Bei uns ist das vorerst noch Zukunftsmusik. Der Untertitel dieses Büchleins lautet nicht zufällig: Ein Blick aus der Zukunft in die Vergangenheit und Gegenwart.
Ich wollte bereits im Alter von zwölf Jahren Pfarrer werden – und bin es auch geworden. Deshalb haben sich mir die religiösen Unterschiede von damals bis heute besonders eingeprägt. Die Leserinnen und Leser werden deshalb dem alten Gott noch ein paarmal begegnen. Doch andere Veränderungen waren genauso einschneidend. Auch davon will ich berichten. Mein Buch ist ein Erlebnisbericht.
Die Kriegsjahre
Meine frühe Kindheit war geprägt von den Kriegsjahren. Eine meiner ersten Erinnerungen besteht darin, dass man zu Weihnachten einen Dezi Schlagrahm auf den Kopf bekam. Ich wunderte mich, wie ich aussehen würde, wenn mir Frau Lory aus unserer Quartiermolkerei Rahm auf den Kopf schmieren würde. Ich wusste ja nicht einmal, was Rahm überhaupt war. Milch, Butter, Käse und Fleisch gab es mithilfe von Lebensmittelmarken, Rahm war nur zu Weihnachten erhältlich, ein Dezi pro Person, oder wie die Erwachsenen eben sagten: auf den Kopf.
Die Männer verbrachten den Tag auswärts, um Geld zu verdienen, die Frauen waren zuhause, um auf die Kinder aufzupassen, zu kochen und zu putzen. Die wenigen Coopläden, die es damals gab, hiessen Konsum. Das Konsum war nach damaligen Begriffen ein grosser Laden, aus heutiger Sicht klein; ohne Regale, von denen man die Waren selber hätte herunterholen dürfen, um damit zur Kasse zu gehen. Hinter einem Ladentisch stand die Verkäuferin und fragte die Kundinnen, was sie brauchten. Sie holte das Verlangte aus grossen Schubladen und packte es in Papier ein.
In der Stadt Bern existierte ein einziger Migrosladen. Je nach Arbeitgeber war es den Mitarbeitern nicht gestattet, bei der Migros einzukaufen. Mein Vater, der bei der Ovomaltinefirma Wander tätig war, verbot uns streng, die Migros zu betreten. Aber als ich bereits gross genug war, um für die Familie einzukaufen, wollte ich wissen, ob die Waren aus der Migros gleich gut seien wie diejenigen aus den Quartierläden von Frau Lory, von Bäckersfrau Klöti, Metzger Schnyder, Gemüsefrau Binggeli, Drogist Guggisberg und aus dem Tante-Emma-Laden von Fräulein Bienz. Mama nahm mich mit in die Stadt und pflegte sich in der Nähe der Migros hinter einer Säule zu verstecken. Ich schaute mich vorsichtig um und wenn ich keine Kundinnen kannte, schlich ich mich klopfenden Herzens in die Migros. Dass die ersten Skier meines Lebens aus der Migros stammten, hat mein Vater nie erfahren.
Besondere Lebensmittel wie Reis führten weder das Konsum noch die Migros. Für solche Herrlichkeiten begab man sich in den Kolonialwarenladen oder in die Drogerie. Der Drogist stieg dann auf eine Leiter und holte eine grosse Büchse herunter und mit einem kleinen Schäufelchen beförderte er die Reiskörner auf die Waage.
Der Drogist, das Molkereiehepaar, die Metzger- und Bäckersleute sowie Fräulein Bienz aus dem Tante-Emma-Laden wohnten im selben Haus, in welchem sich ihr Geschäft befand.