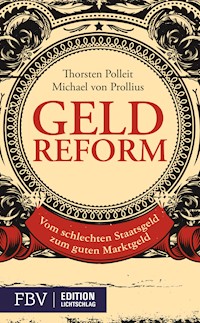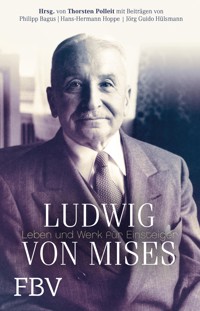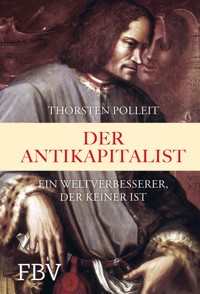21,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FinanzBuch Verlag
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
Alle wichtigen Währungen der Welt sind heutzutage Fiatgeld. Schon Johann Wolfgang von Goethe hat in seinem Werk Faust hellsichtig das volkswirtschaftliche Übel dieses ungedeckten Geldes offenbart: einer Geldart, die für Schein, Lug und Trug und Zerstörung steht. Thorsten Polleit erläutert zeitlose geldtheoretische Erkenntnisse über Fiatgeld: Warum und auf welche Weise der Staat das Geld für seine Zwecke monopolisiert, und wieso das am Ende jeden von uns angeht – denn Fiatgeld weist eklatante ökonomische und ethische Defekte auf. Es verursacht Inflation, löst Finanz- und Wirtschaftskrisen us, treibt Volkswirtschaften in die Überschuldung. Thorsten Polleit legt Ihnen in seinem Buch aber nicht nur eine Analyse der Defizite des vorherrschenden Geldsystems dar, er stellt auch eine Lösung vor, weist den Weg aus dem faustischen Fiatgeld-Pakt, und zwar durch Schaffen eines freien Marktes für Geld. Es ist ein konstruktiver Beitrag, um mit besserem Geld eine bessere Welt zu schaffen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 469
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Thorsten Polleit
Des Teufels Geld
Für
Ruth Victoria H. A. E.
Patricia S. E. T.
Leopold A. K. F.
Thorsten Polleit
Des Teufels Geld
Der faustische Fiatgeld-Pakt – wie wir ihn kündigen und zu gutem Geld zurückkehren
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie. Detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
Für Fragen und Anregungen:
Wichtiger Hinweis
Ausschließlich zum Zweck der besseren Lesbarkeit wurde auf eine genderspezifische Schreibweise sowie eine Mehrfachbezeichnung verzichtet. Alle personenbezogenen Bezeichnungen sind somit geschlechtsneutral zu verstehen.
Originalausgabe, 1. Auflage 2023
© 2023 by FinanzBuch Verlag,
ein Imprint der Münchner Verlagsgruppe GmbH
Türkenstraße 89
D-80799 München
Tel.: 089 651285-0
Fax: 089 652096
Alle Rechte, insbesondere das Recht der Vervielfältigung und Verbreitung sowie der Übersetzung, vorbehalten. Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form (durch Fotokopie, Mikrofilm oder ein anderes Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung des Verlages reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme gespeichert, verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden. Wir behalten uns die Nutzung unserer Inhalte für Text und Data Mining im Sinne von § 44b UrhG ausdrücklich vor.
Redaktion: Anja Georgia Graw
Korrektorat: Anke Schenker
Umschlaggestaltung: Pamela Machleidt, München
Umschlagabbildung: World History Archive/Alamy Stock Foto
Satz: ZeroSoft, Timisoara
eBook: ePUBoo.com
ISBN Print 978-3-95972-743-3
ISBN E-Book (PDF) 978-3-98609-442-3
ISBN E-Book (EPUB, Mobi) 978-3-98609-443-0
Weitere Informationen zum Verlag finden Sie unter
www.finanzbuchverlag.de
Beachten Sie auch unsere weiteren Verlage unter www.m-vg.de
Mephistopheles
Ich bin der Geist der stets verneint!
1338
Und das mit Recht; denn alles was entsteht
Ist wert dass es zugrunde geht;
1340
Drum besser wär’s dass nichts entstünde.
So ist denn alles was ihr Sünde nennt,
Mein eigentliches Element.
…
Mephistopheles
Wo fehlt’s nicht irgendwo auf dieser Welt?
4890
Dem dies, dem das, hier aber fehlt das Geld.
Vom Estrich zwar ist es nicht aufzuraffen;
Doch Weisheit weiß das Tiefste herzuschaffen.
In Bergesadern, Mauergründen
Ist Gold gemünzt und ungemünzt zu finden,
4895
Und fragt ihr mich, wer es zutage schafft:
Begabten Manns Natur- und Geisteskraft.
…
Kaiser
Ich habe satt das ewige Wie und Wenn.
4926
Es fehlt an Geld, nun gut, so schaff’ es denn.
…
Mephistopheles
Ich schaffe, was ihr wollt, und schaffe mehr;
4927
…
Kanzler
So hört und schaut das schicksalsschwere Blatt,
6055
Das alles Weh in Wohl verwandelt hat.
Er liest. »Zu wissen sei es jedem, der’s begehrt:
Der Zettel hier ist tausend Kronen wert.
Ihm liegt gesichert, als gewisses Pfand,
Unzahl vergrabnen Guts im Kaiserland.
Nun ist gesorgt, damit der reiche Schatz,
Sogleich gehoben, diene zum Ersatz.«
…
Kaiser
Und meinen Leuten gilt’s für gutes Gold?
6083
Dem Heer, dem Hofe gnügt’s zu vollem Sold?
…
Mephistopheles
Ein solch Papier, an Gold und Perlen Statt,
Ist so bequem, man weiß doch, was man hat;
Man braucht nicht erst zu markten, noch zu tauschen,
6120
Kann sich nach Lust in Lieb’ und Wein berauschen.
Will man Metall, ein Wechsler ist bereit,
Und fehlt es da, so gräbt man eine Zeit.
Pokal und Kette wird verauktioniert,
Und das Papier, sogleich amortisiert,
6125
Beschämt den Zweifler, der uns frech verhöhnt.
Man will nichts anders, ist daran gewöhnt.
So bleibt von nun an allen Kaiserlanden
An Kleinod, Gold, Papier genug vorhanden.
…
6130
Mephistopheles
Auf meinem Zuge blieb mir nicht verborgen:
10242
Der gute Kaiser schwebt in großen Sorgen.
Du kennst ihn ja. Als wir ihn unterhielten,
Ihm falschen Reichtum in die Hände spielten,
Da war die ganze Welt ihm feil.
Denn jung ward ihm der Thron zuteil,
Und ihm beliebt’ es, falsch zu schließen,
Es könne wohl zusammengehn
Und sei recht wünschenswert und schön:
Regieren und zugleich genießen.
…
Indes zerfiel das Reich in Anarchie,
10260
Wo groß und klein sich kreuz und quer befehdeten
Und Brüder sich vertrieben, töteten,
Burg gegen Burg, Stadt gegen Stadt,
Zunft gegen Adel Fehde hat,
Der Bischof mit Kapitel und Gemeinde;
Was sich nur ansah, waren Feinde.
In Kirchen Mord und Totschlag, vor den Toren
Ist jeder Kauf- und Wandersmann verloren.
Und allen wuchs die Kühnheit nicht gering;
Denn leben hieß sich wehren. – Nun, das ging.
Johann Wolfgang von Goethe, Faust. Der Tragödie Erster Teil, S. 39; und Faust. Der Tragödie Zweiter Teil, S. 10–11, S. 42–44, S. 164–165, Philipp Reclam jun., Stuttgart, 2001.
Inhalt
Einleitung
Kapitel 1: Was man über das Geld wissen muss
Was Geld ist, und welche Funktion(en) es hat
Unsicherheit und Geld
Über den Wert des Geldes
Geld misst keine Werte
Die optimale Geldmenge
Über Geldarten
Bimetallismus, das Greshamsche Gesetz
Geld in der Wirtschaftsrechnung
Die friedensstiftende Wirkung des Geldes
Zur Geldentstehung
Kapitel 2: Die Kaufkraft des Geldes und das Übel der Inflation
Kaufkraft des Geldes
Die Änderung der Kaufkraft des Geldes
Stabile Preise bedeuten nicht Stabilität
Inflation und Inflationstheorien
Cantillon-Effekt
Vermögenspreisinflation – die übersehene Inflation
Inflation ist immer schädlich
Die deutsche Hyperinflation
Kapitel 3: Die jüngste Geldgeschichte – und was wir von ihr lernen können
Phase I: Der klassische Goldstandard 1816–1914:
Phase II: Der Erste Weltkrieg und danach, 1914–1926
Phase III: Der Gold-Devisen-Standard, 1926–1931
Phase IV: Schwankende Fiat-Währungen, 1931–1945
Phase V: Der US-Dollar-Devisen-Standard, 1945–1971
Phase VI: Das Ende von Bretton Woods, das US-Dollar-Regime, 1971 bis 2022
Phase VII: Das globale Fiat-Geldregime im Jahr 2023
Kapitel 4: Das Interesse des Staates am Geld
Entstehung des Staates (wie wir ihn heute kennen)
Der Staat will ungedecktes Geld
Wie der Staat an das Geldmonopol gelangt (ist)
Geld ist kein öffentliches Gut
Staat und Zentralbank – eine kurze Geschichte
Der Schein der politisch unabhängigen Zentralbanken
Staat, Krieg und Geld
»Moderne Monetäre Theory« (MMT)
Der Great Reset
Kapitel 5: Was man über den Zins wissen muss
Der Zins, ein umstrittenes Phänomen
Zeitpräferenztheorie des Zinses
Zinsbildung im Markt
Zeitpräferenz und Urzins können nicht verschwinden
Urzins, Nominalzins, Realzins
Zinskontrolle und finanzielle Repression
»Einheits«-Urzins
Zins und menschliches Werten und Handeln
Kapitel 6: Warum Fiatgeld schlechtes Geld ist
Cheerleader des Fiatgeldes
Wie die Gelderzeugung aus dem Nichts abläuft
Boom und Bust
Weitere Übel des Fiatgeldsystems
Fiatgeld und kollektive Korruption
Gegen Bargeld und die Tyrannei des digitalen Zentralbankgeldes
Welt-Fiatgeld – eine Dystopie
Kapitel 7: Gutes Geld ist möglich
Am Anfang steht die Aufklärung
Notwendigkeit für und Anforderung an eine Geldreform
Ein freier Markt für Geld
Bankfreiheit in der Praxis
Zur Idee der Parallelwährung
Zukunft des Goldgeldes
Bitcoin & Co: Ergänzung oder Alternative?
Kapitel 8: Zurück zu gutem Geld
Krisenszenarien im Fiatgeldsystem
Den Übergang meistern
Ludwig von Mises: Rückkehr zum Goldstandard
Friedrich August von Hayek: Entnationalisierung des Geldes
Murray N. Rothbard: Golddeckung des US-Dollar
George Reisman: Sanfte Rückkehr zum Goldgeld
Jesus Huerta de Soto: Schrittweise zum freien Marktgeld
Politische Initialzündung: Kehrt Amerika zum Goldstandard zurück?
Ein Reformvorschlag, um die Härten des Übergangs abzumildern
Lehrstück aus der Geldgeschichte: Die Renaissance der »Mark Banco«
Das Unvermeidliche: Kosten der Abkehr vom Fiatgeld
Kapitel 9: Zum Abschluss
Anmerkungen
Einleitung
»Es war die Art zu allen Zeiten,
Durch Drei und Eins, und Eins und Drei
Irrtum statt Wahrheit zu verbreiten.«
Johann Wolfgang von Goethe
Die Dichtung Faust. Eine Tragödie ist nicht nur das Lebens- und Hauptwerk von Johann Wolfgang von Goethe (1749–1832). Es ist über Generationen hinweg gewissermaßen auch das Lieblingsbuch der Deutschen – dafür spricht etwa, dass der Verlag Philipp Reclam jun. am 9. November 1867 seine Universalbibliothek mit den Bändchen Goethe.Faust. Erster Theil und Goethe. Faust. Zweiter Theil eröffnet hat; und so konnte der Faust gewissermaßen volkstümlich als Schullektüre eingeführt werden.1 Die Faszination von Goethes Faust war und ist groß. 1847 schrieb Heinrich Heine (1797–1856): »Vielleicht hat die Legende von Johannes Faustus deshalb einen so geheimnisvollen Reiz für unsere Zeitgenossen, weil sie hier so naiv und faßlich den Kampf dargestellt sehen, den sie selber jetzt kämpfen, den modernen Kampf zwischen Religion und Wissenschaft, zwischen Autorität und Vernunft, zwischen Glauben und Denken, zwischen demütigem Entsagen und frecher Genußsucht – ein Todeskampf, wo uns am Ende vielleicht ebenfalls der Teufel holt wie den armen Doktor… .«2
Im Faust werden das menschliche Irren und Streben zur Sprache gebracht, so wie es Goethes Menschenbild entspricht, sie bestimmen die innere Einheit des Handlungsablaufes der Tragödie. In geradezu bestechend kundiger Weise thematisiert Goethe dabei unter anderem auch in seinem Faust. Der Tragödie zweiter Teil die wirtschaftlichen und politischen Probleme des ungedeckten Geldes, oder: des Fiatgeldes. Und zwar, indem der teuflische Mephistopheles den nach Wahrheit strebenden Faust auch zum Hofe des Kaisers führt. Das Volk des Kaisers ist missmutig, der Kaiser ist knapp bei Kasse, ihm fehlt es schlichtweg an Geld. Mephistopheles empfiehlt ihm, sich durch die Ausgabe von offiziell gestempeltem Papier neues Geld zu beschaffen, Papiergeld, das durch die von Mephistopheles herbeigeredeten Goldschätze, die sich angeblich im Boden des Kaiserreiches befänden, gedeckt sei. Gesagt, getan, der Kaiser ist genusssüchtig. Die Ausgabe von diesem ungedeckten, neuen Geld finanziert einen Karneval. Doch der Trick geht nicht auf, am Ende versinkt des Kaisers Reich in Chaos, Mord und Totschlag.
Goethe hat damit in seinem Faust eine meisterhafte Anschauung gegeben für das Geld, das heute überall verwendet wird: ungedecktes Geld, Fiatgeld. Und weil Goethes dichterische Meisterleistung so treffend und (wissenschaftlich) wahr genau an dieser Stelle ist, lautet der Titel dieses Buches auch Des Teufels Geld – denn die Schaffung und Ausgabe eines ungedeckten Geldes ist im wahrsten Sinne des Wortes eine Idee des Teufels. Der Untertitel des Buches Der faustische Fiatgeld-Pakt: wie wir ihn beenden und zu gutem Geld zurückkehren erklärt sich folgendermaßen: Faust schließt einen Pakt mit Mephistopheles. Er schwört seiner Wissenschaft ab, will fortan sich nicht mehr der Erkenntnis, sondern der Erfahrung des sinnlichen Lebens widmen, und Mephistopheles will Faust, der »Vom Wissensdrang befreit« (1768), »der Erden Freuden« (1859) vermitteln – ein Pakt, in dem Mephisto versucht, Faust, den Menschen, in das Nichts zu führen, »diesen Geist von seinem Urquell« abzuziehen, wie es im Prolog heißt (324). Mephistopheles verliert jedoch am Ende die »Wette«, er ist der Verlierer des Paktes.
Heutzutage sind alle wichtigen Währungen der Welt – ob US-Dollar, Euro, Chinesischer Renminbi, Japanischer Yen, Britisches Pfund oder Schweizer Franken – Fiatgeld, sie entsprechen also dem ungedecktem Geld (dem »Papiergespenst der Gulden« (6195), das Mephistopheles im Faust dem Kaiser empfiehlt; das den Menschen zwar anfänglich trügerisch Erfreuliches, letztlich aber großes Unheil, den Zusammenbruch bringt und auch den Kaiser, den Herrscher, ruiniert. Dass Goethe in seinem Faust die Idee des ungedeckten Geldes, des Fiatgeldes, des mephistophelischen Geldes, keinesfalls fehlinterpretiert oder gar überdramatisiert, soll dieses Buch aufzeigen, und dass Goethe die schädlichen Folgen des Fiatgeldes im Zweifel noch unterschätzt hat. Denn das moderne Fiatgeld hat überaus weitreichende Konsequenzen, die über das, was in Goethes literarischem Meisterwerk sehr weitsichtig zur Sprache kommt, sogar hinausgehen.
Im Fiatgeld liegen, und Mephistopheles wusste das natürlich nur zu gut, zivilisatorisch-zerstörerische Kräfte verborgen. Das Fiatgeld sorgt nicht nur für wirtschaftliche Störungen, für Überkonsum und Fehlinvestitionen, Inflation, Boom und Bust sowie Finanz- und Wirtschaftskrisen, es erleichtert auch die Kriegsführung. Es schlägt zudem breite Teile der Bevölkerung in seinen Bann, macht sie geradezu abhängig, lässt sie zu unbeirrten Befürwortern einer Fortführung des Fiatgeldsystems werden. Doch das Fiatgeld ist nicht vereinbar mit einer freien Wirtschafts- und Gesellschaftsordnung. Es ist vielmehr ein sicheres Mittel, um Volkswirtschaften auf Abwege zu bringen, sie wegzuführen von Freiheit und Wohlstand, ihnen Unfreiheit und letztlich auch Verarmung zu bringen.
Dieses Buch soll nicht nur die Probleme eines faustischen Geldregimes zutage fördern. Es soll auch Auswege aus dem unheilvollen Fiatgeld-Pakt weisen. Dazu ist es jedoch erforderlich, das Wesen des Geldes zu (er-)kennen, die Entstehung des heutigen Fiatgeldsystems zu verstehen und seine wirtschaftlichen und politischen Konsequenzen abschätzen zu können. Eine Fort- und Weiterentwicklung meines Buches Geldreform. Vom schlechten Staatsgeld zu gutem Marktgeld3, veröffentlicht im Jahr 2014, schien mir der geeignete Ansatz dafür zu sein. Der ungezügelte weltweite Verschuldungsaufbau und vor allem die Machtausweitung der Staaten im Zuge des Great Reset, der Coronavirus-Krise sowie der Pläne, digitales Zentralbankgeld einzuführen, haben es aus meiner Sicht notwendig gemacht, die besondere Rolle des Fiatgeld-Regimes in Verbindung mit der verstärkten Abkehr von der freien Wirtschaftsund Gesellschaftsordnung (beziehungsweise dem wenigen, was davon noch übrig ist) neu zu thematisieren und Lösungen zu präsentieren.
Es sei in dieser Einleitung herausgehoben, dass die in diesem Buch vorgestellten Erkenntnisse auf einem denkbar rigorosen erkenntnistheoretischen Fundament stehen beziehungsweise ihm entstammen: der Logik des menschlichen Handelns. In diesem Buch wird die Volkswirtschaftslehre einschließlich der Geldtheorie nicht als Erfahrungswissenschaft, sondern als logische (genauer: apriorische) Handlungswissenschaft konzeptualisiert. Das heißt, die Theorien und Gedankengänge, die in den Kapiteln dieses Buches ausgebreitet werden, sind handlungslogisch abgeleitet und fortgeführt.4 Dieser Hinweis erscheint mir wichtig: Denn wer die Volkswirtschaftslehre als handlungslogische Wissenschaft versteht, der gelangt zuweilen zu ganz anderen Erkenntnissen, als wenn die Volkswirtschaft als Erfahrungswissenschaft gesehen wird, wie heute oft üblich.
In den letzten Jahren des Nachdenkens bin ich mehr denn je zu der Ausfassung gekommen, dass der erfolgreiche Weg zu gutem Geld nicht allein die Verbreitung der richtigen ökonomischen Erkenntnisse ist, sondern dass es vielmehr einer tiefergehenden, umfassenden »neuen Aufklärung« bedarf: Wollen die Menschen ihr Leben und das ihrer Mitmenschen verbessern, dann müssen sie ihre Furcht besiegen und auch ihre Faulheit ablegen und selbst denken. Sie müssen, wie der Königsberger Philosoph der Aufklärung Immanuel Kant (1724–1804) sagte, ihre selbst verschuldete Unmündigkeit überwinden.
Dazu gehört zu erkennen, dass viele der heutzutage akzeptierten und hingenommenen und nicht selten auch lieb gewonnenen Glaubenssätze unbegründbar, ja falsch sind. Beispielsweise hat niemand – ob Feudalherr, König, Kaiser oder Menschenmehrheit – das Recht, über andere zu herrschen. Oder: Der Staat (wie wir ihn heute kennen) ist ganz und gar unvereinbar mit dem handlungslogisch unstrittig begründbaren Selbsteigentum des Individuums, seinem Selbstbestimmungsrecht. Es gibt des Weiteren keine überzeugende ökonomische oder ethische Begründung, warum der Staat das Geld, das allgemein akzeptierte Tauschmittel, monopolisieren sollte. Im Gegenteil: Monopolisiert der Staat das Geld, bleibt der wirtschaftliche und kulturelle Fortschritt der Menschheit unter Potenzial, ja die Volkswirtschaften steigen ökonomisch und kulturell ab.
Für wen ist dieses Buch geschrieben? Das Buch richtet sich an alle, die das Funktionieren des heute überall auf der Welt anzutreffenden Fiatgeld-Systems verstehen wollen: Wie es entstanden ist, welche wirtschaftlichen, sozialen und politischen Konsequenzen es hat, wohin es uns führt und vor allem, welche Alternative(n) es dazu gibt. Es ist also geschrieben für alle, die sich für das Phänomen Geld interessieren und deren Erkenntnisdrang mit dem Studieren der gängigen Lehrbuchdarstellung nicht gestillt ist; für alle, die zeitlose Erkenntnisse über das Geld und seine wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Wirkungen suchen. Dazu zählen interessierte Laien, fortgeschrittene Geldtheoretiker, Investoren, Lehrende und insbesondere auch ihre Studenten. Und damit möglichst viele Menschen dieses Buch mit Gewinn lesen können, habe ich mich bemüht, alles so einfach wie möglich darzulegen. Dass mir dies gelungen ist, hoffe ich.
Das Buch ist wie folgt gegliedert: Im ersten Teil geht es um alles, was man über das Geld unbedingt wissen sollte: seine Funktion(en), Unsicherheit und Geld, die Wertbestimmung des Geldes, die »optimale Geldmenge«, es geht um Geldarten, den Einsatz des Geldes in der Wirtschaftsrechnung, die friedensstiftende Wirkung des Geldes und die Geldentstehung.
Der zweite Teil dreht sich um die Kaufkraft des Geldes und die Inflation. Die Bestimmungsgründe und die Veränderung der Kaufkraft werden erklärt, und es wird aufgezeigt, dass stabile Güterpreise nicht per se einen stabilen Geldwert bedeuten. Die Inflationstheorien und die Schädlichkeit der Inflation werden erläutert, und die deutsche Hyperinflation ab 1922 bis 1923 wird nachgezeichnet.
Ein Blick in die jüngere Geldgeschichte, und was man aus ihr lernen kann, ist das Thema des dritten Teils. Beginnend mit der Zeit des klassischen Goldstandards (1816–1914) geht es zur Phase des Ersten Weltkrieges bis Mitte der 1920er-Jahre (1914–1926), zur Phase des Gold-Devisen-Standards (1926–1931), dann zur Phase schwankender Fiatwährungen (1931–1945), zum US-Dollar-Devisen-Standard (1945– 1968), zum Ende des Systems von Bretton Woods im Jahr 1971 und abschließend zum gegenwärtigen globalen Fiatgeldsystem.
Die Zusammenhänge zwischen Geld und Staat (wie wir ihn heute kennen) sind Gegenstand des vierten Teils. Auf eine kurze theoretische Erklärung zur Entstehung des Staates folgend wird dargelegt, warum der Staat ungedecktes Geld wünscht und wie er es bekommt. Es wird darauf hingewiesen, dass Geld kein öffentliches Gut ist, wie die staatlichen Zentralbanken entstanden sind und welcher Zusammenhang zwischen Staat, Krieg und Geld besteht. In diesem Teil des Buches wird auch die Modern Monetary Theorie (MMT) kritisch betrachtet, und die dem Great Reset unterliegenden Ideen werden vorgestellt.
Der fünfte Teil ist dem Zins gewidmet. Um das Zinsphänomen vollumfänglich zu erklären, wird auf die Zeitpräferenztheorie des Zinses abgestellt. Der Zusammenhang zwischen Nominalzins, Realzins und Urzins wird herausgearbeitet, die Folgen, die die »Zinskontrollpolitik« und die »finanzielle Repression« der Zentralbanken haben, werden vorgestellt, und abschließend wird diskutiert, wie Zins und Werten und Handeln der Menschen zusammenhängen.
Warum Fiatgeld schlechtes Geld ist, wird im sechsten Teil erläutert. Er beginnt mit einigen Argumenten, die die »Cheerleader des Fiatgeldes« üblicherweise vorbringen. Erklärt wird, wie die Geldschöpfung aus dem Nichts funktioniert, wie es zu Boom und Bust kommt, dass Dauerschuldnerei und Überschuldung im Fiatgeldsystem an der Tagesordnung sind. Weitere Übel des Fiatgeldes werden genannt, etwa wie das Fiatgeld zu »kollektiver Korruption« führt. Es folgen kritische Bemerkungen zum Vorhaben, digitales Zentralbankgeld auszugeben, und die Dystopie eines Welt-Fiatgeldes wird thematisiert.
Dass gutes Geld möglich ist, wird im siebten Teil dargelegt. Die Notwendigkeit einer »neuen Aufklärung« wird betont, Anforderungen an gutes Geld werden aufgezeigt und ebenso die notwendigen Grundlagen einer Geldreform. Das Funktionieren eines freien Marktes für Geld wird erklärt sowie das der Bankfreiheit. Diskutiert werden die Idee der Parallelwährung, der Zukunft des Goldgeldes und des Bitcoin.
Der Weg zurück zu gutem Geld, wie er im achten Teil gewiesen wird, beginnt mit einer Skizzierung der Krisenszenarien, die das Fortführen des Fiatgeldes sehr wahrscheinlich herbeiführen werden. Wie die Rückkehr zu einem freien Markt für Geld gelingen kann, dazu werden fünf Empfehlungen aus der ökonomischen Literatur vorgestellt, nämlich Ludwig von Mises: Rückkehr zum Goldstandard; Friedrich August von Hayek: Entnationalisierung des Geldes; Murray N. Rothbard: Golddeckung des US-Dollar; George Reisman: Sanfte Rückkehr zum Goldgeld; Jesus Huerta de Soto: Schrittweise zum freien Marktgeld. Zudem wird hier ein eklektischer Vorschlag präsentiert, der die Kosten des Übergangs zum freien Marktgeld abmildern kann. Und zuletzt wird anhand der Hamburger »Mark Banco« ein währungshistorisches Beispiel aufgeführt, das höchst aufschlussreich ist, um sich ein Bild über das Funktionieren eines freien Marktes für Geld zu machen.
Im neunten Teil wird der Blick nach vorn gerichtet: dass gutes Geld möglich und erreichbar ist, dass es eine gute Welt in Aussicht stellt, eine produktive(re) und friedvolle(re) Welt, die aber durch ein Festhalten am Fiatgeld, am Fiatgeld-Pakt, nicht nur unerreichbar bleibt, sondern in immer weitere Ferne rückt. Zurück zu gutem Geld zu gelangen ist möglich, und dazu braucht es tatsächlich nicht viel, im Grunde »nur« eine »neue Aufklärung«.
Mein aufrichtiger Dank gilt allen, die direkt oder indirekt, die wissentlich oder unwissentlich zur Entstehung dieses Buches beigetragen haben. Insbesondere danke ich (in alphabetischer Ordnung): Professor Dr. Philipp Bagus (Universität Rey Juan Carlos, Madrid), Professor Dr. Ansgar Belke (Universität Duisburg-Essen [1965–2020]), Professor Dr. Paul F. Cwik (University of Mount Olive, North Carolina), Prof. Dr. Michael Esfeld (Universität Luzern, Schweiz), Malte Fischer (Wirtschaftswoche), Dr. David Gordon (Ludwig von Mises Institute, Auburn, Alabama), Professor Ph. D. David Howden (Saint Louis University, Madrid), Professor Dr. Jörg Guido Hülsmann (Universität Anger, Frankreich), Professor Dr. Hans-Hermann Hoppe (Property and Freedom Society, Bodrum, Türkei), Olivier Kessler (Liberales Institut Zürich), Dr. Markus Krall (Atlas Initiative), Professor Dr. Martin Leschke (Universität Bayreuth), Andreas Marquart (Ludwig von Mises Institut Deutschland), Professor Dr. Antony Müller (Federal University of Sergipe, Brasilien), Dr. Michael von Prollius (Forum Freie Gesellschaft), Professor Dr. Rolf W. Puster (Universität Hamburg), Dr. Andreas Tiedtke (Ludwig von Mises Institut Deutschland), Lew Rockwell, Jr. (Ludwig von Mises Institute, Auburn, Alabama), Joseph T. Salerno (Pace University, New York), meinen Eltern Dr. Horst Polleit (1934–2018) und Anita Polleit (geb. Veltins). Ganz besonders danke ich meiner Frau Dr. Ruth Polleit Riechert für ihre unbedingte Unterstützung und unerschütterliche Liebe. Ohne sie wäre dieses Buch nicht entstanden. Dass dieses Buch im Handel verfügbar ist, dafür danke ich ausdrücklich Frau Isabella Steidl und Herrn Georg Hodolitsch vom FinanzBuch Verlag. Alle verbliebenen Unzulänglichkeiten, die diese Schrift haben mag, sind ausschließlich mir anzulasten.
Thorsten Polleit, Königstein i. T., Juli 2023.
Kapitel 1
Was man über das Geld wissen muss
»Es ist vielleicht kein Teil der volkswirtschaftlichen Disziplin so sehr mit der Gesamtheit der Volkswirtschaftslehre verwachsen, wie die Lehre vom Geld.«
Karl Helfferich (1872–1924)
Was Geld ist, und welche Funktion(en) es hat
Die moderne, entwickelte Volkswirtschaft zeichnet sich dadurch aus, dass Güter und Dienstleistungen durch Verwendung von Geld ge- und verkauft werden; man spricht daher hier auch von Geldwertwirtschaft.1 Geld ist das allgemein akzeptierte Tauschmittel. Es ist kein Konsumund auch kein Produktionsgut. Vielmehr ist es ein Gut eigener Art (sui generis), wie es der deutsche Ökonom Carl Gustav Adolf Knies (1821– 1898) einordnete: Das Geld ist das Tauschmittel.2
Die Tauschmittelfunktion ist die einzige Funktion, die Geld ausübt. Das ist eine sehr wichtige Erkenntnis, vor allem deshalb, weil dem Geld üblicherweise noch weitere Funktionen zugeschrieben werden: vor allem die Recheneinheits- und die Wertaufbewahrungsfunktion. Doch bei genauer Überlegung zeigt sich, dass die Recheneinheits- und die Wertaufbewahrungsfunktion des Geldes nicht eigenständige Funktionen, sondern Unterfunktionen der Tauschmittelfunktion des Geldes sind.3
Die Tauschmittelfunktion ist die unmittelbar ersichtliche Funktion des Geldes: Eine Ware wird zunächst gegen Geld getauscht, und das erhaltene Geld wird sodann gegen die letztlich gewünschte Ware eingetauscht. Mit der Verwendung von Geld zum Tauschen erweitern sich die Tauschmöglichkeiten für die Menschen ganz erheblich gegenüber den Möglichkeiten, die eine Naturaltauschwirtschaft bietet, also eine Volkswirtschaft, in der nur (Nicht-Geld-)Güter gegen andere (Nicht-Geld-)Güter getauscht werden.
Die Recheneinheitsfunktion bedeutet, dass die Güterpreise in Form eines Gutes, nämlich des Geldes, ausgedrückt werden. Kostet beispielsweise ein Apfel 1 Euro und eine Birne 2 Euro, so bedeutet das, dass zwei Äpfel im Tausch gegen eine Birne aufzuwenden sind; dass sich also eine halbe Birne gegen einen Apfel eintauschen lässt. Das Rechnen in Geldpreisen macht das Tauschen einfacher: Es vermindert die Anzahl der Tauschrelationen zwischen den Gütern, die man kennen muss, um richtige Entscheidungen treffen zu können. Die Kosten des Handelns nehmen ab. Geld ist so gesehen ein wahrer produktiver Segen.
Produktive Wirkung des Geldes
Man nehme einmal an, es gäbe vier Güter in der Volkswirtschaft.4 Wenn man also die vier Güter X1, X2, X3 und X4 hat, dann hat man es mit sechs Tauschrelationen zu tun:
Gibt es viele Güter in der Volkswirtschaft (sagen wir 100), müsste man 4950 Tauschrelationen kennen, um sinnvolle Kauf- und Verkaufsentscheidungen treffen zu können. Mit der Verwendung einer Recheneinheit sinkt die Zahl der Tauschrelationen, die man kennen muss, auf 99. Die Verwendung von Geld setzt also erhebliche Ressourcen frei, die man ansonsten aufwenden müsste, um sich über die Tauschrelationen zu informieren.
Mit der Wertaufbewahrungsfunktion ist gemeint, dass Geld über einen gewissen Zeitraum hinweg Kaufkraft speichern kann. Die Wertaufbewahrung erlaubt dem Geldhalter, seinen Wünschen entsprechend das Einkommen über die Zeit zu verteilen. Die Wertaufbewahrungsfunktion des Geldes steht damit gewissermaßen für die Tauschfreiheit im Zeitablauf. (Das gilt natürlich nur dann, wenn Geld seine Zahlungsmittelfunktion im Zeitablauf nicht [vollständig] einbüßt.)
Die Recheneinheits- und Wertaufbewahrungsfunktion des Geldes sind, wie gesagt, keine eigenständigen Funktionen des Geldes. Sie sind Ausdruck seiner Tauschmittelfunktion. Die Recheneinheitsfunktion steht unmittelbar für die Tauschmittelfunktion des Geldes, und die Wertaufbewahrungsfunktion bedeutet nichts anderes als die zeitliche Verlagerung des Tauschens von der Gegenwart in die Zukunft. Man kommt zum Ergebnis: Geld hat nur eine Funktion, und das ist die Tauschmittelfunktion. Diese Erkenntnis ist von großer Bedeutung für die Beantwortung der Frage, die häufig gestellt wird: Wie viel Geld braucht eine Volkswirtschaft? Zuvor sollen jedoch noch die Rolle der Unsicherheit für die Geldhaltung sowie die Wertfindung des Geldes erklärt werden.
Unsicherheit und Geld
Wenn die Zukunft sicher wäre, wenn mal also schon heute die Zukunft kennen würde, dann bräuchte man kein Geld zu halten. Gäbe es keine Unsicherheit, könnte man schon heute alles wissen, was künftig geschieht, und sich entsprechend heute schon darauf einrichten. Geld wäre verzichtbar. Dass jedoch die Zukunft für uns handelnde Menschen unsicher ist, ist vermutlich jedem von uns unmittelbar einsichtig. Das menschliche Handeln findet vielmehr unter Unsicherheit statt: Man weiß nicht, wie sich die Menschen künftig verhalten, welche Produkte sie nachfragen, welche neuen Angebote es geben wird, wie sich die eigenen Bedürfnisse entwickeln und anderes mehr. Das Halten von Geld ist ein Weg, um mit der Unsicherheit, die es im Bereich des menschlichen Handelns unbestreitbar gibt, umzugehen:
»Die Unsicherheit der zukünftigen Verhältnisse läßt es jedermann rätlich erscheinen, einen größeren oder geringeren Teil seines Besitzes in einer Form zu erhalten, die den Wechsel der Anlage, den Übergang vom Besitze eines Gutes zu dem eines anderen erleichtert, um sich so die Möglichkeit offen zu halten, künftig etwa auftretenden Bedarf an Gütern, die erst im Austausche gegen andere erworben werden müssen, ohne Schwierigkeiten zu befriedigen. Solange der Marktverkehr noch nicht eine derartige Ausbildung erfahren hat, daß alle oder wenigstens gewisse wirtschaftliche Güter jederzeit zu nicht allzu ungünstigen Bedingungen veräußert, das heißt zu Geld gemacht werden können, kann dieses Ziel nur durch Haltung eines entsprechend großen Geldvorrates erreicht werden.«5
Es sei hier angemerkt, dass es im Bereich des menschlichen Handelns zwar Unsicherheit gibt, dass das aber nicht heißt, dass alles im Bereich des menschlichen Handelns unsicher wäre; die Idee der »radikalen Unsicherheit« – dass alles unsicher ist –, wie sie Ludwig Lachmann (1906–1990) vorgebracht hat, ist nicht schlüssig.6 Das lässt sich mit (handlungs-)logischen Mitteln recht einfach einsehen: Die Aussage »Der Mensch handelt« lässt sich nicht widerspruchsfrei verneinen:7 Wer sagt »Der Mensch handelt nicht«, der handelt und widerspricht dem Gesagten. Wäre die Zukunft tatsächlich (perfekt) sicher, so würde das bedeuten, dass man nicht mehr handeln kann: Der Handelnde könnte den künftigen Gang der Dinge nicht mehr durch sein Handeln beeinflussen, er könnte nicht handeln. Das aber wäre ein (handlungs-) logischer Widerspruch und damit falsch. Unsicherheit ist folglich im Bereich des menschlichen Handelns sprichwörtlich nicht wegzudenken (wenn auch nicht alles unsicher ist), und die Unsicherheit ist auch der entscheidende Grund, warum Menschen Geld halten.
Über den Wert des Geldes
Wie erklärt sich der Wert des Geldes? Eine Antwort auf diese Frage zu finden wird uns einfacher fallen, wenn wir uns zunächst den Wert von einfachen (nicht-Geld-)Gütern vor Augen führen. Ein Gut ist nicht einfach so ein Gut. Vielmehr wird ein Ding, eine Sache, zu einem Gut, wenn der handelnde Mensch es als etwas erkennt, mit dessen Einsatz er seinem Ziel näherkommt, und er ihm daher einen Wert zuweist. Und der Wert eines Gutes liegt sprichwörtlich in den Augen des Betrachters – das macht den Kern der subjektiven Wertlehre aus. Nun lässt sich der Begriff »Wert« allerdings unterschiedlich fassen. Nicht-Geld-Güter haben einen objektiven Gebrauchswert. Er kommt darin zum Ausdruck, dass ein Gut aus technischer Sicht geeignet ist, um ein Ziel des Handelnden zu erreichen. Beispiel: Wasser stillt Durst, es hat einen objektiven Gebrauchswert.
Neben dem objektiven Gebrauchswert gibt es einen subjektiven Gebrauchswert eines Gutes. Er erklärt sich dadurch, dass der Handelnde einem Gut einen Wert beimisst, weil er meint – ob nun richtigerweise oder fälschlicherweise –, mit dem Einsatz des Gutes sein Ziel erreichen zu können. Neben dem objektiven und subjektiven Gebrauchswert gibt es auch einen objektiven und subjektiven Tauschwert. Der objektive Tauschwert eines Apfels kommt in der Menge anderer Güter zum Ausdruck, die man für die Hingabe des Apfels bekommt: Herr Müller kann zum Beispiel einen Apfel gegen zwei Birnen tauschen. Der objektive Tauschwert entspricht dem Marktpreis. Der subjektive Tauschwert des Apfels korrespondiert mit dem Nutzen, den die 2 Birnen Herrn Müller stiften.
Bei Konsumgütern zählen vor allem der objektive und subjektive Gebrauchswert, in der Regel jedoch weniger der objektive und subjektive Tauschwert. Beispiel: Für Herrn Müller hat der Apfel einen objektiven Gebrauchswert, weil der Apfel ein Lebensmittel ist und seinen Hunger stillen kann (und das sei hier sein Ziel); und der Apfel hat für ihn auch einen subjektiven Gebrauchswert, weil er die hungerstillende Eignung des Apfels auch tatsächlich erkennt. Ob der Apfel für Herrn Müller nun aber auch einen objektiven oder subjektiven Tauschwert hat, ist in der Regel nicht oder gar nicht bedeutend. Beim Wert des Geldes ist das allerdings anders.
Während bei Konsum- und Produktionsgütern der subjektive Gebrauchs- und subjektive Tauschwert unterschiedliche Dinge sind, fallen beim Geld subjektiver Gebrauchs- und subjektiver Tauschwert zusammen (in der nachstehenden Abb. 1 entspricht Feld (4) Feld (8) – und beide führen auf den objektiven Tauschwert des Geldes zurück.8 Wie erklärt sich das? Der Nutzen des Geldgebrauchs ist untrennbar verbunden mit dem objektiven Tauschwert des Geldes; bei Nicht-Geld-Gütern ist es hingegen meist unerheblich, ob sie einen Tauschwert haben oder nicht. Der objektive Tauschwert des Geldes ist die Anzahl der Güter, die man gegen Hingabe einer Geldeinheit erhält. Der subjektive Tauschwert korrespondiert mit dem subjektiven Nutzen, den die Güter, die der Geldbesitzer für sein Geld eintauschen kann, ihm stiften; und er entspricht dem subjektiven Gebrauchswert des Geldes.
Waren (Nicht-Geld-Gut)
Geld
Objektiver Gebrauchswert
(1) Technische Eignung des Gutes, ein Ziel erreichen zu können
(2) Geld- beziehungsweise Tauschmittelfunktion des Geldes
Subjektiver Gebrauchswert
(3) Subjektiv empfundene Eignung (Nutzen) des Gutes, ein Ziel erreichen zu können
(4) Nutzen, den das Gut stiftet, das man gegen Hingabe von Geld erwirbt
Objektiver Tauschwert
(5) Anzahl der Gütereinheiten, die man im Tausch gegen ein Gut erzielt
(6) Anzahl der Gütereinheiten, die man im Tausch gegen eine Geldeinheit erzielt
Subjektiver Tauschwert
(7) Subjektiv empfundener Nutzen des Gutes, das man gegen sein Gut eintauscht
(8) Nutzen, den das Gut stiftet, das man gegen Hingabe von Geld erwirbt
Abb. 1: Zur Wertbestimmung der (Nicht-Geld-)Güter und des Geldes
Quelle: Eigene Darstellung. Anmerkung: Der subjektive Tauschwert des Geldes korrespondiert mit dem subjektiven Nutzen, den die Güter, die der Geldbesitzer für sein Geld eintauscht, stiften; er entspricht dem subjektiven Gebrauchswert des Geldes.
Wie bereits gesagt: Damit Geld aber überhaupt einen subjektiven Tauschwert haben kann, muss es bereits einen objektiven Tauschwert besitzen. Ohne objektiven Tauschwert kann Geld folglich keinen subjektiven Tauschwert haben. Doch wie erklärt sich das? Die Beantwortung der Frage erfordert die Erklärung des objektiven Tauschwertes des Geldes. Er bestimmt sich durch das Zusammenspiel zwischen Angebot von und die Nachfrage nach Geld. Beispiel: Wenn sie in einen Obstladen gehen, bieten Sie zum Beispiel 1 Euro für eine Birne, und der Obsthändler verkauft ihnen die Birne für 1 Euro. Ihre Nachfrage nach Birnen entspricht dem Geldangebot, und das Angebot der Birne des Obsthändlers entspricht der Geldnachfrage. Der resultierende Preis der Birne – 1 Euro pro Birne – bestimmt die Kaufkraft des Euro.
Doch jetzt stellt sich uns ein ernstes Erklärungsproblem: Sie und ich halten Geld – man kann auch sagen: Sie und ich fragen Geld nach –, weil wir der Auffassung sind, dass Geld bereits Kaufkraft, also einen objektiven Tauschwert hat. Doch haben wird nicht soeben gesagt, dass die Kaufkraft des Geldes bestimmt wird durch das Zusammenspiel zwischen dem Angebot von und der Nachfrage nach Geld. Haben wir es da jetzt nicht mit einem »Huhn-Ei-Problem« zu tun oder, wie Karl T. Helfferich (1872–1924) es beschreibt, einem »Zirkelschluss«? Denn wir sagen nun, man fragt Geld nach, weil es bereits Kaufkraft hat. Aber die Kaufkraft des Geldes wird ja erst dadurch bestimmt, dass es jemand nachfragt (und jemand es anbietet).
Ludwig von Mises löst diesen (vermeintlichen) »Zirkelschluss« auf. Er erklärt, dass wir Geld heute nachfragen, weil es gestern Kaufkraft gehabt hat: Wir haben erfahren, dass kurz zuvor mit Geld gekauft werden konnte. Und gestern haben wir Geld nachgefragt, weil das Geld vorgestern Kaufkraft hatte. Und so weiter. Doch führt diese Erklärung des Wertes des Geldes nicht zu einem ewigen Rückwärtsschreiten, zu einem »infiniten Regress«? Die Antwort ist Nein. Denn wenn wir uns die Erklärung der Kaufkraft des Geldes rückwärtsdenkend erschließen, dann gelangen wir zu einem definitiven »Endpunkt«. Dieser Endpunkt ist der Moment, in dem ein Gut erstmalig als Geld eingesetzt wurde. Es ist der Moment, in dem das Gut erstmalig für monetäre Zwecke eingesetzt wurde. Zuvor wurde das Gut nur für nicht-monetäre Zwecke verwandt, und sein Marktwert erklärte sich allein aufgrund seiner nichtmonetären Dienste.
Mit diesem sogenannten »Regressionstheorem« löst Mises also den »Zirkelschluss« auf, indem er uns erklärt, dass der Tauschwert des Geldes (sein objektiver Tauschwert) eine Zeitdimension hat. Mises informiert uns mit seinem Regressionstheorem darüber, dass Geld aus einem Gut entstanden sein muss, das, bevor es zu monetären Zwecken verwandt wurde, einen Marktwert gehabt haben muss, der nur auf seine nicht-monetären Dienste zurückzuführen ist – und stützt damit die Geldentstehungstheorie von Carl Menger. Daraus folgt weiterhin, dass sich Geld nicht »von oben«, also »ex machina«, einführen lässt. Es muss vielmehr aus dem freien Markt hervorgebracht werden. Es braucht einen Marktwert, der sich allein aufgrund seiner nicht-monetären Dienste erklärt.
Das ist übrigens auch der Grund, warum das heutige Fiat-Geld, ein ungedecktes Geld, nicht natürlich ist: Es konnte nur in die Welt kommen, weil man irgendwann die Eintauschbarkeit von Banknoten und Bankguthaben in das Grundgeld (das Gold) beendet hat – und zwar durch einen höchst unlauteren Akt, nämlich die Enteignung derjenigen, die ihr physisches Gold bei Banken gehalten haben, beziehungsweise diejenigen, die Banknoten und Giroguthaben gehalten haben in der Erwartung, dass man diese – wie versprochen – jederzeit bei den Banken in physisches Gold eintauschen kann.
Der subjektive Tauschwert des Geldes unterliegt – wie der Wert eines jeden anderen Gutes auch – dem Gesetz des abnehmenden Grenznutzens. Das Gesetz des abnehmenden Grenznutzens wurde gegen Ende des 19. Jahrhunderts nahezu zeitgleich, aber unabhängig voneinander von drei Ökonomen erarbeitet: Carl Menger (1840–1921), William Stanley Jevon (1835–1882) und Leon Walras (1834–1910). In der Volkswirtschaftslehre ist es zum allgemein anerkannten Gesetz zur Wert- beziehungsweise Preisbestimmung eines jeden Gutes geworden. Es gilt damit auch für die Wertbestimmung des Gutes Geld. Schließlich ist Geld ein Gut wie jedes andere Gut auch (es zeichnet sich allerdings dadurch aus, dass es das Gut mit der größten Marktfähigkeit ist). Deshalb fällt seine Wertbestimmung ebenfalls unter das Gesetz des abnehmenden Grenznutzens.
Dieses Gesetz besagt: (1.) Ein großer Gütervorrat hat einen höheren (Grenz-)Nutzen als ein kleiner Gütervorrat; und (2.) der Nutzen der zusätzlich erhaltenen Gütereinheit (also der Grenznutzen) nimmt mit steigendem Gütervorrat ab. Ein hoher Geldvorrat, über den ein Handelnder verfügt, wird höher wertgeschätzt als ein kleiner. Geld ist nämlich für den Handelnden ein Mittel, um Ziele zu erreichen. Und je mehr Ziele er erreichen kann, desto höher fällt auch sein Nutzen aus. Die erste Geldeinheit wird dazu verwendet, das drängendste Bedürfnis zu stillen, die zweite Geldeinheit dazu, das nächstdringliche Bedürfnis zu erfüllen – das aber weniger dringlich ist als das zuvor gestillte Bedürfnis. Die dritte Geldeinheit, über die der Handelnde verfügt, stiftet einen geringeren Nutzen als die zweite (und die erste) verfügbare Geldeinheit. Und so weiter. Der Grenznutzen des Geldes nimmt folglich – und (handlungs-)logischerweise – mit einer zunehmenden Zahl von verfügbaren Geldeinheiten ab.
Der subjektive Tauschwert des Geldes bestimmt sich durch den Grenznutzen des Gutes, das gegen Geld getauscht wird. Steigt zum Beispiel die Anzahl der Geldeinheiten auf dem Konto von Herrn Schulze, so nimmt der Grenznutzen des Geldes (das ist der Nutzen, den ihm eine zusätzliche Geldeinheit stiftet) notwendigerweise ab. Das heißt nichts anderes, als dass andere Güter aus Sicht von Herrn Schulze wertvoller werden im Vergleich zu den zusätzlich erhaltenen Geldeinheiten. Das muss das Verhalten von Herrn Schulze beeinflussen. Er wird bereit sein, sein Geld anzubieten (dessen Grenznutzen ja gesunken ist) im Tausch gegen andere Güter (deren Grenznutzen nunmehr gestiegen ist). Das wiederum wird die Preise der Güter ansteigen lassen und die Kaufkraft des Geldes schmälern. Die Kaufkraft des Geldes schwindet hier als Folge einer Geldmengenerhöhung.
Geld misst keine Werte
Der handelnde Mensch bewertet die vorherrschenden und möglichen Zustände. Er schätzt den einen Zustand als besser oder schlechter ein als den anderen, er zieht den einen Zustand vor, den anderen stellt er zurück.9 Das menschliche Handeln reiht und ordnet. Es bedient sich der Ordinalzahlen, nicht der Kardinalzahlen. Ordinalzahlen sind beispielsweise erstes, zweites, drittes. Kardinalzahlen sind eins, zwei, drei etc. Nur die Ordinalzahlen, nicht die Kardinalzahlen stehen für den Ausdruck von Werturteilen im Bereich des menschlichen Handelns zur Verfügung. Durch Werturteile werden die in Betracht kommenden Gegenstände gereiht und geordnet – als besser oder schlechter, als mehr oder weniger –, und zwar nach ihrer Fähigkeit, ein subjektiv empfundenes Unbefriedigtsein des Handelnden abzustellen.
Häufig ist jedoch zu hören, dass der Preis – also das in Geld ausgedrückte Tauschverhältnis zwischen Geldeinheiten und Gut – den Wert des Gutes misst – sich also als Kardinalzahl (beziehungsweise kardinale Nutzenzahl) ausdrücken lässt. Doch das ist ein Irrtum, wie folgendes Beispiel zeigt. Herr Meier kauft beim Obsthändler einen Apfel, für den er 1 Euro bezahlen muss. Ist der Apfel Herrn Meier 1 Euro wert? Nein, der Apfel ist Herrn Meier mehr wert als 1 Euro. Denn Herr Meier tauscht 1 Euro nur dann gegen einen Apfel ein, wenn aus seiner Sicht der Apfel mehr wert ist als 1 Euro. Für den Obsthändler gilt genau das Umgekehrte. Aus seiner Sicht ist 1 Euro mehr wert als der Apfel. Man kann auch nicht sagen, wie viel mehr wert der Apfel ist, den Herr Meier kauft, im Vergleich zum 1 Euro, den er dafür hingibt.
Der Marktpreis eines Gutes – also die Anzahl der Geldeinheiten, die für ein Gut hingegeben werden müssen – bildet also nicht etwa den Wert eines Gutes ab, er misst keine Werte, sondern er zeigt lediglich an, dass zu diesem Preis eine Tauschtransaktion stattgefunden hat; und dass derjenige, der das Geld bezahlt hat, dem dafür erhaltenen Gut einen höheren Wert beigemessen hat als dem dafür hingegebenen Geldbetrag; und dass es sich bei seinem Handelspartner genau umgekehrt verhalten hat, denn dieser schätzte den erhaltenen Geldbetrag höher ein als das Gut, das er dafür hingegeben hat. Es wird zudem mit diesem Beispiel deutlich: Ein freiwilliger Tauschakt ist für alle daran Beteiligten nutzenstiftend!
Die optimale Geldmenge
Die Vertreter der vorherrschenden Volkswirtschaftslehre – die Mainstream-Ökonomen – sind sich darin einig, dass eine wachsende Wirtschaft eine wachsende Geldmenge benötigt. So fordern beispielsweise die Monetaristen als Anhänger der Quantitätstheorie – ihr bekanntester Vertreter ist Milton Friedman (1912–2006), Wirtschaftsnobelpreisträger des Jahres 1976 –, die Geldmenge solle (vereinfachend gesprochen) in Übereinstimmung mit der gesamtwirtschaftlichen Güterproduktion anwachsen. Wächst die Volkswirtschaft zum Beispiel um 3 Prozent pro Jahr (und bliebe die Umlaufgeschwindigkeit des Geldes unverändert, und sollte das Preisniveau unverändert bleiben), so wäre es aus monetaristischer Sicht angemessen, wenn das Geldmengenwachstum ebenfalls 3 Prozent pro Jahr beträgt. Wie ist diese Idee zu beurteilen?
Eine Kritik der Quantitätstheorie
Viele Ökonomen verwenden die Quantitätsgleichung, um den Zusammenhang zwischen den Preisen aufzuzeigen – und darauf aufbauend die richtige Geldmenge abzuleiten. Die Quantitätsgleichung lautet wie folgt:
Dabei steht M für die Geldmenge, V für die Umlaufgeschwindigkeit (die Häufigkeit, mit der eine Geldeinheit [zum Beispiel in einem Monat] für Käufe verwendet wird), Y steht für die Gütermenge und P für die Preise der Güter. Wenn man annimmt, dass die Volkswirtschaft voll ausgelastet ist und dass zugleich die Umlaufgeschwindigkeit konstant ist, so folgt daraus, dass ein Anstieg der Geldmenge zu einem Anstieg der Preise in gleicher Höhe führt: dass also die Güterpreise um 10 Prozent steigen, wenn die Geldmenge um 10 Prozent erhöht wird. Zu diesem Schluss kommt die sogenannte Quantitätstheorie, die genau diese Annahmen macht. Doch das ist eine sehr vereinfachende Theorie. Sie verdeckt wichtige Konsequenzen der Geldmengenvermehrung. Vor allem erweckt sie den Eindruck, die Ausweitung der Geldmenge erhöhe die Güterpreise, treffe also alle Marktakteure in quasi gleicher Weise. Aber das ist nicht der Fall! Dazu die (er-)klärenden Worte von Ludwig von Mises:
»Die Vermehrung des Geldvorrates der Volkswirtschaft bedeutet also stets eine Vermehrung des Geldbesitzes, des Vermögens einer Anzahl von Wirtschaftssubjekten (…). Überdies wird bei diesen Personen das Verhältnis zwischen Geldbedarf und Geldvorrat verschoben; sie haben verhältnismäßig Überfluß an Geld, verhältnismäßig Mangel an anderen wirtschaftlichen Gütern. Die nächste Folge beider Umstände ist die, daß der Grenznutzen der Geldeinheit für die betreffenden Wirtschaftssubjekte sinkt. Das muß ihr Verhalten auf dem Markte beeinflussen. Sie sind »tauschfähiger«, »kaufkräftiger« geworden. Sie müssen nun auf dem Markte ihre Nachfrage nach den Gegenständen ihres Bedarfes stärker zum Ausdruck bringen als bisher; sie können mehr Geld für die Waren bieten welche sie zu erwerben wünschen. Es wird die selbstverständliche Folge davon sein, daß die betreffenden Güter im Preise steigen werden, daß der objektive Tauschwert des Geldes ihnen gegenüber sinkt. Die Preissteigerung auf dem Markte bleibt aber keineswegs auf jene Güter beschränkt, nach denen sich der Begehr der ersten Besitzer des neuen Geldes richtet. Auch diejenigen, die diese Güter zu Markte gebracht haben, sehen ja ihr Einkommen und ihren verhältnismäßigen Geldvorrat vergrößert und sind ihrerseits wieder in der Lage, nach den Gütern ihres Bedarfes eine stärkere Nachfrage zu entfalten, so daß auch diese Güter im Preise steigen. So setzt sich die Preissteigerung, sich dabei verflachend, solange fort, bis alle Waren, die einen in stärkerem, die anderen in schwächerem Maße, von ihr erfasst sind.«10
Abb. 2: Geldmenge und Güterpreise in der Türkei, 2008–2023
Ein illustratives Beispiel für den Zusammenhang zwischen Geldmengenvermehrung und Güterpreisanstieg bieten die letzten etwa 15 Jahre in der Türkei. Wie in Abb. 2 erkennbar, war zwischen der Geldmenge und den Preisen der Konsumgüter ein recht enger und positiver Zusammenhang beobachtbar. Von Januar 2008 bis April 2023 stieg die Geldmenge M3 stark an: Sie wuchs im Jahresdurchschnitt um 23,6 Prozent pro Jahr. Gleichzeitig gingen die Preise der Konsumgüter in die Höhe: Sie legten um 15,4 Prozent pro Jahr im Durchschnitt zu. Dass die Geldmenge stärker stieg, als die Konsumgüterpreise sich verteuerten, kann mehrere Ursachen haben. So werden zum Beispiel in den offiziell ausgewiesenen Konsumgüterpreisindizes nicht alle Güter und deren Preise erfasst, sondern nur ausgewählte. So werden beispielsweise die Vermögenspreise – wie Grundstücks-, Häuser und Unternehmenspreise – nicht oder nur unvollständig erfasst. Die preistreibende Wirkung der Geldmengenerhöhung kann sich folglich in den Vermögenspreisen (also als »Vermögenspreisinflation«) gezeigt haben, und in einem solchen Fall würde der Anstieg der Konsumgüterpreise das wahre Ausmaß des gesamtwirtschaftlichen Preisanstiegs unterzeichnen.
Es sind zwei Annahmen, auf denen die Quantitätstheorie aufbaut: (1.) Die Volkswirtschaft befindet sich auf Vollbeschäftigung und (2.) die Umlaufgeschwindigkeit des Geldes ist konstant, verändert sich nicht im Zeitablauf. Halten wir an (1.) fest und heben wir (2.) auf. Dann kann es sein, dass ein Ansteigen der Geldmenge von, sagen wir, 10 Prozent, keine Preiswirkung entfaltet, und zwar dann nicht, wenn die Geldnachfrage um ebenfalls 10 Prozent steigt. Möglich ist in diesem Zusammenhang aber auch, dass die Güterpreise stärker steigen, als die Geldmenge zunimmt – was der Fall wäre, wenn die Geldnachfrage (als Folge der Geldmengenerhöhung) abnimmt.
Der Gedanke »Die Geldnachfrage ist nicht unabhängig vom Geldangebot« hat einiges für sich. Wenn die Marktakteure beispielsweise fürchten müssen, dass die Zentralbank die Geldmenge stark ausweiten wird und dass das die Güterpreise in die Höhe treibt (und damit die Kaufkraft des Geldes schmälert), dann ist zu erwarten, dass die Geldnachfrage abnimmt relativ zum Geldangebot: Um der Geldentwertung zu entgehen, reduzieren die Menschen ihre Geldhaltung relativ zur Geldmenge. Dazu bieten sie die Geldbeträge, die sie nicht als Kasse zu halten wünschen, im Markt gegen andere Güter an. Die Folge sind höhere Güterpreise (im Vergleich zu einer Situation, in der die Geldmenge nicht ausgeweitet worden wäre).
Damit scheint auch die Vermutung ökonomisch plausibel zu sein, dass in den Ländern, in denen die Zentralbank die Geldmenge immer wieder unerwartet kräftig ausgeweitet und dadurch stark steigende Güterpreise verursacht hat, die Geldnachfrage tendenziell recht stark schwankt und auch im Zeitablauf deutlich rückläufig ist – weil die Menschen das heimische Geld nicht zu Wertaufbewahrungszwecken verwenden, sondern dazu, auf andere Güter setzen (wie ausländische Währungen, Aktien, Häuser, Grundstücke etc.). Beispielsweise betrug die jahresdurchschnittliche Inflation in der Schweiz von 1985 bis Anfang 2023 1,2 Prozent, in Großbritannien 2,8 Prozent. In der Schweiz ging die Geldnachfrage im Betrachtungszeitraum um 36 Prozent zurück, in Großbritannien um 86 Prozent. In dieser Zeit war die Schwankung der Geldmenge in Großbritannien 2,5-mal so hoch wie in der Schweiz.11 Das ist ein Hinweis dafür (wenn auch kein Beweis), dass eine hohe Güterreisinflation und eine relativ stark schwankende Geldmengenvermehrung den Rückgang der Geldnachfrage befördert.
Die Quantitätstheorie in ihrer üblichen Darstellung suggeriert, dass ein Ansteigen der Geldmenge zu einem (Eins-zu-eins-)Anstieg der Güterpreise führt, so gesehen alle Marktakteure gleichermaßen betrifft, dass also alle die Verringerung der Kaufkraft des Geldes gleichermaßen trifft. Doch das ist nicht der Fall! Eine Geldmengenausweitung zieht stets Umverteilungswirkungen nach sich, die unterschiedliche Personen in unterschiedlichem Ausmaß treffen. Einige Gesellschaftsmitglieder profitieren von der Erhöhung der Geldmenge, andere leiden darunter. Warum eine Geldmengenausweitung niemals »neutral« mit Blick auf die Verteilung von Einkommen und Vermögen ist, warum sie mitunter schwere Wirtschaftsstörungen hervorrufen kann, wird nachfolgend noch deutlich werden.
Doch ist eine steigende Geldmenge wirklich eine notwendige Bedingung, damit eine Volkswirtschaft wachsen kann? Ludwig von Mises verneinte diese Frage. Seine Argumente: Anders als bei einem steigenden Konsum- und Produktionsgüterangebot stiftet eine Vermehrung der Geldmenge der Volkswirtschaft keinen Nutzen. Schließlich hat Geld nur eine Funktion: die Tauschmittelfunktion. Wenn die Geldmenge zunimmt, dann hat das zur Folge, dass der Tauschwert des Geldes abnimmt – verglichen mit einer Situation, in der die Geldmenge unverändert geblieben wäre. Diese Schlussfolgerung ruht auf formal-logischen Überlegungen, leitet sich vom Gesetz des abnehmenden Grenznutzens ab.
Die Beantwortung der Frage »Wo liegt die ›optimale Geldmenge‹?« macht einen freien Markt für Geld erforderlich. Das heißt, die Menschen müssen die Freiheit haben, das Geld nachfragen zu können, das ihren Zwecken am besten entspricht. Und Geldanbieter müssen die Freiheit haben, ein Gut anzubieten, dass die Menschen freiwillig als Geld nachzufragen wünschen. Denkbar ist, dass die Menschen ein Gut nachfragen, dessen Menge nicht vermehrbar ist, wie es beispielsweise bei der Cyber-Einheit Bitcoin der Fall ist. Eine konstante (Bitcoin-) Geldmenge wird unweigerlich zu hohen Güterpreisschwankungen und ausgeprägter Güterpreisdeflation führen, anders als eine Geldmenge, die veränderbar ist – wie das beispielsweise bei Gold- oder Silbergeld der Fall wäre.
Denn anders als Gold und Silber – die auch für nicht-monetäre Zwecke nachgefragt werden – hat Bitcoin nur eine Verwendung, und zwar als Tauschmittel zu dienen. Wenn die Menschen (aus welchen Gründen auch immer) also ihre Bitcoin-Haltung zu reduzieren wünschen, dann müssen sie Bitcoin gegen andere Güter anbieten. Die Folge ist, dass die Güterpreise in Bitcoin ausgedrückt (stark) fallen. Eine überschüssige Gold- und Silber-Geldmenge wird hingegen abgebaut, indem die Edelmetalle angeboten und andere Güter nachgefragt werden. Die dadurch abnehmenden Güterpreise erhöhen die Nachfrage nach Gold und Silber für nicht-monetäre Zwecke (Nachfrage nach Schmuck und/ oder für industrielle Produktion) und wirken dem Güterpreisverfall entgegen. Ob die Menschen lieber eine konstante Geldmenge mit stark schwankenden Güterpreisen und starker Güterpreisdeflation oder eine variierbare Geldmenge mit abgemilderten Güterpreisschwankungen und gemäßigter Güterpreisdeflation wünschen, kann nur im freien Markt, nicht vorab und in abstrakter Diskussion entschieden werden.
Macht mehr Geld eine Volkswirtschaft reicher? Oder: Hitlers Geldfälscherplan
Die Auffassung, eine Erhöhung der Geldmenge nütze der Volkswirtschaft, ist heutzutage zwar weit verbreitet, sie ist allerdings falsch. Bei Konsum- und Investitionsgütern gilt, dass ihre Vermehrung den materiellen Wohlstand erhöht. Anders verhält es sich jedoch beim Gut Geld. Eine der vielen historischen Begebenheiten, die das unmissverständlich illustrierten, ist Hitlers Geldfälscherplan. Der Journalist Lawrence Malkin hat sie in seinem 2006 erschienenen Buch Krueger’s Men: The Secret Nazi Counterfeit Plot and the Prisoners of Block 19 (deutscher Titel: Hitlers Geldfälscher) aufbereitet.12 Während des Zweiten Weltkriegs sannen die Nationalsozialisten darüber nach, wie die Kriegskräfte der Alliierten zu schwächen seien. Ein Plan, der bereits am 18. September 1939 im deutschen Finanzministerium vorlag, bestand darin, britische Banknoten zu fälschen und in Umlauf zu bringen. Millionen gefälschter Pfundnoten sollten von der Luftwaffe über Großbritannien abgeworfen, über Straßen und Plätzen verstreut werden. Auf diese Weise sollte das Vertrauen in das britische Pfund, dass damals die Weltleitwährung war, zersetzt werden. Das Ausgeben von gefälschtem britischen Geld würde, so kalkulierten die Nationalsozialisten, Inflation schüren und dadurch die Wirtschaft schädigen. Der Plan sah vor, dass die Geldfälscherei zu einem bestimmten Zeitpunkt öffentlich bekannt werden sollte: Die Nachricht, gefälschte Pfundnoten seien im Umlauf, sollte zum Zusammenbruch, zumindest aber zum schweren Vertrauensverlust in die britische Währung führen. Und sei, so das Kalkül der Geldfälscher, das Vertrauen in das Pfund Sterling erst einmal schwer geschädigt, würde die Kriegsfinanzierung gestört, und letztlich könnte die Deutsche Mark die Weltfinanzmärkte erobern. Die Deutsche Reichsbank wurde mit der Herstellung von gefälschten Pfundnoten beauftragt. Doch das erwies sich als schwieriger als gedacht. Vor allem gelang es nicht, die britischen Banknoten in geeigneter Qualität zu fälschen, und schließlich wurde das ganze Geldfälschungsprojekt aufgegeben. Eine Lehre aus dieser Episode lautet: Die Nationalsozialisten trachteten danach, die britische Geldmenge auszuweiten, nicht zum Nutzen der Briten, sondern zu ihrem Schaden. Sie wussten sehr wohl, dass eine steigende Geldmenge eine Volkswirtschaft nicht reicher macht, sondern dass sie ihr schadet, und zwar auf eine höchst subtile und perfide Art. Die Ironie der Geschichte ist, dass es die extrem inflationierte Deutsche Reichsmark war, die in der Währungsreform 1948 unterging, durch die D-Mark ersetzt wurde, während das britische Pfund noch heute existiert.
Über Geldarten
Ludwig von Mises hat eine Typologie der Geldarten vorgestellt, die Jörg Guido Hülsmann in eine sehr hilfreiche Übersicht gebracht hat, auf die hier zurückgriffen werden soll (siehe Abb. 4). Danach unterscheidet Mises zwischen Geld im engeren Sinne (Grundgeld) und Geld im weiteren Sinne (Geldsubstitute). Zu Geld im engeren Sinne sind zu zählen: (1) Warengeld in Form von Edelmetallen oder anderen Sachgütern; (2) Kreditgeld und Forderungen, die als Geld verwendet werden, die dem Geld, in dem sie denominiert sind, gleich geschätzt werden; und (3) Fiat-Geld, das es in Form von Banknoten, Bankguthaben und Scheidemünzen (deren aufgeprägter Nennwert höher ist als der Metallwert der Münze) gibt.
Abb. 4: Typologie der Geldarten nach Ludwig von Mises
Quelle: Hülsmann (2012), The Early Evolution of Mises’s Monetary Thought, S. 34
Bei den Geldsubstituten lässt sich unterscheiden zwischen Geldzertifikaten und Umlaufsmitteln. Geldzertifikate sind zu 100 Prozent gedeckt durch Grundgeld. Sie können die Form von Banknoten, Guthaben und Münzen haben. Umlaufsmittel, die ebenfalls Banknoten, Guthaben und Münzen sein können, haben eine »Nulldeckung«, sind also nicht durch das Grundgeld gedeckt. Die große Merkwürdigkeit dabei ist natürlich das Fiat-Geld.
Es stellt uns nicht vor große Probleme zu verstehen, dass Sachgeld und auch Kreditgeld aus dem freien Markt entstehen können. Aber Fiat-Geld? Wir haben bereits mehrfach festgestellt: Fiat-Geld kann nicht aus freiwilligen Markttransaktionen entstanden sein. Es muss per Zwang installiert werden. Und so war es ja auch: Die Staaten haben die Goldbesitzer irgendwann enteignet und das Goldgeld (per Zwang, muss man betonen) durch ihr staatliches Fiat-Geld ersetzt.
Dabei ist zu bedenken, dass der Blick auf die Währungsgeschichte in der Tat offenbart, dass es schon sehr viele Geldarten gegeben hat (die Typologie in Abb. 4 hat also sehr engen Realitätsbezug). Viele Güter haben den Menschen schon als Geld – als allgemein akzeptiertes Tauschmittel – gedient: Vieh, seltene Steine, Muscheln, Zigaretten, vor allem aber Edelmetalle. Alle diese Geldarten lassen sich als Sach- oder Warengeld bezeichnen.
Das Sachgeld ist ein Geld, das entweder als physisches Gut verwendet wird (etwa in Form einer Silbermünze) oder das als Anrecht auf die Aushändigung eines Sachgutes, mit dem es hinterlegt ist, existiert. Ein Beispiel ist das Edelmetallgeld. Geld ist hier Gold oder Silber. In einem Goldstandard läuft Geld zum einen in Form von Goldmünzen um; man spricht von Goldumlaufswährung (Kurantmünzen). Es dienen zum anderen auch Banknoten und Giroguthaben bei Banken als Geld; beide können jederzeit zum Nennwert in physisches Gold eingetauscht werden.
Wenn Banknoten und Giroguthaben bei Banken jederzeit zum Nennwert in (kleinteiliges) physisches Gold eingetauscht werden können, spricht man von einem Gold-Specie-Standard. Wenn hingegen nur großvolumige Beträge in physisches Gold (in Form von großvolumigen Barren) eingetauscht werden können, spricht man von einem Gold-Bullion-Standard.
Das heutzutage verbreitete Geld – ob US-Dollar, Euro, Japanischer Yen, Chinesischer Renminbi oder Schweizer Franken – lässt sich als ungedecktes Papiergeld, als Kreditgeld oder auch als Fiatgeld bezeichnen – je nachdem, welche Eigenschaft hervorgehoben werden soll. Die folgenden Überlegungen machen das deutlich.
Erstens: Das heutige Geld ist intrinsisch wertlos. Es ist in nichts einlösbar und hat die Form von mit Tinte bedruckten Papierzetteln und Einträgen auf Computerfestplatten (»Bits and Bytes«). So gesehen lässt es sich als (intrinsisch wertloses) ungedecktes Papiergeld bezeichnen.
Zweitens: Das Geld wird durch Bankkreditvergabe produziert, durch Kredite, denen keine »echte Ersparnis« gegenübersteht. Es wird »aus dem Nichts« (also ex nihilo) geschaffen, es ist Kreditgeld.
Drittens: Das Geld ist staatliches Monopolgeld. Es wird von staatlichen Zentralbanken produziert, die das Geldproduktionsmonopol innehaben. Die Staaten erzwingen per Gesetz, dass ihr Papier- oder Kreditgeld gesetzliches Zahlungsmittel ist. So gesehen ist es Fiatgeld (das Wort fiat ist lateinisch und steht für »So sei es«); Fiatgeld steht für Zwangsgeld.
Im Folgenden werden die Begriffe ungedecktes Papiergeld, Kreditgeld und Fiatgeld benutzt. Sie alle sollen die heute überall anzutreffende unnatürliche Währungsordnung bezeichnen: Eine Währungsordnung, die nicht etwa spontan aus freiwilligen Markttransaktionen entstanden ist, sondern die durch Zwangseingriffe des Staates auf den Weg gebracht wurde und große volkswirtschaftliche und auch gesellschaftliche Probleme erzeugt; etwas, was noch in den folgenden Kapiteln zur Sprache kommen wird.
Bimetallismus, das Greshamsche Gesetz
Es gab Zeiten, da wurden Gold und Silber als Geld verwendet. Man sprach von einem Bimetallismus.13 Der US-Dollar wurde durch das Münzgesetz von 1792 in Gold- und Silberfeingewicht definiert. Und zwar entsprachen 371,25 Grain Feinsilber und 24,75 Grain Feingold einem US-Dollar; eine Feinunze Gold (troy ounce, also 31,10347… Gramm) entsprach 480 Grain. Weil der Dollar als 371,25 Grain Silber definiert war, entsprach eine Feinunze Silber etwa 1,2929 US-Dollar (480 Grain dividiert durch 371,25 Grain pro Feinunze), und der Preis einer Feinunze Gold entsprach etwa 19,3939 US-Dollar (480 dividiert durch 24,75).
Doch der Bimetallismus sorgte immer wieder für Probleme. Diese Probleme wurden und werden fälschlicherweise immer wieder den freien Märkten angelastet. Um das zu erklären, sei an dieser Stelle auf das Greshamsche Gesetz verwiesen. Das Greshamsche Gesetz (»Gresham’s Law«) wird häufig wie folgt wiedergegeben als: »Das schlechte Geld verdrängt das gute Geld«. Doch das ist eine Fehldeutung. Das Greshamsche Gesetz lautet vielmehr: »Das vom Staat überbewertete Geld verdrängt das vom Staat unterbewertete Geld.«14 In der Tat war es immer wieder der Staat, indem er die Preisrelation (den Wechselkurs) zwischen den Geldarten festlegte, der den Bimetallismus verunmöglichte. Das erklärt sich wie folgt.
Nach dem Münzgesetz war eine freie Ausprägung von Silber und Gold im Verhältnis von 15:1 bei der amerikanischen Münze möglich. Kurz darauf verteuerte sich jedoch der Marktpreis des Goldes gegenüber dem Silber auf eine Rate von mehr als 15:1. Silber war nunmehr mit der offiziellen Rate von 15:1 überbewertet gegenüber Gold. Sofort machte sich das Greshamsche Gesetz bemerkbar. Es besagt, dass das vom Staat überbewertete Geld das vom Staat unterbewertete Geld aus dem Zahlungsverkehr verdrängt.
Nehmen wir an, das offizielle Austauschverhältnis von Silber zu Gold bei der Münzanstalt beträgt 15:1. Das heißt, man bringt 15 Feinunzen Silber zur Münze, die man dort in eine Feinunze Gold eintauschen kann. Im freien Markt hingegen betrage das Austauschverhältnis 15,5:1. Was passiert? Nun, man bringt 15 Feinunzen Silber zur Münze und erhält dafür eine Feinunze Gold. Die Feinunze Gold tauscht man dann gegen 15,5 Feinunzen Silber im freien Markt ein. Die 15,5 Feinunzen Silber bringt man zur Münze und erhält dafür 1,0333… Feinunzen Gold. Die 1,0333… Feinunzen Gold tauscht man wieder am freien Markt ein und erhält dafür 16,0167… Feinunzen Silber und bringt diese zur Münze. Und so weiter und so fort. Das Ergebnis: Silber läuft um, Gold wird nicht mehr zu Zahlungen verwendet. Das vom Staat überbewertete Geld (hier Silber) verdrängt das vom Staat unterbewertete Geld (hier Gold).
In der Tat: Silber zirkulierte ab 1792 als Geld, das Goldgeld verschwand gewissermaßen im Sparstrumpf. In den USA herrschte faktisch von 1792 bis 1834 ein Silberstandard. Der staatliche Eingriff in Form von Vorgaben für das Austauschverhältnis zwischen Gold und Silber hatte folglich Konsequenzen: Es machte den mit dem Münzgesetz angestrebten Bimetallismus zunichte. Nachfolgend kam es in den Vereinigten Staaten zu weiteren Veränderungen des gesetzlichen Austauschverhältnisses zwischen Gold und Silber. Im Jahr 1834 zum Beispiel wurde ein Kursverhältnis von 16:1 beschlossen, das Silber-Gold-Preisverhältnis im freien Markt lag jedoch bei 15,625:1. Damit war das Silber unterbewertet, und das Wirken des Greshamschen Gesetzes sorgte dafür, dass in den Vereinigten Staaten von Amerika nun de facto ein Goldstandard herrschte.
Die von staatlichen Eingriffen verursachten Wechsel von einem Geldstandard auf einen anderen waren alles andere als harmlos: Für die Marktakteure ergaben sich große Probleme, und einige wenige (gut informierte) konnten sich auf Kosten vieler anderer besserstellen. Die Probleme mit dem Bimetallismus rührten aber nicht aus der Verwendung zweier Edelmetalle als Geld. Sie resultierten allein aus der staatlichen Fixierung des Austauschverhältnisses zwischen den Metallen.
Geld in der Wirtschaftsrechnung
Eine wichtige Bedeutung hat das Geld für die Wirtschaftlichkeitsrechnung, die häufig übersehen wird.15