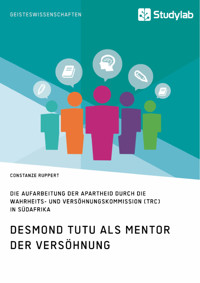
Desmond Tutu als Mentor der Versöhnung. Die Aufarbeitung der Apartheid durch die Wahrheits- und Versöhnungskommission (TRC) in Südafrika E-Book
Constanze Ruppert
19,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Studylab
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Sprache: Deutsch
1996 berief der damals amtierende südafrikanische Präsident Nelson Mandela Desmond Tutu als 1. Vorsitzenden der Wahrheits- und Versöhnungskommission, um Südafrika im Übergang von der Apartheid zur Postapartheid zu begleiten. Die Wahrheits- und Versöhnungskommission (TRC) war von 1996 - 1998 in East London in der Provinz Ostkap in Südafrika tätig. Ihre Aufgabe war es, Menschenrechtsverletzungen aufzuklären, die während der Zeit der Apartheid verübt wurden, Amnestieanträge zu prüfen und Empfehlungen für Entschädigungs- und Schmerzensgeldzahlungen gegenüber der Regierung auszusprechen. Inspiriert durch seinen Glauben reifte in Tutu die Vision, dass eine Veränderung der Gesellschaft und die Heilung der Wunden der Apartheid möglich sind. Die Aufarbeitung der Apartheid, untersucht aus einer theologischen und historischen Perspektive, steht im Zentrum dieses Buches. Anhand der Biographien prägender Persönlichkeiten, die sich als Resultat ihres Glaubens für gesellschaftspolitische Veränderungen eingesetzt und Nationen in Transformationsprozessen begleitet haben, wird die Aufarbeitung der Apartheid im Rahmen der TRC erforscht. Der Fokus liegt hierbei auf dem Friedensnobelpreisträger und anglikanischem Bischof Desmond Tutu, der mit seinem jahrzehntelangen Einsatz gegen Rassismus zu einer Schlüsselperson der Anti-Apartheids-Bewegung wurde. Betrachtet wird seine Rolle als 1. Vorsitzender der TRC. Es wird die These aufgestellt, dass Tutu zu einem Mentor für eine ganze Nation in der Aufarbeitung der Apartheid wurde. In der Verifizierung dieser These findet eine Auseinandersetzung mit Tutus Biographie, seinem Gottes-; Menschen- und Weltbild statt. Ein spezieller Schwerpunkt liegt hierbei auf der afrikanischen Ubuntu-Philosophie, welche Tutu kulturell stark geprägt hat. Im Laufe der Thesis wird der Begriff des gesellschaftlichen Mentorings entwickelt und definiert. Explizit wird auch auf die Gefahren des gesellschaftlichen Mentorings - insbesondere die Gefahr des Machtmissbrauches - hingewiesen. Aus dem Inhalt: - Desmond Tutu; - Anti-Apartheid; - Rassismus - Südafrika; - Ubuntu-Philosophie
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 456
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Impressum:
Copyright (c) 2015 GRIN Verlag / Open Publishing GmbH, alle Inhalte urheberrechtlich geschützt. Kopieren und verbreiten nur mit Genehmigung des Verlags.
Bei GRIN macht sich Ihr Wissen bezahlt! Wir veröffentlichen kostenlos Ihre Haus-, Bachelor- und Masterarbeiten.
Jetzt beiwww.grin.com
Inhaltsverzeichnis
Vorwort
Zusammenfassung
Summary
The archbishop chairs the first session
Der Erzbischof eröffnet die erste Sitzung
1 Die Themenfindung
1.1 Die Informationssammlung
1.2 Der Prozess der Wissensaneignung
1.3 Die Struktur
2 Der erkenntnistheoretische Ansatz
2.1 Was ist Erkenntnis?
2.2 Verschiedene erkenntnistheoretische Ansätze
2.3 Das Geschichtsverständnis nach dem jüdisch-christlichen Verständnis
2.4 Der erkenntnistheoretische Ansatz des Kritischen Realismus
2.5 Kritisch-realistische Epistemologie
2.6 Zur Rolle des Forschers: Erkenntnis in Demut
3 Definition von Schlüsselbegriffen
3.1 Nation
3.2 Interkulturalität
3.3 Mentoring
3.4 Rassismus
3.5 Apartheid
4 Rassismus: ein Gang durch die Historie unter Einbeziehung theologischer Aspekte
4.1 Theologische Axiome zum Thema Rassismus:
4.1.1 Polygenesie
4.1.2 Systemische Sünde
4.1.3 Kontextuelle Theologien
4.1.4 Konsens der Mehrheit der christlichen Kirchen weltweit zum Thema Rassismus zu Beginn des 21. Jahrhunderts
4.2 Die Schwarze Theologie
4.2.1 Definition
4.2.2 Die Kontextanalyse als Schlüssel
4.2.3 Die Historie
4.2.4 Eine Theologie der Inklusion
4.3 Die Partikularität jeglicher Theologie
4.4 Die Wurzeln der Theologie der Gleichwertigkeit im Angesicht globaler rassistisch motivierter Konflikte
4.5 Konsequenzen der Exegese der Inklusion
4.5.1 Die Theologie der Inklusion lokal verortet
4.5.2 Das Ende der Apartheid: Die christliche Gemeinschaft im Licht der Theologie der Inklusion
4.6 Die Theologie der Gleichwertigkeit und ihre transformatorische Kraft untersucht anhand des Philemonbriefes
4.7 Die Vision: das Ende des Rassismus
5 Desmond Tutu
5.1 Biographische Eckdaten
5.2 Trevor Huddleston – Desmond Tutus Mentor
5.3 Schwerpunkte der Theologie Desmond Tutus
5.3.1 Gottesbild
5.3.2 Weltbild
5.3.3 Menschenbild
5.3.4 Selbstverständnis
5.3.5 Kirchenverständnis
5.3.6 Leidenstheologie
5.4 Charakter
5.5 Kommunikationsfähigkeit
5.6 Motivation für politisches Engagement
5.6.1 Ein Plädoyer für die Auswirkungen des Glaubens im Diesseits
5.6.2 Vision
5.7 Tutu als Prophet
6 Ubuntu
6.1 Definition: Ubuntu
6.2 Südafrika - ein Land geprägt durch die Ubuntu-Philosophie
6.3 Ubuntu und die Beziehung zum Christentum
6.4 Das Gewicht von Ubuntu
7 Die Wahrheits- und Versöhnungskommission 199- 1998
7.1 Die Zeit des Umbruchs: der Übergang von der Apartheid zur Postapartheid
7.2 Definition der Aufgabe der Wahrheits- und Versöhnungskommission
7.3 Desmond Tutus Rolle in der Wahrheits- und Versöhnungskommission
7.4 Ein Einblick in die Historie der Wahrheits- und Versöhnungskonferenz
7.5 Die Zielsetzung der Wahrheits- und Versöhnungskommission
7.6 Die Komitees der Wahrheits- und Versöhnungskommission
7.7 Zur Frage der Generalamnestie
7.8 Zur Bewertung der Wahrheits- und Versöhnungskommission
8 Versöhnung
8.1 Definiton: Versöhnung
8.1.1 Versöhnung: Impulse zur exegetischen Dimension
8.1.2 Tutus Verständnis von Vergebung und Versöhnung
8.2 Versöhnung: Impulse zur poltischen Dimension – aus einer theologischen Perspektive
8.3 Auf dem Weg zur Versöhnung: die Praxis des Schuldbekenntnisses
8.4 Das Verständnis der restaurativen Gerechtigkeit
8.5 Axiome, die das Theorierahmenkonzept für Versöhnung bilden: Gerechtigkeit und Gericht, Gnade und Barmherzigkeit
8.5.1 Exkurs zu den Menschenrechten
8.5.2 Das ausschließliche Paradigma eines Gottes der Liebe als Hindernis für einen Vergebungs- und Versöhnungsprozess im südafrikanischen Kontext
8.6 Zur Frage der Wiedergutmachung
8.7 Zur Frage der zu erwartenden Vergeltung
8.8 Versöhnung – eine Torheit in den Augen der Welt
8.9 Die Metanarrative der Versöhnung
8.9.1 Die Gemeinschaft der Versöhnung impliziert das Amt der Versöhnung
8.9.2 Die Ekklesia als Botin der Gnade – erlebte Gnade befähigt zur praktizierten Gnade
8.10 Versöhnung - die gesellschaftliche Dimension: Aussagen von Zeitzeugen der Wahrheits- und Versöhnungskommission
8.11 Hoffnung - als Motivation der Versöhnung
9 Exkurs: Die Auswirkungen der heilsamen Kraft des Evangeliums auf individueller und kollektiver Ebene
9.1 Die individuelle Ebene: ein Zitat aus dem Leben Nelson Mandelas, einem Mann der Versöhnung
9.2 Die kollektive Ebene: das Johweto Projekt, ein Ort der Versöhnung
9.3 Die Dynamik einer theologischen Wahrheit des Evangeliums, die angewandt zur Transformation einer Nation beitragen kann
9.4 Synergieeffekte der Versöhnung auf der individuellen und der kollektiven Ebene
10 Der Vorbildcharakter der Wahrheits- und Versöhnungskommission für nationale Konfliktlösungsprozesse weltweit
10.1 Tutus Botschaft der Versöhnung in internationalen Konflikten
10.2 Buße, Bekenntnis, Versöhnung und Wiedergutmachung als Lösungsansatz für Konfliktherde weltweit
11 Zeitzeugen über Desmond Tutu als Mentor
11.1 Desmond Tutu als Mentor für Individuen auf internationaler Ebene
11.2 Desmond Tutu als Mentor für Kollektive auf globaler Ebene
11.3 Exkurs: Beschreibung der Weltältesten
11.4 Über Desmond Tutus Rolle als 1. Vorsitzender im Rat der Weltältesten
11.5 Resümee: Desmond Tutu als Mentor in unterschiedlichen Kontexten auf der individuellen und der kollektiven Ebene
12 Der Kristallisationspunkt: „Desmond Tutu als Mentor der Versöhnung in der Aufarbeitung der Apartheid im Rahmen der Wahrheits- und Versöhnungs-kommission in der Nation Südafrika“
12.1 Desmond Tutus Rolle als Mentor in der Wahrheits- und Versöhnungskommission
12.2 Charakteristika Desmond Tutus als Mentor in der Nation Südafrika
12.2.1 Desmond Tutu als Identifikationsfigur
12.2.2 Desmond Tutus Mitgefühl
12.2.3 Desmond Tutus Menschlichkeit
12.2.4 Desmond Tutus Demut und Humor
12.2.5 Desmond Tutus Fähigkeit, Menschen als Boten des Friedens und der Gerechtigkeit zu berufen
12.3 Reflexion des Mentorenverhältnisses von Trevor Huddleston zu Desmond Tutu
12.4 Reflexion des gesellschaftlichen Mentoring in Südafrika
13 Desmond Tutu: Mentor für Nationen - Reflexionen auf der Metaebene
14 Historische Beispiele für Mentoren einer Nation
15 Übertragung der These: Vorbilder in Deutschland zu Beginn des 21. Jahrhunderts
15.1 Die Relevanz eines von christlichen Werten inspirierten Mentorings für das deutsche Abendland im Prozess der Säkularisierung
15.2 Deutschland auf der Suche nach Gesellschafts-Mentoren? Ein Blick in den Alltag der Deutschen
15.3 Personen des öffentlichen Lebens in Deutschland, die eine Mentorenfunktion einnehmen
15.3.1 Helmut Schmidt
15.3.2 Hans-Joachim Gauck
15.4 Resümee: Gesellschaftsmentoren in Deutschland
16 Gefahren des gesellschaftlichen Mentorings: Machtmissbrauch
17 Authentizität und Integrität - Schlüsselelemente eines gesellschaftlichen Mentors
18 Resümee und Ausblick
19 Bibliographie
19.1 Bücher
19.2 Lexika, Wörterbücher, Reihen, Enzyklopädien
19.3 Verwendete Bibelübersetzungen und Handkonkordanzen
19.4 Doktorarbeiten
19.5 Zeitungen, Zeitschriften
19.6 Weblinks
19.7 Podcast
19.8 Videoaufzeichnungen und CDs
19.9 Sonstiges
20 Abbildungen
21 Schlagwort-Index
Vorwort
Diese Veröffentlichung setzt sich mit dem Menschenrechtler Desmond Tutu als Mentor der Versöhnung
in der Aufarbeitung der Apartheid in Südafrika im Rahmen der Wahrheits- und Versöhnungs-kommission auseinander. Die Akademie für Leiterschaft in Ditzingen begleitet diese Masterthesis und die New Covenant International University hat dafür den akademischen Grad „Master of Philosophy“ verliehen.
Die Autorin hat sich sehr intensiv, ausführlich und leidenschaftlich mit dem Thema auseinandergesetzt – nicht nur in puncto Literatur, sondern auch durch den auf Masterebene außergewöhnlichen und äußerst lobenswerten Einsatz einer Forschungsreise nach Südafrika.
Wahre Versöhnung und Vergebung, die beide Seiten etwas kostet, und Mentoring, das im interkulturellen Zusammenleben positive Auswirkungen hat und sogar auf internationaler Ebene als Vorbild dient, stehen im Fokus. Am Beispiel des anglikanischen Erzbischofs Desmond Tutu wird verdeutlicht, was erzielt werden kann, wenn sozial-politische Gesellschaftstransformation von christlichen Werten inspiriert ist.
Jedem Leser, der zu grenzüberschreitendem Handeln ermutigt werden möchte und neue Impulse gewinnen will, ist diese Abhandlung wärmstens zu empfehlen.
Jörg Strate
PhD, Vorstands- und Fakultätsmitglied Horizonte weltweit e.V.
Chelmsford (GB), im März 2017
Zusammenfassung
In Vorbereitung auf die Masterthesis hat die Autorin interkulturelle Konflikte in den Fokus genommen. Sie hat Biographien von Persönlichkeiten gelesen, die sich als Resultat ihres Glaubens für gesellschaftspolitische Veränderungen eingesetzt und Nationen in Transformationsprozessen begleitet haben. Dabei ist sie u. a. auf die Biographie von Desmond Tutu, dem ersten schwarzen anglikanischen Dekan von Johannesburg (1975), Generalsekretär des südafrikanischen Kirchenrates (1978) und Friedensnobelpreisträger (1984), gestoßen.
1996 berief der damals amtierende südafrikanische Präsident Nelson Mandela Desmond Tutu als 1. Vorsitzenden der Wahrheits- und Versöhnungskommission, um Südafrika im Übergang von der Apartheid zur Postapartheid zu begleiten.
Die Wahrheits- und Versöhnungskommission war von 1996 -1998 in East London in der Provinz Ostkap in Südafrika tätig. Ihre Aufgabe war es, Menschenrechtsverletzungen, die während der Zeit der Apartheid verübt wurden, aufzuklären, Amnestieanträge zu prüfen und Empfehlungen für Entschädigungs- und Schmerzensgeldzahlungen gegenüber der Regierung auszusprechen.
Inspiriert durch seinen Glauben reifte in Tutu die Vision, dass Veränderung der Gesellschaft und Heilung der Wunden der Apartheid möglich sind.
Es kristallisierte sich in der Recherche heraus, dass sich durch Desmond Tutus Wirken im Rahmen der Wahrheits- und Versöhnungskommission ein komplexer Transformationsprozess mit tiefgreifenden politischen und sozialen Veränderungen in der südafrikanischen Gesellschaft vollzog.
Die Autorin stellte daraufhin die These auf, dass durch das Evangelium inspirierte Mentoringprozesse nicht nur ein Individuum oder ein kleines Kollektiv, sondern auch eine komplette Nation betreffen können.
Diese Masterthesis trägt deshalb den Titel: „Desmond Tutu als Mentor der Versöhnung in der Aufarbeitung der Apartheid im Rahmen der Wahrheits- und Versöhnungskommission in der Nation Südafrika“.
Diesen Sachverhalt untersuchte die Autorin in dem sie Fachliteratur zu Rate zog.
Als erkenntnistheoretischer Ansatz liegt dieser Masterthesis die Kritisch-Realistische Epistemologie, dargelegt in dem Buch: Das Neue Testament und das Volk Gottes verfasst von dem anglikanische emeritierte Bischof N.T. Wright, zugrunde.
Im Rahmen ihrer Recherche reiste die Autorin nach Südafrika, um einen direkten Einblick in die Gegebenheiten des Landes zu gewinnen und Kontakt mit Menschen vor Ort aufzunehmen. In Kapstadt traf sie im Februar 2014 Desmond Tutu für ein Interview.
In dem von Tutu gestalteten Prozess der Aufarbeitung der Apartheid im Rahmen der Wahrheits- und Versöhnungskommission lag der Schwerpunkt in gemeinsamen Schritten ehemals verfeindeter gesellschaftlicher Gruppen, hin zur Vergebung und Versöhnung.
Tutus Verständnis war hierbei nicht eine leichtfertige Art der Vergebung, die Schuld verdrängt. Vielmehr lag sein Schwerpunkt darauf, dem Grauen der Verbrechen ins Angesicht zu blicken, sie zu artikulieren und dann jedoch nicht in Hass und Rache zu verharren, sondern den Weg des Lebens und damit den Weg der Versöhnung zu wählen.
Als Gesellschaftsmentor begleitete er Menschen aus unterschiedlichen ethnischen und religiösen Hintergründen auf einem Weg hin zur Gerechtigkeit, zum Frieden, zur Freiheit und zur Versöhnung.
Die Autorin sieht das Wirken Desmond Tutus im Kontext der Wahrheits- und Versöhnungskommission als ein exemplarisches Beispiel aus der Weltgeschichte an, welches bestätigt, dass es Persönlichkeiten gibt, die zu Vorbildern für eine Gesellschaft werden können und eine Nation in tiefgreifenden Paradigmenwechseln begleiten können. Diese Prozesse kann man als Gesellschaftsmentoring und Desmond Tutu als Mentor einer Nation im Zuge gesellschaftlicher Veränderungsprozesse bezeichnen. Aus der hier dargelegten These kann der neue Fachbegriff des gesellschaftlichen Mentorings entwickelt werden.
Damit eine Person zu einem Mentor für eine ganze Gesellschaft wird, ist es notwendig, dass ein größerer Prozentsatz, der eine gewisse Bandbreite der Gesellschaft widerspiegelt, sich aus eigener Motivation heraus an dem Menschen orientiert und eine Vertrauensebene zu ihm aufbaut.
Die Qualifikation eines Mentors in gesellschaftlichen Prozessen erwächst aus seiner Biographie, Lebenserfahrung, gewonnener Lebensreife, Integrität, Authentizität und Weisheit.
Die Autorin untersuchte weiterführend, ob sich diese These auch auf Deutschland, mit seinem geschichtlich bedingtem, kritischen Verhältnis gegenüber charismatischen Führungspersönlichkeiten übertragen lässt und ob es auch hier vor Ort Persönlichkeiten gibt, die für einen Großteil der Bürger zu einem Vorbild geworden sind. Hierzu untersuchte sie das Leben des ehemaligen Bundeskanzlers Helmut Schmidt und des amtierenden Bundespräsidenten Hans-Joachim Gauck. In ihrer Recherche legte sie einen expliziten Schwerpunkt auf die Erforschung des Verhältnisses der Deutschen zu diesen beiden Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens.
Die zu Beginn der Masterthesis aufgestellt These: „Desmond Tutu als Mentor der Versöhnung in der Aufarbeitung der Apartheid im Rahmen der Wahrheits- und Versöhnungskommission in der Nation Südafrika“ wurde nicht nur bestätigt, sondern noch übertroffen. Die Autorin musste in der Auseinandersetzung mit Tutus Biographie feststellen, dass er nicht nur zu einem Mentor in Südafrika wurde, sondern sich auch andere Nationen in politischen Umbruchsprozessen an ihm orientierten. Beispielsweise luden Regierungsvertreter Ruandas, nach dem 1994 stattgefundenen Völkermord der Hutus an den Tutsis, bei dem circa 800.000 bis 1.000.000 Menschen ums Leben kamen, Tutu 1995 ein, um zu ihnen über die Situation ihres Landes und den Konflitk der verfeindeten Volksgruppen zu sprechen.
D. h. Tutus Wirkungskreis als Mentor in gesellschaftlichen Transformationsprozessen erstreckt sich weit über die Landesgrenzen Südafrikas hinaus.
Er wurde sowohl zu einem Mentor für Individuen auf internationaler Ebene als auch für Kollektive auf globaler Ebene.
Des Weiteren wurde er 2007 als 1. Vorsitzender des Rates der Weltältesten berufen. Dies ist ein Gremium herausragender, angesehner Persönlichkeiten: ehemalige Staatsoberhäupter, Friedensaktivisten, Intellektuelle und Menschenrechtler, die jedoch keine öffentlichen Ämter mehr inne haben und aufgrund dessen politisch unabhängig sind. Sie setzen ihren globalen Einfluss in weltpolitischen Krisen, wie Hunger, Armut, Kriegen, Naturkatastrophen etc. ein, um zum Frieden beizutragen.
Zusammenfassend lässt sich sagen: Desmond Tutu war als Vorbild, Ratgeber und Mentor in der Aufarbeitung der Apartheid in Südafrika und weit über die Grenzen seines Heimatlandes hinaus aktiv.
Unter Mentoring wurde zunächst die Begleitung eines Individuums oder eines kleineren Kollektivs in einem Veränderungsprozess durch einen Mentor verstanden. Anhand der in dieser Thesis dargelegten Beweisführung wurde ein dritter Wirkungsbereich des Mentorings eingeführt - die Gesellschaft.
Anhand des Lebens von Desmond Tutu sieht die Autorin die These als belegt an, dass man das Prinzip des Mentorings auch auf Veränderungsprozesse von Nationen übertragen kann. Nationen, die sich in Transformationsprozessen befinden, die Inspiration suchen und sich an einem weisen Ratgeber oder einem Vorbild orientieren.
Anhand der Beschreibung der tiefgreifenden Veränderungsprozesse, wie sie in den neunziger Jahren in der südafrikanischen Gesellschaft unter entscheidender Mitwirkung von Desmond Tutu stattfanden, wurde die reformatorische Kraft, dass das persönliche Glaubensleben gesellschaftspolitische Auswirkungen haben und Versöhnungsprozesse eines Volkes begleiten kann, deutlich. Es wurde sichtbar, wie auf einer gesellschaftlichen Ebene etwas von der Vision von Gottes Reich, seiner sozialen Gerechtigkeit, bruchstückhaft und unvollkommen, hier auf diesem Planeten aufleuchten kann.
Abschließend lässt sich sagen: Es gibt Gesellschaftsmentoren, Menschen die eine ganze Nation prägend in tiefgreifenden sozialen und politischen Veränderungsprozessen begleiten. Wenn Menschen, die von einer christlichen Ethik geprägt sind in solch eine Rolle hineinwachsen, siehe Martin Luther King, William Wilberforce etc., birgt dies das Potential einer Gesellschaft mit christlich inspirierten Werten zu dienen, so dass Transformationsprozesse inspiriert von Werten des Reiches Gottes, wie Frieden, Freiheit, Gerechtigkeit, Nachhaltigkeit, Barmherzigkeit, Vergebung und Versöhnung eine Gesellschaft mitprägen und gestalten können.
Summary
The author has focussed on intercultural conflict whilst preparing this master thesis. She has read biographies of people, who have championed social and political reform and assisted in the transformation process of nations because of their faith. Among other personalities, she encountered Desmond Tutu, the first black Anglican Dean of Johannesburg (1975), General Secretary of the South African Church Council (1978) and Nobel Peace Prize Winner (1984).
In 1996, Desmond Tutu was appointed as the Chairman of the Truth and Reconciliation Commission to assist South Africa’s transition from apartheid to post-apartheid by the then president Nelson Mandela.
The Truth and Reconciliation Commission took place from 1996 until 1998 in East London in the Eastern Cape Province in South Africa. Their role included the clearing up human rights abuses, which took place during the time of apartheid, checking amnesty claims and speaking out for the recommendations for compensation and damage payments against the government.
Inspired by his faith, Tutu’s vision for societal change and healing of wounds created by apartheid grew.
It has become more and more evident, that through Desmond Tutu’s work in the Truth and Reconciliation Commission, a complex process of transformation of South African society with profound political and social change took place.
The author proposes in this thesis that through Gospel inspired mentoring processes, not only individuals or a small community, but a whole nation can be effected.
This master thesis has therefore been given the title: „Desmond Tutu as a Mentor of Reconciliation in the Reappraisal of Apartheid as the leader of the Truth and Reconciliation Commission in the nation of South Africa“.
The author investigated the real facts by extracting evidence from specialist literature.
As a cognitive theory approach, this master thesis lies within critical-realistic epistemology expounded in The New Testament and the People of God, written by the Anglican emeritus Bishop N.T. Wright.
In order to gain a direct insight into the situation of the country and make contact with the people there the author traveled personally to South Africa. On her journey she met Desmond Tutu for an interview in Cape Town in February 2014.
The main focal point in Tutu’s apartheid reappraisal process as the leader of the Truth and Reconciliation Commission was to bring former antagonized groups together to a place of forgiveness and reconciliation.
Tutu’s understanding here was not a thoughtless type of forgiveness that suppresses guilt, rather he focussed on looking at the horror of the crime face to face, to articulate it, but not to remain hateful or full of revenge, but to choose the way of life and thereby the way of reconciliation.
As a mentor of society, he assisted people from different ethnic and religious backgrounds towards a righteous, peaceful way, towards freedom and reconciliation.
The author considers the work of Desmond Tutu within the context of the Truth and Reconciliation Commission as exemplary in world history, which confirms that there are personalities that can become role models for a society and assist nations in profound paradigm changes. These processes can be identified as social mentoring and Desmond Tutu was designated as mentor of a nation during the course of societal change. The new terminology societal mentoring can be developed from this thesis.
In order for someone to become a mentor for a whole society, it is necessary that a large representative percentrage align themselves with the person and build trust.
The qualification of a mentor for societal change must come out of the individual’s own biography, life experience, maturity gained, integrity, authenticity and wisdom.
The author continually investigates whether this thesis can be adopted in Germany and whether there are local personalities, who could become role models for the majority of citizens. At this juncture, she investigated the lives of the former Federal Chancellor Helmut Schmidt and the officiating Federal President Hans-Joachim Gauck.
The initial proposal of the thesis: „Desmond Tutu as a Mentor of Reconciliation in the Reappraisal of Apartheid as the leader of the Truth and Reconciliation Commission in the nation of South Africa“ is not only confirmed, but surpassed.
In examining Tutu’s biography, the author had to conclude that he not only became a mentor for South Africa, but other nations going through political change looked to him as well. For example, Rwanda’s government representative invited Tutu to speak to them in 1995 about the situation in their country and conflict between tribes, after the genocide between the Hutus and the Tutsis where approximately 800 000 to 1 million people lost their lives. This meant that Tutu’s sphere of influence as a mentor in societal transformation extended beyond the borders of South Africa.
He became not just a mentor for individuals at an international level, but also for communities at a global level.
Furthermore, he became the Chair of the Elders in 2007. This is a board of distinguished reputable personalities: former chiefs of state, peace campaigners, intellectuals and human rights activists, who no longer serve in their offices and are therefore politically independent. They use their global influence in world political crises such as starvation, poverty, wars, natural disasters etc. to promote peace.
In summary, it can be said that Desmond Tutu has been active as a role model, advisor, and mentor in the reappraisal of apartheid in South Africa and further beyond the borders of his homeland.
The concept of mentoring is firstly understood as assisting individuals or smaller groups in a process of change. On the basis of the evidence demonstrated in this thesis, a third sphere has been introduced - a society.
Using the life of Desmond Tutu the author considers her thesis is proven, that the principle of mentoring can also be transferred to assisting nations in their processes of change - nations, that find themselves in a process of transformation that are looking for a wise counsellor or role model.
Based on this description of the profound transformational processes that took place in the 1990s in South African society under the decisive contribution of Desmond Tutu, the reformational power that a personal life of faith can have, socially and politically and assisting the process of reconciliation of a nation is clear. It is evident that having a vision of the the Kingdom of God and its implications of righteousness for society can light up this planet, which is fragmented and imperfect.
It can be said in conclusion that there are mentors of society, people who shape a whole nation during profound processes of social and political change. If people who are influenced by Cristian ethics grow into such a role, for example Martin Luther King, Williams Wilberforce etc., there is the potential to serve a society with values inspired by the Christian faith, so that transformation inspired by kingdom of God values, such as peace, freedom, righteousness, sustainability, mercy, forgiveness and reconciliation can shape the society.
The archbishop chairs the first session
Original
By Ingrid de Kok
Truth and Reconciliation Commission. April 1996. East London, South Africa
On the first day
after a few hours of testimony
the Archbishop wept.
He put his grey head
on the long table
of papers and protocols
and he wept.
The national
and international cameramen
filmed his weeping,
his misted glasses,
his sobbing shoulders,
the call for a recess.
It doesn’t matter what you thought
of the Archbishop before or after,
of the settlement, the commission,
or what the anthropologists flying in
from less studied crimes and sorrows
said about the discourse,
or how many doctorates,
books, and installations followed,
or even if you think this poem
simplifies, lionizes
romanticizes, mystifies.
There was a long table, starched purple vestment
and after a few hours of testimony,
the Archbishop, chair of the commission,
laid down his head, and wept.
Der Erzbischof eröffnet die erste Sitzung
Deutsche Übersetzung
By Ingrid de Kok
Wahrheits- und Versöhnungskommission. April 1996. East London, South Africa
An dem ersten Tag
nach einigen Stunden Zeugenaussagen
weinte der Erzbischof.
Er legte seinen ergrauten Kopf
auf den langen Tisch
inmitten von Dokumenten und Protokollen
und er weinte.
Die nationalen
und internationalen Filmkameras
filmten sein Weinen,
seine beschlagenen Brillenglässer
seine vom Schluchzen bebenden Schultern,
seine Entscheidung für eine Unterbrechung der Zeugenaussagen.
Es ist irrelevant, was Du -
davor oder danach - über den Erzbischof dachtest,
über die Entschädigungszahlungen, die Kommission.
Es ist irrelevant, was Anthropologen,
die eingeflogen wurden und aus Ländern stammen,
in denen die Verbrechen und das Leid noch weniger aufgearbeitet worden waren,
über diesen Diskurs sagten.
Es ist irrelevant, wieviele Doktoranden,
Bücher und Installationen im Nachhinein die Kommission thematisierten.
Oder ob Du denkst, dass dieses Gedicht
vereinfacht und schwärmerisch ist,
romantisiert und mystifiziert.
Dort war ein langer Tisch, bedeckt mit einem purpurfarbenen Priestergewand,
und nach einigen Stunden Anhörung der Zeugenaussagen,
ließ der Erzbischof, der 1. Vorsitzende der Kommission,
seinen Kopf auf den Tisch sinken und weinte.
1 Die Themenfindung
In der Vorbereitung auf diese Masterthesis hat die Autorin interkulturelle Konflikte in den Fokus genommen. Sie hat Biographien von unterschiedlichen Menschen gelesen, die sich als Resultat ihres Glaubens für gesellschaftspolitische Veränderungen eingesetzt und Nationen in Transformationsprozessen begleitet haben. Dabei ist sie u. a. auf die Biographien von Nelson Mandela, dem ersten schwarzen[3] Präsidenten Südafrikas[4] und Desmond Tutus, dem ersten schwarzen anglikanischen Bischof Südafrikas und Vorsitzenden der Wahrheits- und Versöhnungskommission[5], gestoßen.
Es kristallisierte sich in der Recherche heraus, dass sich während Nelson Mandelas Regierung und unter Desmond Tutus Wirken, u. a. als Resultat ihres von ihrem Glauben inspirierten Handelns, ein komplexer Transformationsprozess mit tiefgreifenden politischen und sozialen Veränderungen in der südafrikanischen Gesellschaft zwischen verschiedenen nationalen Gruppen vollzog.
Die Autorin hat sich daraufhin entschieden in ihrer Masterthesis die Bearbeitung eines interkulturellen Konfliktes zu untersuchen.
Diese Masterthesis trägt deshalb den Titel: „Desmond Tutu als Mentor der Versöhnung in der Aufarbeitung der Apartheid im Rahmen der Wahrheits- und Versöhnungskommission[6]in der Nation Südafrika“.
Die Autorin stellt zu Beginn die These auf, dass durch das Evangelium inspirierte Mentoringprozesse nicht nur ein Individuum oder ein kleines Kollektiv, sondern auch eine komplette Nation betreffen können.
1.1 Die Informationssammlung
Im Rahmen ihrer Recherche ist die Autorin nach Südafrika gereist, um einen direkten Einblick in die Gegebenheites des Landes zu gewinnen und um Kontakt mit Menschen vor Ort aufzunehmen. Die erste Station ihrer Reise war Johannesburg, die mit etwa 3,8 Millionen Einwohnern[7] größte Stadt Südafrikas.[8] Gleichzeitig ist der gesamte Großraum Johannesburgs mit nahezu acht Millionen Einwohnern auch die größte Metropolregion im südlichen Afrika.[9] Aufgrund der großen Kluft zwischen dem Reichtum der Weißen in Vororten wie Rosebank und Sandton und der Armut der Schwarzen und Farbigen in den Townships[10] ist es gleichzeitig auch die kriminelle Hochburg Südafrikas.[11]
Die wirtschaftliche Situation ist verfahren. Bei schwarzen und farbigen Jugendlichen unter 20 Jahren beträgt die Arbeitslosenquote mehr als 70%. Im Vergleich dazu liegt die Arbeitslosenquote der Weißen bei 2%.[12] Johannesburg wird zu den zehn gefährlichsten Städten weltweit gezählt.[13]
Die Autorin besuchte in Begleitung eines schwarzen Südafrikaners,[14] der gebürtig aus Johannesburg stammt, das Township Soweto (SoWeTo - offizielle Abkürzung für South Western Townships),[15] das als Wiege der Anti-Apartheids-Bewegung und als ein Symbol des Widerstandes bezeichnet wird.[16]
Im Jahr 1976 wurde dort bei friedlichen Schülerprotesten gegen die Einführung von Afrikaans als Unterrichtssprache Hector Pieterson, ein südafrikanischer Schüler im Alter von zwölf Jahren, erschossen. Die Demonstrationen gingen unter dem Namen Soweto-Aufstand in die Geschichte Südafrikas ein.[17] Der Journalist und Redakteur Roman Heflik[18] bezeichnet den Tag, an dem Hector Pieterson starb, als
„den Anfang vom Ende der Apartheid“.[19]
Pieterson wurde durch seinen Tod zu einer Symbolfigur der schwarzen Bevölkerung in ihrem Kampf gegen das Apartheidsregime. Um die Anfänge und Wurzeln der Anti-Apartheidsgeschichte tiefer zu verstehen, besichtigte die Autorin die Gedenkstätte und das Museum, das in Erinnerung an Pieterson errichtet wurde.[20]
Des Weiteren besuchte sie in Soweto die Vilakazi Street, die einzige Straße weltweit, aus der zwei Nobelpreisträger stammen: Desmond Tutu und Nelson Mandela.[21]
Sie besichtigte dort das ehemalige Wohnhaus von Nelson Mandela, das heutzutage ein Museum ist, welches seinem Wirken und Leben als Anti-Apartheids-Kämpfer gewidmet ist.[22]
In Ormonde, einem Vorort von Johannesburg, informierte sie sich tiefergehend über die Geschichte der Apartheid in Südafrika, welche dort im Anti-Apartheids-Museum eindrücklich und facettenreich beleuchtet wird.
Die Dokumentation beginnt mit den frühen Anfängen der Apartheid, ihrer Entstehung ab 1948. Es wird die menschenverachtende und gesellschaftliche Entwicklung, bis hin zu ihrer Beendigung 1994, dargelegt. Hierbei wird der Museumsbesucher direkt mit in die Erfahrung und das Erleben der Rassentrennung hineingenommen, indem am Eingang z. B. willkürlich Eintrittskarten verteilt werden, auf denen die fiktive Rasse des Besuchers vermerkt ist. Je nachdem, ob er weiß, farbig oder schwarz ist, muss er das Museum durch unterschiedliche, seiner „Rasse“[23] zugeordnete Eingänge betreten.[24] Auf diese Art und Weise wird versucht etwas von der Willkür der Rassentrennung und ihren strukturellen Auswirkungen im Alltag zu vermitteln.[25] Auch der internationale, politische Kontext der Apartheid wird in der Ausstellung detailliert erläutert. Es ist das einzige Museum weltweit, das ausschließlich der Geschichte der Apartheid gewidmet ist. Ein großer Schwerpunkt wird hierbei auf die Aufarbeitung der Apartheid gelegt.
Im Januar 2014, als die Autorin vor Ort war, fand dort in Gedenken an Nelson Mandela, der einen Monat zuvor, am 5.12.2013, verstorben war,[26] gerade eine Sonderausstellung zu seinem Leben statt. In dieser Ausstellung wurden u. a. auch seine Beziehung zu Desmond Tutu und ihr gemeinsames Wirken beleuchtet.[27]
Die Verfasserin dieser Thesis bereiste im Anschluss Pretoria, die Hauptstadt Südafrikas.[28] Dort besuchte sie die Union Buildings, den Sitz der südafrikanischen Regierung. Diese waren von
1994-1999[29] auch der Regierungssitz Mandelas.[30] Im Dezember 2013 wurde er dort aufgebahrt, so dass das südafrikanische Volk von ihm Abschied nehmen konnte.[31] Beigesetzt wurde er zehn Tage später im Familiengrab in seinem Heimatdorf Qunu, welches in der südafrikanischen Provinz Ostkap liegt.[32]
In Pretoria nahm die Autorin außerdem an einer Führung durch den Freedom Park (deutsche Übersetzung: Freiheits-Park) teil. Dieser Park dient als Mahnmal und erinnert in symbolträchtiger Weise an die Menschen, die in kriegerischen Konflikten in Südafrika ihr Leben gelassen haben.[33]
Von dort aus führt direkt eine Straße mit dem Titel Road of Reconciliation (deutsche Übersetzung: Straße der Versöhnung) zu dem Voortrekker Monument,[34] einem Bauwerk,[35] entstanden im Zeitraum von 1937-1949, welches die Vorherrschaft der Weißen über die dort vorab lebenden einheimischen Stämme demonstriert. Ganz konkret erinnert das Monument an die kriegerischen Auseinandersetzungen der burischen Voortrekker mit den Zulus. Dieser Stamm wurde 1838 bei der Schlacht am Blood River vernichtend geschlagen.[36] Das Bauwerk zeugt von der gewaltsamen Kolonialisierung Südafrikas,[37] welche u. a. auch ideologische Grundlagen für die später folgende Apartheid legte.
Die Autorin reiste durch den Osten Südafrikas und führte Gespräche mit Südafrikanern unterschiedlichster Hautfarbe, unter der Fragestellung, wie 2014, also 20 Jahre nach der Apartheid, Menschen unterschiedlichster ethnischer Herkunft miteinander oder auch getrennt leben.
Von Kapstadt aus fuhr sie dann mit einem Schiff nach Robben Island,[38] die Insel auf der Nelson Mandela 18 Jahre als Gefangener gelebt hatte (1964-1982)[39], und besichtigte seine ehemalige Haftzelle. Ihr Weg führte sie in den Kalksteinbruch, in welchem Mandela und seine Kameraden in der glühenden südafrikanischen Hitze ohne Schutzbedeckung bis zu zehn Stunden pro Tag Steine von einer Ecke des Steinbruches in die andere transportierten, nur um sie am nächsten Tag wieder zurücktransportieren zu müssen.[40] Aufgrund dieser Arbeitsbedingungen, dem blendend gleißenden Licht und dem feinen Staub in dem weißen Kalksteinbruch ausgesetzt, erlitt Mandela Augenschäden[41] und erkrankte an Lungentuberkulose[42].
Um einen Einblick in die Lebensbedingungen zur Zeit der Apartheid zu bekommen, die Zwangsumsiedlungen miteinschlossen, besuchte die Autorin gemeinsam mit einem farbigen Südafrikaner verschiedene Townships in Kapstadt, u. a. die Cape Flats. Hierhin wurden ab den 1950er Jahren auf das damals unbewohnte Gebiet schwarze und farbige Südafrikaner, die aus dem Zentrum der Stadt vertrieben worden waren, zwangsumgesiedelt.[43] Des Weiteren besuchte sie das Township Langa,[44] das als eines der ersten Townships Südafrikas bezeichnet wird.[45]
Direkt vor Ort in den Wellblechhütten der Townships konnte sie dadurch, dass ihr südafrikanischer Begleiter die Kontakte herstellte, die Anwohner zu ihrem Leben während und nach dem Apartheidsregime interviewen.[46]
Abschließend fuhr sie nach Gugulethu, einem südlichen Vorort Kapstadts, der ebenfalls in der Zeit der Apartheidspolitik als Township errichtet worden war.[47] Dort nahm sie an einem Gottesdienst einer gemischtrassigen katholischen Kirche mit dem Namen St. Mark the Evangelist teil, um einen kleinen Einblick in die gelebte Spiritualität in den Townhsips zu bekommen.
In Gateswill, Athlone, einem Vorort von Kapstadt, besuchte sie die Moschee Masjidul Quds, um einen kurzen Einblick in das Leben der muslimischen Glaubensgemeinschaft vor Ort zu bekommen.[48]
Um sich tiefergehend mit den staatlich verordneten Zwangsumsiedlungen auseinanderzusetzen, besichtigte die Autorin das District Six Museum,[49] welches nach dem ehemaligen im Zentrum gelegenen Kapstadter Bezirk District Six benannt ist. In diesem Bezirk lebten freigelassene Sklaven, Händler, Künstler, Arbeiter und Immigranten. Ab den 1960er Jahren wurde im Rahmen der menschenverachtenden, rassistischen Politik der Apartheid der multiethnische Stadtteil gewaltsam geräumt, zerstört und als ein „weißes“ Wohnviertel deklariert. Im Zuge dessen wurden über 60.000 Menschen primär in die Cape Flats zwangsumgesiedelt und ihre Häuser mit Bulldozern zerstört.[50] Diese Ereignisse sind im District Six Museum dokumentiert.
Im Anschluss besuchte die Verfasserin die Ausstellung „Glimpsing Hope, Marching for Peace“ (deutsche Übersetzung: „Aufleuchtende Hoffnung, Demonstration für den Frieden“) in der Krypta der St. George Kathedrale. Die Ausstellung dort dokumentiert den Widerstand gegen die Apartheid in Form von Demonstationen, die in den 80er Jahren in Südafrika stattfanden.[51]
Einige Tage später, am 7. Februar 2014, traf die Autorin in der St. George Kathedrale in Kapstadt[52] Desmond Tutu und wohnte einer Messe bei, die er hielt. Im Anschluss daran hatte sie die Möglichkeit ihn für 25 Minuten zu interviewen.
Durch die Begegnung mit Desmond Tutu und anderen Südafrikanern (Schwarzen, Weißen und Farbigen) und den Aufenthalt in Südafrika hat der Autorin ein tieferes Verständnis für das Land, seine Kultur und Geschichte gewonnen.
1.2 Der Prozess der Wissensaneignung
Anhand des vorherigen Kapitels wurde deutlich, dass für die Autorin der persönliche Kontakt mit Zeitzeugen als ein Weg der Wissensaneignung zentral ist. Dies steht für sie im Gegensatz zu einer Informationssammlung, welche ausschließlich distanziert und abstrakt aus sicherer Entfernung aus dem wissenschaftlichen Elfenbeinturm heraus geschieht. Für sie war es entscheidend bei der wissenschaftlichen Auseinandersetzung mit einem Land dieses auch persönlich zu bereisen, um eigene Erfahrungen vor Ort sammeln zu können und nicht nur auf theoretisch angeignetes Wissen aus zweiter Hand angewiesen zu sein.
Ihre wissenschaftliche Arbeitsweise lehnt sie an das jüdische Verständnis von Erkenntnis an, welches nicht losgelöst aus einer abstrakten Distanz zu dem erforschenden Objekt geschieht, sondern demnach der Erkenntnisprozess und der Erkenntnisgewinn aus der Nähe und der Beziehung zu dem Objekt des Interesses erwächst.[53]
Für die Autorin war es entscheidend, wenn irgendmöglich, in eine direkte Beziehung mit dem zu erforschenden Objekt zu treten, welches in diesem Fall Desmond Tutu und die südafrikanische Nation, bestehend aus Menschen verschiedener Ethnien, war. Der Realitätsbezug und die direkte Auseinandersetzung mit der Lebenswelt der Menschen vor Ort ist für sie eines der Hauptkriterien für ihren Erkenntnisprozess im wissenschaftlichen Arbeiten.
Neben dem Bereisen des Landes, dem Betrachten der Geschichte durch südafrikanische Quellen, wie beispielsweise Museen, Ausstellungen, Gespräche mit Bürgern vor Ort und nicht nur dem Lesen der Geschichtsschreibung durch die Brille des westlichen Wissenschaftsbetriebes, gab es noch andere Ressourcen, die die Autorin miteinbezog.
Als weitere Quellen der Wissensaneignung diente ihr Literatur in Form von Biographien, Doktorarbeiten, Zeitungsartikeln, Berichten von Augenzeugen, Journalisten, Fotografen etc., die der Wahrheits- und Versöhnungskommission beigewohnt hatten. Des Weiteren band sie theologische Fachliteratur, unter anderem auch Lexika und Enzyklopädien, in ihr Studium mit ein. Eine weitere ganz entscheidende Ressource der Wissensaneignung waren Verschriftlichungen von Predigten, Ansprachen, Reden und Briefen Desmond Tutus, die er über einen Zeitraum von ca. 40 Jahren verfasst hat. Des Weiteren bezog sie Meinungsumfragen, Studien und Statistiken mit ein. Einen wesentlichen Zugang zum tieferen Verständnis der südafrikanischen Geschichte stellten des Weiteren Videoaufzeichungen in Form von Livemitschnitten der Wahrheits- und Versöhnungskommission dar.
Im Umgang mit den verschiedenen Informationsquellen nahm die Autorin folgende Gewichtung vor: Das höchste Maß an Priorität hatten für sie autobiographische Quellen, welche Aussagen Tutus umfassten. Einen weiteren Schwerpunkt legte sie auf theologische Fachliteratur, die sich mit Tutus Biographie und Theologie auseinandersetzte. Bei Berichten in Form von Zeitungsartikeln und Reportagen maß sie der Aussage südafrikanischer Journalisten, aus unterschiedlichen politischen Lagern, die der Wahrheits- und Versöhnungskommission beigewohnt hatten, eine höhere Bedeutung bei als den Aussagen der westlichen Presse, da sie der Überzeugung ist, dass südafrikanische Journalisten Prozesse innerhalb ihres eigenen Landes tiefergehend verstehen und erläutern können als Personen aus dem Ausland. Deshalb hatten die einheimischen Berichterstattungen eine höhere Priorität für die Autorin.
Des Weiteren lernte sie von Doktor- und Diplomarbeiten, die sich mit der Wahrheits- und Versöhnungskommission auseinander gesetzt hatten. Für die Definition von Fachbegriffen hatten Lexikonartikel und Enzyklopädien einen hohen Stellenwert. All diese Quellen sichtete und beurteilte sie im Licht der Südafrikareise, der Begegnung mit Menschen vor Ort, insbesondere im Kontext des Interviews mit Desmond Tutu.
1.3 Die Struktur
Die Thesis ist dabei wie folgt strukturiert: Nach Erläuterung der Themenfindung, der Informationssammlung und der Wissensaneignung wird im zweiten Kapitel der erkenntnistheoretische Ansatz transparent dargelegt. Das dritte Kapitel widmet sich der Definition der Kernbegriffe Nation, Interkulturalität, Mentoring, Rassismus und Apartheid. Die Historie des Rassismus wird im Kapitel vier unter Einbeziehung theologischer Aspekte beleuchtet. Das Kapitel fünf ist der Person Desmond Tutus, seiner Biographie, seiner Theologie, seinem Charakter und seiner Motivation und Vision gewidmet. Das sechste Kapitel untersucht die südafrikanische Ubuntu-Philosophie. Die Wahrheits- und Versöhnungskommission ist das Thema des siebten Kapitels. Das achte Kapitel setzt sich explizit mit dem Thema der Versöhnung aus einer theologischen, poltischen und gesellschaftlichen Perspektive auseinander. Exemplarische Beispiele dafür, welche Auswirkungen das Evangelium auf die individuelle und die kollektive Ebene hat, werden im neunten Kapitel angeführt. In Kapitel zehn wird der Blick in die Zukunft gerichtet, es wird untersucht, wie die Wahrheits- und Versöhnungskommission als Ereignis, das der Vergangenheit angehört, als Inspirationsquelle und globale Vorbildfunktion für nationale Konflikttransformationsprozesse dienen kann. Im elften Kapitel wird anhand von Zitaten von Freunden, Wegbegleitern und Kollegen Desmond Tutus Rolle als Mentor in individuellen und kollektiven Kontexten beleuchtet.
Der Kristallisationspunkt dieser Masterarbeit befindet sich im zwölften Kapitel, in welchem die These untersucht wird, ob Desmond Tutu im Rahmen der Wahrheits- und Versöhnungskommission im Aufarbeitungsprozess der Apartheid zu einem Mentor für die Nation Südafrikas wurde.
In Kapitel dreizehn wird über die Relevanz der These und ihre eventuelle Übertragungsmöglichkeit nach Deutschland und den damit verbundenen Implikationen nachgedacht.
Das Kapitel vierzehn ist den Gefahren des gesellschaftlichen Mentorings gewidmet und in Kapitel fünfzehn werden zwei Schlüsselelemente prägender Persönlichkeiten hervorgehoben: Authentizität und Integrität. In Kapitel sechzehn findet die Masterthesis ihren Abschluss und zusammenfassend wird die Ausgangsthese reflektiert.





























