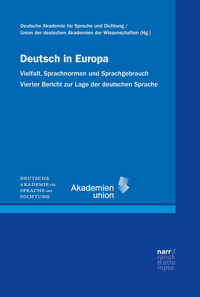
Deutsch in Europa E-Book
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Narr Francke Attempto Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Wo in Europa wird Deutsch gesprochen? Wie kam es dazu? Welchen gesellschaftlichen Status hat die deutsche Sprache in Europa? Wie gestaltet sich der Kontakt mit anderen Sprachen? Wie fügt sich Deutsch in ein mehrsprachiges Repertoire ein? Wie ist die Vitalität des Deutschen einzuschätzen? Diesen und anderen Fragen widmet sich der Vierte Bericht zur Lage der deutschen Sprache. Der erste Teil umfasst 15 Länder-Portraits, in denen wichtige Informationen zur Stellung des Deutschen (z.B. als Amts- oder Minderheitensprache) zusammengetragen werden. Diese >>Steckbriefe<< dienen als Grundlage für die sechs Themenfelder, die im zweiten Teil die Vielfalt des Deutschen über die Ländergrenzen hinweg darstellen. Dabei liegt der Schwerpunkt auf der gegenwärtigen Situation (z.B. im Hinblick auf den Deutschunterricht in mehrsprachigen Konstellationen, den Sprachkontakt und die Einstellungen zur deutschen Sprache), es werden aber immer wieder auch Bezüge zur Geschichte der deutschsprachigen Minderheiten hergestellt. Im Ganzen präsentiert sich so ein facettenreiches Bild des Deutschen in Europa - im Wechselspiel von Vielfalt, Sprachnormen und Sprachgebrauch.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 643
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Deutsch in Europa Vielfalt, Sprachnormen und SprachgebrauchVierter Bericht zur Lage der deutschen Sprache
Herausgegeben von der Deutschen Akademie für Sprache und Dichtung und der Union der deutschen Akademien der Wissenschaften
Gefördert vonErnst Göhner StiftungID BerlinUniversitätsbibliothek Zürich
DOI: https://doi.org/10.24053/9783381135226
Projektleitung: Christa Dürscheid, Rita Franceschini
© 2025 · Deutsche Akademie für Sprache und Dichtung und Union der deutschen Akademien der Wissenschaften; für die einzelnen Beiträge bei den Autorinnen und Autoren
www.deutscheakademie.de / www.akademienunion.de
Das Werk ist eine Open Access-Publikation. Es wird unter der Creative Commons Namensnennung – Weitergabe unter gleichen Bedingungen | CC BY-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) veröffentlicht, welche die Nutzung, Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und Wiedergabe in jeglichem Medium und Format erlaubt, solange Sie die/den ursprünglichen Autor/innen und die Quelle ordentlich nennen, einen Link zur Creative Commons-Lizenz anfügen und angeben, ob Änderungen vorgenommen wurden. Die in diesem Werk enthaltenen Bilder und sonstiges Drittmaterial unterliegen ebenfalls der genannten Creative Commons Lizenz, sofern sich aus der am Material vermerkten Legende nichts anderes ergibt. In diesen Fällen ist für die oben genannten Weiterverwendungen des Materials die Einwilligung des jeweiligen Rechteinhabers einzuholen.
Alle Informationen in diesem Buch wurden mit großer Sorgfalt erstellt. Fehler können dennoch nicht völlig ausgeschlossen werden. Weder Verlag noch Autor/innen oder Herausgeber/innen übernehmen deshalb eine Gewährleistung für die Korrektheit des Inhaltes und haften nicht für fehlerhafte Angaben und deren Folgen. Diese Publikation enthält gegebenenfalls Links zu externen Inhalten Dritter, auf die weder Verlag noch Autor/innen oder Herausgeber/innen Einfluss haben. Für die Inhalte der verlinkten Seiten sind stets die jeweiligen Anbieter oder Betreibenden der Seiten verantwortlich.
Narr Francke Attempto Verlag GmbH + Co. KG · Dischingerweg 5 · D-72070 Tübingen
Internet: www.narr.de eMail: [email protected]
ISBN 978-3-381-13521-9 (Print)
ISBN 978-3-381-13523-3 (ePub)
Inhalt
Geleitwort
Die Berichte zur Lage der deutschen Sprache erscheinen seit 2013; sie werden gemeinsam herausgegeben von der Deutschen Akademie für Sprache und Dichtung und der Union der deutschen Akademien der Wissenschaften. Die „acht wissenschaftlichen Schwestern und ihre schöne Halbschwester“ (Daniel Göske) verbindet bei diesem engen Zusammenwirken das Interesse an einer wissenschaftlich fundierten Auseinandersetzung mit Entwicklungen der deutschen Sprache. Seit dem ersten Bericht ist es gute Tradition, dass Sprachwissenschaftlerinnen und Sprachwissenschaftler zusammenkommen, um jeweils ein die Allgemeinheit besonders interessierendes Thema der Sprachentwicklung und der Sprachforschung gemeinsam über vier Jahre zu bearbeiten und die Ergebnisse in einem Band zusammengefasst vorzulegen. Diese vielbeachtete Reihe begann 2013 mit dem Bericht zu Reichtum und Armut der deutschen Sprache; 2017 wurden Vielfalt und Einheit der deutschen Sprache Thema; 2021 wandte sich der dritte Bericht der Sprache in den Schulen zu und betonte dabei den Aspekt der Sprache im Werden.
Der vierte unserer Sprachberichte liegt nun vor, auf der Grundlage ihrer eigenen jahrzehntelangen Forschungen konzipiert von den Projektleiterinnen Christa Dürscheid und Rita Franceschini und gemeinsam realisiert mit den von ihnen eingeladenen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern. Der vierte Bericht blickt über die Grenzen Deutschlands hinaus, er thematisiert „Deutsch in Europa“.
Dieser Blick über die Grenzen erscheint notwendiger denn je, um ein Bewusstsein für die Vielfalt der deutschen Sprache zu schaffen und damit selbstredend auch für historische Entwicklungen. Auf dieses Wissen können und wollen wir gerade heute nicht verzichten, da überall wieder alte und neue Grenzen errichtet werden. Auch deshalb hoffen wir, dass dieser Band national wie international die ihm gebührende Aufmerksamkeit finden wird.
Wir danken allen herzlich, die es möglich gemacht haben, dass die Akademien den Bericht zu „Deutsch in Europa“ ins Werk setzen konnten: Wir danken für die finanzielle Unterstützung von privaten und institutionellen Förderern, wir danken den Autorinnen und Autoren dieses Berichts, und wir danken insbesondere den Projektleiterinnen Christa Dürscheid und Rita Franceschini für ihre profunde Arbeit und ihren großen Einsatz.
Ingo Schulze
Christoph Markschies
Präsident der Deutschen Akademie für Sprache und Dichtung
Präsident der Union der deutschen Akademien der Wissenschaften
Einleitung
Wo in Europa wird Deutsch gesprochen? Wie kam es dazu? Welchen gesellschaftlichen Status hat die deutsche Sprache in Europa? Wie gestaltet sich der Kontakt mit anderen Sprachen? Wie fügt sich Deutsch in ein mehrsprachiges Repertoire ein? Wie ist die Vitalität des Deutschen einzuschätzen? Dies sind einige Fragen, die wir im vorliegenden Bericht behandeln werden.
Ausgangslage: Wie keine andere Sprache in Europa weist das Deutsche mitsamt seinen Dialekten eine beachtliche Verbreitung auf – sei es institutionell (als National- und Amtssprache, als anerkannte Minderheitensprache, als Zweit- und Fremdsprache) oder sei es areal (man vergegenwärtige sich beispielsweise die Ansiedlung Deutschsprachiger entlang der Wolga, die Präsenz des Deutschen in Ostbelgien sowie in Süddänemark und in Oberitalien). Dieses weite Sprachgebiet kann in ein zusammenhängendes gegliedert werden, in dem die Gebiete eine Kontinuität bilden, und in eines, das diejenigen Gebiete umfasst, die nicht an das zusammenhängende deutschsprachige Gebiet angrenzen und deshalb als Sprachinseln bezeichnet werden. Beides wird in diesem Bericht bedacht: Die Autorinnen und Autoren nehmen sowohl die Lage der deutschen Sprache im zusammenhängenden deutschsprachigen Raum in den Blick als auch die Sprachinseln in Italien, Polen, Rumänien, Russland, Tschechien, in der Ukraine und in Ungarn. Dabei geht es insbesondere um die Frage, wie sich die deutsche Sprache und ihre Dialekte in diesen Ländern erhalten haben und welche Merkmale hier jeweils spezifisch für das Deutsche sind.
Mit seiner hohen Sprecherzahl (rund 95 Millionen als Erstsprache und 30 Millionen als Zweitsprache) ist Deutsch in Europa die am zweithäufigsten gesprochene Sprache (nach Russisch) (Onlinequelle Nr. 1). Wie ist es dazu gekommen? Diese Ausbreitung hat historische Wurzeln, Deutsch kann auf eine lange Sprachmigration zurückblicken (im Band widmen wir diesem Thema ein eigenes Kapitel). Vor allem, aber nicht ausschließlich, aus süddeutschen Gebieten stammend, haben im Mittelalter viele Menschen weite Landstriche im Osten (etwa in Ungarn und Rumänien) und am südlichen Alpenkamm im heutigen Norditalien besiedelt. Getrieben von Hungersnöten oder aus religiösen Gründen, aber auch Lockangeboten oder Anweisungen von Fürsten folgend, waren diese Siedler, oftmals auch Händler und Kaufleute, ausgewandert. Davon sind heute – um es gleich vorwegzunehmen – nur noch wenige Gemeinschaften geblieben: Durch Kriege, Vertreibungen und die rezente Auswanderung in den EU-Raum wurden diese Sprechergruppen immer weiter minimiert.
Doch nicht allein mit der komplexen Geschichte der deutschsprachigen Minderheiten befasst sich unser Band, sondern auch mit den Gebieten, die man als Kernländer bezeichnet und oft mit dem Kürzel DACHL versieht: Deutschland, Österreich, die Schweiz und Liechtenstein. Wichtig ist jedoch zu betonen, dass der Schwerpunkt – anders als bei den drei vorangehenden Berichten zur Lage der deutschen Sprache1 – gerade nicht auf Deutschland liegt. Das deutsche Deutsch dient aber stets als Vergleichsgröße und wird insofern immer mitgedacht. Dies ist auch der Grund dafür, warum sich im Folgenden in den Länderporträts zusätzlich ein „Steckbrief“ zu Deutschland findet.2 Auch sei hier nochmals explizit darauf hingewiesen, dass sich der vorgelegte Bericht auf die Lage der deutschen Sprache in Europa beschränkt. Die Fülle der schon vorliegenden Daten rät zu einem solchen Zuschnitt. Eine Erweiterung der Perspektive auf den Gebrauch des Deutschen weltweit hätte sehr unterschiedlich gelagerte Fälle berücksichtigen müssen (z.B. enger Kontakt des Deutschen mit Englisch in den USA und in Australien; keine Kontaktmöglichkeiten mit der Herkunftsregion; andere Schul- und Rechtssituation; anderer Kulturkreis). Die vergleichende Systematisierung, die wir im zweiten Teil des Berichts vornehmen (z.B. in Bezug auf den Schulunterricht oder die Einstellung zur deutschen Sprache), ist mit der Beschränkung auf Europa bereits sehr komplex. Doch natürlich steht auf dieser Basis einer möglichen Erweiterung auf andere, nicht-europäische Sprachregionen in Zukunft nichts im Wege: auf Afrika (Deutsch in Namibia), auf den süd- und den nordamerikanischen Kontinent und auf Australien. Hierzu liegen bereits einige wichtige Arbeiten vor (für einen Überblick vgl. Ammon 1991, 2014, Plewnia/Riehl 2018, Riehl 2025).
Vielfalt als Schlüsselwort: Die Vielfalt des Deutschen zielt nicht allein auf Quantitäten ab, sondern ebenso auf Qualitäten. Von der Vielfalt der Dialekte ausgehend und über die Vielfalt der Sprachformen selbst innerhalb des Standards hinaus kann Deutsch mannigfache Rollen beim Spracherwerb einnehmen, in unterschiedlichen Sprachkontakten stehen (mit romanischen, slawischen, finnougrischen und anderen germanischen Sprachen), in unterschiedliche Konstellationen von Mehrsprachigkeit eingebunden sein sowie eine Vielfalt von Rechtsformen einnehmen, wie sie keine andere Sprache in Europa in dieser Breite vorzuweisen hat. Deshalb ist Vielfalt ein Schlüsselwort für unseren Bericht zu Deutsch in Europa. Die Vielfalt des Deutschen zeigt sich auch in den charakteristischen Merkmalen, die Deutsch in seinen als Standard angesehenen Varianten von Nord nach Süd, von Ost nach West einnimmt. Dabei wird das, was im Sprachgebrauch in der einen Region als Norm gilt, in einer anderen möglicherweise als nicht mehr zur Norm gehörig angesehen. Auch darin zeigt sich die Vielfalt des Deutschen: Auf standardsprachlicher Ebene sind verschiedene Gebrauchsformen (sprich: Varietäten) zu unterscheiden, die sich durch das Vorkommen unterschiedlicher Varianten konstituieren.3 Beispiele für solche Varianten finden sich nicht nur in der Aussprache, sondern etwa auch im Wortschatz (z.B. Topfen vs. Quark) oder in der Grammatik, so in der Artikelwahl (z.B. das Drittel/die Drittel).4
Sprachnormen und Sprachgebrauch: Damit kommen wir zum zweiten und dritten Stichwort im Titel des vorliegenden Berichts. Wir legen hier einen deskriptiven Normenbegriff zugrunde, der nicht mit Wertungen verbunden ist (siehe dazu auch Eisenberg 2017). Damit einher geht die Annahme, dass Normen nicht absolut gelten, sondern immer relativ sind, also in Relation zur jeweiligen Varietät und zum jeweiligen Gebrauchskontext stehen (auch in einem Geschäftsbrief gelten andere Normen als in einer privaten E-Mail). Doch wie kann man das Wechselspiel von Sprachnormen und Sprachgebrauch in seiner Vielfalt erfassen? Dazu sind verlässliche Informationen über das Vorkommen und die Frequenz von sprachlichen Varianten erforderlich. Dies geschieht auf empirischer Ebene etwa durch Online-Befragungen oder die Auswertung großer Datenmengen (z.B. Zeitungsartikel, Romane, Tonaufnahmen). Solche Untersuchungen zeigen: Das Deutsche ist eine Sprache mit verschiedenen Zentren, die je eigene standardsprachliche Varianten aufweisen (Schmidlin 2011). Oder anders gesagt: Das Deutsche ist eine plurizentrische Sprache (wie beispielsweise auch das Englische und das Französische). Das Auftreten solcher Varianten (vgl. auch Trottoir vs. Bürgersteig; Tram vs. Straßenbahn) ist oft nicht an die jeweiligen Landesgrenzen gebunden, sondern korreliert in vielen Fällen mit großräumigen Gebieten (z.B. Süddeutschland, Norddeutschland; Ostösterreich, Westösterreich). Um diesem Umstand Rechnung zu tragen, wird in der Forschung neben dem Terminus ,plurizentrischʻ häufig auch die Bezeichnung ,pluriarealʻ verwendet (Elspaß 2025). Von besonderem Interesse ist vor diesem Hintergrund die Frage nach dem Gebrauch der Standardsprache und seiner Normorientierung in den Sprachinseln, also in Italien, Polen, Rumänien, Russland, Tschechien, in der Ukraine und in Ungarn. Auch auf diese Frage sucht der Bericht nach Antworten.
Zielsetzung: Dass die deutsche Sprache sowohl auf standardsprachlicher Ebene als auch in ihren vielen dialektalen Varietäten eine beachtliche Vielfalt aufweist, wird in einschlägigen Arbeiten zwar oft dargestellt, was aber meist fehlt, ist eine Reflexion über die Wirkkraft des Deutschen außerhalb Deutschlands. Noch immer gilt das deutsche Deutsch als die Leitvarietät. Dass sich die deutsche Sprache außerhalb Deutschlands auch auf standardsprachlicher Ebene durch verschiedene Varietäten konstituiert, wird meist nicht wahrgenommen oder als Abweichung von der (deutschlanddeutschen) Norm angesehen. In unserem Bericht wird dagegen ein dynamischer, im Gebrauch verankerter Sprachbegriff zugrunde gelegt. Verbunden damit ist das Ziel, das Bewusstsein für das Konzept verschiedener Gebrauchsnormen und verschiedener Varietäten zu schärfen. Damit wenden wir uns nicht nur an Fachkolleginnen und -kollegen, sondern – und dies vor allem – an ein interessiertes, nicht-linguistisches Publikum. So werden im Folgenden viele Informationen gegeben, die für eine breitere Öffentlichkeit interessant sein könnten (z.B. Hinweise auf wichtige Nachschlagewerke, Wörterbücher, Sprachkarten). Das Glossar, das diesem Buch beigefügt ist, soll zudem die Lektüre erleichtern. Es bietet die Möglichkeit, Fachausdrücke, die im Bericht verwendet werden, nachzuschlagen und sich auf diese Weise rasch zu orientieren. Die Wörter, die im Glossar erfasst sind, sind in den folgenden Kapiteln jeweils bei Erstnennung mit einem Pfeil → versehen.
Forschungslage: Wie dargelegt, betrachten wir das Gesamt der deutschen Standardsprache in Europa einschließlich seiner Dialekte. Nicht dass es dazu keine Literatur gäbe: Überblicksdarstellungen (die man als Pionierwerke bezeichnen kann) findet man früh schon in Wiesinger (1983), Ammon (1995), Hinderling/Eichinger (1996) wie auch in Stickel (1997). Überhaupt wird im Umfeld des Leibniz-Instituts für Deutsche Sprache (IDS Mannheim) seit jeher ein besonderes Augenmerk auf die Situation deutschsprachiger Minderheiten in Europa gerichtet (Eichinger/Plewnia/Riehl 2008, Beyer/Plewnia 2019, Riehl 2025). Nur dank dieser guten Datenlage konnte mit dem vorliegenden Band eine Neuerung angestrebt werden: Nachdem im ersten Teil die Sprachprofile einzelner Länder relativ traditionell dargestellt worden sind und sich so schnell ein konziser Überblick hat gewinnen lassen, befassen sich die Beiträge im zweiten Teil länderübergreifend mit thematischen Querverbindungen zwischen den Gebieten (z.B. zur Unterrichtssituation in den verschiedenen Ländern). Eine solch transversale Sichtweise über Areale hinweg ist ein Novum gegenüber bisherigen Darstellungen. Wie auch die Querverweise in den folgenden Kapiteln zeigen, versuchen wir zudem, die verschiedenen Themenfelder (historische Dimension, schulische Bedingungen, Einstellungen zum Deutschen, Sprachkontakt- und Mehrsprachigkeitssituationen, charakteristische sprachliche Phänomene im Gebrauchsstandard, Vitalität des Deutschen) zueinander in Beziehung zu setzen und zu systematisieren. Gerade dies ist angesichts der Fülle an verschiedenartigen Fällen – d.h. angesichts einer hohen Variation – eine große Herausforderung. Zu gerne sieht man jedes Sprachgebiet als einzigartig an, was es unbestritten ist, doch gibt es gute Gründe, nicht nur die Unterschiede, sondern auch die Gemeinsamkeiten herauszuarbeiten. So sind es vergleichbare Merkmale der deutschen Sprache, die sich über die Zeit entwickelt haben und insbesondere in den Dialekten greifbar werden. Ferner sind die Umweltbedingungen – man spricht auch von Sprachökologie – miteinander insofern vergleichbar, als sie einen ähnlichen Rahmen für die Entwicklung der deutschen Sprache setzen. Dabei stellen sich verschiedene Fragen: Wie wirken sich z.B. die Einstellungen auf den Umgang mit dem Deutschen aus? Wie sich die Kriege auf das Prestige der deutschen Sprache ausgewirkt haben, ist leicht zu erraten. Aber wie sieht es mit der heutigen jüngeren Generation aus? Diese Bedingungen sind zu berücksichtigen, wenn wir uns Fragen zum vielfältigen Gebrauch der deutschen Sprache stellen, sei es zur Variation der Standardsprache als auch, offensichtlicher, zu derjenigen der Dialekte.
Themenauswahl: Bevor wir die Konzeption und den Aufbau des Buches skizzieren, sei an dieser Stelle darauf hingewiesen, welche Varietäten bzw. Sprachen trotz der breiten Erfassung ausgeklammert wurden. Dazu gehören bspw. die Nahsprachen des Deutschen (so Niederdeutsch, Jiddisch, Friesisch und Luxemburgisch5). Dies sind eigenständige Sprachen, keine Dialekte des Deutschen.6 Verzichtet haben wir auch auf ein Kapitel zur Gebärdensprache. Das hängt nicht primär damit zusammen, dass die Darstellung zu komplex geworden wäre, da z.B. allein in den drei Kernländern des Deutschen drei verschiedene Gebärdensprachen verwendet werden, die Deutsche Gebärdensprache (DGS), die Österreichische Gebärdensprache (ÖGS) und die Deutschschweizer Gebärdensprache (DSGS).7 Der Hauptgrund ist ein anderer: Auch Gebärdensprachen sind eigenständige Sprachen. Dies muss eigens betont werden, da vielerorts die Meinung vorherrscht, dass das Gebärden neben dem Sprechen und Schreiben lediglich eine weitere Ausdrucksform ein und derselben Sprache sei. Das freilich ist nicht der Fall (Meili 2023), Gebärdensprachen haben wie Lautsprachen je ein eigenes Sprachsystem, das über mehrere Komplexitätsstufen bis hin zur Satzebene reicht. Eine Bezeichnung wie ,Deutsche Gebärdenspracheʻ (DGS) beispielsweise bezieht sich also lediglich darauf, dass diese Sprache in Deutschland gebraucht wird, aber nicht darauf, dass es sich sprachstrukturell um das Pendant zur deutschen (Laut-)Sprache handeln würde.
Konzeption und Aufbau: Der vorliegende Bericht besteht aus zwei Teilen. Der erste Teil dient mit seinen 15 Länder-Steckbriefen als Grundlage für die sechs Themenfelder, die im zweiten Teil unter der Überschrift „Über die Ländergrenzen hinweg“ behandelt werden. In den Steckbriefen werden Zahlen und Fakten zur Stellung des Deutschen zusammengetragen, etwa zu seiner institutionellen Stellung im Staatsgefüge (z.B. als Amts- oder Minderheitensprache) oder zu seiner Sichtbarkeit im öffentlichen Raum. Um eine bessere Vergleichbarkeit zu gewährleisten, sind zudem alle Informationen in tabellarischer Form aufgelistet. Jeder Tabelle vorangestellt ist ein kurzer Text mit Erläuterungen zum Gebrauch des Deutschen im betreffenden Land. Die Steckbriefe sind alphabetisch nach Ländernamen geordnet (Belgien, Dänemark, Deutschland, Frankreich, Italien, Liechtenstein, Luxemburg, Österreich, Polen, Rumänien, Russland, Schweiz, Tschechien, Ukraine, Ungarn). Sie wurden von Kolleginnen und Kollegen verfasst, die aufgrund ihrer Biographie bzw. ihres fachlichen Hintergrunds einen engen Bezug zur Sprachsituation im jeweiligen Land haben. Dies ermöglicht es, eine Innensicht zu präsentieren, die weit über das hinausgeht, was sich in einschlägigen Lexika als enzyklopädisches Wissen zum jeweiligen Sprachgebiet findet. Allerdings wird man keine Steckbriefe zur Slowakei und zu Slowenien vorfinden, einerseits weil sich in der Slowakei nur noch wenige (in der letzten Volkszählung 2021 lediglich 4000 Personen) als Mitglieder der deutschsprachigen Minderheit erklärt haben und andererseits weil es keinerlei staatliche Anerkennung des Deutschen gibt. In Slowenien liegt der Fall ähnlich: Deutsch wird lediglich – im Sinne von Art. 7 der Europäischen Charta der Regional- oder Minderheitensprachen des Europarates – als „Ausdruck des kulturellen Reichtums“ erwähnt, ohne dass daraus beispielsweise eine schulische Unterstützung abgeleitet würde.
Hingewiesen sei an dieser Stelle auch darauf, dass der Schwerpunkt der Steckbriefe auf einer Darstellung der gegenwärtigen Situation in den betreffenden Ländern liegt. Doch sollten Rückgriffe auf wichtige Veränderungen auf der historischen Landkarte Europas nicht ausgelassen werden, und dies v.a. nicht in Sprachinselsituationen, die aus der Geschichte einen Großteil ihrer Zusammengehörigkeit ableiten und wo Deutsch manchmal nur noch als Erinnerungssprache existiert. Zudem erweist sich der auf die Gegenwart konzentrierte Zuschnitt der Steckbriefe mit seinem Bezug auf heutige Ländergrenzen in einigen Fällen als ein zu enges Korsett. Man halte sich bspw. das Gebiet der Bukowina vor Augen (mit Czernowitz als Zentrum), heute durch die ukrainisch-rumänische Grenze geteilt, doch ehemals auch Teil Österreich-Ungarns. Wir sind uns dieser wechselvollen Zugehörigkeiten vieler Gebiete sehr bewusst und haben auch deshalb eigens ein Kapitel zur historischen Entwicklung deutschsprachiger Gemeinschaften aufgenommen (siehe Kap. 1 in diesem Band).
Der zweite Teil des Buches präsentiert die Vielfalt des Deutschen auf transversaler Ebene. Wichtig ist dabei jeweils die empirische Fundierung. Das geschieht unter Rückgriff auf bereits vorhandene Korpora (z.B. auf das Korpus „Deutsch heute“ vom Leibniz-Institut für Deutsche Sprache, das eine Vielzahl von Tonaufnahmen umfasst) und auf anschaulich gestaltete Sprachkarten (z.B. Auszüge aus dem Atlas zur deutschen Alltagssprache [AdA] oder dem Atlas zur Aussprache des deutschen Gebrauchsstandards [AADG]).8 Die Themen, die in den sechs Beiträgen behandelt werden, stellen wir weiter unten kurz vor, hier sei noch darauf hingewiesen, dass insgesamt 22 Autorinnen und Autoren an dem vorliegenden Bericht mitgearbeitet haben. So konnte in fachlicher Hinsicht ein enormes Wissen zusammengetragen werden.
Jeder Steckbrief und jeder thematische Beitrag hat seinen je eigenen Charakter. Wir als Projektleiterinnen haben diesem Umstand Rechnung getragen und uns einerseits bemüht, den Bericht zu einem kohärenten Ganzen zusammenzufügen. Andererseits haben wir alle inhaltlich vertretbaren Unterschiede in der Länge und im Detaillierungsgrad belassen, da wir den Schreibenden einen möglichst großen Spielraum gewähren wollten. Abgesehen von dem Hinweis, dass das Amtliche Regelwerk zur deutschen Rechtschreibung verbindlich sei (weshalb auf den Genderstern verzichtet werden sollte), gab es z.B. keine Vorgaben zum geschlechtergerechten Sprachgebrauch. Folglich wird in manchen Texten das generische Maskulinum verwendet und in anderen durchweg die Doppelnennung oder andere geschlechterneutrale Formulierungen. Auch auf stilistischer Ebene haben wir nur wenig eingegriffen; jeder Text trägt – metaphorisch gesprochen – die Handschrift des/der jeweils Schreibenden.
Über die Ländergrenzen hinweg (Teil II): Im Folgenden skizzieren wir kurz den Inhalt der sechs Beiträge, in denen das Deutsche systematisierend-vergleichend betrachtet wird.
Claudia Maria Riehl macht den Auftakt; ihr Beitrag trägt den Titel „Zur Entstehung deutschsprachiger Gemeinschaften außerhalb deutschsprachiger Staaten: ein Überblick“. In einem ersten Schritt beschreibt sie die Entstehung deutschsprachiger Sprachinseln in Osteuropa, dann geht sie auf die mittelalterliche Migration nach Oberitalien ein, wo sich aufgrund der Abgeschiedenheit der Siedlungen die deutsche Sprache über Jahrhunderte erhalten hat. Schließlich folgt ein historischer Überblick zu den deutschsprachigen Minderheiten in den Gebieten, in denen es durch neue Grenzziehungen zu einer Neupositionierung der Sprachgebiete kam (wie z.B. im Elsass). Deutlich wird, dass es in der Geschichte des Deutschen ganz unterschiedliche Sprachkontaktkonstellationen gab, wobei die jeweilige Umgebungssprache maßgeblich den Status des Deutschen in der jeweiligen Region geprägt hat.
Der zweite Beitrag mit dem Titel „Deutsch in der Schule in mehrsprachigen Konstellationen“ stammt von Stefan Rabanus und Pascale Erhart. Sie beschreiben die Situation des Deutschunterrichts in denjenigen Ländern außerhalb des DACHL-Raums, in denen Deutsch nicht nur als Fremdsprache unterrichtet wird, sondern – wie sie schreiben – „in irgendeiner anderen Form anerkannt wird“. Nach einem Überblick über die Situation in Luxemburg, Belgien, Frankreich, Italien, Ungarn, Rumänien, Tschechien, Polen und Dänemark kommen sie u.a. zu dem Schluss, dass es der bundesdeutsche Standard ist, der in allen untersuchten mehrsprachigen Situationen als Orientierung dient (und dies auch in den historisch eng mit Österreich verbundenen Ländern), was damit zusammenhängt, dass in der Regel Lehrwerke deutscher Verlage verwendet werden.
Im dritten Beitrag, verfasst von Agnes Kim, Wolfgang Koppensteiner und Alexandra N. Lenz, der den Titel „Sprache(n) und Identität – Einstellungen zu Deutsch und seinen Varietäten“ trägt, werden grundlegende Fragen zur identitätsstiftenden Funktion von Sprache gestellt. Wie verhält es sich z.B., wenn – wie etwa im Fall von Österreich – die Staatenbezeichnung (d.h. Österreich) nicht mit der Bezeichnung für die im Land mehrheitlich gebrauchte Sprache (d.h. Deutsch) übereinstimmt? Und welche Rolle spielt Deutsch für die Identitätskonstruktion in den Ländern, in denen es als Minderheitensprache tradiert wird? Der Beitrag präsentiert aktuelle Studien zu Spracheinstellungen und legt dabei den Schwerpunkt auf die Länder bzw. Regionen, in denen Deutsch amtssprachlichen Status hat (Österreich, Südtirol, Schweiz, Liechtenstein, Luxemburg, Ostbelgien). Im Fazit zeigt sich: Deutsch ist nicht nur im Hinblick auf den Sprachgebrauch vielgestaltig, es ist auch eine der einstellungsreichsten Sprachen in Europa.
Der vierte Beitrag trägt den Titel „Sprachkontakt und Mehrsprachigkeitskonstellationen“. Rita Franceschini und Claudia Maria Riehl geben zunächst wichtige Erläuterungen zum Konzept der inneren und äußeren Mehrsprachigkeit und zum Codeswitching, dann beschreiben sie verschiedene Sprachkontaktkonstellationen, in denen das Deutsche eine Rolle spielt, und veranschaulichen dies anhand von Beispielregionen (z.B. Siebenbürgen, Südtirol). Dabei wird deutlich, dass ein Kontinuum besteht zwischen Sprachgemeinschaften, die nur wenige Sprachkontakterscheinungen zeigen, bis hin zu Gemeinschaften, in denen Vereinfachungs- und Restrukturierungsprozesse auftreten (z.B. das Deutsche in Transkarpatien). Im zweiten Teil verschiebt sich die Perspektive auf das Individuum. Gezeigt wird anhand einiger prototypischer Fälle, dass die deutsche Sprache in den individuellen Sprachrepertoires ganz verschiedene Positionen einnehmen kann. Dabei wird auch immer wieder der Bogen zurück zu den zuvor dargestellten Kontaktkonstellationen geschlagen.
Im Beitrag „Sprachliche Phänomene: Norm und Variation im Gebrauchsstandard – Lexik, (Morpho-)Syntax, Aussprache“ von Stephan Elspaß, Elvira Glaser, Stefan Kleiner und Robert Möller wird zunächst treffend festgestellt, dass es wohl nur noch wenige Forschende gibt, „die das Standarddeutsche für eine monolithische Varietät halten bzw. denken, dass es nur ein Standarddeutsch gebe, das für die geschriebene wie für die gesprochene Sprache sowie in allen deutschsprachigen Gebieten gleichermaßen Gültigkeit beanspruchen könne“. Sodann wird aufgezeigt, worin die Vielfalt des Standarddeutschen über die Ländergrenzen hinweg besteht. Dabei wird der Schwerpunkt auf eine Darstellung des Gebrauchsstandards gelegt, d.h. auf das, was mit bestimmter Häufigkeit in Texten formeller Mündlichkeit (z.B. in Vorträgen) bzw. formeller Schriftlichkeit (z.B. in Zeitungen) vorkommt. Präsentiert werden ausgewählte Phänomene, die im Bereich der Aussprache aus dem Atlas zur Aussprache des deutschen Gebrauchsstandards (AADG), im Bereich des Wortschatzes aus dem Variantenwörterbuch (VWB) und dem Atlas zur deutschen Alltagssprache (AdA) und im Bereich der Grammatik aus der Variantengrammatik (VG) stammen. Ergänzt wird der Beitrag um Tonbeispiele, die auf der Internetseite des IDS abrufbar sind (Onlinequelle Nr. 3).
Der letzte Beitrag hat perspektivischen Charakter. Hier geht es um „Die Vitalität des Deutschen in Europa“. Die Verfasser, Ludwig M. Eichinger und Albrecht Plewnia, nehmen sowohl Bezug auf die in den vorangehenden Beiträgen angesprochenen Positionen (z.B. zum Thema Sprache und Identität) als auch auf die Informationen aus den Steckbriefen (z.B. zur Sichtbarkeit des Deutschen im öffentlichen Raum). Auf dieser Basis legen sie dar, wie vital die deutsche Sprache in ihrer Gesamtheit ist. Diese Vitalität, so zeigen sie auf, ist auch der Tatsache zu verdanken, dass es bis zum Ende des 18. Jahrhunderts gelungen ist, eine durchgehend akzeptierte ‚Hochsprache‘ zu entwickeln – eben das Standarddeutsche. Damit einher gehen Ausdifferenzierungen an verschiedenen Stellen, bedingt beispielsweise durch das Vorkommen des Deutschen in offiziell mehrsprachigen Kontexten oder als Minderheitensprache. Was die aktuelle Lage und die Zukunft der deutschen Sprache betrifft, nehmen die beiden Verfasser eine optimistische Perspektive ein. Sie halten fest: „Wie man sieht, ist das Deutsche als voll ausgebaute große europäische Kultursprache in seiner Existenz nicht gefährdet. Das System des Deutschen hat aktuell einen Ausbau- und Differenziertheitsgrad erreicht, der höher ist denn je, und ist damit so leistungsfähig wie nie zuvor.“
Fazit: Wie unser Sprachbericht zeigt, ist das Deutsche eine Sprache, die vital, leistungsfähig und in mehrerer Hinsicht vielgestaltig ist: vielgestaltig in ihrem Vorkommen, vielgestaltig in ihrer Geschichte, vielgestaltig im aktuellen Sprachgebrauch. Zu diesem facettenreichen Bild tragen nicht nur die Dialekte des Deutschen bei, die Vielfalt des Deutschen erkennt man auch – und darauf liegt der Schwerpunkt im vorliegenden Bericht – auf standardsprachlicher Ebene. Keineswegs gibt es in formellen Kontexten nur das eine Standarddeutsch, an dem man sich im zusammenhängenden deutschsprachigen Raum, in den angrenzenden Regionen und in den Sprachinseln orientieren würde. Im Gegenteil: Jede Region weist eigene deutschsprachige Spezifika und eigene Sprachgebrauchsnormen auf, die in aktuellen wissenschaftlichen Untersuchungen, in Nachschlagewerken, auf Sprachkarten etc. gut dokumentiert sind. Ziel des vorliegenden Bandes ist, so wurde weiter oben dargelegt, das Bewusstsein für diese Vielfalt zu schärfen. Auch deshalb haben wir uns in unserer Bestandsaufnahme zu Deutsch in Europa für die Kombination von länderspezifischen Informationen (Teil I) und Beiträgen entschieden, die quer zu den einzelnen Sprachregionen liegen (Teil II). Auf diese Weise, so hoffen wir, erhalten die Leserinnen und Leser interessante Informationen zum Gebrauch des Deutschen, zu seiner Stellung im Kontakt zu anderen Sprachen und den damit einhergehenden mehrsprachigen Bedingungen – und das sowohl aus arealer als auch thematisch übergreifender Perspektive.
Dank: Neben den Autorinnen und Autoren dieses Berichts möchten wir allen Kolleginnen und Kollegen danken, die uns mit Rat und Tat zur Seite gestanden sind und ihre geschätzte Expertise eingebracht haben. Es sind dies: Wolfgang Dahmen, Jeroen Darquennes, Katharina Dück, Peter Eisenberg, Andreas Gardt, Anna Jorroch, Wolfgang Klein, Nils Langer, Johanna Tausch, Alfred Wildfeuer, Evelyn Ziegler.
Literatur
Onlinequellen (Stand: 07.02.2025)
Nr. 1: https://vasco-electronics.de/artikel/sprachen/die-10-meistgesprochenen-sprachen-in-europa/
Nr. 2: https://www.dwds.de/wb/Steckbrief
Nr. 3: https://prowiki.ids-mannheim.de/bin/view/AADG/ElspassGlaserKleinerMoellerTondaten
Teil ILänder-Steckbriefe
Deutsch in Belgien
Nach dem Territorialprinzip ist Belgien seit 1963 in Sprachgebiete aufgeteilt. Das offiziell deutsche Sprachgebiet am Ostrand des Landes – Deutschsprachige Gemeinschaft (DG), zunehmend: Ostbelgien – mit Deutsch als Amts-, Gerichts- und Schulsprache geht auf das nach dem Ersten Weltkrieg von Deutschland an Belgien abgetretene Gebiet zurück. Die Mehrsprachigkeit des belgischen Staats ist heute in komplexer Weise in der Verfassung verankert, gegliedert wird einerseits nach Regionen (mit Kompetenzen vor allem in Wirtschafts- und Umweltfragen) und andererseits nach Gemeinschaften (ehemals Kulturgemeinschaften; mit Kompetenzen in Kultur, Bildung und Sozialpolitik). Die DG ist als Gemeinschaft eigenständig, gehört (bislang) aber zur weitestgehend frankophonen Wallonischen Region (mit ständig zunehmender Emanzipation von dieser, siehe Onlinequelle Nr. 1).
In der DG ist die Position des Deutschen völlig unangefochten; die Stärkung und Förderung der deutschen Sprache sahen hier lediglich 10 % der Befragten in einer repräsentativen Befragung 2022 als wichtige Aufgabe an (in den vorangehenden Befragungen seit 2011 sogar nur 6 % bzw. 2 % [INFO 2023]; der leichte Anstieg könnte darauf zurückgehen, dass ein Förderungsbedarf bei Migranten mit außerbelgischer Herkunft gesehen wird). Die Dominanz des Deutschen wird im Alltag durch die unmittelbare Nähe zu Deutschland bestärkt; auch Zuzug von Deutschen ist häufig (2021 waren knapp 15 % der Bewohner Deutsche [Heukemes 2022]). Die Ostbelgier legen indessen Wert auf die Abgrenzung zu Deutschland, die meisten identifizieren sich klar mit einer durch die Kombination von belgischer Nationalität und deutscher Sprache definierten Heimat; zum Selbstbild gehört dabei auch die Mehrsprachigkeit (Möller 2017: 89, 113f., Bouillon 2019: 68, Rasp/Cosme 2023: 100, 104, siehe auch Kap. 3 in diesem Band).
Das belgische Gebiet, in dem germanische Dialekte gesprochen werden (resp. wurden), die traditionell vom → Gemeindeutschen als Schrift- und Kultursprache überdacht wurden, reicht an mehreren Stellen noch nach Westen (und Süden) über das offizielle deutsche Sprachgebiet hinaus. Diese Gegenden gehören jedoch schon seit der Staatsgründung 1830 zu Belgien, und das Deutsche wird dort seitdem immer weiter vom Französischen verdrängt (Darquennes 2019: 1067–1070). Als überdachende → Standardsprache (→ Überdachung) ist hier spätestens seit dem Ersten Weltkrieg – auch als Reaktion darauf – eindeutig das Französische etabliert, existierende Sonderrechte vor allem in Bezug auf die Schulsprache werden nicht wahrgenommen, und der Abbau der Dialekte ist schon weit fortgeschritten. Erstsprache jüngerer Personen sind deutsche → Varietäten hier nicht mehr, es besteht nur teilweise noch ein verstärktes Interesse an Deutsch bzw. Luxemburgisch als Fremdsprache (Darquennes 2019: 1070).
Deutsches Sprachgebiet in Belgien. © Robert Möller.
Die Dialekte in Ostbelgien unterscheiden sich relativ stark voneinander, auch in ihrer Lebendigkeit; auf sprachlicher Ebene und in ihrem Gebrauch setzen sich hier die Verhältnisse im angrenzenden Deutschland nach Westen fort, während innerhalb des belgischen Gebiets größere Differenzen bestehen, die auch deutlich wahrgenommen werden (Möller 2017: 91, 97f.). Durch einen Streifen, der zum frankophonen Gebiet gehört, ist die DG territorial in zwei Hälften geteilt, darüber hinaus werden beide Hälften durch das Hohe Venn, ein weitgehend unbesiedeltes Hochmoorgebiet, getrennt. In der Nordhälfte, dem Eupener Land (sowie westlich anschließend), gehören die Dialekte größtenteils zum Südniederfränkischen (wie jenseits der Grenze im niederländischen Limburg), in der Südhälfte um Sankt Vith und im südlichen Dialektgebiet außerhalb der DG größtenteils zum Moselfränkischen (wie auch jenseits der Grenze das Luxemburgische). Dazwischen gibt es noch → ripuarische Ortsdialekte. Ein deutlicher Nord-Süd-Unterschied zeigt sich auch im Dialektgebrauch: Von einzelnen Orten abgesehen ist Dialektgebrauch im nördlichen Teil kaum noch üblich und Dialektkompetenz bei jungen Menschen selten, im weniger urbanisierten südlichen Teil (Eifel) ist der Dialekt dagegen oftmals noch Alltagssprache, auch unter Jüngeren.
Ob von einer ostbelgischen Standardvarietät des Deutschen die Rede sein kann oder nicht, kann unterschiedlich betrachtet werden (Küpper/Leuschner/Rothstein 2017, Möller 2017, Darquennes 2019, Rasp/Cosme 2023): Eine eigene Kodifikation existiert, außer im Bereich der Rechtsterminologie, nicht und wird auch nicht diskutiert; in populären Darstellungen regional üblicher Ausdrücke werden diese als alltagssprachlich bzw. regiolektal („zwischen Standardsprache und Mundart“) charakterisiert (Regionalsprachendatenbank, Einleitung). Im Schulunterricht gilt der bundesdeutsche Standard als Norm, die Toleranz von Lehrkräften gegenüber den ostbelgischen Varianten schwankt und hängt teilweise auch davon ab, inwieweit ihnen selbst bewusst ist, dass bestimmte Varianten im bundesdeutschen Gebrauch unüblich sind – ist dies der Fall, werden sie häufig als falsch oder zumindest umgangssprachlich eingestuft und korrigiert (Rasp/Cosme 2023: 99–102). Für die Annahme eines ostbelgischen Gebrauchsstandards spricht allerdings die Verwendung ostbelgischer Varianten auch im formellen Gebrauch. So kommen etwa in den ostbelgischen Medien belgische Varianten neben ihren bundesdeutschen Äquivalenten vor. Spezifische und gleichzeitig im ganzen Gebiet übliche ostbelgische Merkmale sind infolge der dialektalen Verschiedenheit und der Gemeinsamkeiten mit dem angrenzenden Deutschland vor allem lexikalische Übernahmen aus dem Französischen. Bei den 41 im Variantenwörterbuch (VWB) verzeichneten ostbelgischen Varianten (= solche, die in ostbelgischen Printmedien frequenter angetroffen wurden) handelt es sich weitgehend um direkte oder indirekte Entlehnungen (etwa Stagiaire ‚Praktikant/-in‘, Parteikarte ‚Parteibuch‘).
Anders als in den ehemals deutschsprachigen belgischen Gebieten außerhalb der DG ist das Deutsche in der DG heute völlig dominierend in allen Bereichen, und seine Weitergabe steht ganz außer Zweifel; durch die sukzessive erreichte Bildungsautonomie (seit 1989 eigene Lehrpläne, heute fast vollständig autonome Organisation des Schulwesens, für bestimmte Studiengänge eigene Hochschule, siehe Kap. 2 in diesem Band) hat die Beherrschung der Standardvarietät allgemein noch an Sicherheit gewonnen. Mit Blick auf die sprachliche Situation im nationalen Rahmen ist daher mittlerweile die Förderung der Mehrsprachigkeit, vor allem der Kenntnis des Französischen, stärker im Fokus der Bildungsbehörde der DG als die Position des Deutschen. Eine Einschränkung ergibt sich allerdings aus dem Fehlen einer eigenen Universität mit breit gestreutem Angebot (die Autonome Hochschule Ostbelgien bietet nur wenige Studiengänge an, siehe Kap. 2 in diesem Band): Sofern sie nicht an eine deutsche Universität gehen, entwickeln ostbelgische Studierende nach dem Schulabschluss die Kompetenz zur Produktion komplexer distanzsprachlicher Texte eher auf Französisch weiter als auf Deutsch (vgl. auch Riehl 2001: 285f.). Trotz der Bedeutung des Französischen als → Zweitsprache sind direkte lexikalische Übernahmen daraus, von den erwähnten etablierten Fällen abgesehen, jedoch nicht frequent (Strothkämper 2012). Einflüsse des Französischen auf die Bedeutung von Wörtern oder auf grammatische Konstruktionen sind allerdings verschiedentlich zu beobachten (z.B. fragen auch im Sinn von ‚um etwas bitten‘ nach demander qc., normalerweise wie frz. normalement auch im Sinn von ‚eigentlich‘, reflexives sich basieren auf wie se baser sur oder für einmal, dass X ‚wenn schon einmal X‘ nach pour une fois queX u.Ä.).
Tabellarischer Überblick
Themenbereich
Land: Belgien
Quellen
Anzahl/resp. prozentualer Anteil Deutschsprachiger
Offiziell deutschsprachiges Gebiet (Deutschsprachige Gemeinschaft [DG]/Ostbelgien):
rund 79.400 Einwohner (= knapp 0,7 % der Gesamtbevölkerung), von denen etwa 90 % Deutsch als ihre Muttersprache ansehen.
(Zur Anzahl Deutschsprachiger im übrigen Belgien sind die Schätzungen sehr unterschiedlich und unsicher; offenkundig ist, dass die Zahl immer weiter abnimmt.)
Statistikportal: Bevölkerung
forsa 2018
INFO 2023
Darquennes 2019: 1069f.
Rechtliche, institutionelle Stellung im Staatsgefüge
Amtssprache, neben Französisch und Niederländisch (im offiziellen deutschen Sprachgebiet Sprache von Verwaltung, Justiz und Unterricht)
Verfassung Art. 2, 4, 30, 130
Rolle in Schule und anderen Bildungsinstitutionen
Offizielle Unterrichtssprache in der DG
Verfassung Art. 130, Dekret vom 19.4.2004
Ausbaugrad
In allen Bereichen verwendbar: voller Ausbaugrad
Deutsch im Repertoire (d.h. als Erstsprache, Zweitsprache etc. bis hin zu nur noch erinnerter Sprache)
Erstsprache im Gebiet der DG; im heute offiziell französischsprachigen Gebiet in an die DG angrenzenden Gemeinden – Malmédy, Montzen, Bého – sowie in Gemeinden um die Stadt Arlon in der Provinz Luxemburg herum teilweise noch deutscher Dialekt als Erstsprache älterer Personen
siehe dazu Kap. 4 in diesem Band, spez. Mehrsprachigkeitskonstellationen
Beziehung zur Standardsprache
Standardsprache in der DG omnipräsent; Erstsprache ist zumeist standardbasierter → Regiolekt, in ländlichen Gegenden (vor allem im südlichen Teil und bei älteren Personen) auch noch Dialekt.
Normorientierung
Orientierung am bundesdeutschen Standard; die ostbelgischen Spezifika werden zumeist als regiolektal angesehen.
Nur eigene Rechtsterminologie (bei spezifisch belgischen Rechtsbegriffen werden eigene Termini festgelegt).
Dekret vom 19.1.2009 zur Regelung der Rechtsterminologie in deutscher Sprache (Onlinequelle Nr. 2)
Vitalität, generationelle Weitergabe
Weitergabe in der DG selbstverständlich, dabei immer mehr Durchsetzung von Regiolekt resp. regionalem Gebrauchsstandard statt Dialekt; in den oben erwähnten offiziell französischsprachigen Gemeinden keine bzw. sehr stark zurückgegangene intergenerationelle Weitergabe
Medien in Deutsch verfügbar?
Tageszeitung GrenzEcho, Belgischer Rundfunk (BRF) mit zwei Radioprogrammen und einem Fernsehprogramm; Nutzung von Medien aus Deutschland sehr verbreitet
In welchen Domänen verwendet (bspw. nur in der Familie)?
Deutsch ist in allen Domänen im Gebrauch, in der gesprochenen Sprache dabei keine feste Verteilung von Gebrauchsstandard resp. Regiolekt und Dialekt; insgesamt dominiert auch in der gesprochenen Sprache Gebrauchsstandard resp. Regiolekt.
Außerhalb der DG wird Deutsch nur noch in Form des Dialekts von einem Teil der älteren Sprecher/-innen in der Familie und in informellen Alltagssituationen verwendet.
Sichtbarkeit im öffentlichen Raum
In der DG überall sichtbar und quantitativ dominant, Französisch mehr oder weniger häufig daneben
Van Mensel/Darquennes 2012
Verhiest 2015
Einstellungen
Teilweise Inferioritätsgefühl gegenüber bundesdeutschen Sprecherinnen/Sprechern, deren Deutsch als „besser“ (standardnäher, gewandter) empfunden wird; gleichzeitig Stolz auf die eigene Mehrsprachigkeit
Möller 2017
Rasp/Cosme 2023
Sprachidentität (Loyalität, Abgrenzung, Identifikation)
Dezidiert (ost)belgische (nicht deutsche) Identität
INFO 2023
Verwendung in Prosa/Lyrik
Einige Autorinnen/Autoren (Prosa und Lyrik) in Standarddeutsch (z.B. Freddy Derwahl), teilweise mit Verwendung dialektaler Elemente (z.B. Leo Wintgens)
Literatur
Bouillon, Heinz (2019). Deutsch in Ostbelgien. In: Beyer, Rahel/Plewnia, Albrecht (Hrsg.). Handbuch des Deutschen in West- und Mitteleuropa: Sprachminderheiten und Mehrsprachigkeitskonstellationen. Tübingen: Narr, 47–70.
Darquennes, Jeroen (2019). Komplexe Überdachung III: Belgien. In: Herrgen, Joachim/Schmidt, Jürgen Erich (Hrsg.). Sprache und Raum. Ein internationales Handbuch der Sprachvariation. Bd. 4: Deutsch. Berlin/Boston: De Gruyter, 1060–1076. DOI: doi.org/10.1515/9783110261295-040
forsa (2018). Die deutschsprachige Gemeinschaft Belgiens in der Einschätzung ihrer Bürger: Ergebnisse einer Befragung für das Ministerium der Deutschsprachigen Gemeinschaft Belgiens. Abrufbar unter: https://ostbelgienstatistik.be/PortalData/22/Resources/downloads/themen/demoskopische_umfrage/36584_q8351_text_Gesamtbericht.pdf (Stand: 05.03.2024)
Heukemes, Norbert (Hrsg.) (2022). Ostbelgien in Zahlen. Abrufbar unter: https://ostbelgienstatistik.be/PortalData/22/Resources/downloads/studien_und_analysen/publikationen/Ostbelgien_in_Zahlen_Statistik_2021.pdf (Stand: 05.03.2024)
INFO GmbH Markt- und Meinungsforschung (2023). Die Deutschsprachige Gemeinschaft in der Einschätzung ihrer Bürger/-innen. Erarbeitet für: Ministerium der Deutschsprachigen Gemeinschaft. Ergebnisbericht. Abrufbar unter: https://ostbelgienstatistik.be/PortalData/22/Resources/downloads/themen/demoskopische_umfrage/31694-Ostbelgien_W1-Bericht-2023-02-06-final.pdf (Stand: 05.03.2024)
Küpper, Achim/Leuschner, Torsten/Rothstein, Björn (2017). Die Deutschsprachige Gemeinschaft Belgiens als emergentes Halbzentrum: Sprach- und bildungspolitischer Kontext – (Sub-)Standard – Sprachlandschaft. Zeitschrift für deutsche Philologie 136 (Sonderheft), 169–192.
Möller, Robert (2017). Deutsch in Ostbelgien – Ostbelgisches Deutsch? In: Davies, Winifred V./Häcki Buhofer, Annelies/Schmidlin, Regula/Wagner, Melanie M./Wyss, Eva L. (Hrsg.). Standardsprache zwischen Norm und Praxis: Theoretische Betrachtungen, empirische Studien und sprachdidaktische Ausblicke. Tübingen: Narr, 89–120.
Rasp, Verena/Rivera Cosme, Gabriel (2023). „Das“ ostbelgische Deutsch – Zwischen Standard und regionaler Varietät. JournaLIPP 8, 86–105. DOI: doi.org/10.5282/journalipp/4896
Regionalsprachendatenbank = Regionalsprachendatenbank des Ministeriums der DG. Abrufbar unter: https://ostbelgienlive.be/regionalsprache/ (Stand: 05.03.2024); (Einleitung:) https://ostbelgienlive.be/personal/upload/regionalDB/Regionalsprachendatenbank_DG.pdf (Stand: 05.03.2024)
Riehl, Claudia Maria (2001). Schreiben, Text und Mehrsprachigkeit: Zur Textproduktion in mehrsprachigen Gesellschaften am Beispiel der deutschsprachigen Minderheiten in Südtirol und Ostbelgien. Tübingen: Stauffenburg.
Statistikportal = Das Statistikportal der Deutschsprachigen Gemeinschaft Belgiens. Abrufbar unter: https://ostbelgienstatistik.be (Stand: 05.03.2024)
Strothkämper, Nathalie (2012). Sprachkontaktphänomene in Leserbriefen der ostbelgischen Zeitung „Grenz-Echo“. Universität Jena (= Masterarbeit).
van Mensel, Luk/Darquennes, Jeroen (2012). All is quiet on the Eastern front? Language contact along the French-german language border in Belgium. In: Gorter, Durk/Marten, Heiko F./van Mensel, Luk (Hrsg.). Minority languages in the linguistic landscape. London: Palgrave Macmillan, 164–180. DOI: doi.org/10.1057/9780230360235_10
Verhiest, Glenn (2015). Die Deutschsprachige Gemeinschaft Belgiens als visuelle Sprachlandschaft: Eupen und Sankt Vith im Vergleich. Germanistische Mitteilungen 41, 51–72. DOI: doi.org/10.33675/GM/2015/2/5
VWB = Ammon, Ulrich/Bickel, Hans/Lenz, Alexandra N. (Hrsg.) (2016). Variantenwörterbuch des Deutschen: Die Standardsprache in Österreich, der Schweiz, Deutschland, Liechtenstein, Luxemburg, Ostbelgien und Südtirol sowie Rumänien, Namibia und Mennonitensiedlungen. 2. Aufl. Berlin/Boston: De Gruyter. DOI: doi.org/10.1515/9783110245448
Onlinequellen (Stand: 17.02.2025)
Nr. 1: https://ostbelgienlive.be/zuständigkeiten
Nr. 2: https://ostbelgienrecht.be
Deutsch in Dänemark
Deutsch und Dänisch sind nicht nur genetisch (westgermanisch – nordgermanisch) eng verwandt und sprachtypologisch sehr ähnlich (Geyer 2024a), sie weisen vor allem durch den engen Sprachkontakt (genauer: den markanten deutschen Einfluss auf das Dänische) viele Gemeinsamkeiten auf.* So blickt Dänemark auf einen jahrhundertelangen, intensiven und kooperativen Sprach- und Kulturkontakt mit dem Deutschen zurück, der erst durch den aufkommenden Nationalismus im 19. Jh. und v.a. durch die deutsche Besatzung 1940–1945 im 20. Jh. ernsthafte Brüche erlebt hat. Dennoch kann Winge (2021: 231) für die moderne dänische Gesellschaft und ihr Verhältnis zum Deutschen und zu den Deutschen heute resümieren: „Die negative Haltung früherer Generationen gegenüber Deutschland scheint mittlerweile überwunden zu sein, paradoxerweise ist jedoch die Motivation, die Sprache zu erlernen, umgekehrt proportional zum Interesse für Deutschland und insbesondere für Berlin“ (Übersetzung K.G.).
Die deutschsprachige Minderheit in Dänemark ist aufgrund der um ca. 75 km nach Süden verschobenen deutsch-dänischen Grenzziehung durch die Volksabstimmung von 1920 infolge des Versailler Friedensvertrages entstanden. Die Folgejahre gestalteten sich schwierig: zunächst wegen revisionistischer Tendenzen und anschließend, weil nicht unerhebliche Teile der deutschsprachigen Minderheit eine Nähe zu den Ideen des Nationalsozialismus aufwiesen. Erst mit den Bonn-Kopenhagener Erklärungen von 1955 begann sich das Verhältnis zum dänischen Staat und zur Mehrheitsbevölkerung allmählich zu entspannen (Thaler 2022). In diesem Abkommen wird unter anderem festgeschrieben, dass die Minderheiten nördlich und südlich der deutsch-dänischen Grenze Gesinnungsminderheiten sind, bei denen die individuelle Zugehörigkeit nicht überprüft oder hinterfragt werden darf: „Das Bekenntnis zum deutschen Volkstum und zur deutschen Kultur ist frei und darf von Amts wegen nicht bestritten oder nachgeprüft werden“ (zit. nach BMI 2023: 29). Gleichzeitig sind die Angehörigen der Minderheit heute loyale Bürger/-innen ihres Staates. Die deutschsprachige Minderheit wird derzeit auf 12.000 bis 15.000 Personen geschätzt (Kühl 2022: 155, BMI 2023: 28) und ist in den vier südlichsten Kommunen Dänemarks in Jütland, d.h. in Sonderburg/Sønderborg, Tondern/Tønder, Apenrade/Aabenraa und Hadersleben/Haderslev, beheimatet. Die deutsche Eigenbezeichnung dieses Gebietes lautet Nordschleswig. Die Bundesrepublik Deutschland ist durch einen eigenen Honorarkonsul in Hadersleben in Südjütland vertreten. Für einen Überblick zur Lage der deutschsprachigen Minderheit vor ca. zehn Jahren vgl. Ammon (2014: 305–311).
Der dänische Staat hat die deutschsprachige Minderheit in der → Europäischen Charta der Regional- oder Minderheitensprachen des Europarates von 1992 anerkannt (Europarat 1992, 2024a, 2024b). Dies sichert eine Reihe von Rechten, die jedoch ohnehin schon durch die Institutionen der Minderheit wahrgenommen werden und wurden. Allerdings genießt Deutsch nicht den Status einer Amtssprache in Nordschleswig, weshalb beispielsweise die deutschsprachige Minderheit in Dänemark auch nicht im Rat für deutsche Rechtschreibung vertreten ist (Onlinequelle Nr. 1). Zu den wichtigsten Institutionen, die in aller Regel als Vereine organisiert sind, gehören:
der Bund deutscher Nordschleswiger (BDN) mit Sitz in Apenrade, der als Dachorganisation für die deutschsprachige Minderheit fungiert (Onlinequelle Nr. 2);
der Deutsche Schul- und Sprachverein für Nordschleswig (DSSV) (Onlinequelle Nr. 3);
der Verband deutscher Büchereien Nordschleswig (Onlinequelle Nr. 4);
die Schleswigsche Partei/Slesvigsk parti (Onlinequelle Nr. 5), die sich als Regionalpartei auch und besonders für die Belange der deutschsprachigen Minderheit einsetzt.
Hinzu kommt eine Reihe weiterer Vereine in den Bereichen Sport, Kultur, Religionsausübung, Soziales usw. (eine vollständige Übersicht findet sich in BDN 2025). Die deutsche Sprache dient stets als eine, in der Regel jedoch nicht als einzige Option für die Kommunikation.
Die sprachliche Situation der deutschsprachigen Minderheit ist komplex. Die deutsche Sprache besitzt einen hohen Stellenwert als – vielleicht wichtigstes – Identifikationsmerkmal (Tarvet 2021), sie wird in allen offiziellen Kontexten der Institutionen verwendet. Dieses Deutsch trägt bei nicht wenigen Mitgliedern der Minderheit Züge einer → L2, denn zu Hause wird in den Familien zumeist Sønderjysk, die regionale → Varietät des Dänischen, oder eben Standarddänisch gesprochen. Die Minderheit stellt sich so auch konsequent als mehrsprachig dar. In der Kindergartenbroschüre des DSSV (wortgleich in der Schulbroschüre, DSSV 2024c) heißt es beispielsweise: „Bei uns wachsen eure Kinder zweisprachig mit Deutsch und Dänisch auf. Ihr seid herzlich willkommen – egal, ob ihr zuhause deutsch oder dänisch sprecht, oder beides“ (DSSV 2024b: 2). Und der BDN konstatiert: „Wir sprechen zwei Sprachen – manche mit Sønderjysk auch drei“ (BDN 2024). Durch die Zuwanderung von Deutschen in den Grenzraum, die ganz unterschiedlichen Motivationen geschuldet ist und sich nicht nur auf Arbeitsmigration beschränkt, werden die relativ kleinen lokalen Gemeinschaften der deutschsprachigen Minderheit in ihrer besonderen Mehrsprachigkeit in den letzten Jahren sehr herausgefordert, da die Zugewanderten zunächst weder Dänisch noch Sønderjysk kennen und nur eingeschränkt über soziale Kontakte verfügen (Turnowsky 2024).
Die besten verfügbaren und empirisch fundierten Informationen zur sprachlichen Ökologie in Nordschleswig finden sich bei Tarvet (2021). Dieser hat, basierend auf einer recht kleinen Stichprobe von 32 Personen, die sich der deutschsprachigen Minderheit zugehörig fühlen, im Jahr 2017 eine Befragung nördlich und südlich der deutsch-dänischen Grenze mit 38 Fragen durchgeführt. Hier interessieren nur die Ergebnisse nördlich der Grenze: Deutlich wird neben der insgesamt bestehenden Dreisprachigkeit Deutsch-Dänisch-Sønderjysk u.a. die Bedeutung des regionalen Sønderjysken als häufige Familiensprache gegenüber dem Deutschen als Institutionensprache. Als Antwort auf die interessante Frage nach ihrer Identität („trifft zu“ und „trifft eher zu“) geben je 55 % eine dänische oder deutsche Identität an, 32 % eine schleswigsche, 68 % eine südjütische und 80 % eine europäische (Mehrfachnennungen möglich). Nationale Identitäten scheinen in Nordschleswig also durchaus vorhanden, aber nicht vorrangig zu sein. Es überwiegen die regionale und die übernationale Identität. Diese wenigen Daten illustrieren, wie vielgestaltig die Sprachverhältnisse in Nordschleswig sind.
In anderen Diskurszusammenhängen wird das Phänomen des Nordschleswigdeutschen thematisiert, d.h. einer Form des Deutschen, die sich – besonders im Gesprochenen – durch deutlich bemerkbare Sprachkontakterscheinungen mit dem Dänischen auszeichnet. Der Terminus ,Nordschleswigdeutschʻ ist weitgehend unüblich in der Variationslinguistik des Deutschen. Zu den Autoren/Autorinnen, die ihn verwenden, gehört z.B. Fredsted (2009). Zugleich wird diese Form des Deutschen innerhalb der Minderheit aber eben nicht als fehlerhaft ab-, sondern als prestigehaltig-regional aufgewertet. Es handelt sich dabei vermutlich eher um eine Menge unterschiedlicher, individuell beobachtbarer → Interferenzen als um eine sprachsystematische Erscheinung im Sinne einer Varietät. Interessant ist, dass die Schleswigsche Partei, wohl um ihre regionale Identität zu unterstreichen, solche Sprachkontaktphänomene in der Kampagne „Nordschleswig ist, wo …“ verarbeitet. Hier einige Beispiele im Wortlaut. Eine Auswertung der Reaktionen auf solche Kampagnen steht aus.
Nordschleswig ist, wo die Hunde gelüftet werden [Wörtl. Übersetzung von dän. lufte hunden – Gassi gehen]
[…], wo die Ziegen aus Gummi sind [Wörtl. Übersetzung von dän. gummiged – Schaufellader]
[…], wo das Gras geschlagen wird [Wörtl. Übersetzung von dän. slå græsset – Rasen mähen] (Onlinequelle Nr. 6)
Erwähnt werden soll an dieser Stelle auch, dass im Schuljahr 2023/24 die Jugendkunstkonsulentin des BDN, Jana Surkus, in einem Projekt, das aus Mitteln des Auswärtigen Amtes gefördert wird, in den Schulen der Minderheit mit Kindern und Jugendlichen die sprachlichen Besonderheiten des Nordschleswigdeutschen erarbeitet hat, um u.a. ein nordschleswigdeutsches GIF-Paket aus kleinen Grafikdateien für die Smartphone-Kommunikation zu entwickeln (Mensing 2023). Einige laut Jana Surkus häufiger zu beobachtende Beispiele aus dem Material sind in der folgenden Tabelle aufgeführt:
Bereich
Nordschleswigdeutsch
Erläuterung
Kollokationen
ich bin jetzt mit
nu er jeg med ‚nun verstehe ichʻ
ich bin ganz einig
jeg er helt enig ‚ich stimme vollständig zu‘
Entlehnungen
abschlappen
slappe af ‚sich entspannen‘
ich soll nochhandeln
jeg skal handle ‚ich muss noch einkaufen‘
Gehstraße
gågade ‚Fußgängerzone‘
Terminprüfung
terminsprøve ‚Prüfungsklausur‘
Morphosyntax
Glückwunsch mit deiner Tochter
tillykke med din datter ‚Glückwunsch zu deiner Tochter‘
ich soll los
jeg skal afsted ‚ich muss losʻ
da bin ich nicht so gut zu
det er jeg ikke så godt til ‚darin bin ich nicht so gutʻ
Lexik
ich schnupper mal eben deine Schere
jeg snupper lige din saks ‚ich schnappe mir kurz deine Schere‘
das gi’ ich nicht
det gider jeg ikke ‚das mag ich nichtʻ
Ausgewählte Nordschleswigsche Sprachkontakterscheinungen.
Es bleibt abzuwarten, wie sich die Verhältnisse für das Nordschleswigdeutsche in Zukunft entwickeln, in jedem Fall wird hier noch mehr Forschung erforderlich sein.
Deutsch in der Schule: Im dänischen Schulsystem ist Deutsch nach Englisch die wichtigste Fremdsprache. Über 85 % der dänischen Schulkinder lernen ab Klasse 5 bzw. 6 Deutsch als zweite obligatorische Fremdsprache in der folkeskole (‚Volksschule‘; die Klassen 1 bis 9/10 werden in Dänemark gemeinsam unterrichtet). Im Gymnasium, das die 11. bis 13. Klasse umfasst und an den allgemeinen und den Handelsgymnasien eine zweite Fremdsprache (neben dem obligatorischen Englischen) vorsieht, wählt etwas mehr als die Hälfte der Schüler/-innen Deutsch für weitere zwei und manchmal drei Jahre. Diese günstige Ausgangssituation schlägt jedoch kaum in der Hochschulbildung durch, da es den dänischen Universitäten nur in bescheidenem Umfang gelingt, aus diesem Reservoir zu schöpfen. Studiengänge mit Deutsch werden derzeit vor allem an drei Universitäten angeboten: an der Universität Kopenhagen (KU), an der Universität Århus (AU) und an der Süddänischen Universität. Laut den Zahlen aus dem dänischen KOT-System (Den Koordinerede Tilmedling ‚Die koordinierte Anmeldung‘, UFM 2024) gab es in den Jahren 2018 bis 2024 einen deutlichen Rückgang der Studienanfänger/-innen. Zum diversifizierten und wenig überschaubaren Angebot an Deutschunterricht in Abendschulen, durch Vereine, gewerbliche Anbieter vgl. z.B. Geyer (2024b, 2024c).
Im Tourismus spielt Deutsch eine herausragende Rolle, die Anzahl der deutschen Übernachtungen übersteigt diejenige der nächstfolgenden Länder (Norwegen und Niederlande) um den Faktor 10 bis 20 (Onlinequelle Nr. 7). Die dänischen Tourismusanbieter haben sich auf die große Zahl der deutschen Gäste gut eingestellt und halten in aller Regel die erforderlichen Informationen nicht nur auf Dänisch und Englisch, sondern auch auf Deutsch bereit, wie eine erste Übersicht über die Seiten der staatlichen Tourismusorganisation Visitdenmark (Onlinequelle Nr. 8) zeigt. Nicht unerwähnt bleiben soll auch, dass deutsche Staatsbürger/-innen eine der größten Immigrationsgruppen in Dänemark sind und die dänischen Wirtschaftskontakte zu Deutschland als dem wichtigsten Handelspartner (UM 2024) von großer Bedeutung sind.
Tabellarischer Überblick
Themenbereich
Land: Dänemark
Quellen
Anzahl/resp. prozentualer Anteil Deutschsprachiger
Die Größe der Minderheit in Nordschleswig wird auf 15.000 Personen geschätzt.
Kühl 2022: 155
BMI 2023: 28
Rechtliche, institutionelle Stellung im Staatsgefüge
Für das Deutsch der Minderheit in Nordschleswig gilt, dass es durch die Sprachencharta des Europarats als Minderheitensprache in Dänemark geschützt ist und gefördert wird – allerdings auf eher niedrigem Niveau.
Deutsch ist keine Amtssprache.
Hallmann 2024
Europarat 2023
Rolle in Schule und anderen Bildungsinstitutionen
Deutsch ist die Sprache in den Schulen und Kindergärten der deutschsprachigen Minderheit.
Nach Englisch ist Deutsch die wichtigste Fremdsprache, es muss von allen folkeskoler (Klassen 1–9/10) als zweite Fremdsprache angeboten werden. Hochschulstudien mit Deutsch scheinen wenig attraktiv, ab Herbst 2024 nur drei Universitäten mit deutschen Studienangeboten, Tendenz fallend (zurzeit ca. 100 Studienanfänger/-innen).
Geyer 2021, 2024c
DSSV 2024a, 2024b
UFM 2024
Europarat 2023
Ausbaugrad
keine Einschränkungen
Deutsch im Repertoire (d.h. als Erstsprache, Zweitsprache etc. bis hin zu nur noch erinnerter Sprache)
Für die Mitglieder der Minderheit ist Deutsch L1 oder, häufiger, L2.
Für die meisten Dänen/Däninnen ist Deutsch eine mehr schlecht als recht erlernte Fremdsprache.
Geyer 2021
Tarvet 2021
Beziehung zur Standardsprache
Standarddeutsch ist Zielvarietät im Bildungssystem, im Tourismus und im Arbeitsleben sowie in der Minderheit. Abweichungen, die dem Sprachkontakt oder imperfektem Erwerb geschuldet sind, kommen vor (vgl. das Konzept Nordschleswigdeutsch in Teilen der Minderheit).
Onlinequelle Nr. 6
Normorientierung
Bundesdeutsches Standarddeutsch setzt die Norm für das Deutsche in Dänemark.
Vitalität, generationelle Weitergabe
In der deutschsprachigen Minderheit gibt es keine Einschränkung bei der Weitergabe an die nächste Generation.
Über die Weitergabe innerhalb der Gruppe der deutschen Staatsbürger/-innen in Dänemark liegen keine Studien vor.
Tarvet 2021
Medien in Deutsch verfügbar?
Die wichtigsten deutschen Fernsehprogramme (ARD, ZDF, NDR, RTL, Sat1, Pro7) sind in vielen Kabelnetzen zugänglich.
Die Tageszeitung Der Nordschleswiger erscheint nur online und nur auf Deutsch.
Europarat 2023
Onlinequelle Nr. 9
Onlinequelle Nr. 10
In welchen Domänen verwendet (bspw. nur in der Familie)?
Deutsch fungiert als Sprache der offiziellen Zusammenkünfte und der Bildungsinstitutionen der deutschsprachigen Minderheit, aber, neben Dänisch und Sønderjysk, auch als mögliche und ggf. bevorzugte Sprache in unterschiedlichen Vereinigungen und Vereinen (Sport, Chor, …).
Sprachwechsel erfolgen meist personenbezogen.
bspw. Onlinequelle Nr. 8 (mit Unterseiten)
Sichtbarkeit im öffentlichen Raum
Im virtuellen wie auch im physischen Raum ist Deutsch nach Englisch (und Dänisch) landesweit die wichtigste sichtbare Sprache touristischer Angebote, in manchen süd- und westjütischen Regionen sogar die wichtigste.
In den Institutionen der Minderheit ist Deutsch stark präsent; zweisprachige Ortstafeln in den vier Kommunen werden seit geraumer Zeit von der deutschen Minderheit gefordert, sind aber weiterhin nicht erlaubt.
Geyer 2021
BDN 2024
Europarat 2023
Einstellungen
Nach den dramatischen Verwerfungen in der deutsch-dänischen Geschichte wird Deutsch heute kaum mehr explizit negativ bewertet. Auch gegenüber der Minderheit sind v.a. aufgrund der offenen Mehrsprachigkeitspolitik (Deutsch – Sønderjysk – Dänisch) nur noch selten Ressentiments zu beobachten.
Thaler 2022
Winge 2021
Sprachidentität (Loyalität, Abgrenzung, Identifikation)
Standarddeutsch fungiert als Standardvarietät für die deutschsprachige Minderheit, wenn auch ihr regionales Deutsch individuelle Abweichungen aufweisen kann. Das Konzept Nordschleswigdeutsch versucht, die regionalen Eigenheiten als identitätsstiftend zu etablieren.
Tarvet 2021
Onlinequelle Nr. 6
Verwendung in Prosa/Lyrik
Es gibt verschiedene Projekte zu Prosa, Lyrik und Musik (Poetryslam), die im Rahmen von Schul- oder Kulturverbandsprojekten angestoßen werden. Laientheater und eigens produzierte Liederbücher bringen in deutscher Sprache die regionale Kultur zum Ausdruck.
Europarat 2023
Literatur
Ammon, Ulrich (2014). Die Stellung der deutschen Sprache in der Welt. Berlin: De Gruyter.
BDN [= Bund deutscher Nordschleswiger] (2024). Sprache und Identität. Abrufbar unter: https://nordschleswig.dk/sprache/ (Stand: 17.10.2024)
BDN [= Bund deutscher Nordschleswiger] (Hrsg.) (2025). Grenzland 2024. Informationen und Hinweise zu aktuellen Fragen des Grenzlandes aus der Sicht der deutschen Volksgruppe. Apenrade: BDN.
BMI [= Bundesministerium des Inneren und für Heimat] (2023). Deutsche Minderheiten stellen sich vor. 4. Aufl. Berlin: BMI.
DSSV [= Deutscher Schul- und Sprachverein] (2024a). Deutscher Schul- und Sprachverein für Nordschleswig: Jahresbericht 2023. Apenrade: DSSV. Abrufbar unter: https://dssv.dk/wp-content/uploads/2024/05/DSSV_Jahresbericht2023_web.pdf (Stand: 17.10.2024)
DSSV [= Deutscher Schul- und Sprachverein] (2024b). Die deutschen Kindergärten in Nordschleswig. Abrufbar unter: https://dssv.dk/wp-content/uploads/2023/06/2019-DSSV_Folder_Kiga_TYSK_WEB_FINAL.pdf (Stand: 17.10.2024)
DSSV [= Deutscher Schul- und Sprachverein] (2024c). Die deutschen Schulen in Nordschleswig. Abrufbar unter: https://issuu.com/dssv/docs/dssv_die_deutschen_schulen_in_nordschleswig (Stand: 17.10.2024)
Europarat (1992). Europäische Charta der Regional- oder Minderheitensprachen. Abrufbar unter: https://rm.coe.int/168007c089 (Stand: 17.10.2024)
Europarat (2023). Sixth periodical report presented to the Secretary General of the Council of Europe in accordance with Article 15 of the Charter. Abrufbar unter: https://rm.coe.int/denmarkpr6-en/1680aacae5 (Stand: 17.10.2024)
Europarat (2024a). Unterschriften und Ratifikationsstand des Vertrags 148. Abrufbar unter: https://www.coe.int/de/web/conventions/full-list?module=signatures-by-treaty&;treatynum=148 (Stand: 17.10.2024)
Europarat (2024b). Vorbehalte und Erklärungen für Vertrag Nr. 148 – Europäische Charta der Regional- oder Minderheitensprachen (SEV Nr. 148). Abrufbar unter: https://www.coe.int/de/web/conventions/concerning-a-given-treaty?module=declarations-by-treaty&;territoires=&codeNature=0&codePays=&numSte=148&enVigueur=true&ddateDebut=05-05-1949 (Stand: 17.10.2024)
Fredsted, Elin (2009). Sprachen und Kulturen im Kontakt – deutsche und dänische Minderheiten in Sønderjylland/Schleswig. In: Stolz, Christel (Hrsg.). Neben Deutsch: Die autochthonen Minderheiten- und Regionalsprachen Deutschlands. Bochum: Brockmeyer, 1–24.
Geyer, Klaus (2021). Dreimal Deutsch in der mehrsprachigen Corona-Kommunikation in Dänemark. Schnittstelle Germanistik 1:2, 167–194. DOI: doi.org/10.33675/SGER/2021/2/12
Geyer, Klaus (2024a). Dansks ukendte søster – typologiske betragtninger om tysk og dansk. Ny forskning i grammatik 31, 20–36. DOI: doi.org/10.7146/nfg.v1i31.145290
Geyer, Klaus (2024b). Sprachökologische Betrachtungen zum Deutschen in Dänemark. Kalbotyra 78. DOI: doi.org/10.15388/Kalbotyra.2024.77.7
Geyer, Klaus (2024c). Germanistik, Deutsche Philologie – oder „nur“ (etwas mit) Deutsch? Erfahrungen und Erkenntnisse mit integrierten Deutsch-Studiengängen in Dänemark. In: Grzeszczakowska-Pawłikowska, Beata/Mikołajczyk, Beata (Hrsg.). Kompetenzorientierte(s) Hochschullehre und -studium in germanistischen Studiengängen: Herausforderungen – Entwicklungstendenzen – Perspektiven. Göttingen: V&R unipress.
Hallmann, Harro (2024). Die Sprachencharta – Theorie und Praxis in Bezug auf Deutsch in Nordschleswig. In: BDN [= Bund deutscher Nordschleswiger] (Hrsg.) (2024). Grenzland 2023. Informationen und Hinweise zu aktuellen Fragen des Grenzlandes aus der Sicht der deutschen Volksgruppe. Apenrade: BDN, 156–160.
Kühl, Jørgen (2022). Minority in transition: The German community in Denmark 1995–2020. In: Thaler, Peter (Hrsg.). Like snow in the sun? The German minority in Denmark in historical perspective. Berlin: De Gruyter Oldenbourg, 155–174. DOI: doi.org/10.1515/9783110682120-012
Mensing, Lorcan (2023). BDN-Kunstkonsulentin: „Nordschleswig-Deutsch ist kein falsches Deutsch“. Der Nordschleswiger, 06.12.2023. Abrufbar unter: https://www.nordschleswiger.dk/sites/default/files/media/file/17cc58f9e39e31b113183d482dfb7f75.pdf (Stand: 17.10.2024)
Tarvet, Ruairidh Thomas (2021). Re-imaging Slesvig: Language and identity in the German-Danish borderlands: Understanding the regional national and transnational dimensions of minority identity. Odense: Syddansk Universitetsforlag.
Thaler, Peter (2022). Like snow in the sun? A conclusion. In: Thaler, Peter (Hrsg.). Like snow in the sun? The German minority in Denmark in historical perspective. Berlin: De Gruyter Oldenbourg, 195–210. DOI: doi.org/10.1515/9783110682120-014
Turnowsky, Walter (2024). Folkemøde: Zuwanderung als Chance und Herausforderung für Nordschleswig und die Minderheit. Der Nordschleswiger, 14.06.2024. Abrufbar unter: https://www.nordschleswiger.dk/de/nordschleswig-daenemark-politik/folkemode-zuwanderung-als-chance-und-herausforderung-fuer (Stand: 17.12.2024)
UFM – Uddannelses- og Forskningsministeriet [= dänisches Bildungs- und Forschungsministerium] (2024). Hovedtal – Den Koordinerede Tilmelding (KOT). Abrufbar unter: https://ufm.dk/uddannelse/statistik-og-analyser/sogning-og-optag-pa-videregaende-uddannelser/grundtal-om-sogning-og-optag/kot-hovedtal (Stand: 17.10.2024)
UM – Udenrigsministeriet [= dänisches Außenministerium] (2024). Dansk samhandel med Tyskland. Abrufbar unter: https://um.dk/-/media/websites/umdk/danish-site/udenrigspolitik/udenrigsoekonomi/samhandelnotitser/samhandelsnotits-tyskland.ashx (Stand: 17.10.2024)
Winge, Wibeke (2021). Tysk og nederlandsk. In: Hjorth, Ebba/Jacobsen, Henrik Galberg/Jørgensen, Bent/Jacobsen, Birgitte/Jørgensen, Merete Korvenius/Fahl, Laurids Kristian (Hrsg.). Dansk sproghistorie. Bd. 5: Dansk i samspil. Aarhus: Aarhus Universitetsforlag, 221–234.
Onlinequellen (Stand: 17.02.2025)
Nr. 1: https://www.rechtschreibrat.com
Nr. 2: https://bdn.dk
Nr. 3: https://dssv.dk
Nr. 4: https://buecherei.dk
Nr. 5: https://schleswigsche-partei.dk
Nr. 6: https://schleswigsche-partei.dk/bevar-det-soenderjyske/nordschleswig-ist-wo-die-katzen-spinnen-und-die-hunde-gelueftet-werden/
Nr. 7: https://www.dst.dk/da/
Nr. 8: www.visitdenmark.dk
Nr. 9: www.glenten.dk/Kanalplan
Nr. 10: www.nordschleswiger.dk/de
Deutsch in Deutschland
Das Standarddeutsch, das in Deutschland verwendet wird, gilt vielen als das vorbildliche oder sogar das einzig richtige Deutsch. Dies ist in zweierlei Hinsicht problematisch: Zum einen wird damit nicht anerkannt, dass es neben Deutschland weitere Gebiete der deutschen Sprache gibt, in denen die deutsche Standardsprache je eigene Ausprägungen aufweist – und damit sind nicht nur die Schweiz und Österreich gemeint, sondern auch Luxemburg und Liechtenstein, Ostbelgien und Südtirol. Zum anderen stellt die Standardsprache über die verschiedenen deutschsprachigen Regionen hinweg keine homogene Einheit dar, und auch innerhalb Deutschlands gibt es sowohl in der Aussprache als auch im schriftsprachlichen Gebrauch regionale Unterschiede. Das fällt etwa bei der Lektüre von Zeitungen aus Berlin, München oder Stuttgart auf. In der Germanistik sind diese Unterschiede auf lexikalischer Ebene (z.B. Sonnabend/Samstag; Abendbrot/Abendessen/Vesper; Hähnchen/Broiler) im Variantenwörterbuch zu finden (VWB), auf grammatischer Ebene in der Variantengrammatik (VG) und auf lautlicher Ebene im Atlas zur Aussprache des deutschen Gebrauchsstandards (AADG) (siehe Kap. 5 in diesem Band). Auch was das Kommunikationsverhalten betrifft (z.B. bei der Wahl der Du- bzw. Sie-Anrede, beim Begrüßen und Verabschieden), kann angenommen werden, dass sich dieses über den gesamten deutschsprachigen Raum hinweg regional unterscheidet. Aktuelle empirische Untersuchungen dazu stehen aber noch aus. So stellt sich beispielsweise die Frage, ob bei Formeln wie Hallo und Tschüss heute noch von einem Nord-Süd-Gefälle die Rede sein kann oder ob diese Grußformeln inzwischen auch im Süden des deutschsprachigen Raums häufig Verwendung finden.
Um Aufschlüsse zum Sprachgebrauch und zu den Spracheinstellungen zu erhalten, führte das Leibniz-Institut für Deutsche Sprache (IDS) bereits mehrere repräsentative Befragungen zur deutschen Sprache durch (z.B. Adler/Roessel 2023a, 2023b). Allerdings ist dabei zu berücksichtigen, dass es sich bei diesen Erhebungen um Selbsteinschätzungen der befragten Personen handelt. In der Deutschland-Erhebung von 2017 standen beispielsweise Fragen nach der eigenen Dialektkompetenz und dem Dialektgebrauch im Vordergrund (Adler/Plewnia 2020, siehe auch Adler/Plewnia/Ribeiro Silveira 2024). Unterschieden wurden vier sprachliche Großräume: → Niederdeutsch, Westdeutsch, → Mitteldeutsch und → Oberdeutsch





























