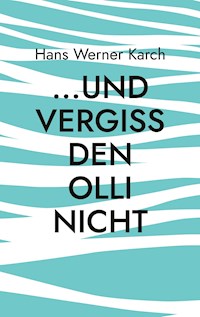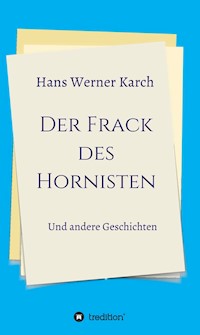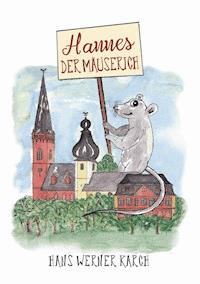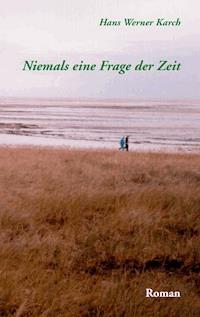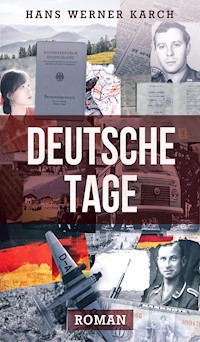
5,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: tredition
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
In dem Roman wird ein Stück neuere deutsche Geschichte erlebbar gemacht. Die Teilhabe am Schicksal einer Familie im geschichtlichen Zusammenhang soll auch Lesern, die sich bisher nicht so sehr für die neuere deutsche Geschichte interessiert haben, diese nahe bringen. Es ist eine chronologische Darstellung der Ereignisse, die im August 1938 beginnen, und den Leser bis ins Jahr 1971 führen. Kriminalkommissar Schiffmann und seine Frau Mai-Lin helfen der befreundeten jüdischen Familie von Alfred Braunfels während der Nazi-Herrschaft. Sie organisieren 1938 die Evakuierung der beiden Söhne nach England. Der Vater (Alfred Braunfels) wird später im KZ Buchenwald ermordet. Kurz danach stirbt die Mutter im Kindbett. De ältere der beiden Jungen wird 1943 als englischer Flieger mit seinem Bomber über Deutschland abgeschossen. Er überlebt den Absturz, wird aber kurz danach gelyncht. Einer der Beteiligten, ein 17-jähriger Flak-Helfer, erleidet dadurch einen über Jahre hinweg bestehenden, kompletten Gedächtnisverlust, der ihn zeitlebens beschäftigt. Der jüngere Bruder Harry, wird ohne Probleme bei einer Familie in Southampton aufgenommen und integriert sich ausgezeichnet. Als die Nazis beginnen, auch ausländische Mitbürger zu verfolgen, gehen Schiffmann und die Chinesin Mai-Lin in die Schweiz, wo sie heiraten und drei Kinder bekommen. Nach dem Ende des zweiten Weltkriegs kehren sie wieder nach Frankfurt zurück, um Aufbauhilfe zu leisten. Mai-Lin arbeitet wieder als Wissenschaftlerin im Senckenberg Institut. Schiffmann wird auf Betreiben der Amerikaner mit der Verfolgung und Aufklärung von Nazi-Verbrechen am Landeskriminalamt betraut. Der ehemalige Flak-Helfer und Beteiligter am Lynchmord des älteren Sohnes Braunfels (Heinz) arbeitet jetzt mit Mai-Lin imSenckenberg Institut. Seine Frau, eine Journalistin, versucht Klarheit in die Ereignisse rund um den Bomberabsturz 1943 zu bringen. Die Wahrheit ist für viele unerträglich.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 290
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Hans Werner Karch
Deutsche Tage
Roman
© 2019 Hans Werner Karch
Lektorat Ursula Hahnenberg
Verlag & Druck: tredition GmbH, Halenreie 40-44, 22359 Hamburg
ISBN
Paperback:
978-3-7482-5959-6
e-Book:
978-3-7482-5961-9
Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlages und des Autors unzulässig. Dies gilt insbesondere für die elektronische oder sonstige Vervielfältigung, Übersetzung, Verbreitung und öffentliche Zugänglichmachung.
„Das Leben hat mich gelehrt, dass alles auf die Menschen an kommt, nicht auf die sogenannten Verhältnisse.“
Theodor Fontane 1819 - 1898
Anmerkung
Im Roman werden vielfach Begriffe und Abkürzungen verwendet, die nicht jedem bekannt sind. Um etwaige Unklarheiten zu beseitigen, ist am Ende ein Glossar angeheftet.
Zudem sind im Text Zitate in kursiver Schrift deutlich gemacht.
Auf Quellenangaben wurde bewusst verzichtet. Diese können auf Wunsch beim Autor eingeholt werden.
Die im Cover verwendeten Bilder entstammen zum Teil dem privaten Archiv des Autors.
Neben den eindeutig belegten historischen Ereignissen sind die Personen des Romans und deren Handlungen frei erfunden. Eine Übereinstimmung oder Ähnlichkeit mit real existierenden Individuen ist rein zufällig.
Kapitel 1
Frankfurt/Main, Altstadt
Sonntag, 28.August 1938
Der Hochsommer Ende August 1938 drückt wie in den Jahren zuvor trockene Hitze in die Stadt. In den Gassen zwischen den engen Häuserreihen liegt eine bleierne Schwere. Nur durch die breiteren Alleen weht ein zarter Wind, den man an der schwachen Bewegung breitblättriger alter Platanen wahrnehmen kann. Die Menschen in Frankfurt versuchen auf unterschiedliche Weise, diesen heißen Sonntagnachmittag erträglich zu gestalten. Die Obermainanlage und das nahe Mainufer mit der „schönen Aussicht“ sind bald heillos von Menschen überfüllt.
In einer kleinen Gasse zwischen der „schönen Aussicht“ und dem Börne-Platz spielt der elfjährige Harry, wie ihn seine Fußballkameraden nennen, mit seinem kleinen Hund auf dem Trottoir vor dem Geschäft seines Vaters. Nero, ein fünf Monate alter Deutscher Schäferhund, soll heute das Apportieren lernen. Am frühen Sonntagnachmittag ist es wie üblich ruhig in der Straße. Nach dem Mittagessen bringen die Frauen die Küche in Ordnung, während der Großteil der Männer sich einem Mittagsschlaf hingibt. Ein Ritual, das seit Jahren in vielen Häusern gepflegt wird und dem Sonntagsleben seinen eigenen Rhythmus verleiht. Gleichwohl gerade in diesem Teil der Altstadt eine fast ausschließlich jüdische Bevölkerung lebt, haben sich die Menschen über viele Jahre hinweg mit christlichen Feier- und Festtagen arrangiert und bestimmte Bräuche übernommen.
An diesem Sonntag ist vieles anders als sonst. Harrys Eltern sind direkt nach dem Mittagessen mit dem Motorrad nach Worms aufgebrochen, um die Eltern seiner Mutter zu besuchen. Sein sechzehn Jahre alter Bruder Heinz treibt wie so oft sein Unwesen in Gesellschaft seiner Clique im Freibad und dies schon seit ein Uhr mittags. Möglicherweise wird man ihn nach einigen Stunden mit blutiger Nase und reichlich Prellungen, wie üblich in Polizeieskorte nach Hause bringen. Das ist so dessen Sonntagsvergnügen und er genießt es unübersehbar, wenn besonders die jüngere Frauenwelt die ganze Woche über seine Heldentaten mehr oder weniger ausgeschmückt herumerzählt.
„Weiß Gott, von wem der so etwas hat. Von mir bestimmt nicht“, bemerkt Alfred Braunfels im letzten Jahr des Öfteren. Aber selbst die Androhung von Ausgangssperren zeigt keine Wirkung bei dem jungen Hitzkopf.
Harrys Bemühungen, dem kleinen Nero das Apportieren beizubringen, gestalten sich schwierig. Der Hund ist heute Mittag sehr unruhig und unkonzentriert. Dann, zunächst nur bruchstückhaft und weit entfernt, hört man ein Gejohle, das immer lauter wird und näherkommt. Über die Obermainbrücke bewegt sich von Sachsen-hausen her ein Zug von sechs LKW, auf deren Lade-flächen SAMänner in ihren braunen Uniformen stehen, rote Fahnen mit dem Hakenkreuz schwenken und laut grölen. Dazwischen erkennt man einige Hitlerjungen, ebenfalls in ihren Uniformen. Der Konvoi schiebt sich, nachdem er den Main überquert hat, am Lessing Denkmal vorbei in die Lange Straße. Offenbar ganz gezielt biegen die LKW dann versetzt nach links in die verschiedenen Gassen des jüdischen Viertels der Altstadt ein.
Die Besatzungen singen und grölen Kampfparolen. Als ein LKW das Geschäft der Änderungsschneiderei des Alfred Braunfels Junior passiert, hört man auf dem LKW einen Hitlerjungen laut schreien. Was dieser Schreihals wirklich will, wird gleich darauf ersichtlich.
Einer der SA-Leute klopft auf das Dach des Führerhauses. Der LKW bremst abrupt. Von der Ladefläche springt ein etwa dreißig Jahre alter SA-Mann mit deutlichem Bauchansatz. Er trägt den typisch kupierten Oberlippenbart wie sein Führer. Die schweren Schaftstiefel knallen auf das Pflaster und man ahnt bei diesem Auftritt nichts Gutes. Zielstrebig geht er auf Harry zu und entreißt dem Jungen die Leine mitsamt dem kleinen Nero. Dann gibt der Scharführer dem bleich vor Angst dastehendem Buben eine kräftige Ohrfeige, sodass sich Harry kaum auf den Beinen halten kann.
„Du weißt doch, Juden halten keine Hunde und erst recht keine Deutschen Schäferhunde. Hunde sind doch in euren Augen gojisch“. Nicht jüdisch. Dann zerrt er den kleinen Nero, der sich mit allen vier Beinen gegen seinen Abtransport stemmt, zum LKW. Er hebt ihn auf die Ladefläche, wo man den kleinen Vierbeiner dem Hitlerjungen Paul Caspar übergibt. Voller Stolz über den Besitz drückt der Junge den Hund fest an sich und küsst ihn mehrfach auf die Stirn. Unter dem Gejohle und dem schrägen Gesang furchterregender Marschlieder, die von der Ladefläche aus die Sonntagsmittagsruhe stören, ist das ängstliche Wimmern des kleinen Nero nicht zu hören. Zu seiner Angst empfindet er den Trennungs-schmerz. Das Tier beginnt zu zittern, obwohl es schon fast dreißig Grad heiß ist.
Harry steht zunächst wie versteinert da. Diesen brutalen Überfall und den Raub seines kleinen Hundes kann der Junge einfach nicht fassen. Er läuft weinend dem LKW hinterher.
„Nero, Nero, gebt mir meinen Nero wieder!“ Als er völlig erschöpft zum Börne-Platz kommt, verliert er sie aus den Augen. Mit gesenktem Kopf geht er den langen Weg zurück nach Hause. Im Wohnzimmer legt er sich aufs Sofa und das Polster wird getränkt von einem See voller Tränen. In der Straße ist wieder die sonntägliche Ruhe eingezogen und man hat den Eindruck, als wäre nichts geschehen.
Kurz nach siebzehn Uhr schleppt sich Heinz die Gasse entlang und steuert auf das elterliche Geschäft zu. Wie zu erwarten war, zeigt er auch heute Spuren einer schweren körperlichen Auseinandersetzung. Kratzspuren in Gesicht und beiden Armen. Das Hemd ist an mehreren Stellen zerrissen, die Nase dick angeschwollen und verkrustetes Blut in beiden Nasenlöchern. Eigentlich das typische Bild, das Hojo, wie seine Kumpels ihn nennen, seit Monaten fast jeden Sonntag abgibt.
Fragen, was passiert sei, sind überflüssig, denn die stereotype Antwort lautet: „Nichts Besonderes.“ Aber wie man auf Umwegen erfahren kann, ging und geht es immer wieder um die hübsche Brunhilde. Der erbitterte Kampf um den braunhaarigen Lockenkopf nimmt so richtig Fahrt auf, seit sich ihr bisheriger Freund endgültig von ihr getrennt hat. Nun buhlen drei neue Interessenten um die Schöne. Einer davon ist Hojo und der lässt bekanntlich nichts anbrennen. Auf Brunhilde machen diese „blöden Hahnenkämpfe“, wie sie schon mehrfach bemerkt hat, keinen besonderen Eindruck. Doch im Blut der drei Bewerber kochen hohe Dosen von Adrenalin und Testosteron, sodass sie überhaupt nicht merken, wie gleichgültig Brunhilde diese pubertären Streitereien betrachtet.
Die Abendsonne ist noch warm und die Temperaturen liegen deutlich über zwanzig Grad. Im Radio sprechen sie von einer tropischen Nacht. Die Fahrt der Eltern mit dem Motorrad nach Worms und zurück ist daher ein wirkliches Vergnügen, obwohl Margarete Braunfels seit vier Monaten schwanger ist. Dies ist der Hauptgrund, warum sie die Eltern besuchen. Der alte Schmiedbach leidet an den Folgen mehrerer Kriegsverwundungen aus dem Krieg 1914/18 und keiner weiß, ob er das Jahr überleben wird. Sie wollen ihm mit dieser Neuigkeit eine Freude bereiten und vielleicht dadurch etwas neuen Lebensmut geben. Die Familie Schmiedbach besitzt einen alt eingesessenen Steinmetzbetrieb am Stadtrand von Worms. Man hoffte jahrelang auf einen Schwiegersohn, der den Betrieb weiterführen könnte. Vergeblich, die älteste Tochter hat einen Lehrer geheiratet, der zwar stundenlang über die Schönheit der Sandsteinarchitektur und über Kunstwerke reden kann, der aber leider, wie so oft, zwei linke Hände hat.
Als die jüngere, Margarete, dann mit einem Schneider ankommt, der zudem noch Jude ist, haben sich die Gedanken des alten Schmiedbach noch mehr verfinstert, denn er hat in den letzten Jahren unzählige grundlose Anfeindungen gegen Juden erlebt. Größer noch als die Sorge um sein Geschäft ist die Sorge um das Schicksal seiner Tochter und seiner Enkel. Er erwähnt das alles nicht. Von Jahr zu Jahr werden aber die Sorgenfalten des überzeugten Katholiken tiefer, denn immer mehr Kirchgänger kehren dem alten Dom den Rücken und tauschen den Katechismus gegen Mein Kampf ein.
Viele wollen die mehr als tausend Jahre deutsche Geschichte, die der Dom repräsentiert, durch ein neues Tausendjähriges Reich ablösen. Das macht dem alten Schmiedbach große Sorgen.
Es ist noch taghell als Alfred Braunfels mit seiner Frau wieder in Frankfurt ankommt.
„Merkwürdig, Nero bellt ja gar nicht“, bemerkt Margarete. Ein beklemmendes Gefühl überkommt sie. Als sie in das Wohnzimmer eintreten, kommt ihnen ihr älterer Sohn Heinz im Unterhemd entgegen. „Mein Gott, wie siehst du denn aus? Wie ein Lands-knecht nach der Schlacht um Magdeburg“, empfängt ihn sein Vater. „War nichts Besonderes los, wie immer!“, ergänzt er noch zynisch.
Wortlos dreht sich Hojo um und begibt sich hinkend in sein Zimmer. Niemand sieht seine Tränen, die nicht nur von körperlichen Schmerzen herrühren.
Dann wendet sich der Vater dem kleinen Harry zu, der immer noch mit geröteten Augen schluchzend auf dem Sofa kauert.
„Und was ist mit dir passiert, wo ist Nero?“, fragen Vater und Mutter fast zeitgleich.
„Er ist mir entlaufen, als ich mit ihm das Apportieren üben wollte. Er ist einfach nicht mehr zurückgekommen und ich kann ihn nicht mehr finden. Stundenlang habe ich nach ihm gesucht.“
„Ich bin sicher, wenn er Hunger hat, wird er wieder zurückkommen“, versucht die Mutter den Jungen zu trösten. Dabei nimmt sie ihn in den Arm und drückt ihn fest an sich. Harry wird zusehends ruhiger.
Die kommenden Tage lassen die Familie nicht zur Ruhe kommen. Im Geschäft erfährt Alfred von einem Kunden, dass in einem Runderlass des Reichsministers des Inneren vom 18. August die Richtlinien über die Führung der Vornamen Deutschlandweit angeordnet wird, dass männliche Juden vom 01.01.1939 an zusätzlich die Zwangsvornamen „Israel“ tragen müssen, Jüdinnen heißen nun „Sara“.
Heinz rückt jetzt mit der tatsächlichen Version seiner Schlägerei heraus: „Bei der Prügelei am vergangenen Sonntag ging es dieses Mal nicht um die schöne Brunhilde, sondern es waren ganz allein Anfeindungen von Hitlerjungen gegen Juden. Es war eine organisierte Bande der HJ. Niemand in unserem Bezirk hat einen dieser wilden Schläger gekannt“.
Des Weiteren hat Margarete in der Bäckerei nebenan erfahren, wie sich das Schauspiel mit Nero und Harry wirklich zugetragen hat. Eine Nachbarin von gegenüber hat das Geschehen beobachtet und sich Notizen gemacht. „Der LKW trug auf der Fahrertür einen Schriftzug Otto Ziegler Brennstoffe. Auf dem LKW befanden sich neun SA-Männer und vier Hitlerjungen. Ihr Junge wurde grundlos geschlagen und seines Hundes beraubt“, versichert die Frau glaubhaft.
„Was kann man tun?“, seufzt Margarete und stützt ihren Kopf in beide Hände.
„Ich werde meinen Freund Friedrich Schiffmann, den Kriminalkommissar befragen, aber nicht offiziell. Morgen schon“, sagt Alfred Braunfels mit fester Stimme.
Gegen neun Uhr am nächsten Morgen wählt er eine Telefonnummer, die er im Kopf hat. Die Nummer steht in keinem Telefonbuch. Es ist eine Geheimnummer, die nur eine ausgewählte Personengruppe kennt. Am anderen Ende meldet sich eine zarte Frauenstimme mit einem leichten Akzent.
„Hallo, hier ist Mai-Lin. Wen möchten Sie sprechen?“
Kapitel 2
KriminalkommissariatFrankfurt/Main 29.August 1938
Friedrich Schiffmann hat sich seit Tagen intensiv in die Ermittlungsakte des Mordes an einer Lehrerin hinter der Liebfrauenschule vergraben, so auch heute. Er überhört das Telefon, das nicht weit von ihm auf dem Schreibtisch steht. Sein Inspektor Becker, der direkt am Schreibtisch gegenüber sitzt, nimmt sofort den Hörer ab, da er offensichtlich zu den ungeduldigen der Zunft zählt.
„Das Gespräch ist für dich. Ich glaube es ist deine Haushälterin, Frau Sun“, bemerkt Becker, wobei er ein verschmitztes Lächeln nicht verbergen will. Dann übergibt er den Hörer an den Kriminal Kommissar. Schiffmann mag es partout nicht, dass Mai-Lin ihn auf der Dienststelle anruft. Er möchte ihre Existenz so gut und so lange wie möglich verbergen.
„Gerade eben hat dein Freund Alfred Braunfels angerufen. Er sagte, dass er mit dir wieder einmal Schach spielen möchte. Ich habe aber das Gefühl, als ginge es um noch mehr und dass es dringend sei. Vielleicht kannst du ihn ja heute noch anrufen.“ Dann legt Mai-Lin auf.
Schiffmann gibt den Hörer kommentarlos an Becker zurück. Er blättert weiter intensiv in der Akte und zeigt keinerlei Regung. Und überhaupt beschränken sich seine Konversationen mit Becker meist auf wenige unverfängliche Bemerkungen, da er diesem Kerl von Anfang an misstraut.
„Becker soll glauben, was er will. Von mir aus, dass das Klo verstopft sei“, sagt sich Schiffmann.
Gegen vierzehn Uhr muss der Kommissar zu einer Zeugenvernehmung in die große Friedberger-Straße. Jetzt sieht Schiffmann eine günstige Möglichkeit, seinen Freund Alfred Braunfels unbemerkt anzurufen. Kurz darauf meldet sich Margarete am Telefon, weil sie hin und wieder im Geschäft mitarbeitet. Da sie gerade Kundschaft bedienen muss, kann sie sich nur kurz fassen. Sie vereinbaren einen Termin um acht Uhr an diesem Abend. Schiffmann bemerkt, dass ihm zunehmend die Konzentration beim Aktenstudium fehlt und er schiebt den Ordner zu Seite. Seine Gedanken kreisen um Alfred und seine Familie.
Seit mehr als fünf Jahren verbindet die beiden Männer eine enge Freundschaft. Begonnen hat sie während eines Krankenhausaufenthaltes im Hospital zum Heiligen Geist. Unklare Probleme mit dem Verdauungstrakt, die ambulant nicht weiter abgeklärt werden konnten, führten beide Männer unabhängig voneinander in den späten Novembertagen des Jahres 1935 ins Spital. Zahlreiche Untersuchungen wechselten sich mit Tagen der Untätigkeit ab. An solchen untersuchungsfreien Tagen wurden viele Patienten mit sogenannten Rollkuren beschäftigt, derweil sich die Ärzte zu Beratungen zurückzogen. Bei genauer Betrachtung arteten aber diese sachverständigen Zusammenkünfte oft in Streitereien aus. Besonders dann, wenn Grobheiten ausgetauscht wurden, war es manchmal schwer verständlich, dass es dabei immer um das Wohl des Patienten ging. Die wahren Gründe für diese Auseinandersetzungen blieben den Patienten und dem Stationspersonal verborgen.
Um der Langeweile Herr zu werden, bat Schiffmann eines Morgens nach der Visite die Stationsschwester, sie möge doch unter den Patienten nachfragen, ob unter den nicht so schwer Erkrankten ein Schachspieler sei, mit dem er sich die Zeit vertreiben könne. Zwei Tage später erschien Alfred Braunfels bei Friedrich Schiffmann im Zimmer. Nachdem man sich bekannt gemacht hatte, kam es recht bald zur ersten Partie. Schnell bemerkten beide, dass sie auf etwa dem gleichen Niveau spielten. Das machte die weiteren Partien interessant, da es nicht immer den gleichen Gewinner oder Verlierer gab. Während der Spiele und auch zwischendurch erzählten beide aus ihrem Leben und nach etwa einer Woche hatte jeder eine reichliche Vorstellung vom Leben des anderen.
Schiffmann, in einem kleinen Dorf im Siegerland aufgewachsen, war schon als junger Mann eine Ausnahmeerscheinung. Durch seine beinahe zwei Meter Körpergröße überragte er bereits zwei Jahre vor dem Abitur seine Mitschüler, auch seine außerordentlichen Leistungen in der Leichtathletik waren beeindruckend. So wurde er mehrere Jahre lang unter den Kugelstoßern in der Bestenliste der Rheinprovinz geführt. Aber auch die schulischen Leistungen waren überzeugend und so bedauerte das ganze Lehrerkollegium sehr, dass der junge Mann eine Ausbildung bei der Polizei einem Studium vorzog. Dabei lag der Grund weniger in einer Begeisterung für den Beruf, als vielmehr in seinem fast zwanghaften Wunsch nach Ordnung und Gerechtigkeit. Zudem wurde ihm jede Absicht eines Hochschulstudiums von vornherein zunichte gemacht. Schuld daran trugen zwei seiner Tanten, die überaus gebildete Lehrerinnen waren. Schon als vierzehnjähriger fand er ihre Arroganz und Blasiertheit unerträglich. In Zukunft verband er den Lehrerberuf unweigerlich mit solcher Attitüde. Was aber eine völlig irre Vorstellung war, wie er später immer wieder betonte.
Im Kölner Polizeipräsidium wurde man sehr schnell auf den Siegerländischen Hünen aufmerksam. Seine Karriere ging ab 1920 steil bergauf und so wunderte es niemanden, dass er früher als alle Mitbewerber zum Oberassistenten befördert wurde. Als einen vernagelten Provinzler konnte man ihn wirklich nicht bezeichnen. Das wäre ein ziemlich schräger Vergleich gewesen. Das Schachspiel hat ihm offenbar die Fähigkeit verliehen, mehrere Züge im Voraus zu denken und tiefere Zusammenhänge zu sehen. 1928, als man in Berlin völlig neue Methoden in der Kriminalistik entwickelte, wurde er von Köln nach Berlin versetzt, um diese Neuerungen kennenzulernen. Die folgenden fünf Jahre sollten die einschneidenden in seinem Leben sein. Zu Beginn wohnte er als Untermieter in einer abgewrackten Bleibe, die zu einem Bauungetüm in Neukölln gehörte. In dieser scheußlichen Behausung, die mehr Kleinkriminelle und Huren als rechtschaffene Bürger beherbergte, wollte Schiffmann nicht einen Tag länger bleiben als unbedingt nötig. Sein Zimmer lag zu einem kleinen Marktplatz hin gelegen und wenn er das Fenster offen hatte, roch es nach Mohrrüben, Kartoffeln und feuchter Erde. Im Treppenhaus dagegen stank es nach schlecht ziehenden Kohleöfen, Schimmel und Urin. Da war ihm das offene Fenster doch lieber. Die meisten Bewohner kannten nur ihre Gossensprache, die mit einer Vielzahl vulgärer Ausdrücke bereichert war, deren Bedeutung er erst mit der Zeit begriff.
Auf der Dienststelle ging es ebenfalls sehr grob zu. Sein Chef, ein vierschrötiger Typ, lebte noch in der Welt kolonialer Eigenartigkeiten und Spleens. Krachkonservativ mit den verstocktesten und rassistischsten Ansichten. Seine ganze Philosophie wäre mit nur drei Sätzen hinreichend ausgebreitet. Die Kommunikation mit ihm verlief demnach meistens in Einwortsätzen. Bekannt war er auch wegen seines robusten Umgangs mit Menschen, die ihn ärgerten. Eine öffentliche Person von absolut peinlicher Geschmacklosigkeit. Sein unbeherrschtes Auftreten war eine einzige Warnung vor etwaigen körperlichen Übergriffen. Der Übergang von gesteigertem Selbstbewusstsein zu schwer erträglicher Aggressivität war fließend. Antisemitismus gehörte an jenem Ort zum guten Ton.
Schiffmann war in den ersten Monaten maßlos enttäuscht über sein Berliner Abenteuer, von dem er sich so viel versprochen hatte. Wo waren die Kollegen, die ihm die neuen Ermittlungsmethoden erklären sollten, wo die Wissenschaft? Stattdessen behandelte man ihn wie einen einfachen Büttel, betraut mit niederen Aufgaben, wie einen, den man gar nicht so richtig wahrnehmen wollte. Lag da vielleicht eine Verwechslung vor?
In seiner naiven Gutmütigkeit konnte sich Schiffmann überhaupt nicht vorstellen, dass die ganze Szenerie von Beginn an sorgfältig geplant war. Zwei Monate vor seinem Amtsantritt wurden zwei seiner Vorgänger bei einer Schießerei getötet. Um die Stabilität des neuen Mannes zu testen, hatte man für ihn ein Zimmer in dieser schrägen Behausung ausgesucht. Auch der bewusste Verzicht auf jegliche Kollegialität gehörte zum Testprogramm. Mit gezielten kleinen Demütigungen war der Siegerländer allerdings nicht aus der Ruhe zu bringen.
Aber eines Tages wurde ihm die Sache doch zu bunt. Mit einem hochroten Kopf verließ er das Büro und rief beim Hinausgehen in den Raum: „Dann macht ihr euren Scheiß doch alleine, Adieu!“
Wer der Vorstellung beigewohnt hatte, berichtete auf ganz unterschiedliche, aber doch beeindruckte Weise davon, wie er den neuen Kollegen Schiffmann bei seinem Auftritt erlebt hatte. Danach verschwand Schiffmann und war den ganzen Tag nicht mehr zu sehen. Dieser Auftritt zeigte Wirkung bis in die oberste Chefetage.
Am darauffolgenden Tag hatte Schiffmann einen Gesprächstermin beim Kriminaldirektor. Ein Mensch mit gepflegtem Aussehen, sein Alter war schwer zu schätzen.
Ganz im Gegensatz zu Schiffmanns direktem Vorgesetzten war dies ein Mann mit guten Anstandsformen. In seiner unverstellten Sprache ohne technokratische Floskeln, kam er auf den Punkt. Er erklärte Schiffmann ausführlich die Strategie, die hinter seiner Behandlung steckte, dass man die bisherigen Abläufe seines Lebens innerhalb und auch außerhalb des Präsidiums als eine bewusst ausgewählte Teststrecke verstehen müsse. Schiffmann könne dies zwar sehen, aber nicht als solche erkennen. In seiner verstärkten Detailwahrnehmung stecke die Gefahr, die Übersicht zu verlieren. Das Gesamtbild könnten dabei nur andere verstehen.
Berlin habe in den vergangenen Jahren eine ungeahnte Sogwirkung auf Populationen unterschiedlicher Kulturen und auch Gewerbe entwickelt. Im Schlepptau angesehener Kaufleute, Wissenschaftler und Künstler fanden und finden sich immer wieder Klein und Großkriminelle. Mittlerweile habe diese Entwicklung zu einem richtigen Bandentum geführt, dem man gezielt und energisch entgegentreten müsse. Hier seien auf polizeilicher Seite nicht nur intelligente Mitarbeiter gefragt, sondern auch Burschen mit einer gewissen Härte. Selbst die vorher eher bedeutungslosen Kleinkriminellen gerieten durch diese Entwicklung an ihr Existenzminimum, sodass auch jene Kleinganoven jetzt eine härtere Gangart einschlagen müssten. Hinzu käme die mittlerweile schwer durchschaubare politische Lage zwischen Kommunisten und Nationalsozialisten. Hier habe man schon lange den Weg gern gesehener Saalschlachten verlassen, in denen sich verschiedene Lager bis zur Erschöpfung austobten. Die Akteure arbeiteten jetzt vermehrt im Untergrund, dafür aber mit einem enorm kriminellen Potential. Brutale und blutige Auseinandersetzungen seien jetzt die Regel. Der Sieger werde sich recht bald in wahrer Größe und ganz ohne Anstand präsentieren. Alles sei irgendwie miteinander verwandt, nichts ist voneinander getrennt, alles gehöre zusammen, auch wenn es nicht so aussehe.
Da man ansonsten mit seiner bisherigen Arbeit sehr zufrieden sei, habe man sich entschlossen, ihn ab jetzt mit den neuesten kriminologischen Methoden vertraut zu machen und ihn in die Abteilung IV zu versetzen, wie es Schiffmanns Wunsch war.
Mit diesen sehr weitreichenden Informationen entließ er den Inspektor. Schiffmann bedankte sich, drehte sich um und verließ gut gelaunt und mit festem Schritt das Zimmer. Das verschmitzte Lächeln des Inspektors konnte der Polizeidirektor zwar nicht sehen, aber doch erahnen.
In den kommenden Monaten bedachte man ihn endlich mit einer bis dato nicht gekannten Fülle von Herausforderungen. Ihm wurden nach und nach neue Techniken nicht nur erklärt, sondern man weihte ihn auch in deren Anwendung ein. Zusätzlich lernte er sehr viel Neues aus der Gerichtsmedizin kennen. All dies kam seinen Vorstellungen einer modernen Kriminologie entgegen. Mittlerweile betrachtete es Schiffmann als willkommene Abwechslung, wenn er hin und wieder auch zu Außendiensten eingesetzt wurde. Allerdings schickte man ihn nicht gerade ins dickste Feuer. Dafür gab es innerhalb des Präsidiums ganz andere Kaliber, die gerne jeden Kampf aufnahmen.
Kapitel 3
Polizeikommissariat Berlin-MitteFreitag 8. November 1929
Mai-Lin Sun verlässt an diesem regnerischen Novembertag im Jahr 1929 mit ihrer deutschen Freundin Charlotte das Institut für Biologie der Humboldt Universität. Sie wollen noch kurz im nahgelegenen Café einen Kaffee oder Tee trinken und dabei ein wenig plaudern. Das machen die beiden öfter. Seit Monaten hat sich die Freundschaft zwischen den beiden Studentinnen vertieft. Vor dem Institut hat sich eine Menge vorwiegend männlicher Studenten versammelt. Viele tragen Spazierstöcke mit sich, worüber sich die beiden Mädchen amüsieren.
„Was hat denn so ein alberner Spazierstock in der Uni zu suchen“, kichert Charlotte. Kurz darauf offenbart sich der Stock, gemeinhin das Attribut großväterlicher Etikette, als ungeheure Angriffswaffe. Unter lautem Grölen von Parolen wie „Deutschland erwache“ und „Juda verrecke“ zieht diese Horde von NS-Studenten durch die Universität. Jeden jüdischen Studenten, den sie als solchen erkennen, prügeln sie mit ihren Spazierstöcken halbtot. Erst durch einen massiven Einsatz der Polizei kann das Drama beendet werden. Die beiden Studentinnen werden als mögliche Zeugen des Geschehens mit aufs Präsidium genommen. Schiffmann ist heute Kommissar vom Dienst und demzufolge mit den Ermittlungen betraut. Als er das Büro betritt, hört er, wie so oft, seinen Chef lauthals poltern.
„Was sollen denn das hier für Zeugen sein? Eine Asiatin, die durch ihre Schlitzaugen kaum was erkennen kann und womöglich kein Wort Deutsch spricht. Und hier eine Brillenträgerin, die auf fünf Meter keinen Baum erkennt, womöglich auch noch Jüdin ist. Die zwei soll man doch zum Teufel jagen.“ Dabei zeigt er abfällig auf Charlotte.
Schiffmann hört sich die dummen Entgleisungen des Kriminal Kommissars an, dann bittet er die beiden Frauen, ohne ein Wort zu sagen, in ein Vernehmungszimmer.
„Entschuldigen Sie bitte vielmals. Was dieser Banause da von sich gegeben hat, ist nicht nur beleidigend, sondern auch strohdumm, und dafür möchte ich mich entschuldigen. Er ist nicht repräsentativ für die gesamte Polizei, aber leider gibt es schon einige, die vom gleichen Schlag sind. Nun, jetzt habe ich hier das Sagen und den Holzkopf lassen wir mal draußen.“
Die beiden Studentinnen wirken jetzt deutlich entspannt und nachdem Schiffmann auch noch Tee aufgefahren hat, lockert sich die Befragung sichtlich. Er macht sich Notizen und stellt fest, dass ihn die Sache an sich gar nicht so recht interessiert. Richtig interessiert ist er an der Chinesin, die er von Minute zu Minute schöner findet. Jetzt erst bemerkt er, dass sie offensichtlich einen kulturell gemischten Hintergrund hat. Das war ihm vorher in dem Trubel nicht aufgefallen.
„Hier sind eindeutig auch europäische Merkmale erkennbar“, sagt er sich. Sein Herz schlägt schneller und als sich ihre Blicke kreuzen, verspürt Schiffmann ein merkwürdig enges, aber wohltuendes Gefühl in seiner Brust. Am liebsten würde er die Befragung noch stundenlang fortsetzen, aber das wäre dann doch etwas ungewöhnlich. Betont schwerfällig nimmt er noch die Personalien der beiden Frauen auf, ergänzt durch eine auffallend höfliche Bemerkung: „Falls es noch Rückfragen unsererseits geben sollte“.
Dabei weiß er schon jetzt, dass er noch viele Fragen haben wird. Bei der Verabschiedung sieht er Mai-Lin noch einmal ganz intensiv an und genießt ihren weichen Händedruck.
„Es war wirklich so. Alle Zeugen haben das gleiche berichtet. Die NS-Studenten haben für jedermann erkennbar grundlos jüdische Studenten angegriffen und schwer misshandelt. Das haben die beiden Frauen genauso gesehen und bezeugt“, lässt Schiffmann den Kriminal Kommissar wissen.
Seit dieser ersten Begegnung entwickelt Schiffmann weit mehr Interesse für Mai-Lin Sun als für die Schlägereien dieser total verblendeten NS-Studenten. Hartwig Vogt, sein engster Mitarbeiter und Freund, mit dem ihn seit Monaten ein grundehrliches Verhältnis verbindet, bemerkt schnell, dass da wohl eine Frau im Spiel ist. In seiner Offenheit spricht er recht bald Schiffmann auf dieses Thema an. Auch weiß er, um welche Person es sich handelt, da Schiffmanns Befragungen an der Universität und speziell im Institut für Biologie sich sehr umfangreich gestalten, aber wenig Essenzielles zutage fördern. Vogt, der aufgrund guter Beziehungen früh und bestens über mögliche politische Absichten informiert ist, warnt seinen Freund, bevor der in eine missliche Situation geraten könnte.
Folglich treffen sich Mai-Lin und Schiffmann jetzt des Öfteren privat. Auch ohne eine steife Liebeserklärung kann Mai-Lin seine aufrichtige und leidenschaftliche Liebe spüren. Irgendwann im Frühsommer 1932 beziehen sie eine gemeinsame Wohnung in Spandau. Mai-Lin beendet ihr Studium und promoviert. Nur wenige wissen von Schiffmanns Verhältnis zu ihr.
Während auf den Straßen und an der Uni, Hass, Gewalt und Rassismus unter weiten Teilen der Bevölkerung zunehmen, liebt Schiffmann die Halb-Chinesin Mai-Lin umso mehr und intensiver. Erschreckend ist für beide die Tatsache, dass sich viele Menschen nicht mehr schämen, diese ungeschminkte und tumbe Anstandslosigkeit gegenüber Ausländern, Andersdenkenden und Andersgläubigen nach außen zu tragen. Als dann Sein Freund Vogt noch die geheime Information durchsickern lässt, dass man nicht nur gegen die Juden, sondern auch speziell gegen die Chinesen sogenannte Säuberungsaktionen plane, sehen beide ihre Tage in Berlin gezählt. Rassismus gehört selbst unter Studenten mittlerweile zum guten Ton.
Das ist nicht mehr ihr Berlin.
Kapitel 4
Umzug nach Frankfurt/MainDienstag, 28. März 1933
In Frankfurt sind wir sicher“ beteuert Frieder, wie Mai-Lin ihren Friedrich Schiffmann liebevoll nennt. Im Nachtzug sitzen die beiden in einem Abteil der ersten Klasse eng beieinander. Es ist Ende März 1933 und die Tage, aber ganz besonders die Nächte, sind noch recht kalt. Mai-Lin hat den Kragen ihres Mantels hochgeschlagen. Eine große Mütze und ein dicker Schal verhüllen große Teile von Kopf und Gesicht. So wird man sie nicht sofort als Asiatin erkennen. Seit dem 30 Januar 1933, als Hitler zum Reichskanzler ernannt wurde, nehmen die Übergriffe der SA-Leute massiv zu. Auch innerhalb der Polizei sind mittlerweile Kollegen mit sehr radikalen Ansichten nicht mehr die Ausnahme. Schiffmann weiß, dass er nur noch seinem Freund Vogt vertrauen kann.
„Du wirst sehen, nicht mehr lange und der Spuk dieser Verrückten ist vorbei, man wird diesen böhmischen Gefreiten, wie ihn Hindenburg genannt haben soll, schon noch zähmen. Bis dahin müssen wir vorsichtig sein“, flüstert Schiffmann. Dabei drückt er Mai-Lin noch fester an sich und küsst sie auf die Wange. Ein salziger Geschmack verrät ihm nicht, ob es Freude oder Angst oder gar beides ist, was Mai-Lin in dieser Nacht empfindet. Das gleichmäßige Rattern des Zuges hat auf Schiffmann eine beruhigende Wirkung und er fällt nach etwa zwei Stunden Fahrt in einen oberflächlichen Schlaf. Seine Sorgen um Mai-Lin beschäftigen ihn mittlerweile auch nachts. Seit Tagen verspürt er einen seltsamen Druck, manchmal auch einen schneidenden Schmerz im rechten Oberbauch. Die Beschwerden kommen in unregelmäßigen Abständen immer wieder und nehmen ihm den Appetit. Solche Befindlichkeitsstörungen sind ihm nicht unbekannt. Früher hatte er dieses Gefühl oft vor Wettkämpfen in der Leichtathletik, weil er nicht wusste, wie die Begegnung ausgehen würde. Heute ist es ähnlich, aber die jetzigen Umstände sind viel ernster. Er will Mai-Lin nicht beunruhigen und behält das Ganze für sich. Für ihn ist es nur eine Magenverstimmung, der er keine größere Bedeutung schenken will. Aus dem oberflächlichen Schlaf erwacht, betrachtet er Mai-Lin. Sie hat die Augen geschlossen und es sieht aus, als wäre sie ebenfalls eingeschlafen.
Es scheint, als wüsste sie nichts von Frieders sorgenvollen Gedanken an die Zukunft, aber ganz ahnungslos und unbekümmert ist sie auch nicht. Das Zuggeräusch ruft bei ihr Erinnerungen an die Jahre in Tsingtau hervor. Jahrelang fuhr sie fast täglich mit der Shantung-Bahn von einem kleinen Vorort nach Tsingtau. Ihre Mutter hatte bei der Eisenbahn-Gesellschaft, ein Zusammenschluss verschiedener deutscher Banken, Reeder und Bergbauunternehmen, eine besondere Stellung bekommen. Da sie neben der Amtssprache Mandarin sowohl Deutsch wie auch Englisch gut beherrschte, war sie schnell auf eine Spitzenposition innerhalb der Eisenbahngesellschaft emporgestiegen. Aus einer Liaison mit dem deutschen Ingenieur Otto Sellbach, der das Projekt der Shantung-Bahn mit betreute, entstammte 1905 Mai-Lin und zwei Jahre später ihre Schwester Kim. Beide Mädchen wuchsen zweisprachig auf. Mai-Lin besuchte eine der vielen Schulen, die die Deutschen in Tsingtau errichtet hatten, und in denen neben Mandarin auch Deutsch gesprochen wurde. Eine Heirat ihrer Eltern war offiziell per Dekret vom Reichstag seit 1906 in Deutschen Kolonien verboten. Grund war die Angst vor der Degeneration der weißen Rasse. Dieser repressive Umgang mit Mischehen war unter den europäischen Kolonialmächten einzigartig.
Dem Familienleben schadete dieser Umstand nicht. Otto Sellbach war nicht nur ein guter Ingenieur mit einem hohen Gehalt, sondern auch ein geschickter Geschäftsmann. Da die Eisenbahnstrecke besonders die Erschließung des Hinterlandes der deutschen „Musterkolonie“ Kiautschou zum Ziel hatte, waren Verträge mit großen Eisenerz- und Kohleminen ein lukratives Geschäft. Um diese Gewinne nicht in der instabilen Kolonie zu lassen, verfügte Sellbach, dieses Geld auf verschiedenen Konten bei unterschiedlichen Banken im Deutschen Reich und in der Schweiz zu deponieren. Im Nachhinein betrachtet hatte er Recht. Nach heftigen Kämpfen wurde Tsingtau am 07. November 1914 von den Japanern erobert und besetzt. Den eingeschlossenen deutschen Verteidigern war schon Anfang November die Munition ausgegangen. Die Verteidiger wurden nach Japan in Kriegsgefangenschaft gebracht. Folglich veränderte sich die Lage auch für die Zivilbevölkerung. Lebten 1913 nur etwa zweihundert Japaner in Tsingtau und etwa viertausend Deutsche, so waren es 1920 etwa siebzehntausend Japaner und nur ungefähr dreihundert Deutsche. Die Stadt wurde mehr und mehr japanisch geprägt. Auf die Erfahrungen von Otto Sellbach wollten und konnten die Japaner nicht verzichten, also konnte er, wenn auch weniger gut bezahlt, seine Arbeit behalten. Da er für die Kinder keine Zukunft in dieser Region sah, schickte der Vater – anfangs gegen den Widerstand der Mutter – Mai-Lin 1928 nach Berlin. Gut ausgestattet aus den Konten aus den Eisenbahngeschäften des Vaters konnte sie hier sorgenfrei studieren.
Kapitel 5
Der Neubeginn in Frankfurt/MainMittwoch 29. März 1933
Mit knapp einer zwanzigminütigen Verspätung läuft der Nachtzug aus Berlin auf Gleis fünf des Frankfurter Hauptbahnhofs ein. Frieder Schiffmann und Mai-Lin sind überrascht, wie viele Menschen schon knapp nach sechs Uhr in der Früh unterwegs sind. Im Vergleich zu Berlin ist das Wetter hier schon fast frühlingshaft.
„Bestimmt drei bis vier Grad wärmer als in Berlin, spürst du das? Du wirst sehen, hier wird es besser. Der Frühling erwartet uns schon“, versucht Schiffmann Mai-Lins Stimmung aufzubessern, denn unterwegs glaubte er in ihrer Stimme eine Bedrücktheit zu hören. Mit nur einem kleinen Handgepäck gehen sie auf das Ende des Bahnsteigs zu. Dort sollen sie den jüngeren Bruder von Mai-Lins Vater treffen. So ist es vereinbart. In der Tat sehen sie nach kurzer Umschau einen Mann mittleren Alters, etwa um die vierzig. Er trägt zwar einen Anzug, aber die Kostümierung ist derart außer Mode und leider auch noch schäbig, dass die Erscheinung des Mannes eher Mitleid als Erheiterung erregt. Man kann sich kaum vorstellen, mit was er seinen Lebensunterhalt verdient. Vor sich hält er ein Schild aus brauner Pappe, auf das er den Namen Fam. Schiffmann mit einer ungelenken Schrift geschrieben hat.
„Das muss er sein, Onkel Theodor“, sagt Mai-Lin, und ihre Gesichtszüge lockern sich zunehmend, als sie auf den Mann zugehen. Sie hat sofort die Ähnlichkeit mit ihrem Vater erkannt, obwohl sie den Onkel noch nie gesehen hat. Die Begrüßung ist verständlicherweise anfangs etwas steif, doch kommen die drei schnell miteinander ins Gespräch. Theodor hat mit sehr viel Aufwand ein Auto mit Fahrer organisiert.
„Es ist nicht so leicht wie in Berlin, hier auf dem Land ein Auto zu organisieren. Der Odenwald, von wo ich herkomme, ist tiefe Provinz und da fahren nicht so viele Autos. Ich bin ja froh, dass mein Freund, der Dorfmetzger, mir so großzügig helfen kann. Er will die Fahrt mit Geschäften hier in Frankfurt verbinden. Der Tag ist ja noch lang.“
Nachdem das große Gepäck im Lieferwagen verstaut ist, nehmen die beiden Berliner im Führerhaus neben dem Fahrer Platz. Der Metzger, eine überaus gut genährte und lustige Gestalt, nimmt sowieso schon die Hälfte des Führerhauses ein. Wäre Schiffmann bei seiner Größe nicht so gelenkig, so müsste eine Person draußen bleiben. Theodor klemmt sich mit seinem zerknitterten Anzug zwischen das Gepäck im Laderaum. Irgendwie fällt er dort gar nicht besonders auf. Mai-Lin und Frieder genießen die Enge im Führerhaus, die sie eigentlich nicht so schnell wieder aufgeben wollen. Nach gut einer halben Stunde hält der Wagen vor einem Haus, das man ohne Übertreibung durchaus als Villa bezeichnen kann. Es ist ein eineinhalbgeschossiger Sandsteinbau mit einem großen Erker und seitlich einem weit ausladendem Balkon. Das Haus steht etwas zurückversetzt und wird von einem kleinen Park mit altem Baumbestand umgeben. Der Garten erscheint ziemlich verwildert, woraus man schließen kann, dass das Haus schon längere Zeit nicht bewohnt ist. In der Villa findet man glücklicherweise einen Mobiliarbestand, der zwar nicht mehr vollständig ist, mit dem aber ein guter Start möglich ist.
Als Mai- Lin ihrem Vater in einem ausführlichen Brief die Situation in Berlin Anfang 1933 schildert und dass sie mit ihrem Verlobten, so bezeichnet sie Frieder, nach Frankfurt am Main ziehen wolle, setzt Otto Sellbach alle Hebel in Bewegung. Darüber hinaus erklärt Mai-Lin, dass in Frankfurt die Stelle des ersten Kriminalkommissars neu zu besetzen sei und ihr Verlobter ausgezeichnete Chancen habe, diese zu erhalten. Dies scheint ihr ein wichtiges Argument. Sie selbst habe bereits Kontakt mit dem Senckenberg Naturmuseum aufgenommen. Ihr Doktorvater habe sich für sie eingesetzt und sie erwarte täglich eine Zusage.
Otto Sellbach zögert nicht lange und schreibt in einem langen Brief an seinen Bruder Theodor, wie er sich die Unterstützung