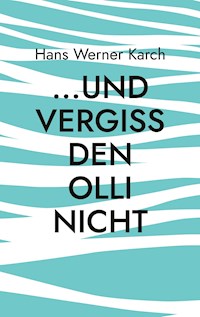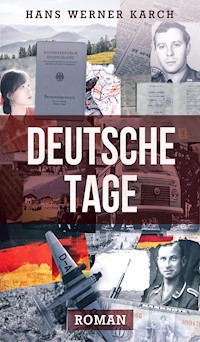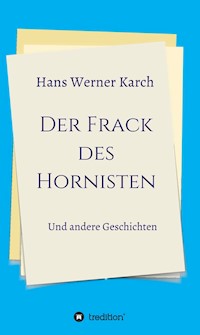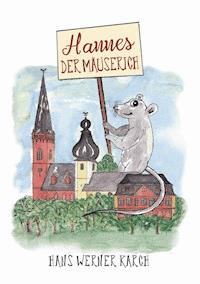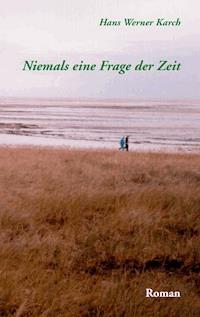
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Wann und wen wir wo lieben, hassen oder gar töten ist nie eine Frage der Zeit. Eingebettet in die schwierige Aufarbeitung der Beziehung der Nachkriegsgeneration zu ihren Eltern sind zwei besondere Deutsch-Französische Liebesbeziehungen. Franz Seeberg, ein junger deutscher Wissenschaftler, wechselt 1978 von Aachen zu einem Laborteam an der Universität Reims. Schnell verliebt er sich in seine Chefin Marie-France. Beide verleben glückliche Tage in der Champagne. Rudolf, der Vater von Franz Seeberg, ein dekorierter Offizier im Frankreich-Feldzug, verliebt sich 1942 in die französische Krankenschwester Véronique. Durch die Kriegswirren verlieren sich beide aus den Augen. Marie-France ist das Kind aus dieser Beziehung. Als sie mit ihrem Verlobten Franz ihre Mutter in der Normandie besucht, überkommt diese nach kurzer Zeit eine dunkle Ahnung.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 187
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Schwierigkeiten werden nicht dadurch überwunden, dass sie verschwiegen werden.
(Bertolt Brecht 1898-1956)
Inhaltsverzeichnis
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Epilog
Kapitel 1
Mittlerweile nahm der Schmerz in seinem rechten Schultergelenk von Minute zu Minute an Intensität zu, gefolgt von einer Missempfindung, die sich jetzt langsam bis zu seinen Fingerspitzen ausbreitete. Er erinnerte sich, dass ihm dieses Phänomen schon einmal in seiner frühen Studentenzeit begegnet war.
Franz Seeberg wusste nicht mehr, was ihn mehr störte, der Schmerz in der Schulter oder dieses Gefühl des drohenden Verlustes der Sensibilität und eventuell auch der Motorik dieser ganzen Extremität.
Schon ertappte er sich dabei, wie er gezielte Fingerbewegungen ausführte, um zu testen, inwieweit dieser kräftige Arm ihm noch gehorchen konnte und nebenbei traten dann Erinnerungen aus seiner Studentenzeit in sein Bewusstsein. Seeberg erlebte intensiv diese Zeit, die geprägt war von Unruhen und teils starken politischen Aktivitäten:
Der Lust an der Konfrontation.
Der Freude an einer neuen, ausgelassenen Debattenkultur, vielfach begleitet von einer grobkörnigen Sprache beider Parteien, die dem ganzen noch die notwendige Würze verlieh.
Der Erwartung an eine Zeit des Umbruchs, des Erwachsenwerdens, „aber nicht im Sinne unserer Väter und Mütter“, wie er oft genug betonte.
Mit seinem besten Freund rief er im Eifer und nach reichlich Alkoholkonsum im Sommer 1969 auf einer der wilden Feste aus:
„Es wird die Zeit der Rache an unseren Eltern kommen!“
Was auch immer die beiden darunter verstanden.
Vorausgegangen war ihnen eine Kindheit in einem bis dahin noch unbekannten Frieden und dem Streben aller nach Wohlstand. Die allgemeine Blickrichtung war verständlicherweise für die meisten nach vorn gerichtet. Für eine Retrospektive war die Generation ihrer Eltern offenbar noch nicht reif genug, und jeder versuchte auf seine Art, den Untergang ganzer Völker und Kulturen, die dieser zweite Welt-Krieg mit sich gebracht hatte, irgendwie zu vergessen.
Ganz besonders in Deutschland hinterließ das Dritte Reich eine bisher nicht gekannte moralische Trümmerlandschaft, in der jede staatliche Ordnung gerade untergegangen war.
An ein echtes Verarbeiten aller Lügen und Verwirrtheiten war noch lange nicht zu denken. Auch 20 Jahre nach Kriegsende kam es nur selten zu freier und ehrlicher Kommunikation mit der Generation ihrer Väter und Mütter über die unselige Zeit von 1933 bis 1945.
Mehrfach wurden bei Treffen unzählige und noch dazu völlig untaugliche Versuche unternommen, sich gegenseitig darin zu bestärken:
„dass man von alledem nur wenig oder gar nichts gewusst hätte.“
Die meisten versuchten, sich so klein wie möglich zu machen, stellten sich als unbedeutendes Rädchen im grausamen Getriebe des Krieges dar oder stritten sogar jegliche Beteiligung an Verbrechen gänzlich ab.
All diese Erklärungen erschienen wie eine, sich selbst spendende, allerdings sehr ungeschickte Generalabsolution, die, in der Nachbetrachtung an Peinlichkeit nicht zu überbieten war, vor allem vor dem Hintergrund der unzähligen Verbrechen in diesen Jahren der NAZI-Herrschaft.
„Die Loslösung vom Gedankengut der Väter gelingt uns“, so dachten Seeberg und viele andere mit ihm, „zunächst und hauptsächlich in der Geburt einer neuen Sprachkultur, die nur wir(!) zu entwickeln imstande sind, denn wir gehören nicht zu den Vorbelasteten.“
Die allgemeine, schlichtweg grauenhafte Verwilderung der Sprache in den Propagandareden und Hass-Schriften des NS-Regimes bediente sich zudem schamlos gefährlicher Euphemismen, die nur dazu bestimmt waren, die grässlichen Verbrechen so darzustellen, dass die abscheuliche Wahrheit nicht als furchterregend wahrgenommen werden konnte.
Mit dem Begriff „Endlösung der Judenfrage“ konnte man nicht unbedingt das Morden an sechs Millionen Menschen in Verbindung bringen.
Diese Menschenverachtung war und ist auch heute noch unvorstellbar.
Ebenso wurde eine gewaltsame Vertreibung ganzer Volksgruppen als „Umsiedlung“ beschönigt.
Es war eine Zeit, die von einigen mit einer vollkommenen Zerstörung jeglichen menschlichen Anstands verbunden war. Von politischer Seite nicht nur gewollt, sondern auch gefördert. Seeberg und viele seiner Freunde empfanden diese Verlogenheiten unerträglich. Die Sprache von Grund auf zu entrümpeln und die Dinge zu benennen, wie sie wirklich waren, das (!)war eines ihrer großen Ziele.
Unausweichlich musste dies sehr oft zu schweren Auseinandersetzungen führen, da die Diskussionen nicht allein vom Inhalt her, sondern auch durch die Verharmlosung der Verbrechen während des Krieges an Schärfe zunahmen.
Hatte einmal irgendeine Person den Versuch unternommen, von einer Großreichnostalgie auch nur zu reden, sie musste diese noch nicht einmal verherrlichen, so blieb der oder dem Betreffenden jene Begegnung mit Franz in dauerhafter Erinnerung.
Neben seinen klugen und schlagfertigen Argumenten bestach er zudem durch ein fundiertes Geschichtswissen über die Zeit zwischen 1933 und 1945. Er vermied es absolut, sein Gegenüber zu belehren.
Vielmehr war es ihm wichtig, alle Widerlichkeiten der NSDAP darzulegen, und die drängende Frage zu eruieren, wie es möglich war, von diesem ungezügelten Größenwahn besessen zu sein.
Jene Nostalgiker des Dritten-Reiches sollten selbst ihre irrigen Vorstellungen durchschauen und aufgeben.
Diese Art der Überzeugung war ihm wichtiger als der erhobene moralische Zeigefinger.
Nicht immer gelang ihm diese mühsame Geschichtsstunde, und so konnte es vorkommen, dass ihm, bei aller Emotionalität auch hin und wieder mal die Gäule durchgingen.
Gerade in diesen Jahren war er wie besessen, die, wie er sagte Ewigen Wahrheiten mit einem nahezu missionarischen Auftrag aller Welt verkünden zu müssen. Demnach war er schnell bekannt für seine teils überladenden, teils krawallartigen Auftritte.
So arteten Schul-und Studentenzeit zeitweise in wortgewaltige Demonstrationen aus, die hin und wieder schon mal begleitet waren von körperlichen Auseinandersetzungen mit der Polizei. Über mehrere Jahre hinweg war er mit vielen seiner Gleichgesinnten, wie man ihnen nachsagte, schwer auf Krawall gebürstet.
Eine Versöhnung mit ihren Vätern, und teilweise auch mit ihren Müttern, schien Teilen dieser Jugend in jenen Jahren sehr weit entfernt, wenn nicht sogar unmöglich. Der Ungeist des sich nicht Verstehens benebelte beide Generationen über Jahre hinweg.
Je länger sich Franz mit der Thematik beschäftigte, umso mehr erkannte er, dass Hass und Gewalt nicht zufällig entstanden. Sie waren zusammen organisiert, vereint in einer ideologisch gezüchteten Bande von Terroristen.
Die grenzenlose Verachtung von Allem was nicht in das verwirrte Weltbild dieser Nazis passte, verschlug ihm öfter die Sprache.
Hatten denn so viele vergessen, oder vielleicht auch nicht gelernt die Dinge zu hinterfragen, die sich tagtäglich vor ihren Augen abspielten?
Möglicherweise auch eine Folge grassierender Verblödung, die bewusst politisch inszeniert wurde!
Wenn Franz dann kommentierte, dass dieser Apparat sein nötiges Schmierfett wesentlich durch das Schweigen des großen Kollektivs der Nicht-Neinsager erhielt, dann beendete der alte Seeberg öfter die festgefahrenen Diskussionen mit dem Satz:
„Hätte, würde, könnte, und so weiter.
In der Nachbetrachtung der Geschichte ist dieser Konjunktiv sicher grundsätzlich diskussionswürdig.“
Allerdings erschöpfte sich seine Neigung zur Vergangenheitserklärung in ähnlichen, und bewusst spärlichen Ausführungen, die man aber bei genauer Betrachtung nur als den vorsichtigen Beginn eines Versuchs werten konnte.
Weiter vorwagen, konnte und wollte er sich nie.
Erst Jahre später erkannte der junge Seeberg, dass Verstand alleine nicht hilft.
„Man braucht ein Gespür für Hoffnungen und Ängste.“
Klingt ziemlich angestaubt, ist aber so.
Mit dem Ende des Krieges musste ein großer Teil der Elterngeneration über Nacht verlernen, was sie über Jahre hinweg lernen mussten.
Hungernd, geächtet und verachtet lebte der größte Teil der Bevölkerung ziellos zwischen Trümmern.
Ein gedemütigtes Objekt der Sieger.
Die schwierige, aber dennoch wichtige Aufgabe, sich im Frieden ganz besonders um den Frieden zu kümmern und daran zu arbeiten, diesen zu erhalten war für sie ein völlig unbekanntes Feld.
Damit kamen Überforderung und Leere in ihr Leben und so war die Flucht in ein stark Konsum orientiertes Dasein, augenscheinlich ohne ideologische Begleitmusik, sehr willkommen.
Die jüngste Vergangenheit blieb bei ihnen über viele Jahre hinweg ausgeblendet, und so verstanden sich viele der 68er Generation als kritische Beobachter der politischen Bühne. Sie wollten verhindern, dass nicht wieder ein gefährlicher Ideologie-Mix angerührt wurde. Denn das Vakuum, das durch den Untergang des Dritten Reiches entstanden war, entfesselte eine enorme Sogwirkung für viele Aufsteiger ganz unterschiedlicher Gesinnung.
Kapitel 2
Jetzt lag Franz Seeberg, schon seit mehr als einem Tag mit Marie-France auf einer ihm noch immer ungewohnt harten Matratze in einem halbdunklen Hotelzimmer unweit des Zentrums von Reims.
Ein milder Junimorgen ohne den häufigen Regen in dieser Jahreszeit gab der Champagne das ersehnte Licht für ihre weitläufigen Weinberge. Der Verkehr der mehrspurigen Ausfallstraße nach Süden war nur wenige hundert Meter von seiner Pension entfernt.
Aber jetzt, nachdem Marie-France das Fenster halb geöffnet hatte, um ein wenig der frischen Morgenluft hereinzulassen, schwoll der Lärm unzähliger Autos an, die offenbar mehrheitlich stadteinwärts fuhren.
Das geräumige Zimmer besaß im Vergleich zu den üblichen Hotelzimmern eine kleine Kochnische mit einem kleinen Tresen, an dem er morgens seinen ersten Kaffee zu sich nahm.
Seeberg hatte bewusst eine dieser neueren Hotelformen, wie man sie jetzt öfter finden konnte, gewählt. Wichtig war ihm Sauberkeit und ein fairer Preis. Sein Gehalt als Assistent war anfangs nicht so üppig, sodass er keine Gedanken an eine Wohnung verschwendete. Und überhaupt wusste er nicht, ob er in dem Forscherteam willkommen sei und wie sich seine Zeit dort entwickeln würde. Zudem hatte er die Pension unter dem Aspekt ausgesucht, dass er das Institut der Pharmazie bequem zu Fuß erreichen konnte. Er musste nur einige Meter der Rue Jacqueline Vernier folgen und dann in die Rue Jean d’Aulan einbiegen. Sie führte ihn dann geradewegs, nachdem er die Rue du Géneral Koenig überquert hatte, zum Centre-Hospitalier der Universität.
Im Nordwesten dieses riesigen Komplexes lag das Pharmazie-Institut UFR (Unité de Formation et de Recherche), was ebenfalls zur Universität gehörte.
Hier arbeitete er seit Monaten in einer Forschergruppe, auf die er während seiner Zeit in Aachen aufmerksam geworden war.
Der glückliche Umstand, dass Aachen und Reims seit 1967 Partnerstädte waren, führte dazu, dass Stellenangebote hier schneller als auf dem üblichen Weg zwischen beiden Universitäten vermittelt werden konnten.
Im Herbst des Jahres 1978 trat Seeberg dann, voll großer Erwartungen, die Stelle als Assistent im Institut der Universität Reims an. Um sein Französisch, das mittlerweile stark durch die Umgangssprache gefärbt war, zu verbessern, belegte er kurz entschlossen einen Sprachkurs, der ihm im Nachhinein große Vorteile brachte. Zukünftig traten nur selten Sprach- und Verständigungsprobleme an seinem neuen Arbeitsplatz auf.
Er wusste durch seine vielen Frankreichaufenthalte als Schüler und Student, wie angenehm freundlich Franzosen sind, wenn man ihre Sprache, auch mit deutschem Akzent, spricht. Eine Anrede in Deutsch finden viele nicht besonders anziehend. Manche wollen diese Haltung bewusst nicht verbergen, was aber absolut keine typisch Französische Eigenart ist.
Überraschend für ihn war dann seine erste Begegnung mit Marie-France, bei der er sich erst etwa eine Woche nach seinem Arbeitsantritt im Institut vorgestellt hatte. Ein früherer Termin war für die Laborleiterin nicht möglich, da sie sich auf einem Kongress in Marseille befand.
Ihre Begrüßung an diesem Morgen war auffallend herzlich, begleitet von einem ungewöhnlichen Händedruck.
„Bonjour und guten Tag, lieber Herr Seeberg. Seien Sie ganz herzlich willkommen in unserem Institut. Ich wünsche uns eine kollegiale und angenehme Mitarbeit mit Ihnen. Nebenbei hoffen wir natürlich auf eine fruchtbare Kooperation.“
Das war eine knappe und klare Begrüßung in Französisch und Deutsch von einer Frau, die offenbar hier das Sagen hatte. Diese Begegnung erlebte er kurz vor 9 Uhr im Treppenhaus zwischen erstem und zweitem Labor.
An ein näheres Kennenlernen war nicht zu denken. Hier war offensichtlich Zeitdruck angesagt.
Ganz im Gegensatz zu dem Begrüßungszeremoniell vor einer Woche durch den Institutsdirektor, der sich vergeblich bemüht hatte, eine kurze Ansprache zu halten, sich dann aber heillos in die Bedeutung Deutsch-Französischer Freundschaften verstieg und die große Vergangenheit der Städte Reims und Aachen für das aufstrebende Europa, aber ganz besonders für die Aussöhnung zwischen Frankreich und Deutschland.
Franz Seeberg genoss es, als Deutscher so viel Huldigung und Ehre aus französischem Mund entgegenzunehmen, obwohl er dafür noch nichts getan hatte.
„So viel Ehrerbietung kann auch eine Last sein“, dachte er. Aber davor fürchtete er sich nicht.
„An deutschen Instituten war der Ton doch wesentlich rauer und direkter.
Lob erhielt man, wenn überhaupt, erst hinterher“.
Marie-France Christine d‘Alouette, so ihr vollständiger Name. Auf eine Anrede mit Docteur legte sie keinen gesteigerten Wert. Auch benutzte sie den Titel nur dann, wenn sie davon überzeugt war, einer Forderung oder auch einer Bitte den nötigen Nachdruck verleihen zu müssen. Sie war sich ihrer Position und dem Status im Institut sehr bewusst, und von daher störte es sie wenig, wenn sie in kollegialer und freundlicher Absicht mal mit Marie-France, mal mit Christine angesprochen wurde.
Die älteren Assistenten bevorzugten indes die Anrede mit „ Madame d’Alouette“. Sie wollten ebenfalls von ihr respektvoll mit „ Monsieur“ angesprochen werden.
Dabei erlebten sie offenbar das hohe Gefühl, auf einer Ebene mit einer Adligen, gleichwertig kommunizieren zu können. Es gab gewiss einige Kollegen, die es schmerzte, keine solche Karriere hingelegt zu haben, obwohl sie viel besser intrigieren konnten, was aber nicht gerade das Terrain von Marie-France war.
Gelegentlich bauten sie ihr kleine Fallen, die sie aber überlegen lächelnd umging.
In der Marie-France und Christine Fraktion befanden sich in den Augen dieser Alt-Assistenten nur despektierliche Proleten, obschon sie allesamt erfolgreich ein Hochschulstudium abgeschlossen hatten, aber nur wenig gute Sitten besaßen.
In ihrer Duzerei mit der Laborleiterin sahen die Jung-Assistenten aber eher eine freundschaftlich-kollegiale Beziehung.
Die Alt-Assistenten hingegen betrachteten deren Benehmen als einen Ausdruck beginnender, subversiver Dekadenz. Dagegen wehrten diese sich entschlossen. Auch bei aller Gegensätzlichkeit bestand keine Feindschaft zwischen beiden Lagern.
Nur mochte keiner den Umgangston des anderen, was nicht unbedingt mit dem Alter an sich zu tun hatte.
Seeberg besaß ein feines Empfinden für diese Spaltung der Assistentenschaft, die sich offenbar nur in der Anrede ihrer Laborleiterin erahnen ließ.
Er sah sich seit dieser ersten Begegnung mit Marie-France in keiner Zwangslage, zu welcher Seite er sich schlagen sollte. Zweifellos stellten die jüngeren Assistenten die Gruppe dar, zu der er sich am meisten hingezogen fühlte. Auch gefiel ihm ganz besonders der legere Umgangston, den er so nicht vermutet hatte. Eine Subversion von Seiten der Jung-Assistenten konnte er nicht erkennen.
Obwohl erst vier Tage vergangen waren, konnte sich Seeberg einfach nicht mehr daran erinnern, wie Marie- France sich ihm vorgestellt hatte und ob überhaupt über eine Form der Anrede gesprochen wurde. Alles war zu schnell gegangen, und ihr Erscheinen hatte ihn derart stark und nachhaltig beeindruckt, dass er nahezu alles von dieser ersten Begegnung vergessen hatte.
Momente, die man auch im Nachhinein nicht begreifen und demnach auch schwerlich erklären kann, bilden ein Reservoir an Gedanken und Erinnerungen, mit denen wir uns ziemlich lange beschäftigen.
Begegnungen mit einem Menschen, den wir bisher nicht kannten, können uns auf Anhieb sehr viel an Sympathie und Liebenswürdigkeit vermitteln, oder auch das Gegenteil.
So die Situation für Franz Seeberg an jenem Morgen. Nach seinem ersten Kontakt mit Marie-France empfand er das große Glück, gerade dieser Person begegnet zu sein. Er war von Anfang an ihrem Charme, der von einer unverfälschten Herzlichkeit begleitet war, erlegen.
Zählte er sich doch eher zu den Vertretern der nüchternen Wissenschaft, so wurde er an jenem Morgen ein wehrloses Opfer seiner Gefühle.
Gewehrt hatte er sich nicht!
Sich zu verlieben war für ihn bisher ein Prozess, der sich aus einer mehr oder weniger langen Phase von Begegnungen entwickeln konnte. Am Ende würde dann in der Regel eine Verliebtheit warten.
Diesen Weg kannte er.
Aber der jetzige Zustand stellte seine bisherigen Liebeserfahrungen komplett auf den Kopf.
„Verrückter könnte es nicht sein, und logisch ist es überhaupt nicht“, stellte er in seiner bekannt nüchternen Betrachtungsweise fest.
Zwei Gedanken beschäftigten ihn seither unablässig: Zum einen könnte er diesen Gefühlsausbruch schnell wieder vergessen, und sich vornehmlich seiner Arbeit widmen.
Der zweite Gedanke erschien ihm allerdings wesentlich reizvoller aber auch gefährlicher. Danach wollte er seinen Gefühlen zu dieser Frau freien Lauf lassen, soweit dies vertretbar wäre.
Seeberg spürte, wie in ihm dieses unwiderstehliche Gefühl des berauschenden Verliebtseins förmlich explodierte, denn diese Hochstimmung hatte keine Vorlaufzeit, keine Entwicklung und erst recht keine Bemühungen gebraucht.
Sie war einfach von Beginn an da - und behauptete sich!
Ungefragt ,unerwartet, aber nicht unerwünscht.
Und so machte er sich Gedanken, wie er diesen ungesteuerten Vorgang doch in einen kontrollierten Prozess überführen könnte.
Mit dem Begriff „Liebe“ wollte Seeberg noch vorsichtig sein.
Ihm war jetzt klar geworden, dass er sich seit Monaten in einem Zustand der Einsamkeit befand, die ihm bis dahin nicht bewusst war. Durch seine Forschungsarbeiten war er in eine Art gefühlsarme Benommenheit geraten. Dabei bemerkte er nicht, wie sehr er seine Freundin Ingrid vernachlässigt hatte, und so war die Trennung von ihr unabwendbar.
Jetzt, während der Begegnung mit Marie France fühlte er sich seltsam, angenehm verwundet, und dieses vermeintliche Trauma riss ihn aus seiner jetzigen Verfassung.
Alles war schlagartig in klares Licht getaucht. Nichts und niemand konnte diese Stille stören, in der er, wenn auch nur für kurze Zeit dieses unbeschreibliche Glücksgefühl erlebte.
Kapitel 3
Philippe Berger, ein etwa gleichaltriger Assistent, wurde ihm als direkter Mitarbeiter innerhalb einer bestimmten Forschergruppe zugeteilt, da man nicht genau wusste, wie gut oder schlecht Seebergs Sprachkenntnisse seien.
Philippe war Elsässer und stammte aus einem kleinen Dorf nördlich von Colmar. Studiert hatte er in Strassbourg sowie vier Semester in Freiburg.
Demnach war die Erwartung groß, dass seine Zweisprachigkeit Garant sein könnte, etwaige Kommunikationsprobleme zu lösen. Des Öfteren diskutierten die beiden in einer Mischung aus Deutsch und Französisch, was auch immer wieder zur Erheiterung der übrigen Assistenten beitrug.
Seeberg, der wie Berger einer Weinregion entstammte, war wie dieser einer der wenigen, die Ende der 1960er Jahre eine Universität besucht hatten. Außer dieser Gemeinsamkeit war es noch ihre Weinverbundenheit und die Liebe zur Provinz, die sie teilten.
Beide fühlten sich auf vielen Ebenen sehr nah, und schnell erwuchs eine freundschaftliche Beziehung zwischen ihnen.
Am Tag 12 nach seiner Anstellung fand Seeberg morgens schon beim Arbeitsantritt einen Briefbogen auf seinem Arbeitsplatz.
Der Briefkopf war der des Instituts mit der Adresse der Laborleiterin. Ganz knapp und deutlich war er auf Französisch verfasst:
„Cher M. Seeberg, erwarte Sie heute gegen 11 Uhr in meinem Bureau.
Dr. Marie-France d’Alouette“
Seeberg dachte nach, mehr noch über die Art der Anrede als über den Grund des Vorsprechens.
Mit der nüchternen Anrede „Cher“ konnte er zu diesem Zeitpunkt nicht viel anfangen. Hätte sie doch anstatt des prosaischen „Cher“, ein zartes „mon Cher“ gewählt, dann hätte Seeberg nicht den leichten Anflug von Enttäuschung verbergen müssen.
Natürlich konnte er nach so einer kurzen Begegnung keine solche freundschaftliche Anrede erwarten, aber gewünscht hatte er sich diese Annäherung schon.
„Was für ein alberner Gedankengang“, sagte er sich.
Nur, wie sollte er sie jetzt anreden?
Ihm fehlte komplett die Erinnerung daran, wie sie sich ihm vorgestellt hatte.
Hier konnte ihm nur noch Philippe in elsässischdeutscher Freundschaft Hilfestellung geben. Kein anderes Volk hat in seiner wechselvollen Geschichte so oft sein Vokabular zwischen Deutsch und Französisch gewechselt wie diese Linksrheinischen, und sie sind dabei nicht untergegangen. Also war hier erfahrene elsässische Diplomatie gefragt.
Die Strategie erwies sich als denkbar einfach.
„Nun, sie ist unsere Chefin. Sie hat dich gerufen.
Sie will sicherlich etwas von dir wissen. Also Ruhe bewahren und zuhören. Alles andere wird sich dann von selbst ergeben.“
Das waren die weisen Worte eines Elsässers!
„Darauf hätte ja auch ein Deutscher kommen können“, dachte sich Seeberg.
An diesem Morgen hatte er keinen Nerv mehr, eine neue Versuchsreihe zu beginnen, sodass er sich damit beschäftigte, in den bisherigen Dokumenten etwaige Fehler zu suchen um diese dann zu korrigieren. Kurz vor 11 Uhr betrat er das Vorzimmer von Marie-France.
Ihre Sekretärin, Madame Arras, den Namen konnte man sich gut merken. Eine Mittvierzigerin, gut gekleidet in einem dunkelblauen Rock und einer hellblauen Bluse, deren oberste zwei Knöpfe sie offen trug. Im Dekolleté glitt an einem feinen Venezianer-Goldkettchen ein schlichtes Kreuz, das bei jeder Bewegung seine Position veränderte und dadurch ziemlich taktlose Blicke auf sich ziehen konnte.
Dies war sicherlich von Madame Arras nicht gewollt.
Aber bei manchen Herren der Schöpfung konnte sie schon in deren Augen eine aufdringliche Indiskretion erkennen.
Nicht so bei Franz Seeberg!
Beim Anblick des Kreuzes erinnerte er sich an den Tag seiner ersten heiligen Kommunion. Elisabeth, seine damalige Freundin, trug an diesem Tag auch ein ebenso zartes Kreuz, jedoch über einem weißen Kommunionkleid.
Seeberg selbst hätte damals gerne auch solch ein Kreuz getragen. Stattdessen wurde ihm und den anderen Jungs ein, in ihren Augen, alberner Strauß ans Anzugrevers geheftet. Dabei wären auch sie stolz gewesen, sich mit einem Kreuz zu ihrem Glauben zu bekennen.
Aber die Erwachsenen konnten oder wollten ihre Wünsche nicht verstehen.
„Auch so ein Mosaikstein des sich Nichtverstehens“, dachte Seeberg.
Madame Arras trug dieses Kreuz möglicherweise nur als Schmuck auf der nackten Haut, die, leicht gebräunt, einen ziemlich erotisierenden Kontrast zu dem goldenen Schmuck bot.
Er konnte so schnell nicht einschätzen:
War es Überzeugung, war es nur Schmuck oder war es beides, was da im aufreizenden Dekolleté baumelte?
Dies zu ergründen, hätte längerer Gespräche bedurft, die zudem sehr persönlich sein müssten.
Eigentlich verlangte das Bild nach Interpretation.
Seeberg wollte jetzt keine weiteren Gedanken daran verschwenden, denn er musste sich für die kommende Begegnung mit Marie-France sammeln.
Madame Arras beherrschte das zarte, unaufdringliche, aber doch gut zu hörende Klopfen an der Tür zur Laborleiterin. Nach einem deutlichen „Entrez!“ aus dem Innern öffnete die Sekretärin die Tür einen Spalt weit und sagte in einem angenehmen Tonfall:
„Monsieur Seeberg, für Sie, Madame.“
Dann trat sie etwas zurück und gab dem Deutschen den Weg frei.
Seeberg setzte einen Schritt ins Zimmer, und seinem vor Erstaunen leicht geöffneten Mund entglitt ein leises, aber doch gut vernehmbares „Oohh“.
Anstatt eines Arbeitszimmers mit schwerer Tapete, Holztäfelung an den Wänden, einem großen Schreibtisch aus Edelholz, dazu die passenden Sessel, sah er lediglich einen der üblichen Labortische mit roten Kacheln. Darauf waren all die ihm wohlbekannten Geräte wie Mikroskope, Zentrifugen, Reagenzien und verschiedene Inkubatoren angeordnet. An den Wänden hingen mehrere Tafeln mit allerlei Formeln. Zum Glück gab es zwei Stühle, wie Seeberg schnell feststellte, sodass nicht einer von ihnen stehen musste. Seine Überraschung über das, was sich ihm da bot, war so groß, dass er die elsässische Strategie vollkommen vergessen hatte und sofort zu reden begann:
„So hatte ich mir das Arbeitszimmer einer Laborleiterin nicht vorgestellt“, sprudelte es aus ihm heraus.
Als er es gesagt hatte, merkte er, wie unpassend und dämlich diese Äußerung war.
Er war ja nicht eingeladen worden, um die Einrichtung seiner Chefin zu begutachten.
Was sollte auch diese Äußerung.
Keiner wollte wissen, wie Deutsche sich französische Arbeitszimmer vorstellen.
Plumper konnte sein erster Auftritt nicht ausfallen, und voller Angst, die nächste Blamage zu riskieren, verstummte er abrupt. Er war sich nicht sicher, ob er sich für diese Äußerung entschuldigen sollte, aber er hatte ja noch keine Bewertung des Interieurs abgegeben. Also dachte er, eine Entschuldigung ließe womöglich den Schluss zu, dass er die ganze Einrichtung als nicht passend oder gar schäbig ansehen würde.