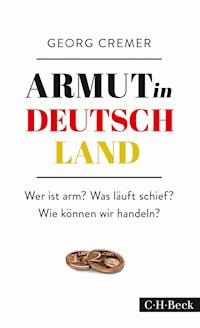12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: C. H. Beck
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Wie ungerecht ist Deutschland wirklich? Hat es einen neoliberalen Soziala bbau gegeben, der nur noch einen «Suppenküchensozialstaat» übrigließ, wie vielerorts zu lesen ist? Georg Cremer unterwirft den vorherrschenden Niedergangsdiskurs einem Realitätstest und zeigt, dass zwar längst nicht alles gerecht ist in Deutschland, aber doch gerechter als viele meinen. Wer unsere Debatten verfolgt, der liest viel über soziale Kälte, über steigende Armut und wachsende Ungleichheit, aber wenig über die Leistungen des Sozialstaats. Dabei steigt die Zahl der in diesem Sektor Beschäftigten stetig. Heute geben wir fast 30 Prozent der jährlichen Wirtschaftsleistung für den Sozialstaat aus. Zur Zeit der Wiedervereinigung waren es noch 26 Prozent. Wenn das, was der Sozialstaat leistet, schlecht geredet wird, wenn positive reformerische Schritte als Klein- Klein diskreditiert oder schlicht nicht wahrgenommen werden, dann nützt das den populistischen Kräften, die der Politik unterstellen, sich nicht um «die Belange des Volkes» zu kümmern. Wenn wir unsere Demokrati e stärken wollen, ist eine realistischere Diskussion über den Zustand des Sozialstaats unerlässlich. Denn in Wahrheit sahen wir in den letzten Jahren keinen herzlosen Sozialabbau, sondern den Versuch der Politik, den Sozialstaat bei wachsenden Leistungen auch in Zukunft zu sichern und bezahlbar zu halten. Im Niedergangsdiskurs droht Sozialpolitik die breite politische Unterstützung zu verlieren, ohne die sie nicht handeln kann.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Georg Cremer
Deutschland ist gerechter, als wir meinen
Eine Bestandsaufnahme
C.H.Beck
Zum Buch
Wer unsere Debatten verfolgt, der liest viel über soziale Kälte, ständig wachsende Ungleichheit, prekäre Jobs oder den Zerfall der Mitte. Aber wieweit sind diese schrillen Töne von den Fakten gedeckt? Heute geben wir fast 30 Prozent der jährlichen Wirtschaftsleistung für den Sozialstaat aus. Es hat den neoliberalen Sozialabbau, der angeblich nur noch einen «Suppenküchensozialstaat» übrigließ, nicht gegeben. Wenn das, was der Sozialstaat leistet, schlecht geredet wird, wenn positive reformerische Schritte kaum wahrgenommen werden, dann nützt das den populistischen Kräften, die der Politik unterstellen, sich nicht um «die Belange des Volkes» zu kümmern. Georg Cremer unterwirft den vorherrschenden Niedergangsdiskurs einem Realitätstest. Dabei macht er deutlich, wo der Sozialstaat wirkt, und stellt klar, wo nachgebessert werden muss, gerade auch um Menschen am unteren Rand der Gesellschaft zu stärken. Eine Bestandsaufnahme, die zeigt, dass zwar längst nicht alles gerecht ist in Deutschland, aber doch gerechter als viele meinen.
Über den Autor
Georg Cremer war von 2000 bis 2017 Generalsekretär des Deutschen Caritasverbands e.V. Zuvor war er viele Jahre in der Entwicklungszusammenarbeit tätig. Cremer ist habilitierter Volkswirt und lehrt als apl. Professor für Volkswirtschaftslehre an der Universität Freiburg. Er beteiligt sich regelmäßig an der Debatte zum deutschen Sozialstaat. Bei C.H.Beck ist von ihm erschienen: Armut in Deutschland (22017).
Inhalt
1.: Raus aus dem Niedergangsdiskurs
ZU LAGE UND STIMMUNGEN
2.: Der Populismus, der aus der sozialen Kälte kam?
Die Schuldigen schnell ausgemacht
Es sind nicht allein die Abgehängten
3.: Alles schreiend ungerecht?
Mir geht es gut, dem Land geht es schlecht
Gerecht sind nur Gerechtigkeiten
Märkte und Gerechtigkeit
4.: Wie weit öffnet sich die Schere?
Die Wirtschaft boomt – und unten kommt gar nichts an?
Mehr Ungleichheit, aber kein Zerfall der Mitte
Was bleibt, wenn die Miete bezahlt ist?
Schließung der Qualifizierungslücke
Der neidvolle Blick nach oben
5.: Eine im internationalen Vergleich hohe Vermögensungleichheit
Unser Wissen ist lückenhaft
Auch die soziale Sicherung berücksichtigen
Sind wir ärmer als die Griechen?
Die Kehrseite der erfolgreichen Wirtschaftsstruktur
Ist Erben gerecht?
6.: Amerikanisierung des Arbeitsmarktes?
Das Normalarbeitsverhältnis gewinnt an Boden
Ist atypisch prekär?
Müssen immer mehr Rentner arbeiten?
Beschäftigungsboom mit Schattenseiten
7.: Armut in einem reichen Land
15,7 % der Bevölkerung in Deutschland sind arm – was heißt das?
Neue Armutsgruppen?
Werden die Arbeitslosen immer ärmer?
Familienarmut
Weniger Armut in einem Land, das sich abschottet?
Es tut sich nichts?
Und die Tafeln?
Zugewanderte Armut aus Osteuropa
ZUM BEFUND DES SOZIALSTAATS
8.: Suppenküchensozialstaat?
Das Narrativ des neoliberalen Sozialabbaus
Das Soziale wächst mit dem Wohlstand
9.: Gesundheitswesen mit niedrigen Zugangshürden
Ständige Reformbaustelle
Steuerung eines schwer steuerbaren Systems
Zuzahlungen
Die historisch überkommene Spaltung in gesetzliche und private Krankenversicherung
Zweiklassenmedizin?
Wenn es um Gesundheit geht, darf Geld keine Rolle spielen?
10.: Rente – schmerzliche Anpassung an den demographischen Wandel
Jahrhundertreform, sorglose Flexibilisierung, nicht mehr zu ignorierende Herausforderungen
Stellhebel der Rentenpolitik
Selbständige und Beamte in die gesetzliche Rentenversicherung?
So wirksam wie unpopulär: Erhöhung des Renteneintrittsalters
Rentenreformen für Nachhaltigkeit
Renten im freien Fall?
11.: Pflege, die neue Säule der Sozialversicherung
Ausbau des Sozialstaats oder Erbenschutzprogramm?
Pflegemarkt statt Wartelisten
Reformbaustelle Pflege
12.: Kinder- und Jugendhilfe – eine Geschichte der Expansion
Kitas – Rechtsanspruch auf Betreuung
Jetzt muss es um Qualitätssicherung gehen!
Hilfen für gefährdete junge Menschen und ihre Familien
13.: Menschen mit Behinderung – der lange Weg zur Teilhabe
Von der Fürsorge zum Recht auf Selbstbestimmung
Neues Denken – neue Praxis?
Grenzen der Ökonomie
14.: Der neoliberale Sozialabbau fand nicht statt
Warum hält sich ein falsches Narrativ so hartnäckig?
Mentalitätswandel der Eliten?
Fehlalarm von rechts
Verschlimmern sich die Verhältnisse oder werden wir sensibler?
15.: Die Banalisierung der Finanzierungsfrage
Auch ein reiches Land kennt Grenzen
Altersversicherung – das Wunder von Bern?
Aufspaltung in kleine Häppchen
WIE WEITER?
16.: Einfach mal aus dem System aussteigen?
Die Freikugel gegen alle Leiden unserer Zeit?
Entkoppelung von Einkommen und Arbeit
Grundeinkommen statt Sozialstaat?
Wegfall der Sozialleistungen?
Wie hoch werden die Steuern sein?
Bleibt uns gar nichts anderes übrig?
Was ist mit den großen Zielen?
Diskreditierung des Stückwerks
17.: Hartz IV nicht abschaffen, sondern reformieren
Was sich bei Hartz IV rasch ändern muss
Niemanden aufgeben!
Höhere Hilfen führen zu mehr Empfängern
«Lohnabstandsgebot» – daran kommt keine Reform vorbei
Transferentzug und der Sinn der Zuverdienstregelung
Also ein höherer Mindestlohn?
18.: Fairness für Familien mit niedrigem Einkommen
Für Familien am unteren Rand der Mitte lohnt sich Arbeit zu wenig
Einkommensabhängige Kindergrundsicherung
19.: Arbeit muss sich auch im Alter gelohnt haben
Wie stark wächst das Risiko, im Alter arm zu sein?
Eine allgemeine Rentenerhöhung nutzt den Armen kaum
Rente und Grundsicherung klug kombinieren
20.: Ausblick: Stückwerk für mehr Gerechtigkeit
Danksagung
Anmerkungen
1. Raus aus dem Niedergangsdiskurs
2. Der Populismus, der aus der sozialen Kälte kam?
3. Alles schreiend ungerecht?
4. Wie weit öffnet sich die Schere?
5. Eine im internationalen Vergleich hohe Vermögensungleichheit
6. Amerikanisierung des Arbeitsmarktes?
7. Armut in einem reichen Land
8. Suppenküchensozialstaat?
9. Gesundheitswesen mit niedrigen Zugangshürden
10. Rente – schmerzliche Anpassung an den demographischen Wandel
11. Pflege, die neue Säule der Sozialversicherung
12. Kinder- und Jugendhilfe – eine Geschichte der Expansion
13. Menschen mit Behinderung – der lange Weg zur Teilhabe
14. Der neoliberale Sozialabbau fand nicht statt
15. Die Banalisierung der Finanzierungsfrage
16. Einfach mal aus dem System aussteigen?
17. Hartz IV nicht abschaffen, sondern reformieren
18. Fairness für Familien mit niedrigem Einkommen
19. Arbeit muss sich auch im Alter gelohnt haben
20 Ausblick: Stückwerk für mehr Gerechtigkeit
Literaturverzeichnis
Register
1.
Raus aus dem Niedergangsdiskurs
Nein, es ist nicht alles gerecht in Deutschland, beileibe nicht. Es gibt weiterhin einen unnötig engen Zusammenhang zwischen sozialer Herkunft und Bildungserfolg. Wer ein Leben lang im Niedriglohnsektor gearbeitet hat, bekommt im Alter oft dennoch nicht mehr zum Leben, als wenn er nie gearbeitet hätte; seine Lebensleistung wird nicht anerkannt. Der falsche, weil ausländisch klingende Name kann bei einer Bewerbung oder der Wohnungssuche massive Nachteile bringen. Asylbewerber erhalten nicht den vollen medizinischen Schutz, der allen Versicherten zusteht. Das sind nur einige Beispiele. Es gibt genügend Gründe, über Gerechtigkeit zu streiten und laut zu protestieren, wenn Ungerechtigkeit kein Gehör findet.
Aber es hat sich bei uns ein Niedergangsdiskurs breitgemacht, der den sozialen Verhältnissen in Deutschland nicht gerecht wird. Obwohl die Zahl der Beschäftigten in nahezu allen Hilfefeldern des Sozialstaats zunimmt, verfängt die Rede vom Sozialabbau. Man kann, ohne verlacht zu werden, öffentlich behaupten, Deutschland habe heute nur noch einen «Suppenküchensozialstaat». Die großen Erfolge der Arbeitsmarktpolitik werden kleingeredet, so als sei die Halbierung der Arbeitslosenquote seit 2005 Folge einer «Amerikanisierung» des Arbeitsmarkts, als seien seither nur miese Jobs entstanden. Selbst ein Ausbau der Unterstützung wird in sein Gegenteil verkehrt: Werden Sozialleistungen verbessert und erhalten diese dann mehr Menschen, ist auch dies nur Indiz für eine wachsende soziale Schieflage. So ging es mit der Grundsicherung im Alter. Ihre Diskreditierung behindert notwendige Reformschritte, um Menschen in der Altersarmut wirksamer zu helfen, und das steht uns sozialpolitisch massiv im Weg.
Sozialpolitiker können sich mühen, wie sie wollen – das, was sie bewirken, bleibt immer meilenweit hinter den ohnehin widersprüchlichen Erwartungen der unterschiedlichen Anspruchsgruppen zurück. Auch wenn sie nach zähem Ringen eine Reform durchgeführt haben, die Benachteiligten hilft (aber nicht allen, die benachteiligt sind, oder gar allen, die sich für benachteiligt halten), so wird dies öffentlich kaum zur Kenntnis genommen. Sozialverbände, die die Reform seit langem gefordert haben, mögen sich noch in einer Pressemeldung zu einem verhaltenen Lob durchringen, aber das Erreichte ist dann kaum mehr der Rede wert. Plötzlich ist es nur noch Klein-Klein, nie der große Wurf und immer zu wenig. Wenn die zähe reformerische Alltagsarbeit einen Erfolg verbuchen konnte, rückt das, was Sozialpolitiker bewerkstelligen sollen, wieder in unerreichbare Ferne. Dass sich Politiker in Regierungsverantwortung nicht der leidigen Frage entziehen können, wie die finanzielle Nachhaltigkeit der Sicherungssysteme gewahrt werden kann, scheint ohnehin ihr persönliches Problem zu sein.
Der Untergangsdiskurs hat seit langem die Mitte erfasst, immerhin die Mitte in einem der reichsten Länder der Erde. Verfestigt ist die Wahrnehmung einer stark schrumpfenden oder gar zerfallenden Mittelschicht. Die Bücher, die der Mittelschicht einreden wollen, gerade sie sei es, die – von wem auch immer – ausgebeutet werde, füllen Regale. Das ist aber von der Empirie nicht gedeckt. Der Befund ist keineswegs so eindeutig, wie man angesichts der Debattenlage meinen könnte. Trotz aller Düsternis sagt eine breite Mehrheit bei Befragungen, es ginge ihr sehr gut oder gut. Verbreitet ist jedoch die Angst, die eigenen Kinder könnten den Lebensstandard, den man selbst erreicht habe, nicht halten und würden ihre Position in der Mitte der Gesellschaft verlieren. Man gehöre zur letzten Generation, der es besser gehe als der Generation ihrer Eltern. Dazu passt, dass viele die Einkommensverteilung in Deutschland als weit ungleicher wahrnehmen, als es der Realität entspricht. Mehr als die Hälfte glaubt, in einer Gesellschaft zu leben, in der die meisten Menschen unten stehen.[1] Wer aber sich selbst der Mitte zurechnet und gleichzeitig die Mehrheit unten wähnt, der kann der Angst vor dem Abstieg kaum entkommen. Jede gesellschaftliche Veränderung, die Folgen für das Schichtgefüge haben kann – verstärkter Wettbewerb, die Entwicklung neuer, arbeitssparender Technologien oder Umbrüche im Bildungssystem –, stachelt die Angst an, die vermeintliche Minderheitsposition, die man in der Mitte einnimmt, zu verlieren und in die vermeintlich große Gruppe derer abzurutschen, die unten stehen.
Zukunftsangst vergällt die Lebensfreude. Aber nicht nur das. Verzerrte Wahrnehmungen erschweren eine zukunftsgewandte Politik. Also sollten wir übertriebenen Ängsten entgegentreten. Wenn wir ein innovatives und produktives und zugleich soziales Land in politischer Stabilität bleiben, wird es unseren Kindern nicht schlechter gehen als uns. Das Übermaß an pauschaler Empörung ist zudem auch gefährlich. Wenn das, was der Sozialstaat leistet, schlechtgeredet wird, wenn positive reformerische Schritte als Klein-Klein diskreditiert oder schlicht nicht wahrgenommen werden, ist dies ein massives Problem in der Auseinandersetzung mit populistischen Kräften. Zu ihrer Mobilisierungsstrategie gehört die Verleumdung, die Politik würde sich um «die Belange des Volkes» nicht kümmern.
Im Übrigen hilft der Untergangsdiskurs nicht, die Unterstützung zu mobilisieren, die der Sozialstaat in einer demokratischen Gesellschaft benötigt. Das Lamento des «immer schlimmer» desorientiert und entmutigt. Wenn der Sozialstaat wirklich zum «Suppenküchensozialstaat» verkommen wäre, obwohl wir Jahr für Jahr etwa 30 % unserer Wertschöpfung für ihn ausgeben, ist doch daraus der Schluss zu ziehen, dass der Sozialstaat nicht wirksam sei. Wie werden die Bürger der Mittelschicht darauf reagieren, die die Kosten des Sozialstaats tragen, ja tragen müssen und dies auch in der Differenz zwischen ihren Brutto- und Nettoeinkommen wahrnehmen, die allerdings von diesem Sozialstaat, das darf nicht vergessen werden, ebenfalls stark profitieren? Fordern sie deswegen seinen Ausbau? Nicht zwingend. Wenn der Sozialstaat so wenig wirksam ist, wie in der skandalisierenden Zuspitzung behauptet wird, dann – so ein mindestens ebenso plausibler Schluss – wären die Verhältnisse mit weniger Sozialstaat ja vielleicht auch nicht viel schlimmer als heute.
Niedergangsstimmung ist Gift für jede Reformpolitik. Letztere aber ist dringend nötig. Denn es gibt Risiken, die uns zu Recht Sorgen machen und die Politik und alle gesellschaftlichen Kräfte herausfordern. Es gibt Blockaden in der Sozial- und Bildungspolitik, die höchst ärgerlich sind und an denen eine auch zugespitzte Kritik Not tut. Und natürlich gibt es Menschen, die zu Recht unzufrieden sind. Aber eine Mitte, die sich selbst im Niedergang wähnt, wird für tatsächlich Benachteiligte wenig Empathie entwickeln. Wenn breite Teile der Bevölkerung das Gefühl haben, genau sie wären es, die zu wenig bekommen oder zu viel bezahlen, wird der Druck auf Politiker hoch, vielen eher vage etwas zu versprechen und dabei Erwartungen zu wecken, die letztlich keine Regierung erfüllen kann. Die dann eintretende diffuse Enttäuschung öffnet wiederum populistischen Kräften das Tor. Wer den Zukunftsängsten durch rationale Politik entgegentreten will, darf kein Öl in das Feuer des Niedergangsdiskurses gießen.
Dieses Buch will einen Kontrapunkt setzen. «Deutschland ist gerechter, als wir meinen». Das heißt nicht: Deutschland ist gerecht, hört also auf damit, über Gerechtigkeit zu streiten. Aber wir sollten so sprechen und streiten, dass eine lösungsorientierte Politik befördert wird. Das kann man nur in einer Debatte, die differenziert und sachlich ist. In ihr muss anerkannt werden, was der Sozialstaat leistet und wo er – allem Gerede vom Sozialabbau zum Trotz – auch in jüngerer Zeit ausgebaut wurde. Man muss sich dem Postfaktischen, das sich in der Debatte zum Sozialstaat breitgemacht hat, entgegenstemmen. Das erfordert, nicht allgemein von Gerechtigkeit zu reden, sondern jeweils zu benennen, welche der unterschiedlichen Dimensionen der Gerechtigkeit im jeweiligen Kontext gemeint sind. Dann zeigt sich schnell, wie unterschiedlich und auch widersprüchlich die Vorstellungen darüber sind, was gerecht sei. Und erst dann trennt sich die Spreu vom Weizen, kann unterschieden werden, wer Gerechtigkeit aus gesellschaftlicher Verantwortung einfordert und wer schlicht das für gerecht erklärt, was ihm persönlich nutzt. Erst dann kann aus dem Untergangsdiskurs eine politische Debatte werden, die Handlungsspielräume öffnet.
Es ist mir bewusst, dass es in Deutschland auch Menschen gibt, die – abseits vom Mainstream der Debatte – Gerechtigkeitsdefizite nicht wahrhaben wollen, sei es aus Ignoranz oder einer privilegierten Abgehobenheit. Vielleicht machen wir es ihnen zu leicht. Je schriller der Duktus der Empörung seitens der Schwarzmaler, desto leichter fällt es Gesundbetern, sich den realen Problemen zu verschließen und Gerechtigkeitsfragen als Hype abzutun, der irgendwann wieder vorbei ist.
Der Sozialstaat braucht Unterstützer. Folgenlose Empörung hilft nicht, aber eine differenzierte politische Debatte sehr wohl, um das Vertrauen in unseren Sozialstaat wieder zu festigen. Sie kann und soll neue Perspektiven eröffnen, denn der Reformbedarf ist unabweisbar. Die Nachhaltigkeit des Sozialstaats zu sichern geht nicht im Stillstand. So umfassend auch das Hilfenetz ist, der Sozialstaat bleibt weit unter seinen Möglichkeiten, Notlagen zu vermeiden. Das kann die Sozialpolitik nur im Bündnis mit der Bildungspolitik, der Wohnungspolitik, der Regionalpolitik und anderen relevanten Politikfeldern.
Um den Blick zu weiten, ist es notwendig, den Diskurs zur Gerechtigkeit um das Prinzip der Befähigungsgerechtigkeit zu erweitern. Das Handeln sozialstaatlicher Instanzen ist auf die Befähigung des Individuums zu einem eigenverantwortlichen und solidarischen Leben hin auszurichten. Das hat mit Entsolidarisierung oder der Individualisierung von Notlagen, wie immer wieder behauptet wird, nichts zu tun. Befähigung ist Teil der Solidarität, sie ist kein Widerspruch zu ihr. Gelingende Befähigung trägt dazu bei, dass die Zustimmung zum Sozialstaat sich festigt. Denn Befähigung ist eine Wirkungsvoraussetzung sozialstaatlicher Interventionen. Nur ein Sozialstaat, dem die Bürger gute Wirkungen zutrauen, wird dauerhaft ihre Zustimmung erhalten.
Man kann das in fast 150 Jahren erbaute, verschachtelte Gebäude des Sozialstaats nicht einfach abreißen und durch einen Neubau ersetzen. Phantasien eines radikalen Neuanfangs sind populär, eröffnen aber keine konkreten Perspektiven. Es geht um zähe Reformarbeit.
Um den Sozialstaat zu verteidigen und offensiv weiterzuentwickeln, müssen wir innerhalb eines komplexen Systems Stück für Stück reformerisch vorgehen. Wir müssen uns fragen, wie es gelingen kann, die Sicherungssysteme zu stärken und gleichzeitig die Grundsicherung so weiterzuentwickeln, dass sie Armut wirksam bekämpft. Wie erreichen wir, dass sich ein Arbeitsleben auch im Alter gelohnt hat? Wie setzen wir das Recht auf Teilhabe derer durch, die heute in einem verhärteten Kern der Langzeitarbeitslosigkeit ohne Perspektive sind, obwohl die Arbeitsmarktpolitik so erfolgreich ist? Wie stärken wir Familien, in denen die Eltern im Niedriglohnbereich arbeiten und das Gefühl haben, dass ihre Arbeit sich nicht rentiert? Wie gelingt es, den bisher engen Zusammenhang zwischen sozialer Herkunft und Bildungserfolg zu lockern? Was ist zu tun, um das umfangreiche Hilfenetz des Sozialstaats besser als heute auf Befähigung auszurichten? Wie sichern wir, dass der, der ein Recht auf Hilfe hat, diese Hilfe auch verlässlich bekommt? Wie erhalten wir die Solidaritätsbereitschaft der Mitte mit dem unteren Rand der Gesellschaft? Was kann eine empathische Zivilgesellschaft für eine Sozialpolitik der Befähigung leisten? Und nicht zuletzt: Wie gelingt eine gesellschaftliche Debatte zum Sozialstaat, die Empathie, nüchterne Analyse und Faktentreue so verbindet, dass Rationalität das Wort führt? Jede reformerische Leistung bei den genannten Herausforderungen, durchgesetzt nach zähem Ringen um einen tragfähigen Kompromiss, hilft, unser Land dem Ideal der Gerechtigkeit ein Stück weiter anzunähern.
ZU LAGE UND STIMMUNGEN
2.
Der Populismus, der aus der sozialen Kälte kam?
Die Schuldigen schnell ausgemacht
Am Abend der Bundestagswahl 2017 stand es fest: Die «Alternative für Deutschland» (AfD) wurde drittstärkste Kraft im Deutschen Bundestag. An schnellen Erklärungen war kein Mangel. In wachsender Zahl folgten die Abgehängten der AfD. Am Wahlabend verwies die Vorsitzende der Linkspartei, Katja Kipping, auf «kulturelle und ökonomische Verlustängste und auch Existenzängste» als Folge einer «Politik der sozialen Verunsicherung»,[1] die es zu beenden gelte. Der Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung, Marcel Fratzscher, sah in dem Wahlergebnis einen «Ausdruck der Spaltung der deutschen Gesellschaft»; es solle «ein Weckruf an die Politik sein, die Ungleichheit und soziale Polarisierung der deutschen Gesellschaft endlich ernster zu nehmen».[2] Und Stephan Hebel schrieb anlässlich der Wahl in den Blättern für Deutsche und Internationale Politik: Der Populismus komme aus der «sozialen Kälte»; durch «ihr unbeirrbares, ja unbelehrbares Festhalten am neoliberalen Modell», durch ihre Weigerung, in den sozialen Frieden zu investieren, sei Angela Merkel zur «Geburtshelferin der AfD» geworden.[3]
Kippings Hinweis auf Verlustängste ist berechtigt, und die Forderungen, die Fratzscher mit seinem «Weckruf» verbindet, etwa eine Stärkung der Investitionen in Bildung, sind gut begründbar. Aber der Duktus dieser und vieler anderer Kommentare war: Letztlich habe der Vormarsch der AfD seine Ursache in einer unsozialen Politik der Bundesregierung. Diese Sicht passt in die größere Erzählung des Sozialabbaus, die auch von Sozialverbänden verbreitet wird. Also sei gegen den Populismus genau das zu tun, was man immer schon gefordert habe, den Sozialabbau zu stoppen und den Sozialstaat weiter auszubauen.
Das Narrativ des Sozialabbaus soll in den Kapiteln 8 bis 14 einer ausführlichen Prüfung unterzogen werden. An dieser Stelle sei nur darauf hingewiesen, dass die Sichtweise einer Regierungspolitik der sozialen Kälte, die verunsichert und in neoliberaler Verblendung untätig bleibt, nicht in Deckung zu bringen ist mit der tatsächlichen Politik der Großen Koalition, die 2017 eine so derbe Niederlage erlitten hat. Sie hat nämlich sozialpolitisch Bemerkenswertes geleistet, gemessen daran, dass Politik ausschließlich in reformerischen Schritten handeln kann. Nur die Einführung des Mindestlohns hat es geschafft, ins öffentliche Bewusstsein vorzudringen. Die Ausweitung der Mütterrente ist nahezu vergessen. Und sofern man sich ihrer erinnert, steht die Begrenzung auf zwei Beitragspunkte für die vor 1992 geborenen Kinder (im Vergleich zu drei Beitragspunkten für die danach geborenen Kinder) als neuer Beweis der Ungerechtigkeit im Vordergrund. Der Unterhaltsvorschuss für Alleinerziehende wird jetzt unbefristet bis zum 18. Geburtstag des Kindes bezahlt. Dies entspricht einer seit langem erhobenen Forderung der Sozialverbände. Mit dem Elterngeld Plus haben Eltern nun flexible Möglichkeiten, die Betreuung ihrer Kinder mit Teilzeitarbeit zu verbinden, ohne auf Ansprüche verzichten zu müssen. Für pflegende Angehörige zahlt die Pflegeversicherung nun höhere Beiträge zur Rentenversicherung; das wird helfen, Altersarmut zu vermeiden. In der Behindertenhilfe sind die Regeln zur Anrechnung des Einkommens und Vermögens behinderter Personen deutlich verbessert worden, und es wird künftig das Einkommen des Partners nicht mehr herangezogen. Das ist eine substantielle Verbesserung; der Kreis derer aber, die dadurch etwas gewinnen, ist zu klein, als dass dies in einem Wahlkampf Wirkung entfalten könnte.
All dies hat dem verbreiteten Bild einer negativen sozialpolitischen Bilanz der Regierung nichts anhaben können. Besonders bitter ist dies für die SPD, die den Mindestlohn der Union abgerungen hat und dennoch bei der Wahl nicht punkten konnte. Das hat auch etwas mit ihr zu tun. «Das Problem der SPD im jüngsten Wahlkampf», so der Politikwissenschaftler Wolfgang Jäger, «war doch, dass der Kanzlerkandidat gar keinen Stolz auf die Regierungsleistungen der SPD in der vergangenen Legislaturperiode zeigte.»[4] Wird nur thematisiert und betont, was weiterhin ungerecht ist, rückt aus dem Blick, was der Sozialstaat leistet und was Sozialpolitik erreicht hat. Das untergräbt die Glaubwürdigkeit der politischen Akteure, die heute Verantwortung tragen oder in früheren Regierungen trugen. Da ja alles so schreiend ungerecht ist, fragt man sich, warum sie es dann nicht geändert haben, als sie an der Macht waren. Dieses Problem hat nicht, wer noch nie Verantwortung trug. Daher der irritierende Wettbewerbsvorteil radikaler Außenseiter.
Es sind nicht allein die Abgehängten
Käme der Populismus schlicht aus der sozialen Kälte, so sollte man erwarten können, dass er dort besonders stark ist, wo die Ungleichheit besonders hoch und der soziale Schutz besonders schlecht ist. Aber Rechtspopulisten feierten in Österreich weit früher als in Deutschland große Erfolge – trotz einer wirtschaftlichen und sozialen Lage, die am ehesten mit Bayern und Baden-Württemberg vergleichbar ist, trotz eines ausgebauten Sozialstaats. Erfolgreiche rechtspopulistische Parteien gibt es auch in den skandinavischen Staaten – trotz ihrer langen wohlfahrtsstaatlichen Tradition, trotz niedrigerer Armutsrisikoquoten, trotz geringerer Einkommensungleichheit. Sie erreichen dort ähnlich hohe oder sogar deutlich höhere Stimmenanteile als derzeit die AfD in Deutschland.
Wäre der Rechtspopulismus eine Folge der sozialen Kälte, so müssten sich seine Mitglieder und Wähler vorrangig unter deren Opfern finden, Menschen, die abgehängt sind, Menschen, denen es im Vergleich zur Mitte deutlich schlechter geht. Diese Erklärung ist beliebt, sie setzt häufig an regionalen Besonderheiten an, an gebrochenen Ostbiographien oder gescheiterten Stadtvierteln im Ruhrgebiet. «Das Markanteste am Aufstieg der AfD», so eine Analyse in der Zeit, «sind aber nicht die 35,5 Prozent der Stimmen, die sie in der Sächsischen Schweiz bekam, oder die 17 Prozent in Gelsenkirchen. Das Markanteste ist, dass sie fast nirgendwo in Deutschland schlecht abschnitt.»[5] Regionale Problemballungen können die Anfälligkeit für Populismus erhöhen, aber sie erklären sie nicht. Es ist schlicht ignorant, die AfD zu einem Problem der neuen Bundesländer zu stilisieren. Stefan Locke, der Dresdner Korrespondent der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, in der DDR aufgewachsen, schreibt verbittert über das hanebüchene Herumpsychologisieren unmittelbar nach der Bundestagswahl über den abgehängten ostdeutschen Mann: «Er ist jetzt der Problembär der Republik, in deren Vorstellung er einsam und von allen Frauen verlassen in seinem Plattenbau hockt und diesen nur verlässt, um Ausländer zu verprügeln, die Bundeskanzlerin anzubrüllen und falsche Parteien zu wählen.»[6] Solche Stereotype, gepaart mit Geringschätzung und Ignoranz gegenüber den Lebensleistungen von Menschen, die nach der Vereinigung und der massiven Deindustrialisierung der ehemaligen DDR ganz neu anfangen mussten, können Spaltungen vertiefen, die der AfD nur nutzen werden.
Auch die gängigen sozialwissenschaftlichen Datensätze[7] widersprechen der These, es seien vorrangig die Abgehängten, die die AfD unterstützten. Zwar sind die AFD-Anhänger (ebenso wie diejenigen der Linken) häufiger mit ihrer materiellen Situation unzufrieden als der Rest der Deutschen. Aber ihr durchschnittliches Nettohaushaltseinkommen liegt mit etwas über 2900 Euro nur etwa 150 Euro unter dem der Gesamtbevölkerung. Fast drei Viertel der AfD-Anhänger haben Lehre, Fachschule oder den Meisterabschluss, ein knappes Fünftel einen Fach- oder Hochschulabschluss. Da überdurchschnittlich viele Arbeiter von der AfD erreicht werden, weisen sie unterdurchschnittliche Stundenverdienste aus, aber immerhin bewertet etwa die Hälfte der AfD-Anhänger ihre materielle Situation als gut oder sehr gut. Allerdings ist mehr als die Hälfte der AfD-Anhänger der Auffassung, keinen gerechten Anteil am Lebensstandard zu erhalten, während dies in der Gesamtgruppe der Befragten nur ein Drittel meint. Von den statistisch erfassten «großen Sorgen» beunruhigen «Zuwanderung nach Deutschland» (82 %) und «Entwicklung der Kriminalität» (71 %) die AfD-Anhänger am stärksten. Hier unterscheidet sich ihr Profil am radikalsten von den Anhängern anderer Parteien. Die Sorge um den eigenen Arbeitsplatz (9 %) ist nicht höher als in der Gesamtbevölkerung.[8]
Ein überdurchschnittlicher Anteil von ihnen lebt in kleinen (ländlichen) Gemeinden.[9] Das könnte daran liegen, dass sich viele AfD-Anhänger Sorgen um die Lebensperspektiven im ländlichen Raum machen. Diese Interpretation wird durch eine ökonometrische Auswertung der Bundestagswahlergebnisse der AfD, differenziert nach den 299 Wahlkreisen, gestützt. Es gibt keinen signifikanten Zusammenhang zwischen den AfD-Werten und der Arbeitslosenquote oder dem Bildungsniveau. Dagegen erzielt die AfD überdurchschnittliche Ergebnisse in dünn besiedelten Räumen mit einer überdurchschnittlich alten Bevölkerung,[10] in Räumen also, aus denen viele Junge wegziehen und wo es schwerfällt, Perspektiven gegen diesen Trend zu finden.
Die populistische Bedrohung lässt sich, das zeigen die Daten, nicht mit einer simplen Theorie materieller Benachteiligung erklären. Man kann sich auch in der gut situierten Mitte radikalisieren. Zukunftsängste können wirksam werden, verbunden mit dem Gefühl, nicht gehört und nicht wertgeschätzt zu werden. Es kann aber auch handfeste Benachteiligung sein. Immer wieder kommt ein Ton in die Debatte, als käme es gar nicht so genau darauf an, ob der Abstieg «gefühlt» ist oder sich in harten Daten zu Einkommen oder Beschäftigung niederschlägt. Ob «gefühlt oder nicht», für die politischen Prozesse sei entscheidend, dass wir uns in einer Gesellschaft befinden, in der der Abstieg oder zumindest die Angst vor ihm das Lebensgefühl prägt.
Sicher, weit verbreitete Gefühle sind höchst relevante Tatsachen, aber es ist falsch, die Unterscheidung zwischen Gefühlen und Realität für irrelevant zu halten. Damit schwindet die Grundlage für rationale Politik. Wenn es eindeutig benennbare Benachteiligung gibt, kann Politik versuchen, im Rahmen des Möglichen Benachteiligungen abzubauen oder auszugleichen, sei es auf dem Feld der Sozial-, Bildungs-, Arbeitsmarkt- oder Regionalpolitik. Auch dann ist nicht gesichert, dass sich das Gefühl ändert, denn dies setzt zumindest voraus, dass die Bemühungen der Politik wahrgenommen und keine Erwartungen an sie gerichtet werden, an denen sie nur scheitern kann. Wenn aber alle das Gefühl haben, zu kurz zu kommen, hat rationale Politik keine Chance, Gehör zu finden. Wenn die Anfälligkeit für populistische Verheißungen in der Angst vor einer unbekannten Zukunft besteht, kann Politik kein Vertrauen in die Zukunft verordnen. Aber jeder kann Verantwortung dafür übernehmen, dass der Diskurs des Niedergangs nicht weiter geschürt wird.
3.
Alles schreiend ungerecht?
Mir geht es gut, dem Land geht es schlecht
Das Allensbach-Institut befragte 2017 eine repräsentative Stichprobe der Bevölkerung im Alter zwischen 30 und 59 Jahren, wie sie zurzeit die eigene Lebensqualität einschätzen. 79 % der Befragten antworteten mit sehr gut oder gut. 41 % waren der Meinung, ihre Lebensqualität habe sich in den letzten Jahren verbessert, weitere 40 %, es habe sich nicht viel verändert, 17 % meinten dagegen, es sei schlechter geworden.[1] Die Daten des Sozio-oekonomischen Panels (SOEP) zur Lebenszufriedenheit zeigen ebenfalls ein durchaus erfreuliches Bild. Das SOEP ist eine repräsentative Wiederholungsbefragung, die derzeit etwa 35.000 Personen in 15.000 Haushalten erfasst. Sie erfolgt im Auftrag des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung und ist eine der wichtigsten Datenquellen zu wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Entwicklungen in Deutschland. Seit 1984 lautet eine Kernfrage des SOEP: «Wie zufrieden sind Sie gegenwärtig, alles in allem, mit Ihrem Leben?» Die Befragten können auf einer Skala zwischen null (ganz und gar unzufrieden) und 10 (ganz und gar zufrieden) wählen. Die so gemessene mittlere Lebenszufriedenheit lag stets zwischen 6,8 und 7,5 – zu stark lässt sich dieser Wert von den politischen und wirtschaftlichen Konjunkturen offensichtlich nicht beeinflussen. Der tiefste Punkt der Lebenszufriedenheit wurde 2004 erreicht, auf dem Höhepunkt der Arbeitslosigkeit in Deutschland; seitdem steigen die Werte kontinuierlich mit Ausnahme einer kleinen Delle während der Finanzmarktkrise und nach der Reaktorkatastrophe von Fukushima. Heute liegt die mittlere Lebenszufriedenheit auf dem höchsten Wert seit Beginn der Erfassung durch das SOEP. Auch der Abstand zwischen West- und Ostdeutschland wird kleiner.[2] Und: Dieser positive Befund gilt für alle Einkommensgruppen, die Zunahme ist unten sogar etwas stärker ausgeprägt als oben. Mit der deutlich verbesserten Arbeitsmarktlage sinkt die Sorge um den eigenen Arbeitsplatz und die persönliche wirtschaftliche Situation, ebenfalls in allen Einkommensgruppen.[3]
Die Bürger, die in überwältigender Mehrheit bekunden, es ginge ihnen gut, sind gleichzeitig zu etwa zwei Dritteln überzeugt, dass die wirtschaftlichen Verhältnisse in Deutschland ungerecht seien. Auch hier sind die Werte auf einem konstant hohen Level,[4] recht unabhängig von aktuellen politischen Lagen und Einflüssen. Die Bürger sorgen sich um den gesellschaftlichen Zusammenhalt. Allerdings gibt es auch hier eine Diskrepanz zwischen einer durchaus positiven Beurteilung des Zusammenhalts in der Gegend, in der die Befragten wohnen, und dem verfestigten Gefühl, dass der Zusammenhalt in Deutschland insgesamt gefährdet sei.[5]
Stellt die Gleichzeitigkeit hoher persönlicher Zufriedenheit und der Wahrnehmung großer Ungerechtigkeit einen Widerspruch dar? Nein, sagt Marcel Fratzscher, Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung. Vielen Menschen gehe es nicht nur um ihre ganz persönliche Lage. Sie wollen in einer Gesellschaft leben, die einen Ausgleich schafft, sie wollen die eigene Zufriedenheit mit anderen teilen.[6] Ist das stark verbreitete Gefühl großer Ungerechtigkeit und schwindenden gesellschaftlichen Zusammenhalts also Folge der starken Empathie einer Mitte, der es gut geht, mit denen, die am Rande stehen? Das wird ein Teil der Erklärung sein; zum Glück gibt es diese Empathie. Aber die Mitte sieht, wenn sie Ungerechtigkeit empfindet, durchaus auch sich selbst als Opfer von Benachteiligung. Sonst wäre nicht zu erklären, dass populistische Kräfte auch unter «sich ausgeliefert fühlenden Durchschnittsverdienern»[7] erfolgreich werben können. Viele bewerten ihren persönlichen Lebensstandard positiv und sind gleichzeitig überzeugt, weniger zu haben, als ihnen eigentlich gerechterweise zustünde.[8] Auch hier sind die Werte im gesamten Zeitraum seit der Wiedervereinigung recht stabil.
Wie zu erwarten, unterscheiden sie sich nach Einkommensgruppen. In Westdeutschland empfindet etwa die Hälfte der Bezieher niedriger Einkommen, dass sie weniger als ihren gerechten Anteil erhalte, aber auch bei jenen mit mittleren Einkommen liegt dieser Anteil in den meisten Jahren bei 35 %. Und bei Beziehern oberer Einkommen sind es immerhin noch etwa 20 %. Auch Menschen oberhalb der Mitte haben vielfältige Möglichkeiten zu einem Vergleich, der sie unzufrieden werden lässt. In Ostdeutschland sind die Werte in allen Einkommensgruppen deutlich höher, sie passen sich langsam den Westwerten an, aber die Diskrepanz bleibt groß.[9] Die Stabilität der Werte über den langen Zeitraum seit der Wiedervereinigung lässt wenig Raum für die Hoffnung, die Regierung besäße praktikable Stellhebel, das Gerechtigkeitsempfinden massiv zu verändern. So wichtig Reformen auf den einzelnen Feldern sozialstaatlicher Sicherung sind, nichts von dem, was eine Regierung realistischerweise bewältigen kann, wird zu einer völligen Verschiebung der gesellschaftlichen Gefühlslagen führen.
Die Vorstellungen darüber, was gerecht ist und wo die größten Gerechtigkeitsdefizite verborgen liegen, werden von der persönlichen Lebenslage und den eigenen Interessen stark beeinflusst. Der Soziologe Uwe Engel verdichtete dies aufgrund umfangreicher Befragungen in einem Buchtitel: «Gerechtigkeit ist gut, wenn sie mir nützt».[10] Die bereits erwähnte Allensbach-Umfrage hat auch gefragt, was der Staat tun könne, um für mehr Gerechtigkeit zu sorgen. Dabei erhalten die Optionen Zustimmungswerte von 70 %, die Gerechtigkeitsdefizite betreffen, die in der Mitte erfahren oder zumindest gefühlt werden: gleiche Bezahlung für gleiche Arbeit, Schließung von Steuerschlupflöchern. Und: «Wer arbeitet, sollte spürbar mehr verdienen als derjenige, der von staatlicher Unterstützung lebt.» Dagegen werden Optionen, die unten ansetzen, wie «Migranten besser fördern» und «Die Unterstützung für Hartz-IV-Empfänger erhöhen», nur von etwa einem Viertel der Befragten befürwortet.[11]
Auch wenn soziale Anliegen breit unterstützt werden, ist die Bereitschaft, hierzu finanziell beizutragen, sehr verhalten. Mit Zustimmungswerten von 70 % oder mehr wünschen die von Allensbach Befragten ein zukunftssicheres Gesundheitssystem, den Abbau der Unterschiede zwischen Arm und Reich, eine gute Altersversorgung, die stärkere Förderung von Familien mit Kindern und gute Schulen und Hochschulen; fast drei Viertel der Befragten wollen aber zugleich eine Senkung der Belastungen durch Steuern und Abgaben.[12] Die Diskrepanz zwischen großen Wünschen und kleiner Finanzierungsbereitschaft zeigen auch andere Befragungen.[13]
Gerecht sind nur Gerechtigkeiten
Alle sprechen von Gerechtigkeit. Aber man sollte nicht der Illusion erliegen, es gäbe eine einheitliche Vorstellung darüber, was unter Gerechtigkeit zu verstehen ist, und dass es jeweils die eigenen politischen Vorschläge für mehr Gerechtigkeit wären, die mehrheitsfähig sind. Gerechtigkeitsvorstellungen stehen miteinander im Konflikt. Was der eine für gerecht hält, hält der andere für schreiend ungerecht.
Bei aller Unschärfe des Begriffs können wir nicht auf ihn verzichten. Gerechtigkeitsfragen stellen sich insbesondere dann, wenn Interessenkonflikte bestehen, wenn etwa zu klären ist, wie knappe Güter und Lasten, wie die Erträge aus Kooperationen zu verteilen sind. Kooperation in komplexen Gesellschaften erfolgt zwischen Menschen, die häufig in keiner nahen Beziehung zueinander stehen, sich nicht einmal persönlich kennen. Gute Kooperation ist ohne die Sicherheit, dass die Kooperationsbereitschaft nicht ausgebeutet wird, nicht möglich. Gerechtigkeit treibt Menschen um, weil sie vor Verhältnissen geschützt sein wollen, die sie bedrohen oder übervorteilen. Fühlen sich Arbeitnehmer am Arbeitsplatz schlecht behandelt, verlieren sie die emotionale Bindung zu ihrem Unternehmen und ihre Kooperationsbereitschaft sinkt. Erfahren oder fühlen Menschen Ungerechtigkeiten auf der gesellschaftlichen Ebene, sinkt das Vertrauen in die Institutionen, die die Gesellschaft tragen.[14] Gerechtigkeit ist für den Zusammenhalt einer Gesellschaft eine zwingende Voraussetzung. Was sie genau bedeutet, welche Regeln und Strukturen Gerechtigkeit sichern können, muss in einer offenen Gesellschaft immer wieder neu ausgehandelt werden.[15]
«Wirklich gerecht sind nur Gerechtigkeiten», schreibt der Sozialethiker Gerhard Kruip.[16] Wir benötigen unterschiedliche Konzeptionen von Gerechtigkeit, die in unterschiedlichen Kontexten Geltung besitzen. Sie sollen im Folgenden kurz erläutert werden. Es bedarf dabei einer Leitorientierung. Ausgangspunkt ist der Mensch, der mit unveräußerlichen Rechten ausgestattet ist und als vernunftbegabtes Wesen sein Leben selbstbestimmt gestaltet. Er will als Bürger am gesellschaftlichen Leben teilhaben, mit den gleichen Rechten und Pflichten wie alle anderen Bürger. Die Ordnung, in der er lebt, darf daher nicht von Privilegien bestimmt sein, denn in deren Genuss können, sonst wären es keine Privilegien, nur einige, aber nicht alle Bürger kommen. Die rechtliche und politische Ordnung muss den Bürgern Raum zur selbstbestimmten Lebensführung geben, ihre Freiheit sichern.
Die entscheidende Voraussetzung hierfür ist ein demokratischer Rechtsstaat. Er schützt vor Zwang und Gewalt, er bietet über das allgemeine Wahlrecht demokratische Mitwirkungsrechte und durch den Zugang zu den Gerichten rechtlichen Schutz. Dabei muss strikt das Prinzip der Gleichheit gelten; jede Abweichung von diesem Anspruch wäre die Rückkehr in eine vordemokratische Privilegienordnung. So wichtig Rechtsgleichheit ist, es gibt dennoch Hürden, die einer politischen Beteiligung weniger artikulationsfähiger Teile der Bevölkerung oder der faktischen Durchsetzung ihrer Rechte entgegenstehen; diesen Bürgern fehlen häufig Informationen und Beziehungen. Daher bleibt auf dem Feld der Durchsetzung gleicher Bürgerrechte noch viel zu tun.
Der demokratische Rechtsstaat ist eine notwendige, aber keine hinreichende Bedingung für ein selbstbestimmtes Leben.[17] Bei existenzieller Not kann sich Leben nicht entfalten. Die Wahrnehmung von Freiheitsrechten ist an Mittel gebunden. Um diese erwirtschaften zu können, sind die Bürger auf eine Wirtschaftsordnung angewiesen, in der sie sich durch Einsatz ihrer Fähigkeiten ein Einkommen erarbeiten können. Sie benötigen ein Umfeld, insbesondere ein Bildungs- und Ausbildungssystem, in dem sie die für ein gelingendes Leben erforderlichen Fähigkeiten entwickeln und ihre Potentiale entfalten können. Wenn ein Einkommen, das eine autonome Lebensführung ermöglicht, nicht erwirtschaftet werden kann, etwa weil hohe Arbeitslosigkeit herrscht, so ist die Gesellschaft verpflichtet, die Lebensgrundlagen durch Sozialleistungen zu sichern, solange der Ausschluss von produktiver Arbeit nicht überwunden werden kann. Und die Gesellschaft ist verpflichtet, ein möglichst selbstbestimmtes Leben auch denen zu ermöglichen, die aufgrund etwa einer Behinderung oder Erkrankung keine Möglichkeiten der Einkommenserzielung durch Arbeit haben. Diese Verpflichtung beinhaltet nicht allein die Sicherung der physischen Existenz, sondern auch die Gewährung basaler sozialer Teilhabe. Ein selbstbestimmtes Leben aller Bürger kann nur ein Rechtsstaat sichern, der gleichzeitig Sozialstaat ist.