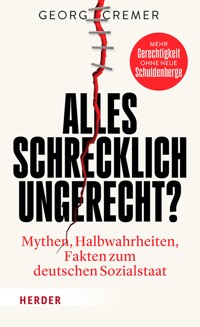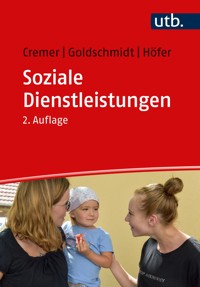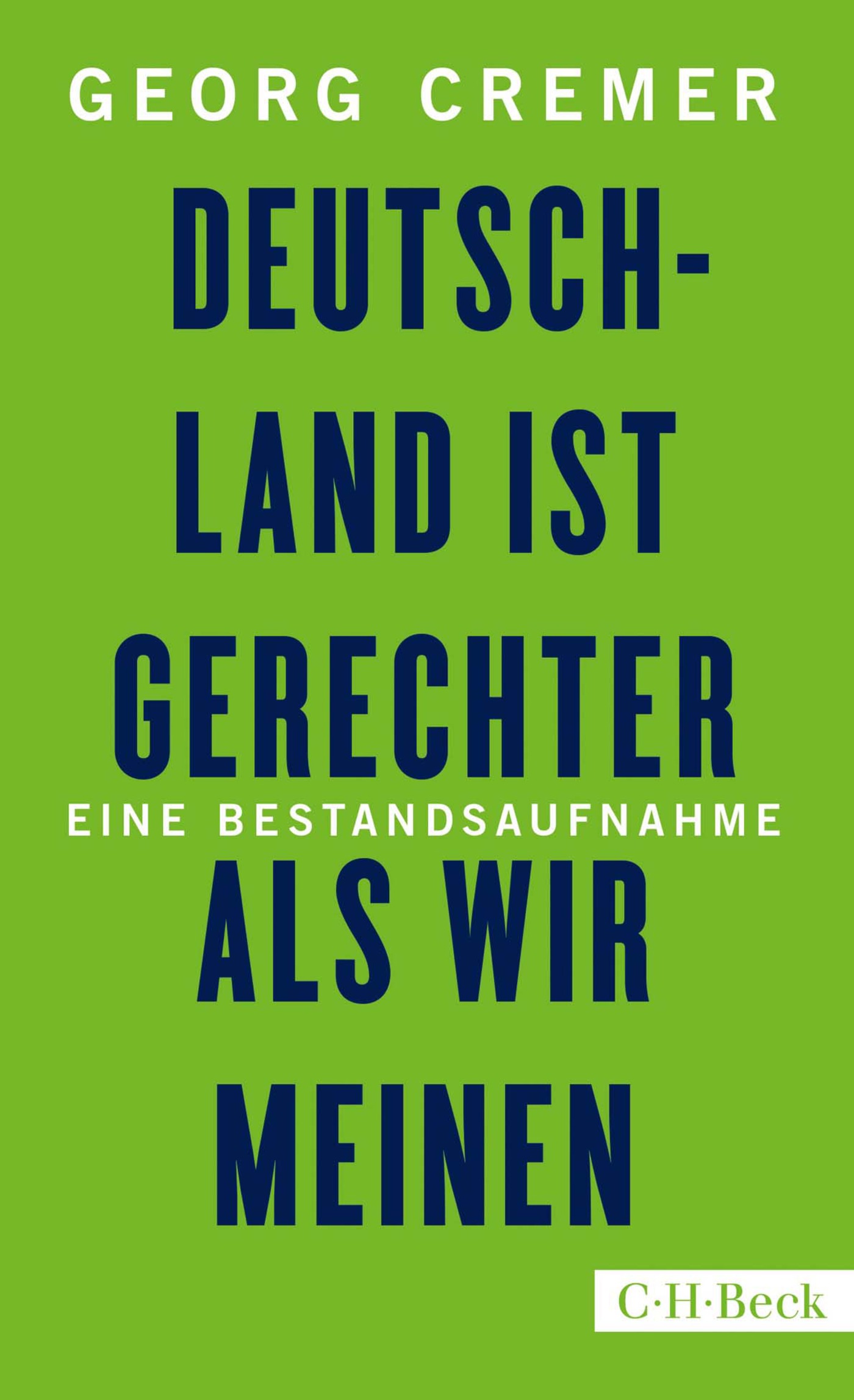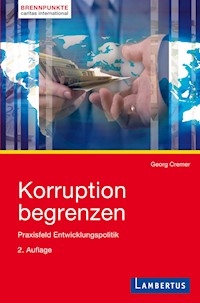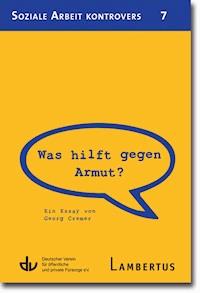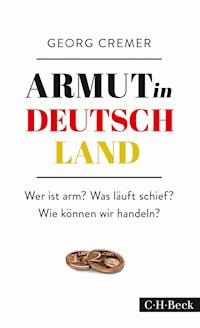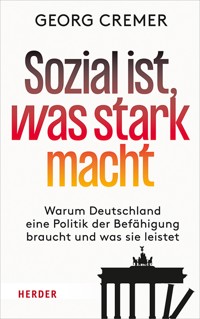
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Verlag Herder
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Der deutsche Sozialstaat ist gut ausgebaut, aber er leistet nicht genug gegen gesellschaftliche Spaltung. So wichtig Umverteilung ist, Geld allein kann Gerechtigkeit nicht erzwingen. Um teilhaben zu können, müssen alle Bürgerinnen und Bürger ihre Potentiale entfalten können. Eine Politik der Befähigung, wie sie Georg Cremer in diesem Buch vorstellt, fördert Selbstsorge und Autonomie, ohne die Fürsorge zu vernachlässigen. Sie stärkt zugleich die Leistungsfähigkeit des Sozialstaats. Und sie ermöglicht einen Mittelweg zwischen dem illusionären Wunsch nach völlig anderen Verhältnissen und der resignativen Kapitulation vor verfestigter sozialer Ungleichheit. Sozial ist, was Menschen schützt und sie zugleich stärkt.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 328
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Georg Cremer
Sozial ist, was stark macht
Georg Cremer
Sozial ist, was stark macht
Warum Deutschland eine Politik der Befähigungbraucht und was sie leistet
© Verlag Herder GmbH, Freiburg im Breisgau 2021
Alle Rechte vorbehalten
www.herder.de
Umschlaggestaltung: Finken und Bumiller, Stuttgart
Satz: Röser MEDIA, Karlsruhe
E-Book-Konvertierung: Röser MEDIA GmbH & Co. KG
ISBN E-Book (E-Pub) 978-3-451-83126-3
ISBN Print 978-3-451-39126-2
Inhalt
1. Einleitung: Vor sozialer Spaltung nicht kapitulieren!
2. Befähigung: die vernachlässigte Dimension sozialer Gerechtigkeit
Prinzipien sozialer Gerechtigkeit: Gleichheit, Verdienst und Bedarf
Der Befähigungsansatz – ein erster Zugang
Verwirklichungschancen als Maßstab menschlicher Wohlfahrt
Persönliche und soziale Umwandlungsfaktoren
Ein freiheitsorientierter Ansatz
Ansatz allein zur Armutsbekämpfung?
Keine soziale Gerechtigkeit ohne Befähigungsgerechtigkeit
FELDER DER BEFÄHIGUNG
3. Bessere Bildung bei weniger Ungleichheit ist möglich!
Bildung und der Zufall der Geburt
Lesekompetenz in Deutschland – ein Krisenindikator
Zusammenhang mit der sozialen Herkunft
PISA und die Grabenkämpfe der Bildungsdebatte
4. Duldet die bürgerliche Mitte Befähigung für alle?
Widersprüchliche Erwartungen
Bildungspanik als Folge von Abstiegsängsten
Spaltpilz Privatschulen?
5. Bildungsgerechtigkeit fördern, ohne die Bildungsaspirationen der Mitte zu gefährden
Schulfrieden: Gute Schulen für alle
Entwertung der Bildungsabschlüsse?
Bildung ist kein Nullsummenspiel
6. Herausforderung des Sozialstaats: Helfen und zugleich befähigen
Kann der Sozialstaat wirksamer werden?
Das Präventionsdilemma
Selbstwirksamkeit
Armut vererbt sich nicht wie eine Krankheit
7. Menschen zur Selbstwirksamkeit ermutigen
Frühe Hilfen – Gelingt es, das Präventionsdilemma zu entschärfen?
Haushaltsorganisationstraining
Sozialer Arbeitsmarkt: Ermutigung zur Selbstwirksamkeit
Stromspar-Check: Befähigung und Umweltschutz verbinden
8. Blockaden wegräumen: Hilfen (wie) aus einer Hand
Der Sozialstaat als Verschiebebahnhof
Können Sozialtransfers bürgerfreundlicher werden?
Wie kann die Hilfe vor Ort wirksamer werden?
Wollen wir etwas verändern – oder wollen wir nicht schuld sein?
Recht haben heißt noch nicht Recht bekommen
9. Stadtentwicklung ist kein Gedöns
Befähigung ist auch eine Frage des Umfelds
Quartiere aufwerten
10. Der Staat schafft es nicht allein
Bürgerschaftliches Engagement als Lückenbüßer?
Ehrenamtliche Akteure der Befähigung
Befähigung im Ehrenamt
11. Der Sozialstaat in der Pandemie
Muster der Verwundbarkeit
Das System im Lockdown
Lehren für eine Politik der Befähigung?
DEBATTE
12. Befähigung: Ablenkungsmanöver im Verteilungskampf?
Lob der Umverteilung: Gegen den Missbrauch des Befähigungsansatzes
Die Reichen sollen zahlen! Aber kaum jemand meint, reich zu sein
Am Produktivvermögen kann man nicht abbeißen
Sozialstaat: Ohne Befähigung nicht nachhaltig
13. Ohne Eigenverantwortung ist kein (Sozial-)Staat zu machen
Der Befähigung folgt die Verantwortung
Ist der Befähigungsansatz zu individualistisch?
Ohne Eigenverantwortung keine Autonomie
14. Befähigung: Zurichtung der Bürger für den Markt?
Befähigung ist auch Befähigung für den Markt
Hass auf die Gans, die die goldenen Eier legt?
Verrat der Solidarität durch die Selbstoptimierer?
15. Staatlicher Übergriff, fürsorgliche Belagerung?
Wie paternalistisch ist der Befähigungsansatz?
Darf man mündige Bürger vor sich selbst schützen?
Paternalismus im Sozialstaat
Grenzen ausloten: Das Prinzip des schonendsten Paternalismus
16. Befähigungsgerechtigkeit – Orientierung für eine anspruchsvolle Reformpolitik
Ein erweiterter Blick auf soziale Gerechtigkeit
Befähigung: Anschlussfähig an unterschiedliche politische Denktraditionen
Wo bleiben die Visionen?
Anmerkungen
Literaturverzeichnis
Dank
1. Einleitung: Vor sozialer Spaltung nicht kapitulieren!
Sozial ist, was Menschen stark macht. Das hört man immer wieder mal auch von Debattanten, die den Sozialstaat in der Erwartung zurückstutzen wollen, Menschen würden, wenn sie gezwungen sind, ohne Hilfe zu gehen, von alleine stark. Aber darum geht es in diesem Buch nicht. Menschen zu stärken bedeutet, sie dabei zu unterstützen, ein Leben zu führen, das sie wertschätzen, und ihnen so Macht über ihr Leben zu geben. Das gelingt nicht ohne einen Rechts- und Sozialstaat, der Menschen schützt und ihnen zugleich Möglichkeiten eröffnet, ihre Potentiale zu entfalten. Es geht somit im Folgenden nicht um weniger gesellschaftliche Verantwortung, sondern um einen erweiterten Blick, wie wir ihr gerecht werden wollen. Der deutsche Sozialstaat ist gut ausgebaut, aber er leistet nicht genug gegen gesellschaftliche Spaltung. So wichtig Umverteilung ist, Geld allein kann Gerechtigkeit nicht erzwingen.
Welche Chancen Menschen offenstehen, darüber entscheidet in Deutschland wie anderenorts auch der Zufall der Geburt. Die Natur verteilt ihre Gaben höchst ungleich, aber es ist nicht die Natur allein. Kinder werden in Familien hineingeboren, die arm oder wohlhabend sind, wachsen in einer Familie auf, die zerbricht, oder können sich einer dauerhaften Beziehung ihrer Eltern erfreuen, haben Eltern, die sie ermutigen und an ihrer Entwicklung hohen Anteil nehmen, die selbst Bildung erfahren haben und diese hochschätzen, oder Eltern, die ihre Kinder weit weniger unterstützen können. Wer ermutigt wird, traut sich mehr zu und ihm wird mehr zugetraut. So entwickelt er die Überzeugung, dass er handeln kann und damit Wirkung erzeugt, und so verstärken sich die sozialen Unterschiede, mit denen Kinder ins Leben starten.
Das muss man nicht als gottgegeben hinnehmen. Die Antwort des Sozialstaats ist Umverteilung. Umverteilung mildert soziale Ungleichheit; der Sozialstaat in Deutschland leistet dies in erheblichem Umfang. Aber Umverteilung reicht nicht, um Menschen stark zu machen, damit sie ihr Leben in die eigenen Hände nehmen können. Es gibt zahlreiche Gerechtigkeitsfragen, die sich stellen, bevor der umverteilende Sozialstaat zum Zuge kommt, etwa der Zugang zu guter Bildung oder auskömmlicher produktiver Arbeit. So unverzichtbar Umverteilung in einem Sozialstaat ist, sie hat ihre Grenzen. Auch wenn sich politische Mehrheiten fänden, sie auszubauen, die Auswirkungen auf die soziale Spaltung wären gering, wenn nicht zugleich Fragen sozialer Gerechtigkeit jenseits materieller Verteilung und Umverteilung bearbeitet werden. Wenn der Zufall von Geburt und sozialer Herkunft weiterhin so stark wirkt, wie er heute wirkt, gibt es auch künftig zu viele Menschen, die vom Sozialstaat zwar versorgt, aber nicht gestärkt werden.
Wie können wir weiterkommen? Erforderlich ist ein breiteres Verständnis sozialer Gerechtigkeit, das nicht verteilungspolitisch verengt ist.1 Gerechtigkeit ist kein Synonym für Gleichheit. Es gibt gerechte und ungerechte Ungleichheiten, so wie es gerechte und ungerechte Gleichheiten gibt.2 Wir akzeptieren Ungleichheit, soweit sie mit Leistungen zu rechtfertigen ist – trotz aller Kontroversen, was jeweils als Leistung belohnungswürdig ist. Dabei soll Chancengerechtigkeit gelten, aber was verstehen wir darunter? In einem engen Verständnis von Chancengerechtigkeit kommt es allein darauf an, dass Diskriminierung unterbunden wird, insbesondere Diskriminierung nach Geschlecht, sozialer oder ethnischer Herkunft. Der Zugang zu Bildungsoptionen oder Arbeitsstellen soll schlicht nach dem Leistungspotential erfolgen, das Bewerberinnen und Bewerber zeigen. Dann aber kommen Menschen aus dem Abseits häufig nicht zum Zuge, nicht, weil sie im konkreten Fall diskriminiert würden, sondern weil sie nie in der Situation waren, die Leistungspotentiale zu entwickeln, die jeweils entscheidend sind.
Zum Abbau sozialer Ungleichheit kann ein eng verstandenes Konzept von Chancengerechtigkeit wenig beitragen. Der Wunsch, Chancengleichheit zu erreichen, würde dagegen bedeuten, die Zufälle der Natur und das Schicksal der sozialen Herkunft aufheben zu wollen. Dieser Wunsch, so verständlich er ist, bringt uns in das Reich politisch folgenloser utopischer Gegenentwürfe. Er bringt uns auch in Widerspruch zu den Zusagen einer liberalen Gesellschaft, die die Freiheit des Einzelnen schützt. In Wahrnehmung ihrer Grundrechte treffen Bürgerinnen und Bürger vielfältige Entscheidungen, die zu sozialer Differenzierung und damit Ungleichheit führen. Man kann es bildungsbürgerlichen Eltern nicht verdenken, dass sie alles tun, was in ihrer Macht steht, damit ihre Kinder gestärkt und mit besten Kompetenzen ins Leben treten.
Also doch kapitulieren vor den ungleichen Startbedingungen? Nein, das ist nicht die Schlussfolgerung, die zu ziehen ist. Damit mehr Aufstiege aus dem Abseits gelingen, brauchen wir ein stark erweitertes Konzept von Chancengerechtigkeit. Es geht nicht allein um die Abwehr von Diskriminierung, sondern um Befähigungsgerechtigkeit. Dieses Prinzip ist abgeleitet aus dem Befähigungsansatz, der in den letzten Dekaden starken Einfluss auf die Wahrnehmung von Armut und Entwicklung in den Ländern des Südens hatte, der aber auch den Diskurs über Gerechtigkeit in einem reichen Land wie Deutschland produktiv weiten kann. Der einflussreichste konzeptionelle Wegbereiter des Befähigungsansatzes ist der indisch-amerikanische Philosoph Amartya Sen. Die Armut und Gewalt, deren Zeuge er in seinen Jugendjahren in Indien wurde, haben seine wissenschaftlichen Interessen und sein umfangreiches Werk stark beeinflusst, für das er 1998 mit dem Nobel-Gedächtnispreis für Wirtschaft geehrt wurde.
Menschen brauchen, um ein Leben führen zu können, das sie wertschätzen, nicht allein ökonomische Ressourcen, sondern Fähigkeiten oder, diesen Begriff verwendet der Befähigungsansatz synonym, Verwirklichungschancen. Diese sind Ausdruck der Freiheit, unterschiedliche Lebensziele und Lebensstile realisieren zu können. Der Befähigungsansatz stellt die Potentiale jedes Menschen in den Mittelpunkt; jede und jeder ist zur Entfaltung und Verwirklichung ihrer und seiner Fähigkeiten auf ein förderliches soziales Umfeld angewiesen. Gelingende Befähigung ist somit ein Feld gesellschaftlicher Verantwortung, sie obliegt nicht allein der Selbstsorge. Das Ausmaß der realen Freiheit, mit dem Menschen ihr Leben gestalten können, hängt von vielfältigen persönlichen und sozialen Faktoren ab, die veränderbar und damit politischer Gestaltung zugänglich sind. Der Befähigungsansatz kapituliert nicht vor verfestigter Ungleichheit, wie man dies einem engen Verständnis von Chancengerechtigkeit vorwerfen kann. Das Bildungssystem, der Sozialstaat und vielfältige andere Politikfelder sind daran zu messen, ob sie das Mögliche leisten, damit Menschen ihre Potentiale entfalten können, ob sie darauf ausgerichtet sind, Menschen so zu stärken, dass sie Akteure ihres eigenen Lebens werden können. Warum eine Politik der Befähigung notwendig ist und was sie in wichtigen Feldern der Politik zu leisten vermag, darum geht es in diesem Buch. Auf Bedingungen, die Befähigung ermöglichen, sind alle Menschen angewiesen, aber im Fokus stehen im Folgenden Menschen am unteren Rand der Gesellschaft. Aus dem Blickwinkel der Befähigungsgerechtigkeit gibt es dort die bei weitem größten Defizite und Versäumnisse.
Ein Rechts- und Sozialstaat, der Menschen ermöglicht, ihre Potentiale zu entfalten, schützt und stärkt sie zugleich. Eine Politik der Befähigung ist keine Abkehr von einem sorgenden Sozialstaat, der Menschen in Notlagen und den vielfältigen sozialen Bedarfen beisteht, die unser Leben begleiten. Sie stellt auch nicht die Bedeutung herkömmlicher Politiken infrage, die Milderung von Einkommensungleichheit durch Umverteilung oder Regulierungen zur Sicherung erträglicher Arbeitsbedingungen beispielsweise. Der Befähigungsansatz zielt auch nicht darauf, Notlagen zu individualisieren, um einen Rückzug aus staatlicher Verantwortung zu legitimieren. In der politischen und fachlichen Debatte gibt es vielfältige Vorbehalte und Vorurteile, die dabei im Weg stehen, den Befähigungsansatz produktiv zu nutzen, unser Verständnis von sozialer Gerechtigkeit zu erweitern. Dazu gehört auch der Vorwurf, der Befähigungsansatz sei „individualistisch“, er ersetze Solidarität durch Eigenverantwortung. Richtig ist, wer Handlungsoptionen hat, trägt zugleich Verantwortung dafür, wie er oder sie seine oder ihre Optionen wahrnimmt; damit verweist der Befähigungsansatz auf Eigenverantwortung und Selbstsorge.
Eigenverantwortung und Solidarität sind aber kein Widerspruch, Eigenverantwortung ist kein „neoliberaler“ Wert. Das ist zu betonen, wenn es darum geht, Menschen zu stärken. Die Einforderung von Eigenverantwortung ist leer und hohl, wenn sie nicht mit der erforderlichen Unterstützung verbunden ist, Handlungsoptionen zu erweitern, die verantwortliches Handeln ermöglichen. Aber auch Menschen in gefährdeten Lebenslagen sind nicht nur die Opfer der externen Bedingungen, denen sie ausgesetzt sind. Eine Politik der Befähigung muss auch Mechanismen der Selbstexklusion und des selbstschädigenden Verhaltens in den Blick nehmen. Sie sind aus den jeweiligen Sozialisations- und Lebenserfahrungen heraus zu verstehen; aber ändern können sich Menschen nun mal nur selbst. Wer ihnen jegliche Verantwortung abspricht, spricht ihnen zugleich ihre Autonomie und die Fähigkeit ab, ihr Leben zu verändern.3 Eine soziale Arbeit, die Menschen allein auf eine Opferrolle festschreibt, verpasst ihren Auftrag, Befähigung zu ermöglichen.
Aus dem bisher Gesagten ergibt sich der Aufbau des Buches: Eine knappe Einführung in den Befähigungsansatz erfolgt in Kapitel 2. Um wichtige Felder einer Politik der Befähigung geht es in den Kapiteln 3 bis 11, um Bildungspolitik, die Instrumente des Sozialstaats, um eine Arbeitsmarktpolitik für Menschen am Rande, um die Aufwertung abgehängter Quartiere, zudem um erste Erfahrungen aus der Pandemie. Es geht um politische Blockaden, die zu überwinden sind, und zugleich um vielfältige Ansätze, die hoffen lassen, dass eine Politik gegen soziale Spaltung möglich ist. Die Kapitel 12 bis 15 dienen einer intensiven Debatte des Befähigungsansatzes, ich hoffe, einige der Vorbehalte und Vorurteile ausräumen zu können, die gegen ihn vorgebracht werden. Es geht zugleich um die Grenzen, die eine Politik der Befähigung akzeptieren muss, soll sie nicht übergriffig wirken und Menschen fürsorglich belagern. Das wäre mit einem Ansatz, der freiheitsorientiert ist, nicht zu vereinbaren. Zu thematisieren ist auch der mögliche Missbrauch des Befähigungsansatzes; wie alles, kann auch er missbraucht werden.
Der Anspruch, Befähigungsgerechtigkeit zum Durchbruch zu verhelfen, führt nicht zu einer völlig anderen Politik. Dieses Buch skizziert auch keine radikale Systemtransformation, es entfaltet keine großartige Sozialvision, es malt kein Luftschloss einer anderen Welt ohne Konkurrenz oder Mühsal. Es geht schlicht darum, das befähigende Potential der vorhandenen staatlichen und zivilgesellschaftlichen Institutionen und Initiativen möglichst gut zu erschließen. Ich hoffe, begründen zu können, dass genau das notwendig ist, um Menschen zu stärken und zugleich mehr Aufstiege aus dem Abseits zu ermöglichen. Das reiche Deutschland hat ein gut ausgebautes Bildungs- und Sozialsystem, aber es bleibt weit hinter seinen Möglichkeiten, allen Menschen die Befähigung zu ermöglichen, die notwendig ist, um ein gelingendes Leben zu führen. Der Befähigungsansatz kann Orientierung geben für eine anspruchsvolle Reformpolitik, die wirksamer gegen soziale Spaltung handeln will. Sozial ist, was Menschen schützt und sie zugleich stärkt.
2. Befähigung: die vernachlässigte Dimension sozialer Gerechtigkeit
Prinzipien sozialer Gerechtigkeit: Gleichheit, Verdienst und Bedarf
Soziale Gerechtigkeit ist in aller Munde. Aber im öffentlichen Diskurs verkommt sie zu oft zu einem Schlagwort, mit dem man so gut wie jede Forderung rechtfertigen kann, ohne näher erläutern zu müssen, welches Problem man lösen will, wer gewinnen würde und welche Kosten die Bürgerschaft zu tragen hätte. Jede Interessengruppe begründet ihr Anliegen damit, es diene der sozialen Gerechtigkeit. Ein rationaler politischer Diskurs erfordert, dass wir uns bewusst darüber verständigen, was wir meinen, wenn wir von sozialer Gerechtigkeit sprechen. Das ist selbstredend auch einzulösen, wenn – wie in diesem Buch – Befähigung als vernachlässigte Dimension sozialer Gerechtigkeit ausgemacht und gefordert wird, diesem Missstand mit einer Politik der Befähigung entgegenzuarbeiten. Bevor der Befähigungsansatz ausführlicher erläutert wird, soll eine kurze Einordnung in den Diskurs zu sozialer Gerechtigkeit erfolgen.
Die Debatte wird häufig so geführt, als sei soziale Gerechtigkeit ein Synonym für Gleichheit; zumindest ist es leicht, Abweichungen von der Gleichverteilung als ungerecht zu brandmarken. Das steckt tief in uns; das Gefühl, ungerecht behandelt zu werden, dürften die meisten Menschen zuerst empfunden haben, wenn sie als Kinder anders und in ihren Augen schlechter behandelt wurden als ihre Geschwister oder Freunde. Sollte Gleichheit nicht das Ideal sein, an dem wir alle unsere Vorstellungen zur Gerechtigkeit ausrichten, auch wenn wir dieses Ideal nie erreichen werden?
Das Problem aller Konzepte eines radikalen, alle gesellschaftlichen Bereiche umfassenden Egalitarismus ist, dass sie dabei versagen, Reformanstrengungen zu mehr Gerechtigkeit Orientierung zu geben. Philosophische Gerechtigkeitstheorien, die soziale Gerechtigkeit einseitig auf den Wert der Gleichheit gründen, haben sich, so der in Oxford lehrende Philosoph David Miller, so weit von den Überzeugungen der Bürgerinnen und Bürger entfernt, dass sie bei der Gestaltung konkreter Probleme im gesellschaftlichen Alltag ohne Einfluss sind.1 Miller hat herausgearbeitet, dass Menschen je nach den Beziehungen, die sie unterhalten, ganz verschiedene Prinzipien der Gerechtigkeit zugrunde legen.2 Seine Differenzierung ist auch höchst relevant, um einzuordnen, was eine Politik der Befähigung für Gerechtigkeit leisten kann.
In solidarischen Gemeinschaften, so Miller, ist das dominante Gerechtigkeitsprinzip die Verteilung gemäß dem Bedarf: Knappe Ressourcen sollen so verteilt werden, dass die Bedürfnisse ihrer Mitglieder möglichst gedeckt werden können. Maßgeblich dabei sind Bedürfnisse, die erfüllt sein müssen, um nach den Normen der Gemeinschaft ein angemessenes menschliches Leben zu führen. Dies gilt für die Sphäre der Familie ebenso wie für die existenzsichernden Leistungen ausgebauter Sozialstaaten.
Geht es um ökonomische Beziehungen und die Mitgliedschaft in Zweckverbänden, ist dagegen die Verteilung gemäß Verdienst das einschlägige Gerechtigkeitsprinzip. Bürgerinnen und Bürger bringen ihre Fähigkeiten und Talente auf unterschiedliche Art ein und können legitimerweise ein Entgelt erwarten, das ihrem Anteil entspricht. Das Verdienstprinzip ist das dominierende Gerechtigkeitsprinzip wirtschaftlicher Kooperation; es findet, wie sich in empirischen Studien zu Gerechtigkeitsvorstellungen zeigt, breite Anerkennung. Zugleich wird es immer wieder vehement angegriffen, es sei nichts weiter als ein Prinzip zur Legitimation gesellschaftlicher Ungleichheit. Alles andere als eindeutig sind zudem die Verteilungsregeln, die aus dem Verdienst- oder Leistungsprinzip folgen und die daher auszuhandeln sind; denn in einer arbeitsteiligen Gesellschaft sind Arbeitsprozesse und die Leistungen vieler eng verwoben. Auch gibt es in einer Reihe von Spitzenpositionen Gehälter, die etwa aufgrund von Gefälligkeit in Aufsichtsgremien oder fehlender Kontrolle deutlich überhöht sind und sich von nachvollziehbaren Leistungsüberlegungen entkoppelt haben. Aber trotz massiver Kritik kann man das Verdienstprinzip nicht ad acta legen, wenn man nicht zurück will in eine ständische Ordnung, in der der gesellschaftliche Status durch Geburt festgelegt wird.3 Das Verdienstprinzip hat auch eine instrumentelle Funktion, weil es dazu beiträgt, die Leistungsanreize zu schaffen, ohne die Kooperationsgewinne in arbeitsteiligen Gesellschaften nicht möglich sind; aber es erschöpft sich darin nicht. Leistungsträger verdienen auch dann ein ihrer Leistung entsprechendes Entgelt, wenn sie, da rein intrinsisch motiviert, ihren Arbeitseinsatz bei niedrigerem Entgelt nicht schmälern würden. Die breite Anerkennung des Verdienstprinzips bedeutet gleichzeitig, dass eine ungleiche Verteilung von Einkommen akzeptiert wird.4 Gerechtigkeit ist kein Synonym für Gleichheit.
Die Akzeptanz des Verdienstprinzips bedeutet allerdings nicht, dass das Ausmaß der faktisch bestehenden Einkommensungleichheit für gerecht gehalten wird. Man kann ohne Widerspruch dieses Prinzip hochhalten und zugleich für Umverteilung eintreten, um die Ungleichheit, die sich als Ergebnis der Marktprozesse ergibt, zu mildern. Dies leistet der deutsche Sozialstaat in erheblichem Umfang. Die Verteilung von Einkommen und Vermögen in Marktökonomien ist das nicht intendierte Gesamtresultat vielfältiger Handlungen unterschiedlichster Marktakteure, die im Rahmen der Ordnung, die die Regeln des Marktgeschehens setzt, ihre Interessen verfolgen. Es gibt keine Instanz, die das Handeln von Unternehmen und Haushalten nach einem politischen Plan so steuern könnte, dass die Marktprozesse zu vorab bestimmten erwünschten Ergebnissen führen. Das ist in einer freiheitlichen Gesellschaft weder möglich noch wünschenswert. Und dennoch haben Fragen der Gerechtigkeit auch bei der Beurteilung der Ergebnisse des Marktprozesses Bedeutung. Die Leistungsfähigkeit von Märkten stellt sich nicht naturwüchsig ein, sondern beruht auf einer politischen Rahmenordnung; diese ist im demokratischen Prozess zu verhandeln, und sie kann nicht losgelöst davon gestaltet werden, ob die Ergebnisse der Marktprozesse – im Großen und Ganzen, nicht in jedem Einzelfall – als sozial akzeptabel gelten können.5 Rigide Regulierung, auch eine rigide Umverteilung, die Leistung abwürgt, kann die Fähigkeit von Märkten, Wohlstand zu generieren, untergraben und damit höchst unsoziale Folgen zeitigen. Dieser Einwand kann jedoch nicht bereits im Ansatz eine Debatte darüber infrage stellen, welche klugen Regulierungen im Blick auf die zu erwartenden Ergebnisse von Marktprozessen sinnvoll und vertretbar sind und wie die vom Markt erzeugten Verteilungsergebnisse korrigiert werden sollen.6 Denn schließlich sind Markt und Wettbewerb ein Mittel der Gestaltung sozialer Verhältnisse, und nicht ihr Ziel.
In unseren Beziehungen als Staatsbürger, so Miller, ist Gleichheit das primäre Gerechtigkeitsprinzip. In freiheitlichen Demokratien sind die Bürgerinnen und Bürger Träger gleicher Rechte und Pflichten; sie haben die gleichen Grundrechte, das gleiche Wahlrecht, das gleiche Recht der freien Rede, den gleichen Schutz durch die Gerichte. Und sie haben ein Recht darauf, dass die Rahmenordnung der Wirtschaft diskriminierungsfrei gestaltet ist. Alles andere wäre ein Rückfall in eine vordemokratische Privilegienordnung. Und sie unterliegen nach allgemeinen Grundsätzen der Verpflichtung, durch Steuern und Abgaben zur Finanzierung des Gemeinwesens beizutragen, dem sie angehören.7
Nur der demokratische Rechtsstaat kann sicherstellen, dass die unveräußerlichen Rechte, die Menschen zustehen, gewahrt werden. Unterschiedliche Vorstellungen herrschen darüber, wie weit diese staatsbürgerliche Gleichheit reicht: umfasst sie allein die Gleichheit vor dem Gesetz oder ist es Aufgabe des Gemeinwesens, auch die materiellen Grundlagen zu legen, damit sich Bürgerinnen und Bürger als politisch Gleiche verstehen können?8 Wenn die Rechts- und Sozialordnung allen ein selbstbestimmtes Leben ermöglichen soll, so ist der demokratische Rechtsstaat eine unverzichtbare, aber keine hinreichende Bedingung. Denn die Wahrnehmung von Freiheitsrechten ist an Mittel gebunden. Die Wirtschaftsordnung soll den Bürgerinnen und Bürgern ermöglichen, durch den Einsatz ihrer Fähigkeiten diese Mittel zu erarbeiten. Sie sind angewiesen auf ein Bildungs- und Ausbildungssystem, in dem sie die für ein gelingendes Leben und für eine erfolgreiche wirtschaftliche Tätigkeit erforderlichen Fähigkeiten entwickeln und ihre Potentiale entfalten können. Aber auch wenn dies in vorbildlicher Weise gewährleistet wäre, ein Zustand, von dem wir weit entfernt sind, so ist weiterhin die Teilhabe derer zu sichern, die ohne staatliche Unterstützung kein nach den Normen der Gesellschaft angemessenes Leben führen können, etwa weil sie arbeitslos werden oder weil sie aufgrund von Behinderung, Krankheit oder Alter nicht die Möglichkeiten haben, Einkommen zu erzielen. Ein selbstbestimmtes Leben aller Bürgerinnen und Bürger kann somit nur ein Rechtsstaat sichern, der zugleich Sozialstaat ist.
Im Rechtsstaat dominiert das Gerechtigkeitsprinzip der Gleichheit. In der Marktordnung, die der Rechtsstaat durch Gesetz und Regulierung ermöglicht und gestaltet, gilt das Verdienstprinzip. Der Sozialstaat, der dem Rechtsstaat zur Seite tritt, soll nach dem Prinzip der Bedarfsgerechtigkeit allen Bürgern ein Leben in Würde garantieren, sofern dies nicht bereits durch ihre Markteinkommen und die daraus abgeleiteten Versorgungsansprüche gesichert ist. Im Dreiklang dieser Prinzipien müssen wir aushandeln, was soziale Gerechtigkeit konkret bedeutet und wie sie uns zum Handeln verpflichtet. Der Befähigungsansatz kann unseren Blick, wo zu handeln ist, in allen drei Dimensionen sozialer Gerechtigkeit schärfen. Wir kommen in Kürze darauf zurück.
Der Befähigungsansatz – ein erster Zugang
Amartya Sen, dem Wegbereiter des Befähigungsansatzes, geht es, wie er in seinem Werk „Die Idee der Gerechtigkeit“ herausstellt, nicht darum, Kriterien zu formulieren, wann eine Gesellschaft als vollkommen gerecht anzusehen wäre. Solche, wie er sie nennt, transzendentalen Ansätze sind nicht geeignet, das praxisorientierte Nachdenken darüber zu befördern, wie konkrete Ungerechtigkeiten überwunden werden können. „Ein transzendentaler oder utopischer Ansatz für sich genommen“, so Sen, „kann nichts zu Fragen über die Förderung von Gerechtigkeit und den Vergleich alternativer Vorschläge für das Erreichen einer gerechteren Gesellschaft beitragen – nichts außer dem utopischen Vorschlag, einen fiktiven Sprung in eine vollkommen gerechte Welt zu tun.“9 Sen benutzt den Komparativ von „gerecht“ sehr bewusst, es geht um ein Handeln, das zu „mehr“ Gerechtigkeit führt, nicht um eine „vollkommen gerechte“ Gesellschaft.10 Ein Konsens, was eine solche Gesellschaft sei, ist in pluralen Gesellschaften ohnehin nicht zu erreichen; er ist auch nicht notwendig, um sich im demokratischen Diskurs darauf zu verständigen, was zu tun ist, um etwa Armut zu bekämpfen oder die Chancen von Benachteiligten zu verbessern. Und selbst wenn es einen Konsens über einen idealen Zustand gäbe, kann es dennoch höchst unterschiedliche Ansichten darüber geben, welche Schritte für mehr Gerechtigkeit prioritär sind und ob und wie sie überhaupt wirken.11
Sen hat den Befähigungsansatz in einer Auseinandersetzung mit philosophischen Gerechtigkeitstheorien entwickelt.12 Wenn zu beurteilen ist, wie gleich oder ungleich Güter, Vorteile oder Vergünstigungen zwischen den Mitgliedern einer Gesellschaft verteilt sind und ob diese Verteilung gerecht ist, müssen wir uns zuerst darauf verständigen, was denn verglichen werden soll. „Equality of what?“, so Sens Frage.13 Zuallererst denken wir, wenn es um Verteilungsgerechtigkeit geht, an Einkommen und Vermögen, somit an wirtschaftliche Ressourcen. Aber das greift, wie Sen darlegt, zu kurz.
Der beste Zugang zu Sens Konzept von Befähigung führt über sein Verständnis von Entwicklung. Die Frage, wie Hunger überwunden und die Lebensverhältnisse weltweit, auch in den ärmsten Ländern, verbessert werden können, hat in seinem Werk große Bedeutung. Die lange dominante Antwort war: Entwicklung bedeutet wirtschaftliches Wachstum; die Verbesserung der Lebensverhältnisse setzt dann in der Folge nahezu zwangsläufig ein. Sen stellt keineswegs die Bedeutung von wirtschaftlichem Wachstum infrage. Bildung für alle, ein gutes Gesundheitssystem und soziale Sicherung sind ohne eine solide ökonomische Basis nicht möglich. Aber ökonomische Ressourcen sind, wie Sen betont, ein Mittel, sie sind nicht das Ziel menschlicher Existenz. Nicht die Verfügungsgewalt über Ressourcen macht unsere Wohlfahrt aus, sondern die Handlungsoptionen, die sie ermöglichen.
Das Werk, in dem Sen sein Verständnis von Entwicklung entfaltet, in Deutschland erschienen unter dem Titel „Ökonomie für den Menschen“, hat im englischen Original einen Titel, der Programm ist: „Development as Freedom“ (Entwicklung als Freiheit).14 Sen versteht „Entwicklung als Prozess der Erweiterung realer Freiheiten“15, als „Erweiterung der ‚Fähigkeiten‘ der Menschen, das Leben führen zu können, das sie wertschätzen – und das wertzuschätzen sie Gründe haben“16. Der im englischen Original genutzte Begriff capabilities, von dem sich der Name des Ansatzes als capabilities approach oder Befähigungsansatz ableitet, wird im Deutschen auch mit Verwirklichungschancen übersetzt. Entwicklung bedeutet, die Verwirklichungschancen von Menschen zu sichern und zu erweitern. Dieser Blickwinkel kann auch für die Politik in reichen Ländern produktiv genutzt werden.
Der Begriff „Fähigkeiten“ kann zu dem Missverständnis verleiten, es ginge allein um persönliche Fähigkeiten und der Befähigungsansatz sei in erster Linie ein pädagogisches Konzept, in dem Befähigte jene Menschen, denen wichtige Fähigkeiten fehlen, dabei unterstützen, sich zu befähigen. Persönliche Fähigkeiten sind zweifelsohne von großer Wichtigkeit, damit Menschen ein Leben führen können, das sie wertschätzen. Deren Entfaltung zu fördern, ist ein wichtiger Teil einer Politik der Befähigung, aber darin erschöpft sich das Konzept nicht. Es geht um den gesamten Raum von Möglichkeiten, die Menschen offenstehen oder die sie sich unter Einsatz ihrer persönlichen Fähigkeiten eröffnen können. Der Befähigungsansatz hat somit die Individuen im Blick, um deren Freiheit es geht, aber in gleicher Weise den gesellschaftlichen Kontext, in dem sie ein autonomes Leben führen wollen. Sen, dessen primärer Fokus sich auf die Not in den Ländern des Südens richtet, betont den gesellschaftlichen Kontext. Entwicklung als Prozess der Erweiterung realer Freiheit erfordere, „die Hauptursachen von Unfreiheit zu beseitigen: Armut wie auch Despotismus, fehlende wirtschaftliche Chancen wie auch systematischen sozialen Notstand, die Vernachlässigung öffentlicher Einrichtungen wie auch die Intoleranz oder die erstickende Kontrolle seitens autoritärer Staaten.“17
Die Fähigkeiten oder Verwirklichungschancen, über die Menschen verfügen, bestimmen, welche Lebensentwürfe sie realisieren können und wie umfangreich ihre diesbezüglichen Wahlmöglichkeiten sind. Das, was Menschen aus ihren Fähigkeiten oder Verwirklichungschancen machen, was sie sind und tun, wird im Befähigungsansatz functionings genannt, üblicherweise übersetzt mit Funktionen oder Funktionsweisen. Gemeint ist, ob Menschen gesund sind, wie sie sich ernähren, ob und wie sie ausgebildet sind, ob und was sie arbeiten, ob sie dabei eigene Ambitionen verwirklichen, ob sie eine Familie gründen, soziale Kontakte pflegen, sich an politischen Debatten beteiligen und ob die Art, in der sie leben, Selbstachtung ermöglicht.18 Auch der Begriff der „Funktionen“ kann im Deutschen zu Missverständnissen verleiten, so als ginge es darum, dass Menschen in Anpassung an die jeweiligen Verhältnisse möglichst gut „funktionieren“ können. Das ist natürlich nicht gemeint. Man könnte functionings statt mit Funktionsweisen auch schlicht mit Verwirklichung oder Verwirklichungen übersetzen;19 vermutlich würde dies das Verständnis erleichtern.
Der Begriff der Funktionsweise ist normativ gesehen neutral. Er beinhaltet keine moralische Wertung, sondern beschreibt lediglich Verhaltensweisen. Entsprechend kann der Begriff Funktionsweise eine gesundheitsbewusste Ernährung genauso meinen wie einen nachlässigen Umgang mit seiner Ernährung oder auch den Gebrauch von Drogen. Fähigkeiten oder Verwirklichungschancen beschreiben den Raum der Möglichkeiten; Funktionen sind das, was Menschen von diesen Möglichkeiten realisiert haben. Je größer die Wahlmöglichkeiten, die ein Mensch hat, sein Leben zu gestalten, desto größer ist seine reale Freiheit.20
Dabei sind Verwirklichungschancen und Verwirklichungen nicht nur einzeln, sondern auch in ihrer Gesamtheit zu betrachten. Gut ausgebildete alleinerziehende Frauen, beispielsweise, haben die Fähigkeit, eine anspruchsvolle Arbeit auszufüllen, zugleich tragen sie Verantwortung für ihre Kinder, zwei für ihr Leben sehr zentrale Funktionen. Beide Fähigkeiten aber gleichzeitig in befriedigender Weise zu verwirklichen, ist ihnen nur möglich, wenn es die dafür erforderlichen Betreuungseinrichtungen gibt, erst diese schaffen die reale Freiheit, nicht gezwungen zu sein, das eine oder das andere zu vernachlässigen.21
Verwirklichungschancen als Maßstab menschlicher Wohlfahrt
Sen führt gewichtige Gründe an, warum Verwirklichungschancen und nicht wirtschaftliche Ressourcen die entscheidende Währung sind, um die Lebensbedingungen von Menschen zu beurteilen. Er verweist immer wieder auf das Beispiel behinderter Menschen, die zum Ausgleich der Benachteiligungen, die mit ihrer Behinderung verbunden sind, mehr Mittel benötigen, um die gleichen elementaren Dinge tun zu können, die nicht behinderten Menschen offen stehen.22 Sie brauchen je nach Lage ihrer Behinderung zusätzliche Mittel, um ebenfalls mobil sein zu können, kulturelle Angebote zu nutzen oder am Arbeitsleben teilzunehmen. In einem Sozialstaat, der den Anspruch hat, Teilhabe zu ermöglichen, ist dies eigentlich selbstverständlich. Aber auch bei uns gibt es in der Auseinandersetzung zu einem Bedingungslosen Grundeinkommen Forderungen nach einer radikalen Vereinfachung unseres Sozialsystems, dem vorgeworfen wird, zu bürokratisch zu sein. Die Ablösung des Sozialstaats heutiger Prägung durch ein für alle gleiches Bedingungsloses Grundeinkommen sei ein System, das „radikal einfach“ und daher „radikal gerecht“ sei.23 Aus dem Blickwinkel der Verwirklichungschancen zeigt sich aber unmittelbar, dass eine gleiche Ressourcenausstattung mit nicht akzeptabler Ungleichheit in anderen Dimensionen verbunden sein kann.
Das ist auch in vielfältigen anderen Zusammenhängen so. Die gleiche Ressourcenausstattung aller Schulen erscheint allenfalls auf den ersten Blick gerecht. Wenn wir nicht den Anspruch aufgeben wollen, dass auch Kinder aus prekären Milieus ihre Potentiale entfalten können, dann gibt es gute Gründe, Schulen, die viele dieser Kinder aufnehmen, mit mehr Ressourcen auszustatten als andere Schulen. Damit aber werden staatliche Mittel ungleich verteilt, nicht willkürlich, sondern aus wohlüberlegten Gründen, um die krasse Ungleichheit der Verwirklichungschancen zu mildern, die sich sonst verfestigen würden.
Einkommen ist eine wichtige Dimension, um Ungleichheit zu messen. Aber der Blick auf Verwirklichungschancen eröffnet eine Differenzierung, die Sen betont. Man müsse „zwischen dem Einkommen als Meßeinheit für Ungleichheit und als Mittel zur Verringerung von Ungleichheit unterscheiden“24. Umverteilung ist ein unverzichtbares Mittel ausgebauter Sozialstaaten, aber sie muss nicht immer der beste Weg sein, einer unakzeptabel hohen Ungleichheit der Einkommen und der Lebensperspektiven entgegenzuwirken. Investitionen in die öffentliche Infrastruktur, in bessere Elementarförderung und bessere Schulen, in befähigende soziale Dienstleistungen können mittel- und langfristig stärkere Wirkungen erzeugen.
Sens Forschungen gaben wichtige Impulse dafür, das Verständnis von Entwicklung zu erweitern und eine mehrdimensionale Messung von Entwicklung durchzusetzen. Der heute verwandte Index der menschlichen Entwicklung kombiniert drei für die Verwirklichungschancen von Menschen zentrale Dimensionen: die Fähigkeit, ein langes und gesundes Leben zu führen, gemessen an der Lebenserwartung bei Geburt, die Fähigkeit, Wissen zu erwerben, gemessen an der Zahl der Schul- und Ausbildungsjahre, sowie die Fähigkeit, einen angemessenen Lebensstandard zu erreichen, gemessen am Pro-Kopf-Einkommen.25 Auch das ist ein einfacher Indikator menschlicher Entwicklung, aber er ermöglicht einen breiteren Blick. Sen erläutert die Fehlschlüsse, wenn wir allein auf das Einkommen schauen, am Beispiel der Lebenserwartung der schwarzen Bevölkerung in den USA. Wird allein das Einkommen betrachtet, scheint „aus internationaler Perspektive gesehen … die Benachteiligung der Schwarzen in Amerika zur Bedeutungslosigkeit zu verblassen“.26 Sie sind im Durchschnitt schlechter gestellt als die weißen Amerikaner, aber ihr Einkommen ist um ein Mehrfaches höher als das der Bevölkerung in ärmeren Ländern. Bei der Lebenserwartung und damit „der elementaren Verwirklichungschance, ein reifes Lebensalter zu erreichen und nicht eines vorzeitigen Todes zu sterben“,27 zeigt sich die Benachteiligung jedoch sehr deutlich; die schwarze Bevölkerung in den USA schneidet dabei nicht besser, sondern eher schlechter ab als die Bevölkerung in einer Reihe asiatischer Länder, die im Vergleich zu den USA nur als arm bezeichnet werden können.28
Persönliche und soziale Umwandlungsfaktoren
Aus Sicht des Befähigungsansatzes ist es entscheidend, dass das Ausmaß der realen Freiheit – das Leben, das Menschen zu führen in der Lage sind – nicht nur von den Ressourcen abhängt, zu denen sie Zugang haben, sondern auch von „Umwandlungsfaktoren“, die aufgrund persönlicher Konstitution oder gesellschaftlicher Bedingungen höchst unterschiedlich sein können. Amartya Sen betont, „dass unterschiedliche Menschen aufgrund persönlicher Eigenschaften oder unter dem Einfluss ihrer geographischen oder sozialen Umwelt oder durch ihre relative Benachteiligung … sehr unterschiedliche Chancen haben, allgemeine Ressourcen (etwa Einkommen und Vermögen) in Befähigungen, also das, was sie tatsächlich tun oder nicht tun können, umzuwandeln“.29 Sen unterscheidet zwischen persönlichen und sozialen Umwandlungsfaktoren. Zu den persönlichen Umwandlungsfaktoren gehören die körperliche Konstitution, das Geschlecht, Intelligenz, kognitive Fähigkeiten und Motivation sowie andere Merkmale, die in der jeweiligen Person liegen. Menschen sind unterschiedlich; bezüglich körperlicher Konstitution und Intelligenz verteilt die Natur ihre Gaben höchst ungleich. Der Befähigungsansatz legt keinen durchschnittlichen Normmenschen zugrunde, sondern erfasst die Vielfalt menschlichen Lebens.
Welche Einschränkungen sich aus persönlichen Umwandlungsfaktoren ergeben, ist nicht zu trennen von den sozialen Umwandlungsfaktoren der Gesellschaft, in der Menschen leben; dazu zählen die sozialen Normen, Geschlechterbeziehungen, die politischen Verhältnisse und Machtbeziehungen. In einer Gesellschaft ohne Geschlechterdiskriminierung wäre das Geschlecht für die Umwandlung von Fähigkeiten in Verwirklichungen (weitgehend) irrelevant. Wenn in Einstellungsverfahren Menschen mit Migrationshintergrund subtil oder offen diskriminiert werden, dann führt eben auch eine gute Ausbildung nur zu einer eingeschränkteren Verwirklichung der betroffenen Menschen auf dem Arbeitsmarkt im Vergleich zu Menschen, die keiner Diskriminierung ausgesetzt sind. Wenn Menschen aufgrund sehr langer Arbeitslosigkeit das Vertrauen in ihre Fähigkeiten verloren haben, scheitern sie auch beim Zugang zu Stellen, die sie mit ihren Qualifikationen ausfüllen könnten. Wenn jedoch die aktive Arbeitsmarktpolitik darauf Rücksicht nimmt, etwa indem für einen Übergangszeitraum Beschäftigungsmöglichkeiten mit intensiver sozialer Begleitung angeboten werden, kann der hemmende persönliche Umwandlungsfaktor kompensiert werden. Wer sich schwertut, komplexere Informationen zu lesen und zu verstehen, kann sich im deutschen Sozialstaat schlecht zurechtfinden; aber eine gute, bürgerfreundliche Beratung, die möglichst zu einer Hilfe wie aus einer Hand führt, würde dem entgegenwirken. Und ein letztes Beispiel: Wer dauerhaft und legal in Deutschland lebt, hat den rechtlich garantierten Zugang zu einem im internationalen Vergleich sehr guten Gesundheitssystem. Aber viele nutzen Angebote zur Prävention und Vorsorge nicht. Das kann an persönlichen Umwandlungsfaktoren liegen, etwa der mangelnden Bereitschaft oder Fähigkeit, sich zu informieren, oder der fehlenden Kraft, gesundheitsschädliches Verhalten zu ändern. Aber wie weit sich solche persönlichen Faktoren negativ auswirken, hängt auch davon ab, ob die Verantwortlichen im Gesundheitssystem die soziale Dimension ihrer Arbeit ernst nehmen und in Strukturen arbeiten, die dies ermöglichen.
Wie diese Beispiele zeigen, sind viele der persönlichen wie auch der sozialen Umwandlungsfaktoren veränderbar. Und die nachteilige Wirkung ungünstiger persönlicher Umwandlungsfaktoren kann gemildert oder aufgehoben werden, wenn soziale Umwandlungsfaktoren anders gestaltet werden. Aus Sicht einer Politik der Befähigung ist dies eine durchaus optimistische Botschaft, denn es ergeben sich daraus Ansätze, Verwirklichungschancen zu erweitern. Persönliche und soziale Umwandlungsfaktoren sind gemeinsam in den Blick zu nehmen. Das geschieht häufig ungenügend, auch aus einer falschen Angst heraus, mit der Feststellung beschränkter persönlicher Umwandlungsfaktoren soziale Problemlagen zu „individualisieren“. Der Befähigungsansatz befördert den notwendigen offenen Blick, da er die Wirkungen aller Politik auf die Verwirklichungschancen in den Fokus seiner Betrachtung setzt.
Um Verwirklichungschancen zu erweitern und nachteiligen Umwandlungsfaktoren entgegenzuwirken, wird es häufig erforderlich sein, Ressourcen einzusetzen. Es gibt einen verfestigten Automatismus in der sozialpolitischen Debatte, in der jedes soziale Problem dann, aber auch nur dann als lösbar gilt, wenn „die Politik“ mehr Mittel bereitstellt. Diese Argumentation ist fester Bestandteil der DNA von Sozialverbänden. Häufig ist sie ja auch nicht falsch; um beispielsweise einen besseren Betreuungsschlüssel in der frühkindlichen Bildung zu erreichen – sicherlich eine dringende Herausforderung einer Politik der Befähigung –, wird man umfangreiche Mittel einsetzen müssen. Aber: Die Differenzierung, die der Befähigungsansatz ermöglicht, kann helfen, kritischer, als dies bisher geschieht, zu überprüfen, ob Ressourcenmangel das entscheidende Problem ist, und falls ja, wo Ressourcen am besten eingesetzt werden, um Wirkung zu erzielen. Mehr Geld muss nicht unbedingt helfen, wenn es nicht gelingt, nachteilige persönliche und soziale Umwandlungsfaktoren anzugehen. Es gibt wichtige Umwandlungsfaktoren, die nichts oder allenfalls am Rande damit zu tun haben, wie viele materielle Ressourcen zur Verfügung stehen, etwa Selbstachtung, Kooperationsbereitschaft oder Netzwerke in der Nachbarschaft.30
Ein freiheitsorientierter Ansatz
Sens Ansatz ist freiheitsorientiert. Er versteht, wie bereits gesagt, Entwicklung als Prozess der Erweiterung „realer Freiheiten“. Sen verwendet den Begriff im Plural. Was „reale Freiheiten“ bedeuten, muss näher erläutert werden. Der Begriff zielt nicht auf Abgrenzung gegenüber einem liberalen Verständnis von Freiheit. Sen betont die Bedeutung der Freiheit von Willkürherrschaft, der Teilhabe an der demokratischen Willensbildung, des Rechts der freien Rede oder der freien Presse. In seinen Forschungen zu epidemischen Hungersnöten, die im 20. Jahrhundert auftraten, hat Sen (gemeinsam mit Jean Drèze) überzeugend dargelegt, dass nur in Ländern ohne funktionierende Demokratie mit regelmäßigen Wahlen, ohne Oppositionsparteien, freie Meinungsäußerung und freie Medien sich jene Ignoranz gegenüber den Lebensinteressen des hungernden Teils der Bevölkerung verfestigen konnte, die für Hungerkatastrophen mit Massensterben ursächlich war.31 Auch widerspricht Sen der verbreiteten Sicht, die Demokratie sei ein „westliches“ Konzept; er verweist auf alte Traditionen partizipativer Regierungsführung und des öffentlichen Vernunftgebrauchs in nicht-westlichen Gesellschaften und damit auf die globalen Wurzeln der Demokratie.32 Sen bekennt sich somit sehr eindeutig zu einem Verständnis von Freiheit, das die Freiheitsrechte beinhaltet, die auch aus einem liberalen Verständnis betont werden.
Aber der Begriff der „realen Freiheiten“ weist darüber hinaus; es geht Sen um eine Erweiterung der Chancen von Menschen, ein Leben zu führen, das sie aus ihren wohlüberlegten Gründen führen wollen. Eine solche Lebensführung kann auch in liberalen Gesellschaften, die die Bürgerrechte garantieren, aus vielfältigen Gründen eingeschränkt sein: aufgrund von materiellem Mangel bis hin zu bedrückender Armut, subtiler Diskriminierung, fehlender Bildung oder einem Arbeitsmarkt, der keine Chancen bietet. Aber auch einschränkende Traditionen oder sozialer Druck, dem Menschen nicht zu widerstehen gewachsen sind, können Handlungsoptionen einschränken. Aber bedeutet dies Unfreiheit? Es gibt durchaus eine Diskussion darüber, ob Sen den Begriff der Freiheit nicht überdehnt.33 Der irritierende Befund, dass es nicht gelingt, den engen Zusammenhang zwischen sozialer Herkunft und Bildungserfolg nachhaltig zu lockern, macht aus Deutschland kein Land in Unfreiheit. Aber Faktum ist, dass viele Jugendliche mit ungenügenden Voraussetzungen die Schule verlassen und somit nur sehr eingeschränkte Optionen auf ein gelingendes Leben haben, sie also an den Möglichkeiten eines freien, reichen, entwickelten Landes nicht ausreichend teilhaben. Ob man dieses Faktum als einen Mangel an realer Freiheit bezeichnet, mag strittig sein. Entscheidend ist, dass wir im öffentlichen Vernunftgebrauch, der die Demokratie ausmacht, bereit sind, das Problem zur Kenntnis zu nehmen, und es als Aufforderung verstehen, das Mögliche zu tun, die Kluft zu reduzieren. Dieser Herausforderung muss sich eine Politik der Befähigung stellen.
Ansatz allein zur Armutsbekämpfung?
Der Befähigungsansatz hat breite Anwendung gefunden bei der Analyse der Lebensverhältnisse in armen Ländern und bei der Entwicklung von Vorschlägen, wie Armut überwunden werden kann. Das verleitet zu dem Missverständnis, seine praktische Relevanz sei entsprechend begrenzt. Sen hat sich in seinem wissenschaftlichen Werk sehr ausführlich mit Armut befasst. Auch die amerikanische Philosophin Martha Nussbaum, die die wohl einflussreichste Theorie sozialer Gerechtigkeit entwickelt hat, die auf dem Befähigungsansatz beruht,34 hat vorrangig basale menschliche Ansprüche im Blick. Nussbaum geht es „um die philosophischen Grundlagen einer Theorie grundlegender menschlicher Ansprüche, die von allen Regierungen als von der Menschenwürde gefordertes absolutes Minimum geachtet und umgesetzt werden sollten.“35 Dazu hat sie eine Liste von Grundfähigkeiten erarbeitet, die in allen Gesellschaften zu garantieren sind, um ein Leben in Würde zu sichern. Diese Liste umfasst Leben, körperliche Gesundheit und körperliche Integrität, kognitive und emotionale Fähigkeiten, soziale Interaktion, die sozialen Grundlagen der Selbstachtung, politische Rechte und politische Partizipation und Teilhabe am wirtschaftlichen Leben.36 Alle Regierungen unabhängig vom Entwicklungsstand und Reichtum der jeweiligen Gesellschaften haben bezüglich dieser Grundfähigkeiten Schwellenwerte zu sichern, die nicht unterschritten werden dürfen, da sonst ein Leben in Würde gefährdet ist. In diesem Sinne schlage sie, so Nussbaum, „nur eine partielle und minimale Theorie der sozialen Gerechtigkeit vor.“37 Aussagen darüber, was oberhalb dieser Schwellenwerte aus Gründen der Gerechtigkeit zu fordern ist, trifft Nussbaum nicht. Man kann Nussbaums Liste der grundlegenden Fähigkeiten als eine philosophische Fundierung38 oder zumindest Veranschaulichung der Menschenrechte lesen. Ganz so „minimal“, wie Nussbaum dies sagt, ist ihre Theorie der Gerechtigkeit nicht; die Welt ist weit von einem Zustand entfernt, in dem die Ansprüche, die Nussbaum formuliert, für alle Menschen verwirklicht wären.
Sen, der konzeptionelle Wegbereiter des Befähigungsansatzes, war, wie bereits erwähnt, stark mit Fragen der Armut befasst. Mit dem Index menschlicher Entwicklung und den Millenniumsentwicklungszielen der Vereinten Nationen hat der Befähigungsansatz politische Wirkung entfaltet.39 In Analysen zu Entwicklung und Armutsbekämpfung in Ländern des Südens hat der Befähigungsansatz breite Anwendung gefunden. Weit seltener dagegen ist er explizit genutzt worden, Gerechtigkeitsdefizite und sozialpolitische Herausforderungen in reichen Ländern zu analysieren.40 Aber das bedeutet in keiner Weise, dass die Anwendbarkeit des Befähigungsansatzes auf die Probleme armer Länder beschränkt wäre. Der Befähigungsansatz kann unseren Blick auch auf die Herausforderungen in reichen Ländern produktiv weiten.
Keine soziale Gerechtigkeit ohne Befähigungsgerechtigkeit
Kommen wir zurück auf die drei Prinzipien sozialer Gerechtigkeit, wie sie David Miller entfaltet hat und mit denen dieses Kapitel eingeleitet wurde. Befähigung ist für jedes dieser Prinzipien relevant. Gleichheit als Staatsbürgerin oder Staatsbürger erfordert zuallererst, dass die bürgerlichen Rechte qua Gesetz gewahrt sind und staatliches Handeln sie respektiert und schützt. In einer gefestigten Demokratie wie in Deutschland ist dies glücklicherweise ganz überwiegend der Fall, und wo es Defizite gibt, gibt es dazu eine Debatte oder zumindest engagierte Gruppen, die sich bemühen, das Defizit ins öffentliche Bewusstsein zu heben. Ungleich in ihrer staatsbürgerlichen Teilhabe sind Menschen aber auch, wenn sie trotz gleicher Rechte von der politischen Teilhabe ausgeschlossen sind und sich durch Wahlabstinenz auch selbst ausschließen, etwa weil das Bildungssystem sie nicht erreichen und fördern konnte oder die Themen, die sie bewegen, in der politischen Kommunikation nicht vorkommen. Politische Gleichheit ist ohne Befähigung nicht zu erreichen.