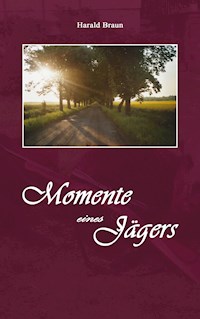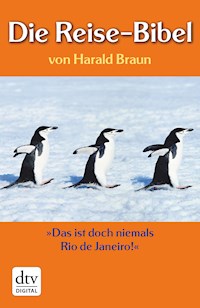9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Kein Geld, aber gut zu Fuß. Und jede Menge Freunde ... «Ich war offenbar nicht unbedingt der Mensch, von dem man ein Projekt wie ‹Deutschland umsonst reloaded› erwartete. Ich galt zwar nicht als völlig unsportlich und trotz meines fortgeschrittenen Alters immer noch als recht rüstig, wenn man das so sagen darf. Die körperlichen Anstrengungen eines solchen Projekts traute man mir noch bedenkenlos zu. In meinem unmittelbaren Umfeld brach allerdings trotzdem immer gleich hysterisches Gekicher aus, wenn ich von meinem Projekt erzählte. ‹Du willst betteln und wandern gehen?›, fragten meine Leute amüsiert. ‹Ausgerechnet du?› ‹Warum denn nicht?›, fragte ich zunehmend genervt zurück. ‹Was ist denn daran so komisch?› Ich erhielt auf diese Frage eine Menge Auskünfte, es würde den Rahmen sprengen, sie alle aufzuführen. In der Regel fokussierten sie sich auf folgende Punkte: ‹Du bist ein Vollzeit-Warmduscher, der Genussreisen, schickes Essen und luxuriöse Hotels schätzt, der im Sommer ein Cabrio im Kreis bewegt und im Winter gern mal aus Deutschland flüchtet, weil es ihm zu kalt und nass ist!› Na, vielen Dank, Freunde. Der Subtext dieser kurzen Skizzen meiner Persönlichkeit lautete doch wohl: Du bist ein saturierter Spießer, mein Lieber, wir gehen davon aus, dass du nicht mal die erste Woche überstehst! Ich würde lügen, wenn ich behauptete, dass mich das nicht nachdenklich gemacht hätte. Selbstwahrnehmung und Außenwirkung liegen ja immer ein wenig, ähem, auseinander, aber gleich sooo gravierend?» Harald Braun bezeichnet sich selbst als Warmduscher – und doch lässt ihn die Frage nicht los, wie es sich anfühlt, auf Geld und komfortable Fortbewegungsmittel zu verzichten und einfach loszulaufen. Er macht sich auf den Weg, mit seinem Hund an der Seite und 20 Euro Notreserve (für Hundefutter!) im Rucksack. Worauf er nicht verzichtet, ist sein Smartphone – denn er möchte ausprobieren, wie tragfähig die sozialen Netzwerke im echten Leben tatsächlich sind. Wird ihn einer seiner Facebook-Freunde auf dem Sofa schlafen lassen, und wird eine Blogleserin ein warmes Essen spendieren?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 328
Veröffentlichungsjahr: 2011
Ähnliche
Harald Braun
Deutschland umsonst reloaded
Zu Fuß und ohne Geld unterwegs
Über dieses Buch
Kein Geld, aber gut zu Fuß. Und jede Menge Freunde ...
«Ich war offenbar nicht unbedingt der Mensch, von dem man ein Projekt wie ‹Deutschland umsonst reloaded› erwartete. Ich galt zwar nicht als völlig unsportlich und trotz meines fortgeschrittenen Alters immer noch als recht rüstig, wenn man das so sagen darf. Die körperlichen Anstrengungen eines solchen Projekts traute man mir noch bedenkenlos zu. In meinem unmittelbaren Umfeld brach allerdings trotzdem immer gleich hysterisches Gekicher aus, wenn ich von meinem Projekt erzählte. ‹Du willst betteln und wandern gehen?›, fragten meine Leute amüsiert. ‹Ausgerechnet du?›
‹Warum denn nicht?›, fragte ich zunehmend genervt zurück. ‹Was ist denn daran so komisch?›
Ich erhielt auf diese Frage eine Menge Auskünfte, es würde den Rahmen sprengen, sie alle aufzuführen. In der Regel fokussierten sie sich auf folgende Punkte: ‹Du bist ein Vollzeit-Warmduscher, der Genussreisen, schickes Essen und luxuriöse Hotels schätzt, der im Sommer ein Cabrio im Kreis bewegt und im Winter gern mal aus Deutschland flüchtet, weil es ihm zu kalt und nass ist!›
Na, vielen Dank, Freunde. Der Subtext dieser kurzen Skizzen meiner Persönlichkeit lautete doch wohl: Du bist ein saturierter Spießer, mein Lieber, wir gehen davon aus, dass du nicht mal die erste Woche überstehst!
Ich würde lügen, wenn ich behauptete, dass mich das nicht nachdenklich gemacht hätte. Selbstwahrnehmung und Außenwirkung liegen ja immer ein wenig, ähem, auseinander, aber gleich sooo gravierend?»
Harald Braun bezeichnet sich selbst als Warmduscher – und doch lässt ihn die Frage nicht los, wie es sich anfühlt, auf Geld und komfortable Fortbewegungsmittel zu verzichten und einfach loszulaufen. Er macht sich auf den Weg, mit seinem Hund an der Seite und 20 Euro Notreserve (für Hundefutter!) im Rucksack. Worauf er nicht verzichtet, ist sein Smartphone – denn er möchte ausprobieren, wie tragfähig die sozialen Netzwerke im echten Leben tatsächlich sind. Wird ihn einer seiner Facebook-Freunde auf dem Sofa schlafen lassen, und wird eine Blogleserin ein warmes Essen spendieren?
Impressum
Rowohlt Digitalbuch, veröffentlicht im Rowohlt Verlag, Reinbek bei Hamburg, Dezember 2011
Copyright © 2011 by Rowohlt Verlag GmbH, Reinbek bei Hamburg
Umschlaggestaltung ZERO Werbeagentur, München
(Umschlagabbildung: FinePic®, München; Sabine Braun)
ISBN Buchausgabe 978-3-499-62742-2 (1. Auflage 2011)
ISBN Digitalbuch 978-3-644-45371-5
www.rowohlt-digitalbuch.de
Schrift Droid Serif Copyright © 2007 by Google Corporation
Schrift Open Sans Copyright © by Steve Matteson, Ascender Corp
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Alle angegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf die Printausgabe.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
www.rowohlt.de
Inhaltsübersicht
Prolog
1 Warum eigentlich?
2 Ich kann auch anders! (Wirklich?)
3 Von Netz- und Nutzwerken
4 Die Route
5 Reise in die Vergangenheit: Traunstein
6 Startprobleme
7 Die erste Nacht
8 Vorbeifahrers verpasste Chance
9 Röslerhaus
10 Die Beinahe-Begegnung
11 Kerngeschäft Barmherzigkeit
12 Beharrlich freundlich
13 Mein Treffen mit Heike Makatsch
14 Wo bleibt das Leid?
15 Schlossträume
16 Die Medien sind dran
17 Abenteuer bis zum Abwinken
18 Trecker, Kicker und Kloster
19 In Ulm, um Ulm und um Ulm herum
20 Kein schöner Land
21 Nur die Freiheit: Zelt
22 Neue Leute kennenlernen!
23 Wissenswertes über Stuttgart
24 Viel von allem
25 «Ich zahl dir Bahnhof!»
26 Kentucky oder Nieder-Liebersbach
27 Hundstage
28 Endstation Hauptbahnhof
29 Brady Bunch, Butzbach und der Anfang vom Ende
30 Der lahme Hund geht nach Hause
31 Patertag
32 Jungs
33 Flasche leer
34 Wo liegt dieses Spanien?
35 Rückenwind
36 Allein zu Haus
37 Polizeieinsatz und das richtige Leben
38 Bedingt wanderbereit
39 Schrittfrisch
40 Die Stunde null – Reset
41 Finale
Epilog
Danksagung
Prolog
Ich weiß noch genau, als mir klar wurde, worauf ich mich hier überhaupt eingelassen hatte. Es war der Moment, in dem ich hilflos vorm Lenzi stand und ihn um einen Gefallen bitten musste. Ich kannte den Lenzi nicht, und der Lenzi kannte mich nicht. Aber ohne den Lenzi, das war klar, wären wir aufgeschmissen in dieser Nacht. Sozusagen am Arsch. Selten zuvor habe ich mich so ungeschützt und hilflos gefühlt. Bis zu diesem Augenblick waren die ganzen Ängste, die ich mit «Deutschland umsonst reloaded» verband, blasse Theorie. Gedankenspiele, abstrakte Problemstellungen, die sich in der Praxis dann schon irgendwie auflösen würden. Doch schon an diesem zweiten Abend auf der Wanderung erhielten der Hund und ich einen Vorgeschmack darauf, was uns in den nächsten zwei Monaten bevorstand. Plötzlich hatte zumindest einer von uns ganz schön die Hosen voll.
Bleischwer und grau hingen die Wolken am Himmel, von Minute zu Minute wurde es dunkler über den Wäldern im Chiemgau. Seit sechs, sieben Stunden schlurften wir nun schon durch Oberbayern. Gestartet waren wir am frühen Morgen in Übersee am Chiemsee, nach einer kurzen, aber gemütlichen Nacht in einem Sportstudio voller Turnmatten und dickbäuchiger bunter Gymnastikbälle. Der Tag begrüßte uns sonnig und heiter, Thomas – der Wirt vom Gleis 1 in Übersee – spendierte uns Milchkaffee und frische Croissants und zeigte uns eine idyllische Strecke nach Riedering, unserem nächsten Ziel. Derartig eingestimmt wanderten wir am Vormittag am Bayerischen Moor- und Torfmuseum in Bernau vorbei bis hinein nach Prien am Chiemsee. Wir fanden, besser hätte unser ganzes Projekt gar nicht beginnen können.
Im Laufe des Tages aber wich unsere beschwingte Stimmung zunehmend einer gewissen Beklemmung. Immer wieder versteckte sich die Sonne hinter stetig bedrohlicheren Wolken, bis sie irgendwann gar nicht mehr zu sehen war. Stattdessen entfaltete sich ein dichter grauer Vorhang über unseren Köpfen. Regen setzte ein, erst tröpfelnd und sporadisch, später ergiebiger. Schließlich war aus der Ferne auch das leise Grummeln zu hören, mit dem sich ein ausgewachsenes Gewitter ankündigt.
Das war jetzt dumm. Wir befanden uns gerade mitten auf dem Weg nach Söllhuben, einem kleinen Ortsteil von Riedering, und die Wanderung an kleinen Wäldern und Kuhwiesen vorbei erwies sich auch ohne Gewitter bereits als komplizierte Herausforderung. Auf den kurvigen Kreisstraßen war nicht einmal ein kleiner Streifen für Fußgänger vorgesehen, sodass uns nur die linke Seite der ohnehin viel zu engen Fahrbahn blieb. Zum Glück herrschte hier kein reger Verkehr, doch ganz ungefährlich war die Wanderung auf diesen engen Landstraßen trotzdem nicht. Immer wenn uns ein Fahrzeug entgegenkam, ruckelte ich den Hund mit der Leine ganz eng an mein linkes Bein und drückte uns so nah wie möglich an die Straßenbegrenzung. Mehr konnte ich nicht tun. Nun blieb nur die Hoffnung darauf, dass uns der Lenker des jeweiligen Autos rechtzeitig wahrnahm und in vernünftigem Abstand umkurvte. Längst nicht jeder Fahrer war dazu bereit, selbst wenn weit und breit kein Gegenverkehr zu sehen war.
Zudem hatte Paula ja neuerdings dieses Problem … Kühe! Ausgerechnet jetzt traten die Viecher in Massen auf, knapp einen Meter von meinem aufgeregten Hund entfernt, und glotzten uns blöde an. Immer wieder versuchte Paula ruckartig in Richtung Straßenmitte auszuweichen, um sich so weit wie möglich von diesen potenziellen Gefahrenherden zu entfernen. Sie war ein paar Wochen zuvor vom Zwergesel eines Bekannten angegriffen worden, der zwar auf den Namen «Sir Henry» hörte, die dazugehörigen Manieren allerdings vermissen ließ. Offenbar machte mein misstrauischer Hund nun keinen Unterschied mehr zwischen Esel, Pferd oder Kuh. Für ihn galt seitdem: Alles Große auf vier Beinen ist gefährlich, davon hält man sich besser so fern wie möglich. Ich wurde langsam verdrossen. Es ist mühsam, mit dem eigenen Hund zerren und ringen zu müssen, im Dauerregen auf diesem kleinen Streifen, der uns vom Kuhzaun und den vorbeirauschenden Autos trennte.
Alle drei, vier Kilometer standen kleine Holzkreuze, Blumengestecke oder Mahnsteine am Straßenrand, häufig garniert mit brennenden Friedhofskerzen. Das war ein melancholischer Anblick und ein sehr unwillkommener dazu, wenn man ohnehin schon ein wenig abgekämpft mit einem nervösen Hund durch den Regen marschiert. Handelte es sich ausschließlich um Unfallopfer, an die hier mit Kreuzen und Kerzen gedacht wurde? Oder war auch der eine oder andere darunter, den ein Blitz erwischt und niedergestreckt hatte? Beide Möglichkeiten gefielen mir nicht, aber die Option, vom Blitz getroffen zu werden, erschien mir in diesen Minuten noch eine Spur unheimlicher. Vor allem in Anbetracht der Wetterverhältnisse, denen Paula und ich ausgesetzt waren. Das Grollen am Himmel war lauter geworden, aus der unangenehmen Sprühbrause hatte sich inzwischen ein sehr ergiebiger, vom Wind gepeitschter und seitwärts auf uns einprasselnder Dauerregen entwickelt. Ich hatte Paula längst unter ihrem roten Regencape verstaut, mit dem sie aussah wie Graf Zahl, doch mir selbst konnte so ein Umhang schon lange nicht mehr helfen. Die Feuchtigkeit kroch mir unter Regenjacke, Fleece und T-Shirt, die Hose klebte bereits an den Beinen, Regentropfen perlten an meinem Nacken hinunter, bis sie langsam und kalt über den Rücken rannen wie kleine spitze Nadeln. Dazu hatten wir längst die Orientierung verloren, das fürchtete ich jedenfalls. Immer wieder verlangten unbeschilderte Abzweigungen nach neuen Entscheidungen. Ich traute mich schon längere Zeit nicht mehr, in diesem feuchten Inferno mein iPhone aus der Tasche zu ziehen, um auf Google Maps zu überprüfen, ob in der Nähe möglicherweise ein kleiner Bauernhof oder eine Gaststätte auf uns wartete. An unserem zweiten Wandertag wollte ich nicht gleich riskieren, dieses geheimnisvolle Gerät zu zerstören. Schließlich war das iPhone meine einzige Verbindung zu meinem alten Leben, außerdem Kamera, Wegweiser und Musikbox in einem. Angeblich mochte es keine Feuchtigkeit. Was blieb uns also übrig? So lehnten Paula und ich uns einigermaßen orientierungslos, aber entschlossen gegen den Wind und den schräg einfallenden Regen, leicht vornübergebeugt wie Pilger auf ihrem Büßergang. Ich hoffte, dass irgendwo in der Richtung, in der wir Söllhuben vermuteten, auch Söllhuben war. Mehr als eine Menge Hoffnung blieb uns beiden an diesem Tag auch nicht. Es war ja nicht einmal ausgemacht, dass Paula und ich ein Nachtlager in dieser kleinen Gemeinde zwischen Chiem- und Simssee finden würden. Im Gegenteil. Wenn man unsere Situation realistisch einschätzte, war es sogar ziemlich unwahrscheinlich. Ich hatte noch nie von einer Ortschaft mit diesem Namen gehört und kannte auch keinen Menschen dort. Trotzdem gab es keinen Plan B an diesem Tag, an dem Paula und ich durchnässt bis auf die Knochen Kilometer fraßen und hofften, dass uns wenigstens das drohende Gewitter verschonen würde.
Ich hatte gleich nach dem Einbruch des Regens, als es erst ein wenig tröpfelte und ich mein iPhone noch in Sicherheit wähnte, auf Facebook unsere Koordinaten gepostet und meinen Leuten berichtet, dass wir am Abend vermutlich Riedering erreichen würden. Das war jedenfalls der Plan. Ob nicht jemand einen Tipp habe, wo wir dort oder in der näheren Umgebung übernachten könnten? Fremde Menschen holten sich doch an einem so scheußlichen Tag nicht auch noch zwei dubiose Gestalten ins Haus. Lange passierte nichts, dann meldete sich meine alte Freundin Marlies mit einer Nachricht aus Hamburg: «Versucht’s doch mal beim Lenzi, dem Hirzinger-Wirt in Söllhuben, der ist nett!» Söllhuben liegt nur ein paar Kilometer von Riedering entfernt, das passte also. Trotzdem klang ihre Nachricht ein klein wenig vage, also erkundigte ich mich nach Einzelheiten: «Kennst du den denn näher?» Kurz darauf antwortete Marlies: «Ich kenne den gar nicht, aber der Franz-Joseph, mein Bruder, der kennt ihn. Bestellt dem Lenzi einfach einen Gruß vom Chico, dann wird das schon …»
Nun.
Ein sicherer Deal hörte sich anders an, wenn Sie mich fragen. Aber wenn man schon stundenlang gewandert ist und langsam verzweifelt, weil sich a. eine klamme Feuchtigkeit durch alle Kleiderschichten gearbeitet hat und b. die Vorstellung, in dieser Nacht im Freien zu schlafen, minütlich an Schrecken gewann, dann klammert man sich auch schon mal an einen unbekannten Hirzinger-Wirt. Von dem man zwar noch nie gehört, der aber einen Freund namens Chico hat, der eigentlich Franz-Joseph heißt. Und der hoffentlich über ein großes Herz verfügt.
Das Gewitter tobte sich in der Zwischenzeit genau über uns aus. Ungefähr auf der Höhe von Farnach erreichte es seinen Höhepunkt, es blitzte und donnerte unablässig, der Regen erreichte Monsunstärke. Paula schaute immer wieder zu mir hoch, als ob sie mich für dieses Inferno verantwortlich machen wollte. Mit Mühe und Not war der schwarze Hund davon abzuhalten, in die kleinen Wäldchen zu rennen, die unseren Weg säumten. Erst knappe zwei Kilometer vor unserem Ziel konnten wir uns unter ein überdachtes Buswartehäuschen flüchten. In dieser Hinsicht sind die Bayern dem Rest des Landes weit voraus. Vulgäre Haltestellen des öffentlichen Nahverkehrs sehen hier manchmal aus wie gemütliche Skihütten. Das war jetzt ein Moment, in dem ich diesen folkloristischen Gestaltungswillen zu schätzen wusste. Es dauerte über eine Stunde, in der wir schwitzend unter unseren nassen Kleiderschichten darauf warteten, dass sich die Wetterlage besserte. Unter dem Dach unseres Unterschlupfes dampfte es wie in einer Waschküche.
Der Hirzinger an der Endorfer Straße entpuppte sich schließlich als prächtiger Gasthof mit einer leichten Tendenz zum bayrischen Designhotel. Wenn ich das vorher gewusst hätte, wäre ich noch mutloser auf unser Ziel zumarschiert. Ich erwartete in einer Gemeinde wie Söllhuben höchstens eine brave, unscheinbare Pension, irgendwo zwischen einem gesichtslosen Hotel garni und dem Gästezimmer von Großmutter Walburga. Dazu hätte so ein Name wie Lenzi ja auch gut gepasst. Doch der Hirzinger Hotel Gasthof zur Post war eindeutig Premiumgastronomie, schick, gediegen und nicht gerade billig, das konnte man auf einen Blick erkennen.
Vor dem Hirzinger warteten ein paar rauchende Herren mit aufgespannten Regenschirmen. Die örtliche Musikkapelle, wie sich herausstellen sollte. Die Männer, Bajuwaren mit Gardemaß in einheimischer Kluft, schauten uns mit großen Augen an: den triefenden Hund mit seinem lustigen roten Umhang und dessen zerknirschten Rudelführer mit seiner tropfenden Mütze und dem nassen, schweren Gepäck. Wir müssen ein Bild des Jammers abgegeben haben. Wer um Himmels willen ist denn so narrisch, bei diesem Wetter in der Natur umherzuspazieren, mögen die Musikanten gedacht haben. Hätten sie gewusst, dass wir nicht mal ein Bett beim Hirzinger gebucht hatten und auch nicht die Mittel besaßen, solch einen Luxus zu bezahlen, hätten sie uns vermutlich noch eine Spur irritierter angestarrt.
Das war jetzt der Moment der Wahrheit. Beklommen rüttelte ich das rustikale Eingangstor zur Gastwirtschaft auf. Wenn das schiefging, waren wir geliefert. Wo sollten wir denn jetzt noch hin, so müde, nass und ausgehungert wie wir waren? Wir mussten hier unterkommen, wir hatten gar keine Wahl. Gemütlich schaute es beim Hirzinger aus, urig, alle Räume waren geschmückt mit landwirtschaftlichem Kunstgewerbe aus vergangenen Tagen. Die rustikale Wirtsstube brummte im vollbesetzten Betrieb, und auch hier blickten uns viele der Gäste an, als ob sie eine Erscheinung hätten. Ich musste mir einen Ruck geben und Paula vorschieben, um mich an die Theke zu wagen: «Könnte ich einmal kurz den Lenzi sprechen?»
Die Fachkraft am Zapfhahn, adrett gekleidet in einem dieser modernen Dirndl, die man neuerdings auch außerhalb der Wiesn-Zeit trägt, zog kurz die Augenbrauen hoch. «Der ist in der Weinstube!» Ich atmete durch. Immerhin gab es hier einen Lenzi.
Um in die Weinstube zu gelangen, musste man durch eine Art Gewölbe tief hinein in den Bauch des Gasthofes. Auch hier überall geschmackvolle Visitenkarten gediegenen Wohlstands, so in der Art Folklore meets Zeitgeist. Das hier war unverkennbar ein Sterneschuppen made in Bavaria. Mein Mut sank mit jeder Sekunde, die ich hier verbrachte. Warum sollte der Wirt eines solchen Ladens einem nassen Penner und seinem müffelnden Hund Unterschlupf gewähren, dazu auch noch umsonst? Aushängeschilder für seinen Laden wären wir ja nicht gerade. Da könnte ich es in München ja auch im Bayrischen Hof oder in Hamburg im Hotel Atlantik versuchen. Unter normalen Umständen hätte ich mich von dieser absurden Idee verabschiedet und einfach kehrtgemacht. Doch hier, an diesem Abend, hatte ich einfach keine Wahl. Wenigstens um einen Platz im Stall würde ich betteln müssen, allein schon für den armen Hund. In dieser Nacht noch einmal hinaus in die Kälte und den Regen zu müssen, hätte bedeutet, sich mit einer schlaflosen Nacht anzufreunden – und einer Lungenentzündung. Mit einem Mal wurde mir klar, dass dieses Gefühl in den nächsten beiden Monaten unser ständiger Begleiter sein würde. Dieses Gefühl der Verlorenheit, der Heimatlosigkeit, ja, nennen wir es ruhig: Verzweiflung. So fühlte es sich also an, mittellos zu sein und um das Wenigste bitten zu müssen, was jeder Mensch haben sollte: Essen und ein Dach über dem Kopf.
Würde ich dieses Gefühl zwei Monate lang ertragen?
Die Frage blieb erst einmal offen, denn inzwischen hatte mich der Lenzi entdeckt. Ein gutaussehender Kerl, so der Typ Hansi Hinterseer, Mitte dreißig, Anfang vierzig vielleicht, etwas längeres Haar, leicht gebräunt, schlank und gutgekleidet. Dieser Mensch war kein vulgärer Schankkellner, das sah ich gleich. Ich nahm all meinen Mut zusammen, viel war es nicht mehr: «Ich soll Ihnen einen schönen Gruß vom Chico ausrichten. Der Chico hat gesagt, sie wären sicher so nett und würden einem mittellosen Wanderer wie mir ein Dach über dem Kopf anbieten. Wir haben aber leider kein Geld!» Dann hielt ich die Luft an und schaute den Lenzi flehend an. Und der Lenzi schaute zurück. Einundzwanzig. Zweiundzwanzig. Dreiundzwanzig …
1Warum eigentlich?
Es gibt zwei Bücher, die ich in den achtziger Jahren immer wieder gelesen habe: «Der schöne Vogel Phönix» von Jochen Schimmang und «Deutschland umsonst» von Michael Holzach. Texte von Zweiflern auf der Suche, melancholisch, ernsthaft und kraftvoll. Schimmangs Buch handelt davon, wie ein Berliner Student die APO-Zeit erlebt, die Sozialisation eines aktiven 68ers, wenn man so will. Spätestens seit der Lektüre dieses Buches habe ich es bedauert, nicht zehn Jahre früher auf die Welt gekommen zu sein. In Berlin, Frankfurt oder sogar München hätte ich auch gern an der Universität mitgemischt, möglicherweise dabei ja sogar Rudi Dutschke kennengelernt, Uschi Obermaier oder Rainer Langhans, bevor er zu einer weiß gekleideten Karikatur wurde. Leider war mir das nicht vergönnt. Mein revolutionärer Geist arbeitete sich stattdessen Ende der siebziger Jahre (also zu spät!) daran ab, Flugblätter gegen den Abriss eines alten Rathauses in meiner Heimatstadt zu verteilen. Beinahe hätten wir den ehrwürdigen Koloss sogar besetzt. Als aber unter uns der Verdacht grassierte, dass dort ein bissiger Schäferhund für Sicherheit am Bau sorgen könnte, ließen wir von unseren aufständischen Plänen ab. So viel zu meiner Karriere als Revolutionär.
Auch meine gefühlte Verbundenheit mit Michael Holzach schien über Jahrzehnte hinweg keine praktischen Auswirkungen zu haben. Es hatte mir gefallen, dass da Anfang der achtziger Jahre jemand ohne Geld in den Taschen in das Wirtschaftswunderland Deutschland hinauszog und sich empörte. Michael Holzach, so schien es mir damals, hatte die gleichen Feindbilder und die gleichen Schwierigkeiten wie ich, sich in einem Land zurechtzufinden, in dem nur Materielles zählte, Leistung und Erfolg. Zudem hegte ich den Verdacht, dass so ein Projekt auch ein grandioses Abenteuer werden könnte, so eine Art gelatschtes Roadmovie. So träumte ich also heimlich schon fünfundzwanzig Jahre davon, ein paar Wochen als «mittelloser Penner» durch Deutschland zu ziehen und zu schauen, ob es da draußen freundliche und barmherzige Menschen gibt, die Leuten wie mir helfen, wenn es darauf ankommt. Ein bisschen suchte ich natürlich auch nach einem Alibi dafür, eine Zeitlang wie ein Kerouac’scher Hobo planlos durch die Gegend zu stromern, die Struktur meines konventionellen Alltags aufzulösen, Freiheit zu spüren. Wenn es denn Freiheit war, die man erfuhr, wenn man den ganzen Tag kilometerweit marschierte und nichts weiter im Kopf haben musste als die nächste Mahlzeit.
Natürlich blieb dieser Traum ohne Folgen. Ich trampte mit zweiundzwanzig einmal mit sehr wenig Geld nach Südfrankreich, um dort in Antibes am Strand herumzugammeln, näher kam ich dem Holzach-Projekt nie.
Eines Tages aber saß ich in Reinbek mit meiner Lektorin zusammen, um über gemeinsame Projekte nachzudenken, im Frühjahr 2010 muss das gewesen sein. Arglos erwähnte ich Holzachs «Deutschland umsonst» und seufzte: «So was macht heute doch keiner mehr.»
«Dann mach du es doch!», antwortete meine Betreuerin aus dem Rowohlt Verlag ein wenig schnippisch, wie mir schien. Das stachelte mich an.
«Würde ich ja gern, wenn ihr das dann verlegt!» Ich dachte keine Sekunde daran, dass aus diesem knappen Wortwechsel ein Jahr später das eigentümlichste Projekt meines Lebens werden sollte. Meine Lektorin schwieg und lachte still in sich hinein. Was das zu bedeuten hatte, erfuhr ich einige Tage später. Offenbar hatte sie das Thema auf der Verlagskonferenz zur Sprache gebracht und dort tatsächlich Interesse entfacht.
«Wir machen dir ein offizielles Angebot», sagte sie am Telefon, «wir möchten, dass du ‹Deutschland umsonst› dreißig Jahre später noch einmal aufleben lässt. Nur ein wenig anders. Moderner. Zeitgemäßer.»
Das hieß konkret, ein boomendes Phänomen in das «Deutschland umsonst»-Projekt zu integrieren, auf das sich Michael Holzach damals noch nicht stützen konnte: Ich würde auf meiner Reise soziale Netzwerke anzapfen. Facebook zum Beispiel oder Myspace, vielleicht sogar Twitter. Für mich war das gleich aus zwei Gründen beruhigend. Zum einen hoffte ich, dass mir über eine große Facebook-Community zumindest hin und wieder mal ein Dach über dem Kopf oder ein warmes Essen angeboten würde. Zum anderen war mir nicht wohl bei dem Gedanken, das Holzach-Projekt einfach bloß eins zu eins zu kopieren. Der Facebook-Aspekt ermöglichte mir eine neue und, wie ich fand, originelle Herangehensweise an «Deutschland umsonst». Und erst durch den Zusatz «reloaded» fühlte ich mich legitimiert, den Titel für mich und das Buch in Anspruch zu nehmen.
(Zugegeben: Nicht jeder muss dieser Ansicht sein. Vom NDR kam im Laufe meiner Wanderreise die Anfrage, mich für ein, zwei Tage mit der Kamera begleiten zu dürfen. Ein paar Tage später ruderte man wieder zurück: Auf Chefebene hielt man das ganze Projekt, so hieß es, leider eher für eine Kopie, eine Art geistigen Diebstahl. Und Axel Hacke, der Autor des SZ-Magazins, sorgte sich vor allem um das Wort «reloaded» und hoffte: «Möge dieses Wort schwer wie Blei sein und möge es der Verlagsleitung auf die Füße fallen, es ist ja furchtbar!» Ich halte das in beiden Fällen für den üblichen Bullshit alter Männer – gut, ich bin selbst fast einer – und Hochkulturbewahrer, aber hey, ich wollte es Ihnen wenigstens mal gesagt haben.)
Bis zu dem Tag, an dem der Buchvertrag tatsächlich bei mir im Briefkasten landete, glaubte ich nicht daran, dass ich wirklich auf diese Reise gehen würde. In der sogenannten Projektphase verdrängte ich den Gedanken daran, so gut es ging. Ich besänftigte auch meine inzwischen bereits ziemlich aufgescheuchte Frau, die mich schon hungernd unter Brücken schlafen sah und mir «für alle Fälle» dringend die Anschaffung einer Feuerwaffe empfahl.
«Reg dich nicht auf, am Ende wird doch nichts draus», versicherte ich ihr. Tja, das sah jetzt natürlich schon ganz anders aus mit einem rechtskräftigen Vertrag auf dem Schreibtisch. Zudem erhielt ich plötzlich noch einen Anruf aus Reinbek: «Wir haben jetzt den Ausrüster für dich gefunden!»
Ich hatte darauf bestanden, für die Wanderreise mit professionellem Equipment ausgestattet zu werden. Ich war schließlich kein geübter Outdoorspezialist und verfügte nicht einmal über ein Paar feste Wanderschuhe oder einen geeigneten Rucksack für solch eine Unternehmung. Bei mir musste so eine Survival-Fachkraft bei null anfangen.
Offenbar kannten auch die Verantwortlichen der Outdoorkette Unterwegs das Buch von Michael Holzach und mochten die Idee, solch ein Abenteuer dreißig Jahre später neu aufleben zu lassen. Das erhöhte natürlich den Druck: Hier war von Verlagsseite offenbar schon Zeit und Arbeit in meine Zukunft als Landstreicher investiert worden. Vielleicht ahnte meine Lektorin ja intuitiv, dass meine Lautsprecher-Visionen vom großen Tippelabenteuer auf keinem sonderlich stabilen Fundament standen. Jetzt aber gab es keinen Weg mehr zurück: Ich setzte meine Unterschrift unter den Vertrag und lehnte mich zögerlich zurück. Okay, ich würde also «Deutschland umsonst reloaded» tatsächlich angehen. Ohne Geld und zu Fuß über 1000 Kilometer vom südlichsten Zipfel Bayerns zurück nach Hause in Schleswig-Holstein laufen. So langsam sollte ich mir ein paar ernsthafte Gedanken darüber machen, was genau da eigentlich auf mich zukam.
2Ich kann auch anders! (Wirklich?)
Ich war offenbar nicht unbedingt der Mensch, von dem man ein Projekt wie «Deutschland umsonst reloaded» erwartete. Ich galt zwar nicht als völlig unsportlich und trotz meines fortgeschrittenen Alters immer noch als recht rüstig, wenn man das so sagen darf. Die körperlichen Anstrengungen eines solchen Projekts traute man mir also noch bedenkenlos zu. In meinem unmittelbaren Umfeld brach allerdings trotzdem immer gleich hysterisches Gekicher aus, wenn ich von meinem Projekt erzählte.
«Du willst betteln und wandern gehen?», fragten meine Leute amüsiert, «ausgerechnet du?»
«Warum denn nicht?», fragte ich zunehmend genervt zurück. «Was ist denn daran so komisch?»
Ich erhielt auf diese Frage eine Menge Auskünfte, es würde den Rahmen sprengen, sie alle aufzuführen. In der Regel fokussierten sie sich auf folgende Punkte: «Du bist ein Vollzeit-Warmduscher, der Genussreisen, schickes Essen und luxuriöse Hotels schätzt, der im Sommer ein Cabrio im Kreis bewegt und im Winter gern mal aus Deutschland flüchtet, weil es ihm zu kalt und nass ist!»
Na, vielen Dank, Freunde. Der Subtext dieser kurzen Skizzen meiner Persönlichkeit lautete doch wohl: Du bist ein saturierter Spießer, mein Lieber, wir gehen davon aus, dass du nicht mal die erste Woche überstehst!
Ich würde lügen, wenn ich behauptete, dass mich das nicht nachdenklich und ein wenig sauer gemacht hätte. Selbstwahrnehmung und Außenwirkung liegen ja immer ein wenig, ähem, auseinander, aber gleich sooo gravierend?
Ich hatte mich eigentlich immer für einen kernigen Typen gehalten, sportlich, neugierig und vielleicht sogar eine Spur verwegen. Für einen Mann eben, der jederzeit für ein Projekt wie «Deutschland umsonst reloaded» in Frage kam. Aber es stimmt schon. Ein Anhänger von Rüdiger Nehberg und anderen Outdoorverfechtern war ich im richtigen Leben wirklich nicht. Meine journalistischen Neigungen hatten sich stets im warmen Planschbecken der Kultur- und Lifestyle-Themen abgearbeitet. Als knallharter Reporter mit investigativen Vorlieben und dem Drang zu zäher Recherche war ich bislang kaum aufgefallen. Auf der Liste der Dinge, die ich noch erledigen wollte, bevor der letzte Vorhang fiel, stand die Anschaffung eines 911er Targas aus den Jahrgängen 72 bis 74 und ein Besuch im Camp Nou in Barcelona, während Leo Messi auf dem Spielfeld einen Gottesdienst mit dem Ball feierte. Das war alles nicht sehr ernsthaft, möglicherweise, aber die Wahrheit.
Es hätte also sicher Journalisten, Autoren oder Schriftsteller mit besserer Eignung gegeben, nach fast dreißig Jahren Michael Holzachs Wegen zu folgen. Weil sie vielleicht engagierter, sozialer, altruistischer sein mochten, weil sie über einen entsprechenden Ton und über eine Haltung verfügten, die über jeden hedonistischen Zweifel erhaben gewesen wäre. Aber sollte ich deshalb gleich abwinken? War es nicht im Gegenteil eine besondere Herausforderung, wenn ein üblicherweise spaßgetriebener Leichtmatrose wie ich ohne Geld auf Wanderschaft ginge? In der Möglichkeit, auf dem langen Weg zu scheitern, lag doch auch ein gewisser Reiz.
Ich ging noch einmal in mich, um die wahre Motivation meiner Wanderreise zu überprüfen. War es wirklich nur ein Job, der an meinen Schreibtisch gespült worden war? Was versprach ich mir von den Erfahrungen dieser Reise für mein weiteres Leben?
Ich gehörte zu den Menschen, denen sich in der Regel bei Begriffen wie «Selbsterfahrung» oder «die eigenen Grenzen erweitern» ganz schnell die Nackenhaare aufstellten. Zu oft hatte ich sie aus dem Mund von Spinnern vernommen, die obskuren Nonsens und eskapistische Merkwürdigkeiten mit ihrem blümeranten Psycho- und Soziologengeschwätz vertuschen wollten. Selbsterfahrung … um Gottes willen. War das nicht das gängige Codewort und die kollektive Legitimation für jeden Blödsinn, der einem so einfiel?
Ich wollte mich nicht um jeden Preis «selbst erfahren». Das tat ich doch schon ausgiebig in meinem Alltag, wenn ich Bücher las, Sport trieb und in meinem Garten die führenden Sonntagszeitungen las. Ich war halt keiner, der unablässig an der Welt verzweifelte und dabei täglich für den Weltfrieden betete. Mein persönlicher Leidensdruck war nicht allzu groß, im Gegenteil: Mein Leben machte mir Spaß. Ich war nicht mehr ständig auf der Suche, ich wusste, was gut für mich war, und hatte kein schlechtes Gewissen dabei, drei Sätze hintereinander mit ICH zu beginnen.
Mag sein, dass das komisch klingt, aber ich hoffte trotzdem, kein ausgemachtes Arschloch zu sein.
Mir war also schon vor Antritt der Reise klar, dass ich mit der getriebenen Unruhe, dem moralischen Tiefgang und der altruistischen Energie eines Michael Holzachs nicht konkurrieren konnte. Trotzdem war für mich dieses Projekt von Anfang an auch eine ehrfürchtige Verbeugung vor ihm, einem Reporter, der mich durch seinen Blick auf die Welt beeindruckt hatte und dem ich einen lange gehegten Traum verdankte. Auch wenn auf den ersten Blick nicht jedem klar gewesen sein dürfte, wieso ausgerechnet ich mich für sein Projekt begeisterte.
Natürlich spielte auch schlichte Neugier eine Rolle: Ich wollte herausfinden, wie es sich anfühlt, mit leeren Taschen durch ein reiches Land zu wandern. Nicht weil ich dieses Land, in dem ich gern lebe, an den Pranger stellen wollte. Sondern weil ich auf diese Art mehr über seine Menschen und, ja, möglicherweise auch ein bisschen mehr über mich selbst herausfinden konnte. Wie es sich zum Beispiel anfühlt, Hunger zu haben und keinen Schlafplatz zu finden, wenn mein Facebook-Netzwerk zu löchrig und mein Stolz zu groß wären, darum zu betteln. Was es mit mir macht, auf die üblichen Ablenkungen meines Alltags zu verzichten und mich nur noch um die elementarsten Bedürfnisse der menschlichen Existenz sorgen zu müssen: Essen. Trinken. Schlafen.
Dann natürlich die Sache mit dem Geld. Oder besser: kein Geld mehr zu haben für einen begrenzten Zeitraum. Was würde dieser Umstand, den man so verräterisch wie fälschlich als Mittellosigkeit bezeichnet, mit meinem Selbstbewusstsein anstellen? Der englische Songwriter David Gray beschäftigt sich in seinem Stück «What are you» mit diesem Thema, er nennt es explizit «money’s ugly confidence». Das war eine Textzeile, die mich jedes Mal nachdenklich machte, wenn ich sie hörte. War das wirklich so, korrespondierte unser Selbstverständnis, unser Auftreten in der Welt hauptsächlich damit, wie viel Geld wir in der Tasche hatten? Ich nahm mir vor: Ich wollte auf dieser Reise herausfinden, inwieweit ich selbst von diesem hässlichen Selbstvertrauen durchsetzt war und zu einem hilflosen Geschöpf regredierte, wenn der Griff zum Geldbeutel meine Probleme nicht mehr lösen konnte.
3Von Netz- und Nutzwerken
Ich muss Sie warnen. In diesem Kapitel geht es sehr viel um Technik (und um meine Unfähigkeit, sie effektiv einzusetzen) sowie um einige vorbereitende Maßnahmen, ohne die «Deutschland umsonst» nicht denkbar gewesen wäre. Möglicherweise langweilt das den einen oder anderen, vor allem, wenn er sich mit sozialen Netzwerken bestens auskennt. In diesem Fall hätte ich Verständnis dafür, wenn Sie jetzt einfach schnell weiterblättern zum nächsten Kapitel. Falls dann irgendwann im Verlauf des Buches ein paar Fragen zur logistischen Mechanik der Reise aufkommen sollten, nun: Zurückblättern geht ja eigentlich immer.
Ich gehöre vermutlich zu den Erfindern der Prokrastination. Ich habe eine mal mehr, mal weniger ausgeprägte Erledigungsblockade. Es war ja schon schwer genug, mich mental auf die nächsten Monate einzustimmen. Die praktischen Vorbereitungen des Projekts verlor ich darüber viel zu lange aus den Augen. Ursprünglich hatte ich mit dem Verlag vereinbart, etwa zwei Monate vor dem Start der Reise eine Facebook-Seite einzurichten, um mit einigem Vorlauf genügend Helfer für mein Vorhaben zu gewinnen. Ich hatte sogar eine Art Claim entwickelt, mit dem ich schnell erklären wollte, warum wir Facebook und Konsorten bei dem Buchprojekt mit im Boot haben wollten: «Ich möchte rausfinden, ob ein soziales Netzwerk auch ein Nutzwerk sein kann!» Inzwischen gehörte dieser Satz bei der Erklärung der ganzen Chose schon zu meinem automatischen Repertoire, das ich aufsagte wie eine Sprechpuppe.
Auch Myspace und Twitter sowie einen eigenständigen Blog wollte ich nach Abschluss der Gespräche mit dem Verlag tunlichst schnell auf den Weg bringen, um die größtmögliche Aufmerksamkeit für die ganze Geschichte zu gewährleisten.
Was heißt Aufmerksamkeit: Ich versprach mir ganz konkrete Hilfe auf meinem Weg. Ich würde «Deutschland umsonst»-Seiten einrichten und über mein iPhone jederzeit posten können, wo ich gerade steckte – das war der Plan. Die Leute, die meine Wanderung online verfolgten, sollten die Möglichkeit erhalten, mich direkt zu kontaktieren. Sie könnten das, was ich da gerade erlebte, einfach nur kommentieren oder – im besten Fall – ein paar kompetente Tipps geben. Alle möglichen Tipps: zur Streckenführung beispielsweise. Oder wo sie Leute kannten in abgelegenen Regionen, die mich bei sich aufnehmen oder mir etwas zu essen anbieten könnten. In der Theorie klang das simpel, aber ich hatte keine Ahnung, ob dieses Modell auch in der Praxis funktionieren würde. Ob sich meine «Freunde» bei Facebook für mein merkwürdiges Projekt wirklich interessierten und sogar konkrete Hilfe anbieten würden, stand in den Sternen.
Dazu ist anzumerken, dass ich «schon» seit 2009 über einen Facebook-Account verfügte. Aber nur, weil wir damals ein halbes Jahr in Australien vor dem deutschen Winter flüchteten und beinahe unser gesamtes Umfeld der Meinung war, ohne solch einen Facebook-Briefkasten seien wir da unten vom guten alten Europa komplett abgeschnitten. Vorher, das gebe ich zu, gehörte ich zu den mentalen Brandstiftern, die soziale Netzwerke für Teufelszeug, mindestens aber für unnütze Zeitdiebe hielten. Das hat sich geändert. Inzwischen betrachtete ich zumindest Facebook als maßvoll amüsantes und praktisches Angebot und nutzte es kontinuierlich. Dabei war ich weit davon entfernt, die ganzen technischen Möglichkeiten auszuschöpfen, die sich da boten. In dieser Hinsicht war ich einfach nicht sehr ambitioniert, was eine freundliche Umschreibung ist für: begriffsstutzig.
Von daher hatte ich auch lange Zeit keine Ahnung, wie ich eine extra Facebook-Seite zu einem Projekt wie «Deutschland umsonst reloaded» einrichten sollte. Ich las mir die «How to …»-Seiten des Betreibers durch und vergaß alles gleich wieder, las sie mir noch einmal durch und richtete im Affekt eine «Gruppe» auf meiner privaten Facebook-Seite ein. Das war ein Fehler. Es gibt vermutlich Menschen, die mich dafür immer noch hassen. Der Unterschied zwischen einer monothematischen «Gruppe» und einer eigenen «Seite» besteht nämlich unter anderem darin, dass alle Mitglieder einer Gruppe unaufgefordert über jede Aktion jedes Mitglieds dieser Gruppe informiert werden. Sie wissen das vermutlich. Ich hatte keine Ahnung. Da ich gleich mal alle meine Facebook-Freunde (etwa dreihundert zu dieser Zeit) ungefragt in die Gruppe gepackt und dort ein wildes «Gefällt mir»- und Kommentar-Feuerwerk entfacht hatte, erhielten sehr viele Menschen in diesen Tagen eine Menge überflüssiger Post. Diejenigen, die über so viel technisches Knowhow verfügten wie ich selbst, nämlich nahezu keines, waren leider nicht in der Lage, sich mit einem Häkchen an der richtigen Stelle in ihren Facebook-Einstellungen aus meinem «Gruppenzwang» zu befreien. Ich verfasste daraufhin einige kleinlaute «Sorry-Postings» und hoffte, das Problem damit aus der Welt zu schaffen. Vergeblich. Was wiederum nachvollziehbar wird, wenn man sich die verwirrten Beiträge durchliest, die ich damals verschickte …
Harald Braun Liebe Leute, ich bin ja leider ein Social-Network-Amateur und habe nicht gewusst, dass Mitglieder einer GRUPPE jeden Beitrag von jedem unaufgefordert erhalten. Das ist lästig, weiß ich. Sorry.
Bitte tretet aus der Gruppe aus (ich kann euch leider nicht selbst rauswerfen, ihr müsstet auf GRUPPE VERLASSEN klicken) und geht stattdessen auf meine «Deutschland umsonst»-Seite. Da poste ich dann auch die Positionslichter meiner Wanderung – und wenn und wann und wo ich Hilfe brauche. :-)
Es gibt noch eine «Deutschland umsonst»-Seite, da steht BUCH drunter, sie hat auch kein Bild von mir. Auch schön, die ist vom Rowohlt Verlag. Allerdings ist es sinnvoller, auf meine persönliche Seite zu gehen, wenn ihr zeitnah wissen wollt, was los ist! Danke. Und nochmals: sorry.
10. April um 12:36
Es gibt diese Gruppe immer noch auf meiner Seite. Sie besteht aus momentan hundertfünfundachtzig Mitgliedern, aber zum Glück gibt es dort keine Aktivitäten mehr. Ich kann sie selbst nicht löschen, auch wenn ich nichts lieber täte. Aber irgendwie habe ich es geschafft, mich als Administrator der eigenen Gruppe zu eliminieren. Sie treibt jetzt führungslos durchs digitale Universum …
Mit etwas Anlauf schaffte ich es schließlich im dritten oder vierten Versuch dann doch noch, eine eigene «Deutschland umsonst»-Seite auf Facebook einzurichten, am 7. April. Natürlich viel zu spät. Der Verlag selbst hatte derweil – wohl in der begründeten Annahme, ich selbst würde es ohnehin nicht hinkriegen – eine eigene Verlagsseite aufgebaut, die ebenfalls mit «Deutschland umsonst» überschrieben war. Verwirrend, chaotisch, absurd? Aber klar. Willkommen in meiner Welt.
Deutschland umsonst Am 1. Mai geht’s los. In Traunstein. Sehr südliches Süddeutschland. Vorher wäre es prima, wenn Ihr diese Seite vielen eurer FB-Freunde schicken könntet. Nur damit sich die Wahrscheinlichkeit erhöht, ein paar potenzielle Unterstützer zu finden. Für den Hund und mich, auf unserem Weg nach Hause in den Horst.
07. April um 21:42
Zum Reisestart am 1. Mai hatten sich auf dieser Seite etwa hundertfünfzig Menschen mit einem knappen «Gefällt mir» angemeldet, doch im Laufe der zwei Wandermonate stieg die Community der Interessierten bis in den Juli hinein auf über sechshundert Leute an.
Nachdem ich die Facebook-Seite tatsächlich eingerichtet hatte, war mein Elan auch schon wieder erloschen. Es überforderte mich, jetzt noch mehr Seiten bei anderen Netzwerken zu installieren. Ich hielt es schlicht für überflüssig. Ein Freund von Twitter war ich ohnehin noch nie, auch wenn sich jetzt die Echtzeit-Junkies und News-Fetischisten aus meiner Branche verzweifelt vor die Stirn schlagen. Jaja, von mir aus, da habe ich halt den Schuss nicht gehört.
Nein, ernsthaft: Was sollte ich denn praktisch mit einem Twitter-Account auf dem Trip anfangen? Glaubt denn jemand, dass ich durch einen breaking news-Tweet am späten Nachmittag einen Landwirt in Langgöns oder Heisterbacherrott im Schweinestall alarmieren und dazu bewegen könnte, mir ein Bett für die Nacht oder einen Liter Milch zu spendieren?
Eher zufällig gelang es mir, wenigstens den geplanten Blog auf wordpress.com anzulegen. Wobei das so nicht mal stimmt: Unser Freund Arndt, unter anderem ein praktizierender Webdesigner, quartierte sich just in dieser Zeit ein paar Tage in unserem Gartenhaus ein. Als Gegenleistung bot er mir an, solch eine Seite aufzubauen. Ich malte ihm auf einem weißen Blatt Papier auf, wie ich mir die Seite vorstellte: viel Blau, viel Schwarz und ein paar redaktionelle Rubriken, mit denen ich mein Publikum bei Laune halten wollte. Ich hatte mir vorgenommen, dort alle paar Tage einen längeren Beitrag über meine Reise zu posten und mit der Facebook-Seite zu verlinken. Außerdem wollte ich dort täglich etwas «Verkehr» generieren, indem ich meine Route nachzeichnete («On the Route»), die Menschen vorstellte, die mir halfen («Jeden Tag ein guter Täter!»), und über meine zahlreichen Schlafstätten blödelte («Bettentest»). Der begleitende Effekt des wordpress-Blogs war, dass auch Facebook-Verächter die Möglichkeit erhielten, mein Projekt mitzuverfolgen. Von denen gab es ja immer noch mehr, als man glaubt. Arndt leistete ganze Arbeit, am 23. April, Ostersamstag also, konnte ich den ersten Beitrag auf der Seite http://deutschlandumsonst.wordpress. com online stellen. Wenn ich gewusst hätte, wie viel Arbeit jeden Abend nach den langen Stunden auf der Landstraße auf mich wartete, um wenigstens die kleineren Rubriken kontinuierlich zu aktualisieren, wäre ich möglicherweise etwas leiser eingestiegen …
4Die Route
Ich wusste nicht allzu viel über das Wandern, bevor ich zu meiner Tippelei aufbrach. Ich fasse meine theoretische Expertise vor dem Start einmal kurz zusammen: Man ging also am frühen Morgen los, ein Ziel vor Augen, munter und voller Energie. Auf dem Rücken ein Ranzen mit Proviant und allem, was man am Tag (und gegebenenfalls für eine aushäusige Übernachtung) so brauchte. Gern wurde an diversen Aussichtspunkten oder touristischen Highlights ein kleiner Halt eingelegt. Ein wenig länger durfte er ausfallen, wenn dazu in einer gastlichen Hütte ein Schnitzel oder ein Bierchen in Ehren kredenzt wurde. Am frühen Nachmittag nach dem Wiederaufbruch verlief man sich in der Regel, leicht fressnarkotisiert und schon ein wenig trübe im Kopf. Natürlich war die undurchsichtige Beschilderung schuld.