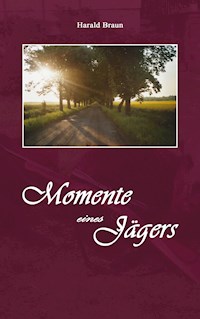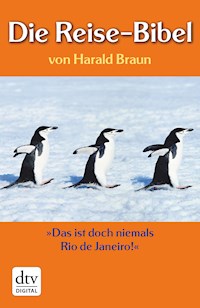7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Bastei Lübbe
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Eigentlich ist alles ganz okay in Haralds Leben. Er führt ein typisches Städter-Dasein in einer schicken Altbauwohnung im Szeneviertel, gönnt sich samstags ein ausgiebiges Frühstück bis die Sportschau beginnt und muss keinen Nagel gerade in die Wand schlagen können.
Dann allerdings hat er diese fixe Idee von der eigenen Scholle auf dem Land. Von einem schnuckeligen Häuschen im Grünen, das aus ihm einen ausgeglichenen und richtig zufriedenen Menschen machen würde: Kuscheln vor dem Kamin, Äpfel und Erdbeeren ernten, neben der Katze lässig in der Sonne lümmeln - soweit die zauberhafte Vorstellung.
Doch Harald ist dumm genug, sie wahrmachen zu wollen. Er siedelt um. Und was passiert? Die Frau haut ab, der Job ist futsch - und Harald sitzt alleine in der Pampa ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 358
Veröffentlichungsjahr: 2011
Ähnliche
Harald Braun
DasGummistiefelGefühl
Mein neues Leben in der Pampa
BASTEI ENTERTAINMENT
Vollständige E-Book-Ausgabedes in der Bastei Lübbe AG erschienenen Werkes
Bastei Entertainment in der Bastei Lübbe AG
Copyright © 2011 by Bastei Lübbe AG, Köln
Textredaktion: Henrike Heiland, Berlin
Titelbild: © SuchBild, Pauline Schimmelpenninck
Büro für Gestaltung, Berlin
Umschlaggestaltung: Pauline Schimmelpenninck
Büro für Gestaltung, Berlin
Datenkonvertierung E-Book:
hanseatenSatz-bremen, Bremen
ISBN 978-3-8387-0471-5
Sie finden uns im Internet unter www.luebbe.deBitte beachten Sie auch: www.lesejury.de
Für Sabine, den weltbesten Albert.
Prolog
Wenn mal jemand nach dem miserabelsten Tag meines Lebens fragen sollte, müsste ich nicht lange nachdenken.
»Samstag, 2. August 2003.«
Kein Zweifel. Das ist der Tag. Es muss so gegen 21 Uhr gewesen sein, als der letzte meiner Freunde sich verabschiedete.
»Bist du okay?«, fragte Greumel leise.
Ich nickte. Klar war ich okay. Mehr okay ging gar nicht. Nicht für einen Typen jedenfalls, der gerade seine Heimat und seine große Liebe verloren hatte.
»Keine Sorge, alles wird gut!«
Mein Freund Greumel sah mir fest in die Augen. Ungewöhnlich genug. Jungs tun so was nicht. Meine Freunde schon mal gar nicht. Ich bin unter Fußballern aufgewachsen. Da gilt ein Tritt in den Hintern als Sympathiebekundung. An diesem Abend aber schien sich Greumel ernsthaft Gedanken zu machen.
»Ich kann auch hier übernachten, wenn du willst.«
Kopfschütteln.
»Nee, mach, dass du rauskommst«, sagte ich. »Wir sind doch nicht bei Aktion Sorgenkind!«
Greumel sah mich ein letztes Mal zweifelnd an, dann wandte er sich zum Gehen.
»Ruf mich an.«
»Klar, ich meld mich.«
Ich sah noch, wie Greumel sich auf dem kurzen Weg zum Gartenzaun umdrehte, das Haus und den sattgrünen Garten drumherum kurz musterte und fast unmerklich den Kopf schüttelte. Nicht zum ersten Mal. Kurz darauf verschwanden langsam die Rückleuchten seines VW Bully auf der Allee. Dunkelheit umgab meine neue Heimat. Allein, zum ersten Mal an diesem Tag. Ich stolperte über einen Umzugskarton, der im Weg stand, und sah kurz ins zukünftige Esszimmer, in dem der Handwerker meines Vertrauens immer noch keine Zeit gefunden hatte, neue Dielen zu verlegen. Ich pilgerte durch die Räume, als sähe ich sie zum allerersten Mal. Jedes Zimmer unterzog ich einer eingehenden Musterung, voller banger Zweifel: Würde ich hier ein schönes Leben führen können? Was hielt die Zukunft hier drin für mich bereit?
Ich weiß noch, wie ich mich auf die kleine Treppe vor dem Haus setzte, ein Glas Rotwein in der Hand, und den Geräuschen der Nacht lauschte. Das Dumme daran war: Es gab gar keine Geräusche. Alles war still, die Nacht mild, der Himmel hing voller Sterne. Doch diese Idylle hatte nichts Heimeliges für mich, im Gegenteil: Alles fühlte sich furchterregend fremd an. Wie die Anfangssequenz von »Scream 3«, knapp vor der ersten Leiche. Eine noch namenlose Katze, die ab heute offiziell meine sein würde, kletterte über planlos im Raum verteilte Möbel und schlich sich hinter meinem Rücken in den Garten. Melancholie lag über dieser Szene wie Mehltau, und auch ein bisschen zu viel Verzweiflung für meinen Geschmack. Offenbar wollte selbst die Katze nur noch weg aus diesem Trauerspiel.
Da saß ich nun, im August 2003, frisch gebackener Single und Neu-Besitzer eines Hauses, das irgendwo einsam in der Pampa herumstand und das ich, wenn ich die Lage realistisch einschätzte, auch so bald nicht wieder loswerden würde. Das hatte ich mir wirklich alles ganz anders vorgestellt. Vor einem Jahr noch, als ich zum ersten Mal über ein Leben im Grünen nachgedacht hatte. Zur Ruhe wollte ich kommen, mit Anna zusammen vor dem Kamin sitzen, gute Bücher lesen, Äpfel und Erdbeeren ernten, Blumensträuße pflücken, Gemüsebeete anlegen.
Und jetzt? Jetzt wollte ich am liebsten alles ungeschehen machen, bevor ich mein neues grünes Leben überhaupt ausprobiert hatte. Wollte ganz schnell zurück in meinen Fünf-Zimmer-Altbau mit Holzdielen in der Hamburger City. Zurück zu Anna, der meine plötzlichen Naturschwärmereien gleich suspekt gewesen waren. Sie hatte ja recht: Wer würde hier schon leben wollen? Es war absurd. Was wollte ich auf dem Land? Allein? Was hatte ich hier verloren, in der Provinz, im Off, im Neandertal der Zivilisation, wo ich niemanden, wirklich N I E M A N D E N kannte und wo mich sicher bislang auch niemand vermisst hatte? Ich nippte an meinem Rotwein und dachte darüber nach, wie mein Leben wohl in Zukunft aussehen würde. Ich dachte nach, so fest ich konnte, aber nicht einmal der Rotwein lieferte brauchbare Ergebnisse.
Teil I
Das Landleben lockt sogar diejenigen, die sich nichts aus ihm machen
Fernando Pessoa
Ich bin ein Stadtmensch. Ich weiß es, und jeder andere, der mich kennt, weiß es auch. Ich bin eine dieser Gestalten, die gern Latte Macchiato trinken und über eine Miles-&-More-Karte verfügen. Ich bin ein Fünf-Zimmer-Altbau-Typ in einem Viertel, in dem man überteuerte Mieten zahlt, bloß weil vor der Tür ein paar anständige Bars und Cafés zu finden sind. Ich fahre ohne erkennbaren Grund einen sogenannten Lifestyle-Kombi und esse dreimal in der Woche bei einem kleinen Italiener in der Nebenstraße. Menschen wie ich führen ein Leben zwischen Programmkino, Antik-Trödel-Markt und Fitnessstudio, wir gehören zu den Event-Fans eines kultigen Fußballvereins und besuchen hin und wieder ein Open-Air-Konzert im Stadtpark (wenn’s nicht zu laut wird). Ich weiß auch, was LOHAS oder Trendscouts sind, und finde es ganz in Ordnung, gegen 23 Uhr bei einem Bringdienst rohen Fisch im Gegenwert eines iPods zu bestellen. Ich war häufiger in New York als Udo Jürgens, aber noch nie im Harz. »Bauer sucht Frau« nehme ich höchstens mal zufällig beim Zappen zur Kenntnis, aber die DVD-Collection von »Mad Men« habe ich aus den Staaten importiert. Ich bin bei Utopia und Facebook registriert, verfüge über ein ZEIT- und ein 11-Freunde-Abo sowie vierzehn Paar Sneakers, mit denen ich keinen Sport treibe. Und Wasser trinke ich nicht aus der Leitung, sondern von San Pellegrino. Ich weiß inzwischen, dass mich all das in den Augen eines durchschnittlichen Landbewohners zu einer rätselhaften Person macht, die man allenfalls belächelt, wenn nicht besser gleich ignoriert. Aber ich stehe dazu: So ein Mensch bin ich nun mal. Und so ein Mensch war ich auch schon, als ich im August 2003 aufs Land zog.
Da drängen sich natürlich Fragen auf.
»Bist du sicher?«, wollten meine Eltern zum Beispiel wissen, als ich ihnen zum ersten Mal von meinen Plänen erzählte.
»Bist du ganz sicher?«, fragten meine Freunde, als ich begann, in Wochenendausgaben nach Häusern auf dem Land zu suchen.
»Bist du in letzter Zeit mal auf den Kopf gefallen?«, fragte mich meine Lebensgefährtin Anna, als ich ein paar Monate lang an jedem Wochenende in der näheren Umgebung Hamburgs nach möglichen Zufluchtsorten suchte. Man kann zusammenfassend wohl behaupten, dass ich schon für Außenstehende nicht als idealer Kandidat für ein Leben auf dem Land in Frage kam, und je mehr jemand über mich wusste, desto ungläubiger fielen die Blicke aus, wenn ich von meinen Plänen erzählte. Doch ich war nicht nur ein Stadtbewohner, ich hatte auch Phantasie. (Man kann natürlich auch behaupten, dass ich mich in fixe Ideen mit einer Vehemenz hineinsteigern kann, die den meisten Menschen nicht geheuer ist.) Am 2. August 2003 zog ich also unwiderruflich vierzig Kilometer entfernt von der Hansestadt Hamburg in einen Ort in der Pampa, in dem etwa fünftausend Einwohner und vermutlich doppelt so viele Kühe und Pferde lebten. Wie konnte das geschehen?
Es ist schwer zu erklären.
Man muss sich meinen Wunsch, aufs Land zu ziehen, in etwa so vorstellen wie den Traum eines Stotterers, vor der UNO-Vollversammlung zu sprechen. Er klang einfach absurd. Und es mussten schon eine Menge Faktoren zusammentreffen, bis ich tatsächlich im Haasenbütteler Gemeindeamt vorstellig wurde und mich als Neubürger Schleswig-Holsteins registrieren ließ.
Eines aber weiß ich genau: Das Bazillus für diesen Traum schlummert in jedem von uns. Oder wollen Sie behaupten, dass Sie nicht mindestens einmal in Ihrem Leben gedacht haben: »Wär’ das nicht schön, wenn man so ganz einfach auf dem Land leben könnte, in einem Häuschen im Grünen, mit Tieren, offenem Feuer, Obstbäumen im Garten?« Solche Hirngespinste hegt doch jeder irgendwann irgendwie. Meistens sitzt man dabei allerdings arglos in einem Kino mitten in der Stadt und schaut sich seufzend eine englische Literaturverfilmung an. Oder man ist eingeladen auf die Hochzeit eines Freundes, der ganz originell auf einem rustikalen Bauernhof feiert. Ich wette, viele von Ihnen sehen die verführerischen Bilder von goldgelben Sonnenuntergängen, niedlichen Hofhunden und magisch vertrödelten Sommernachmittagen direkt vor sich. Man feiert mit seinen Freunden an einer langen Hochzeitstafel unter einer Kastanie, hat schon einen beachtlichen Schwips und beobachtet, wie sich die Katzen lässig in der Sonne lümmeln. In so einem Moment denkt man dann eben gern mal: Boah, wie schön ist das denn?
Aber Vorsicht. Solche Bilder müssten zensiert werden. Sie sind die perfekten Vorlagen für diese hübschen, aber leider völlig unrealistischen Projektionen von einem idyllischen Leben auf dem Land, das es außerhalb des Kinos (und auf lustigen Hochzeiten) wohl kaum geben dürfte. Es sind die typischen Gefühlsverstärker für ahnungslose Städter wie mich, die sich nach einem einfachen, idyllischen Leben in der Natur sehnen, ohne zu wissen, welche Geister sie da rufen.
Gut, meistens bleibt es bei diesen sporadisch aufblitzenden Traumbildern, die man nach ein paar Tagen wieder vergessen hat, bis wieder ein James-Ivory-Film die Kinos verstopft oder der nächste gute Freund auf einem zünftigen Landgut heiratet. Stattdessen wendet man sich bald wieder den neuen Bars in der City zu oder zieht, wenn sich das bisschen Country-Sehnsucht auch nach Monaten nicht vertreiben lässt, in ein Penthouse mit Wasserblick. Ist ja auch irgendwie naturverbunden.
Ich kritisiere das nicht. Vielleicht ist es ja auch wirklich besser so, dass nicht alle Wünsche, die man so leichtfertig hegt, wirklich in Erfüllung gehen. Wenn sich Wünsche dieser Größenordnung plötzlich verselbständigen und man sich eines Tages dabei wiederfindet, wie man ein Nummernschild mit einer merkwürdigen Buchstaben-Kombination an sein Auto schraubt, kann man schon mal von sich selbst überrascht sein. Ich weiß, wovon ich rede. Ich kann Ihnen versichern, dass ich die Uhr am 2. August 2003 gern noch einmal um ein ganzes Jahr zurückgedreht hätte. Mein neues Leben XX Country? Hätte ich sofort wieder zurückgegeben, wenn ich dazu auch nur den Hauch einer Chance gehabt hätte. Aber die gab es nicht. Ich wusste: Da musst du jetzt durch. Allein. In einem Kaff namens Haasenbüttel. HAASENBÜTTEL. Du meine Güte.
Wo lag mein Problem? An welcher Stelle war ich falsch abgebogen und am Ende in Haasenbüttel gelandet, in einer Sackgasse ohne Wendemöglichkeit? Nun, in meinem Fall lag das klar auf der Hand: Schuld waren Frau Dutziak und Anna.
Frau Dutziak ist meine Bankberaterin. Allein den Umstand, dass ich über so etwas wie eine Bankberaterin verfügte, hätte ich die längste Zeit meines Lebens nicht für möglich gehalten. Ich bin einer von den Jungs, die nicht rechnen können. Oder, wie mein Vater es formulierte: »Jeder Esel kann besser zählen als du!« (Wörtlich sagte er: »Du häs’ nüs ronger als et fottloch«, was aber nur Freunde der rheinischen Mundart verstehen – und das ist vielleicht auch besser so.) Natürlich hatte er recht, ganz gleich, wie man es formulieren möchte. Ich kann mit Geld einfach nicht umgehen. Alles, was man mir zusteckt, gebe ich sehr schnell wieder aus. Ich glaube ganz fest an Kreisläufe. Sparen ist nicht so mein Ding. Bausparverträge, Altersvorsorge, Rücklagen für schlechte Zeiten – mit meinem Leben schien das lange Jahre nichts zu tun zu haben. Wenn mir jemand blöd kam, renommierte ich mit einem Zitat von Karl Lagerfeld, das ich mal in der ZEIT gelesen hatte: »Man muss das Geld zum Fenster rauswerfen, damit es zur Tür wieder reinkommt.«
Irgendwann Mitte der 90er Jahre rief mich Frau Dutziak zum ersten Mal an. Ich arbeitete zu dieser Zeit in der Chefredaktion eines Frauenmagazins bei einem großen Hamburger Verlag. Dafür, dass ich tagsüber ins Büro ging, um viel Kaffee zu trinken und mein Sekretariat mit laut aufgedrehten Drum-&-Bass-Klängen in den Wahnsinn zu treiben, wurde ich ganz formidabel bezahlt. Das waren grandiose Zeiten, als die Zeitungskrise noch kein Thema war und das Internet höchstens als kurioser Abenteuerspielzeug für ein paar kleinwüchsige Garagenhocker galt. Jedenfalls war Frau Dutziak aufgefallen, dass mir jeden Monat ein hübsches Sümmchen aufs Konto überwiesen wurde. Ich ließ die vielfältigen Möglichkeiten, mit diesem Geld etwas Sinnvolles, sprich: Nachhaltiges anzufangen, souverän außer Acht. Eigentlich war ich immer leicht im Dispo, egal, wie viel man mir aufs Konto packte.
Normalerweise pflegte ich die Anrufe von Menschen aus Versicherungen, Telefongesellschaften oder Banken zügig zu beenden, weil ich intuitiv davon ausging, dass man mir nur etwas aufschwatzen wollte, das ich nicht brauchen konnte. Stimmte in der Regel ja auch. Bei der freundlichen Frau Dutziak aber verhielt es sich anders. Ich mochte ihr unaufdringliches Nachhaken, blieb freundlich und ließ sie meistens aussprechen – auch wenn ich ihre Vorschläge nicht mal ansatzweise verstand. Frau Dutziak drang mit dem Wunsch, mir Aktiengeschäfte oder sonstige finanzielle Transaktionen schmackhaft zu machen, in den ersten Jahren unserer Bekanntschaft nicht zu mir durch. Doch die Frau blieb hartnäckig. Meine alberne Schutzbehauptung, ich hätte kein Interesse an der Vervielfältigung meiner Einkünfte, nahm sie ziemlich sportlich. Jedes Mal verabschiedete sie mich nach einem unserer Gespräche hörbar belustigt mit dem Hinweis: »Wenn Sie es sich mal anders überlegen sollten – ich helfe Ihnen gern!«
Ich konnte Hilfe gebrauchen, so war es ja nicht. Allerdings war Frau Dutziak nicht die naheliegende Lösung für meine Probleme. Finanziell ging’s mir prima. Mein Privatleben allerdings … Sagen wir, es gestaltete sich zu jener Zeit etwas turbulent. Seit einigen Jahren führten Anna und ich etwas, das ein Frauenmagazin eine »On-Off–Beziehung« nennt. Für Verächter dieser publizistischen Sondergruppierung kann man das auch anders umschreiben: Wir trennten uns alle paar Wochen, um dann recht schnell herauszufinden, dass wir miteinander einfach mehr Spaß hatten. Unsere Krisen waren uns fast zu einer lieb gewonnenen Gewohnheit geworden, schließlich waren ja auch die Versöhnungen anschließend nicht ohne Reiz.
Einer von Annas Lieblingsfilmen war »Pretty Woman«. Ich vermutete, das hing mit einem Wunschtraum aller Frauen zusammen, die ich kannte: Einmal im Leben mit der limitfreien Kreditkarte eines reichen Mannes shoppen gehen … Anna aber behauptete, nicht der Shopping-Exzess, sondern vor allem die Schlussszene, in der Richard Gere im offenen Straßenkreuzer bei Julia Roberts vorfährt, hätte sie gerührt. Das sei so mutig, so unmännlich – sooo cool!
»Romantische Männer – wo gibt’s die denn überhaupt noch?«
Das war nur eine rhetorische Frage, die an mich und gleichzeitig gegen mich gerichtet war. Ich bin kein Freund von kitschigen Gesten, und wenn Gott gewollt hätte, dass wir den ganzen Tag Süßholz raspeln, hätte er das neunte Gebot unter den Tisch fallen lassen. Anna war da anderer Meinung: »Du brichst dir keinen Zacken aus der Krone, wenn du mir mal hin und wieder ein Kompliment machst!«
Das waren im Prinzip unvereinbare Haltungen – aber auch die Positionslichter unserer Liebe. Wir waren der Beweis dafür, dass sich Gegensätze tatsächlich anziehen. (Auch wenn das eine Menge Probleme machte.)
Ich liebte Anna, und daran änderte auch der Umstand nichts, dass sie an den achtzehn wachen Stunden ihres Tages ein kaum kontrollierbares Chaos-Potential in sich barg. Sie sah schon aus wie eine Frau, die vor noch nicht allzu langer Zeit aus dem Wald gekommen und nun mühsam gebändigt worden war: Zuerst sah man eine Menge widerspenstig-lockiges blondes Haar über der schwarzen Business-Uniform, die ihr Job ihr auferlegte. Sie verfügte über einen zarten, fast zierlichen Körper, der allerdings ständig unter äußerster Spannung zu stehen schien. Dazu dieser freche, fordernde Blick: Selbst wenn Anna in friedfertiger Stimmung schien, strahlten ihre grün-blauen Augen gefährlich. Mit Anna zusammen zu sein, hieß, das Leben eines Kriegsreporters zu führen. Wenn es nach ihr ginge, dann würden wir nach dem gemeinsamen Joggen jeden Abend mindestens drei Freunde und eine Vernissage besuchen, einen Kochkurs belegen und dann vor dem Schlafengehen noch am Mitternachts-Slam eines Literaturclubs teilnehmen. Neben ihren zahlreichen Dienstreisen organisierte sie für ihr Leben gern Überraschungstrips. Die Ziele waren ihr egal – ob Madrid oder Murmansk, Hauptsache, man konnte in 48 Stunden genügend Museen, Clubs und Modeboutiquen erkunden. Nach diesen »kleinen Fluchten« mit Anna brauchte ich immer ein paar Tage, bis ich mich vollständig erholt hatte. Diese Frau brannte an beiden Enden, und wir reden hier nicht von einer kleinen Flamme. Ich hatte schon länger den Verdacht, dass ihre Schilddrüse mal in einen Kessel mit Zaubertrank gefallen sein musste. So viel Energie konnte kein einzelner Mensch haben – und so viel Hunger auch nicht. Wer mal jemanden mit sehr viel Appetit essen sehen möchte, dem empfehle ich einen Restaurant-Besuch mit Anna. Da kann man einem Kraftwerk bei der Energiegewinnung zusehen.
»Dein Kiefer hat die Malmkraft der zwei Herzen!«, spottete ich immer, wenn sie nach Suppe, Vorspeise und dem zweiten Wiener Schnitzel immer noch keinerlei Ermüdungserscheinungen zeigte. Dabei sah sie so aus, als ob sie sich ausschließlich von Salatblättern ernähren würde. Ein Stoffwechselwunder.
Wenn ich eine längere Zeit am Stück mit Anna verbracht hatte, dann provozierte ich zuweilen schon aus reinem Selbstschutz einen Streit. Nur um schnaubend das Weite suchen zu dürfen und mich für eine Weile in meiner beschaulichen, eher mäßig aufregenden Existenz abzuschotten. Klar, manchmal konnte sie einem auf den Wecker gehen mit ihrer Unfähigkeit, die Dinge einfach mal nur laufen zu lassen. Doch ich muss zugeben: Nach ein paar Tagen Anna-Abstinenz erschien mir mein eigenes Leben immer ziemlich trostlos.
Ich habe schon oft darüber nachgedacht, was uns beide eigentlich verbindet. Ich bin zum Beispiel kein Freund von Veränderungen, reise nicht allzu gern und lerne neue Leute nur kennen, wenn ich dazu gezwungen werde. Mir gehen die alten ja schon oft genug auf den Wecker. Anna hingegen war als PR-Managerin eines Reiseveranstalters ständig auf der ganzen Welt unterwegs, kannte jedes Theater und jede Galerie in Hamburg und hätte aus dem Stand etwa 150 Freunde nennen können, die ihr sofort eine Niere spenden würden. (Dazu mussten sie Anna nicht mal länger als eine Woche kennen.)
Anna und ich waren wie Hamburg und München, wie Red Bull und Buttermilch, oder von mir aus auch wie Kerner und Beckmann – ein schräges Paar mit viel explosivem Potential.
Vielleicht waren es ja unser etwas morbider Sinn für Humor und die Fähigkeit, sich selbst nicht allzu ernst zu nehmen, die uns auf Langstrecke zusammenhielten. Und ihre gut versteckte, aber in seltenen Momenten aufblitzende Kümmerer-Mentalität natürlich.
Wir hatten uns auf einer Pressereise nach Schweden kennen gelernt, die sie für einen ihrer Kunden betreute. In Westschweden hatte es vier Tage am Stück geregnet. Ich war schon bei einem Segelausflug am ersten Tag seekrank geworden. Es folgte eine Magen-Darm-Geschichte beim Versuch, mir die verlorenen Eiweiße, Vitamine und Mineralien durch den Konsum einer größeren Menge Fisch wieder zuzuführen. Als ich am letzten Tag der Reise dann beinahe wieder auf dem Damm war, kommentierte eine ausgewachsene Grippe die schwedische Nasskälte mit laufender Nase und Halsschmerzen, gepaart mit zunehmendem Stimmverlust. Anna verbrachte in diesen Tagen mehr Zeit an meinem Bett als bei ihrer Journalistengruppe. Ich fühlte mich kraft- und saftlos wie ein nasses Brötchen, und dieser Zustand war mir vor Anna unsagbar peinlich. Aber mir fehlte die Energie, mich dagegen aufzulehnen. Stattdessen nahm ich ihre Dienste als Krankenschwester dankbar an. Anna behauptete später, sie habe sich in mich verliebt, weil ich so rührend hilflos, aber auch so freundlich und fatalistisch gewesen sei und nicht so muffig wie andere Männer in meiner misslichen Lage. Nun. Da kann man mal sehen …
Mittlerweile ging mir unser ständiger Kleinkrieg an die Substanz. Wir hatten uns bisher davor gedrückt zusammenzuleben. Natürlich dachten wir darüber nach – nach so langer Zeit ja wohl kein Wunder. Sechs Jahre, oder waren es schon sieben? Mir erschien ein wenig mehr Alltag mit meiner Freundin nicht ohne Reiz. Anna war spürbar weniger begeistert von dem Gedanken. Ein gewisser Abstand würde jeder Liebe guttun, behauptete sie. Außerdem befürchtete sie, ich würde sie spätestens nach drei Monaten in einer gemeinsamen Wohnung im Schlaf erwürgen, weil ihre Vorstellung eines lebendigen Ambientes sich an einem Marktplatz in Marrakesch orientierte, während ich mich ja wohl eher in einem Sanatorium in Meran zu Hause fühlte. Natürlich widersprach ich vehement, aber insgeheim war ich ein wenig erleichtert. (Ich war natürlich der Ansicht, dass ein bisschen mehr Meran ihrem Leben guttun würde.) So ein- bis zweimal im Monat kam das Thema inzwischen auf den Tisch, doch bislang hatten wir uns einfach nicht dazu durchringen können, Nägel mit Köpfen zu machen. Die offizielle Sprachregelung lautete: »Vorerst nicht, aber wenn wir mal zufällig auf eine tolle Wohnung stoßen, können wir ja noch mal ernsthaft darüber reden.«
So standen die Dinge zwischen Anna und mir, als sich Frau Dutziak mal wieder bei mir meldete. Ihre Anrufe waren mir im Laufe der Jahre zu einer lieb gewonnenen Gewohnheit geworden. Wir plänkelten fröhlich über meine Neigung zur Verschwendung, und sie lachte mich jedes Mal aufs Neue aus, so als ob sie eine wohlwollende Großtante sei, die sich um das schwarze Schaf ihrer Sippschaft kümmert:
»Was Sie da jeden Monat für ein Geld verschenken, Respekt, Herr Braun!«
Vermutlich hatte sie mich alle zwölf Monate auf Wiedervorlage, mit der Anmerkung: »Nachfrage beim Finanzidioten!«
Das konnte ich ihr kaum übel nehmen. Jeder Mensch in meinem Umfeld, dem man schon einmal den Fisch in der Financial Times eingeschlagen hatte, faselte in dieser Zeit von Aktiendepots, Immobilienfonds und Optionsscheinen für Schweinehälften. Ich war umgeben von Finanzgenies, die alle im Begriff waren, in spätestens zehn Jahren Millionäre zu sein. Nur ich und ein paar andere mentale Einzeller verweigerten sich standhaft dem ökonomischen Fortschritt. (Ich schätze, in meinem Fall war das eher Bequemlichkeit als eine Vorahnung des Desasters, das den meisten der selbst ernannten Wall-Street-Gekkos noch bevorstehen sollte).
Ich nahm Frau Dutziaks Anteilnahme an meinem ökonomischen Gebaren mit der Zeit persönlich. Diese Frau war sympathisch und nicht in erster Linie an meinem Geld interessiert, daran bestand für mich kein Zweifel. Zudem war sie auch noch ziemlich attraktiv, wie ich bei unserem ersten persönlichen Treffen irritiert zur Kenntnis nahm. Frauen in Businesskostümen bringen mich leicht aus der Fassung, und dazu trug sie auch noch eine dieser dunkel eingefassten Hornbrillen. Es war schon eine Herausforderung, immer nur bei den nackten Zahlen zu bleiben.
Trotzdem verlor sich nach dem siebten oder achten Gespräch mit Frau Dutziak so langsam meine Scheu, einmal seriös über meine wirtschaftlichen Perspektiven zu sprechen. Frau Dutziak stöhnte zum Beispiel darüber, dass ich für eine gemietete Altbauwohnung in Eppendorf 1500 Euro auf den Tisch legte – zur Freude meines Vermieters, der sich auf meine Kosten eine schwere Kawasaki leistete.
»Uiuiui …«, seufzte Frau Dutziak, »ganz schön viel Holz. An die Anschaffung von Wohneigentum haben Sie wohl noch nie gedacht? So als Altersvorsorge?«
Altersvorsorge. In meiner Sprache war das ein Wort, das so ähnlich klang wie Schwelbrand, Fußpilz oder, sagen wir: Wurzelbehandlung. So unsexy. So undurchsichtig. Und so weit weg.
Auch über »Wohneigentum« hatte ich bislang auf genau dieselbe Art nachgedacht wie über den Wunsch, Astrophysiker zu werden oder beim Iron Man auf Hawaii mitzumachen. Mag ja nett sein, so im Prinzip, aber in meinem Leben? Never ever! Zumal ich ja, siehe oben, auch keinen Cent auf so eine Idee hin gespart hatte.
»Gute Frau, wie soll das denn gehen«, flachste ich meine attraktive Bankdame an, »so ganz ohne Startkapital? Ich habe doch nichts Gescheites auf dem Konto, das wissen Sie doch! Rufen Sie wieder an, wenn die Süddeutsche Klassenlotterie mir einen größeren Geldbetrag aufs Konto überwiesen hat!«
Doch selbst diesen Einwurf parierte Frau Dutziak lässig.
»Bei Ihren regelmäßigen Einkünften dürfte es doch für uns kein Problem sein, einen Kreditwunsch – auch in interessanter Höhe – wohlwollend zu prüfen …«
Oops! Diese Frau wusste, wie man Jungs wie mir den Bauch pinselte. Bei meinen Einkünften … Kreditwunsch … interessante Höhe … Hey, ich war für die Sparkasse offenbar so eine Art Premium-Kunde. So hatte ich mich noch nie gesehen.
Natürlich hielte dieser Eindruck einer seriösen Prüfung kaum stand, das ahnte ich schon. Aber geschmeichelt fühlte ich mich doch. Frau Dutziak machte das sehr clever, schätze ich. Vermutlich werden diese Bankleute in Seminaren auf so wankelmütige Gestalten wie mich abgerichtet. Bei mir funktionierten ihre Tricks: Ich fühlte mich plötzlich ziemlich reich und dachte: »Klar, genau, man könnte doch mal drüber nachdenken.« Warum sollte ich mir denn keine Villa am Stadtrand zulegen? Und einen Porsche obendrauf? Für den Anfang.
Zwar lachte ich Frau Dutziak aus und wollte offiziell nichts davon wissen, unter die Hausbesitzer zu gehen, doch die Lunte war gelegt. Es dauerte nur ein paar Monate, bis diese »Idee« sich so ganz, ganz langsam in meinem Kopf festsetzte. Als sie sich dort erst einmal eingerichtet hatte, ließ sie sich nicht wieder auswildern. Zumal Anna verblüffend neutral auf meinen ersten Vorstoß reagierte.
Wir hatten gerade mal wieder eine unserer »Trennungen« überstanden. Ich hatte es gewagt, ihr zum Geburtstag ein teures »Zeitmanagement«-Seminar zu schenken. Das hatte sie mir als versteckten Vorwurf ausgelegt, obwohl ich noch eine Tüte teuerste Leonidas-Pralinen aus Belgien obendrauf gelegt hatte. So ein Stoffel bin ich ja nun auch nicht. Jedenfalls hatte sich die Lage gerade erst wieder beruhigt, als sich Frau Dutziak bei mir meldete und mich mit der Idee infizierte, ein eigenes Haus zu besitzen. Vielleicht war das ja auch ein prima Anlass, unsere Diskussion über das Zusammenziehen wieder aufzunehmen. Möglicherweise würden Anna und ich uns ja entspannen, wenn wir mehr Zeit miteinander verbrachten. In unserer eigenen Wohnung, vielleicht sogar in einem eigenen Haus …?!
Anna?«
»Hmm?«
»Kannst du das mal einen Moment ausschalten?«
Anna sah mich irritiert an. Normalerweise ging die Initiative zu einem Problemgespräch von aus. Aber ganz bestimmt nicht gerade dann, wenn »Sex & the City« im Fernsehen lief. Ich hatte den Zeitpunkt allerdings ganz bewusst gewählt. Ich wollte Programm schnell durchziehen, und zwar ohne große Gegenwehr.
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!