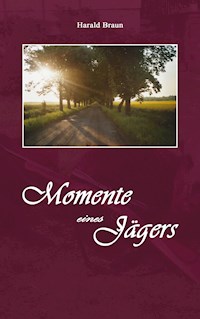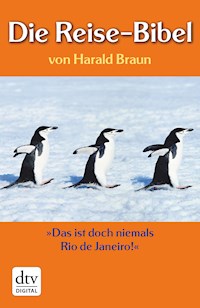6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: dtv Verlagsgesellschaft
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Wie Männer ticken - eine Nabelschau Ein Junge, den die Mädchen doof finden. Ein Teenager, der die ›Bravo‹ missversteht. Ein junger Mann, der Angst vor seiner Sex-Premiere hat. Ein Student, der einen »Blow Job« zu wörtlich nimmt. Einer, der im selben Frühling die erste große Liebe und peinliche Erektionsprobleme kennenlernt. Ein Ehemann, der nur noch zweimal im Monat will. Ein Ex-Ehemann, der ins Internetdating einsteigt und nach sechs Monaten immer noch kein neues Schlafzimmer von innen gesehen hat. Die Geschichte eines Mannes, der die Frauen liebt, aber lange keinen überzeugenden Weg fand, es ihnen mitzuteilen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 294
Veröffentlichungsjahr: 2010
Ähnliche
Harald Braun
Der mieseste Liebhaber der Welt
Roman
Deutscher Taschenbuch Verlag
Originalausgabe 2010© Deutscher Taschenbuch Verlag GmbH & Co. KG, München
Das Werk ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist nur mit Zustimmung des Verlags zulässig. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.Rechtlicher Hinweis §44 UrhG: Wir behalten uns eine Nutzung der von uns veröffentlichten Werke für Text und Data Mining im Sinne von §44 UrhG ausdrücklich vor.
eBook ISBN 978-3-423-40284-2 (epub)ISBN der gedruckten Ausgabe 978-3-423-21229-8
Ausführliche Informationen über unsere Autoren und Bücher finden Sie auf unserer Website www.dtv.de/ebooks
Inhaltsübersicht
Vorspiel
I. Kapitel
II. Kapitel
III. Kapitel
IV. Kapitel
V. Kapitel
VI. Kapitel
VII. Kapitel
VIII. Kapitel
IX. Kapitel
Nachspiel
Danksagung
Für meinen Vater, einen eigenwilligen Mann
Vorspiel
2010, Studio Hamburg
Tags Exfrau, Frauenflüsterer, Künstlername, Ratgeber, Talkshow
Soundtrack Falling down a Mountain/ Tindersticks
Film Avatar/ James Cameron
Alle Verliebtheit, wie ätherisch sie sich auch gebärden mag, wurzelt allein im Geschlechtstriebe.
Arthur Schopenhauer
Ich hätte jetzt die Wahl, Sie gleich mit meinem ersten Satz zu langweilen oder anzulügen. Variante eins klänge so: »Guten Tag, mein Name lautet Markus P.Stiltfang, und ich bin sehr froh, heute bei Ihnen sein zu dürfen.« Na, was denken Sie? Komischer Name, Stiltfang. Hört sich an wie was, wofür der Klempner zuständig ist. Jedenfalls nicht gerade lebendig, kompetent oder kreativ. Oder was immer man mit einem Mann verbindet, der Ratgeber schreibt, um seinen Lebensunterhalt zu verdienen. Würden Sie gern von jemandem belehrt werden, der auf den Namen Stiltfang hört? Geht mir genauso. Ich habe ja bei Dale Carnegie schon so meine Probleme. Klingt doch, als hätte der Mann eine Boxhalle betrieben. Nicht sehr subtil jedenfalls. (Aber bei ihm hat’s ja trotzdem ganz gut funktioniert.)
Sie sehen schon, ich habe mich mit diesem Namens-Dings beschäftigt. Lange, sehr lange. Und meinen Lektor habe ich damit bis an den Rand der geistigen Zerrüttung geführt. Als mir vor zwölf Jahren angeboten wurde, ein Buch zu schreiben, haben wir nicht lange über Inhalte debattiert. Da waren wir uns schnell einig. Ich rotzte zu der Zeit gerade eine wöchentliche Kolumne über Frauen (und wie man mit ihnen klarkommt) in einer Wochenzeitung runter, die sich nach außen progressiv gab, aber nach innen eine harte F…-Wort-Quote vorgab. Drei grenzwertige Ausdrücke oder Bilder pro Kolumne waren erlaubt, wenn nicht sogar erwünscht. Nur »Arschficken« war ausdrücklich verboten. (Es existiert sogar ein Mailverkehr zwischen dem Chefredakteur des Blattes und der greisen Verlegerin, in dem sie aus gegebenem Anlass deutlich zum Ausdruck brachte, dass dieser Begriff in keinem ihrer Blätter jemals wieder auftauchen dürfe. »Analsex« war meines Wissens aber erlaubt.)
Aber ich schweife ab: das Buch. Mein Briefing lautete: »Schreiben Sie was darüber, warum Männer und Frauen nicht zusammenpassen, aber mit einer positiven Wendung, verstehen Sie, eher so konstruktiv.« Das entspricht zwar in etwa dem Auftrag, über Tschernobyl zu schreiben und dabei möglichst die positiven Begleiterscheinungen für die Bevölkerung in der Ukraine nicht aus den Augen zu verlieren. Andererseits passt so eine Ansage doch recht gut zum Beziehungsdschungel da draußen: Mit Logik haben doch auch die meisten »Liebespaare« (und jene, die auf der Suche nach der großen Liebe sind) wenig am Hut. Ich nahm das Angebot an. Der Titel des Buches lautete: ›Männer und Frauen passen (wirklich) nicht zusammen!‹ Untertitel: ›Aber sie haben keine andere Wahl.‹ Nicht sehr originell, das ist klar, aber mein Verlag sucht seine Leser in der Regel nicht unter Universitätsabsolventen. »Schreiben Sie klar und eindeutig!«, lautete der Wunsch meines Lektors. »Und wiederholen Sie die Kernaussage Ihres Textes mindestens drei Mal.« Wie gut, dass das mit dem Titel schon EIN MAL erledigt war. Wie gesagt, über Inhalte wurde nicht lange gestritten. Ich handelte einen hohen Vorschuss aus und akzeptierte im Gegenzug, dass mein Lektor mir 32Kapitelüberschriften in einer Excel-Liste schickte. Mindestens 25Kapitel davon sollte ich bearbeiten, vielen Dank, Abgabe in sechs Monaten.
Es gab da nur noch ein Problem. Es tauchte erst in der allerletzten Mail vor der Vertragsunterzeichnung auf. Eine Petitesse für meinen neuen Verlag. Business halt. Ob ich mir vorstellen könne, unter einem Pseudonym zu schreiben, fragte mein Lektor, ich solle mir mal ein paar Gedanken darüber machen. Hatte ich bis dahin noch nicht. Ich ging davon aus, der Verlag habe mich für den Job ausgewählt, weil ich mit der Wochenendkolumne einigermaßen erfolgreich war und man auf diese Weise gleich ein paar meiner Stammleser einkassieren wollte. Allerdings stand auch über der Kolumne in der Zeitung nicht etwa »Markus P.Stiltfangs Ideen über die wunderbare Welt des Beischlafs«, sondern schlicht: »The Diary of a Date Doctor«, ohne Autorenzeile. Wer es wissen wollte, konnte ja im Impressum nachlesen, wer der Autor der beliebten, oder sagen wir: polarisierenden Kolumne war. Moi. Das reichte mir.
Dass mein erstes Buch allerdings unter einem Pseudonym erscheinen sollte, machte mir zu schaffen. So eitel war ich dann doch. Träumt man nicht als kleiner Zeilenschinder in der heimischen Lokalzeitung davon, später mal seinen Namen auf einem Buchdeckel lesen zu dürfen? Und nun sollte da einfach irgendein gut klingender Mumpitz stehen? Beziehungsweise nicht einmal irgendeiner, sondern auch noch der einer Frau!?
»Frauen sind unsere Kernleserinnen«, klärte mich mein Lektor auf, »und die kaufen nun mal lieber Geschichten, die andere Frauen geschrieben haben. Hat die Marktforschung ergeben, können wir auch nicht ändern.« Auf die Idee, den Job dann vielleicht eher einem Schreiber anzubieten, der nicht gleich einer Geschlechtsumwandlung zustimmen musste, war er wohl nicht gekommen. Oder es gab einfach noch nicht so viele Frauen, die kein Problem damit hatten, einen Schwanz einen Schwanz und eine Muschi eine Muschi zu nennen. (Charlotte Roche war da noch kein Thema.)
Ich überlegte eine Woche, bevor ich ablehnte. Einen kurzen Moment hatte ich mit dem Gedanken geliebäugelt, mich »Winny Twix« zu nennen, in Anlehnung an eine leidlich bekannte amerikanische Ladendiebin, in die ich früher mal verliebt gewesen war, doch das war dann sogar mir zu albern. (Und sie würde vermutlich eh nie davon erfahren.)
Mein Lektor nahm es sportlich. Dann eben kein weibliches Pseudonym. Aber was mit einem Namen wäre, der wie ein Label funktioniert. Sozusagen eine Projektionsfläche für Leserinnen aller Altersklassen. So etwas wie Johannes Engels oder Constantin Schönburg zum Beispiel oder Claus von Castell. Irgendwas jedenfalls aus der Liga »RTL – der Heimatfilm«. Ich überlegte eine Woche. Und sagte wieder ab. Ich war nicht bereit, als Karikatur eines verarmten Landadeligen durch die Buchläden Deutschlands zu tingeln und am Ende noch zu ›Hans Meiser‹ eingeladen zu werden. Zugegeben, es war eine enge Entscheidung. Mein Lektor nahm es nicht mehr sooo sportlich. Ich galt bereits als kapriziös, da hatte ich noch kein Wort geschrieben. Er werde sich mal mit dem Layout zusammensetzen, dann werde ich sein Problem schon erkennen. Ein paar Tage später schickte er mir einen Covervorschlag mit dem Titel des Buches und meinem Autorennamen. Das Cover war unterlegt von der Illustration eines tanzenden Paares, das sich zärtlich im Arm hält, aber gleichzeitig auf die Füße tritt. Da hatte sich ein Art Director Gedanken gemacht. Aber die Illustration war nicht das Problem: Der Grauwert war es, die Buchstabenmenge. Und der eher uncharmante Klang meines Namens.
Männer und Frauen passen (wirklich) nicht zusammen!
Aber sie haben keine andere Wahl
Von Markus P.Stiltfang
So hätte das also ausgesehen. Und es war nicht von der Hand zu weisen: Ein Buch von einem gewissen Markus P.Stiltfang wirkte, als habe ein bebrillter Ökotrophologe über den Nährwert von Liebesperlen geschrieben. Ich rief meinen Lektor an, warf mich vor ihm in den Dreck und verabredete ein Brainstorming. Das heißt, wir betranken uns bei einem Griechen in der Vorstadt mit einem süßlich-klebrigen Gesöff namens Samos. Das ergab einen entsetzlichen Kater und meinen neuen Namen als Autor: Marcus Perry. (Süßlich und klebrig? Aber sicher!)
Diesen Namen haben Sie vermutlich schon einmal gehört. Oder Sie haben sogar ein Buch von mir gelesen. Als »Marcus Perry« bin ich schließlich eine große Nummer auf dem deutschsprachigen Sachbuchmarkt. Aus Markus wurde Marcus – weil das weicher und internationaler klingen würde, behauptete mein Lektor. Und Perry war der Spitzname meines Großvaters Peter, von dem mein zweiter Vorname stammt.
»Da hätten wir auch einen persönlichen Bezug!«, argumentierte wiederum mein Lektor. »Das fühlt sich doch gut an!« Über Stiltfang sprachen wir nie wieder.
Mein erstes Buch wurde ein kleiner Erfolg, mein zweites Buch mit identischen Inhalten, aber unter einem anderen Titel, lief sogar noch besser. Der Titel lautete: ›Gegensätze stoßen sich ab!‹ Untertitel: ›Wie Paare in Beziehungen aufeinander zuwachsen.‹ Ich finde ja, das ist ein selten dämlicher Titel und muss dabei immer an betrüblich dreinschauende siamesische Zwillinge denken. Aber Zahlen lügen nicht, wie mein Lektor sagt. Was nicht für mich gilt, muss ich zugeben. Mein drittes Buch hat den Titel: ›Der Frauenflüsterer‹. (Wie gut, dass ich mich vehement gegen ein weibliches Pseudonym gewehrt habe.) Im ›Frauenflüsterer‹ wird behauptet, es gäbe da ein paar hundertprozentige Tipps, wie man jede Frau betört (um sie ins Bett zu bekommen). Und darin wird weiterhin angedeutet, dass ICH derjenige sei, der all diese Tricks auf Lager hat. Schön wär’s.
Man könnte nun zur Tagesordnung übergehen und diesen Quatsch vergessen, schließlich darf man nicht jedes Wort, das geschrieben wird, auf die Goldwaage legen. In diesem Fall aber ist das nicht so einfach: ›Der Frauenflüsterer‹ von Marcus Perry schoss aus dem Stand an die Spitze aller Bestsellerlisten und atmete ein ganzes Jahr lang Höhenluft. Das Buch verkaufte sich rund 250000Mal, ich wurde zu Lesungen und Vorträgen eingeladen und bei ›Beckmann‹ interviewt. Ich wurde reich, weil da draußen eine Menge Männer wissen wollten, wie sie sicher bei den Frauen zum Zuge kommen würden. Und Frauen kauften das Buch aus vorauseilender Empörung darüber, wie ein Marcus Perry es wagen konnte, sie alle über einen Kamm zu scheren und ihnen jeglichen gesunden Menschenverstand abzusprechen. Selbst im seriösen Feuilleton beschäftigte man sich mit meinen hanebüchenen Frauenflüsterer-Ratschlägen: Man schnüffelte und stocherte mit spitzen Fingern darin herum und legte ein paar Sätze unter das literarische Mikroskop, bevor man zum Ergebnis kam: ein stinkender Misthaufen. Überraschung! Nach jeder dieser deprimierenden Rezensionen zogen die Verkäufe wieder an. Der Höhepunkt dieser unfreiwilligen Verkaufskampagne war ein Interview mit Marcus Perry im Frühstücksfernsehen eines Privatsenders, in dem der Autor sich von einer hasserfüllten, moppeligen Blondine fragen lassen musste: »Und Sie wollen also jede Frau rumkriegen? Versuchen Sie es doch mal bei mir!« Dabei blickte die Dame so gefährlich, als hätte sie seit Tagen nichts gegessen. An diesem Morgen stotterte Marcus Perry vor der Kamera um sein nacktes Leben. (Und in den Tagen danach bestellten alle relevanten Buchhändler ganze Stapel des ›Frauenflüsterers‹ nach.)
Ich spreche übrigens nicht zufällig von »Marcus Perry« und nicht etwa von mir, wenn es um den ›Frauenflüsterer‹ oder eines der anderen Bücher geht, denen ich meinen Wohlstand verdanke. Inzwischen schätze ich den Umstand, mich hinter einem Pseudonym verbergen zu können, nämlich sehr. Zum einen, weil an meiner Haustür kein sprechbehinderter Kneipenschläger klingelt, der sich beschweren will, dass meine wasserdichten Flirt Lines ihm nur Ärger und Spott eingebracht haben. Zum anderen, weil ich mich in Talkshows und Interviews immer wunderbar darauf berufen kann, dass Marcus Perry ja nur eine Kunstfigur ist, eine Art spielerischer Entwurf einer schillernden Persönlichkeit mit einem Riesenego. Subtext: Im Grunde sei ich ein schreibender Schauspieler, der mit der Hilfe einer Kunstfigur Meinungen anprobiert wie der Leitartikel in der ›Zeit‹. Bei den Kulturmenschen im Fernsehen komme ich damit durch – die kennen das. Und meine Leser vor der Glotze gehen offenbar gedanklich nicht den ganzen Weg mit. Meiner Auflage hat das indirekte Eingeständnis, dass ich im Grunde nicht mal selbst an all die Weisheiten glaube, die ich da auf 300Seiten mit feiner Klinge unters Volk bringe, jedenfalls noch keine Einbrüche beschert. Die Einladungen zu Seminaren, Lesungen und Gastbeiträgen reißen nicht ab. Sie sind adressiert an »Marcus Perry«, aber sie landen – über das Büro meines Agenten – alle bei Markus P.Stiltfang in der Mailbox.
Ich habe ein schönes Leben. Manchmal träume ich, ich würde am Samstagvormittag nackt durch eine Fußgängerzone spazieren und so tun, als sei das ganz normal, obwohl ich mich entsetzlich dafür schäme. (Zählen Sie eins und eins zusammen…) Aber meistens schlafe ich ganz prima. So hätte das auch bleiben können. Alle drei Jahre ein neues Buch, ein paar alberne Interviews, einige gemeine Rezensionen und anschließend Ruhe, neue Länder und viel Sonne. Aber wie es so ist, wenn man in diesem Land erfolgreich ist – Neider tauchen auf, Stinkstiefel, die einem an den Karren fahren wollen. Nur so, aus Bosheit. Oder um Quote und Auflage zu machen. Normalerweise ficht mich das nicht an, Sie wissen ja: Never complain. Never explain. Oder auch: Bad news are good news! Solange es der Auflage nutzt, können meine Bücher mit so ziemlich jeder Kritik leben. Ich werde sicher nicht widersprechen.
Das heißt, bislang WAR das so. Ich erzähle Ihnen das alles ja nicht ohne Grund. Seit dem Tag, an dem meine Exfrau Svenja ins Fernsehen eingeladen wurde, ist mein Leben aus dem Ruder gelaufen. Dabei reden wir hier über einen Regionalsender, drittes Programm, über lockeres Geplauder bei trockenem Burgunder und Selters vor der Kamera. Thema des Abends: »Wunsch & Wirklichkeit«. Schlau verkauft, oder? Unter dem feuilletonistischen Deckmäntelchen wollte man mal wieder hinter die Kulissen der Medienwelt schauen, das verkauft sich ja immer. Mal sehen, was zum Beispiel hinter der glanzpolierten Fassade des erfolgreichen Bestsellerautors Marcus Perry wirklich los ist. Als ob das irgendwen interessieren sollte.
Meine Exfrau Svenja und ich haben noch leidlich Kontakt, keine Kinder, keine finanziellen Auseinandersetzungen, null Rosenkrieg. Zum Geburtstag rufen wir uns an, nicht mal die gemeinsamen Fotoalben sind rituell verbrannt worden. Lauwarme Zivilisation, der Kollateralschaden serieller Monogamie. Sie hat mich sogar gefragt, ob sie die Einladung des Senders annehmen solle. »Fünf Minuten schwelgen über alte Zeiten, das kriegst du hin!«, habe ich ihr jovial geantwortet, nicht im Mindesten beunruhigt. Und gönnte ihr das geschenkte Wochenende in Berlin, Luxushotel und Flug inklusive. Ich weiß nicht, was in sie gefahren ist, als sie dann zur besten Sendezeit vor der Kamera unsere Ehe durch den Kakao zog. (Die im Übrigen schon bald sechzehn Jahre zurückliegt.) Ein Glas Sekt zu viel gegen das Lampenfieber, ein paar einschmeichelnde Lächler des Talkmasters, ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass meine Exfrau über mich, den Autor des Ratgeber-Bestsellers ›Der Frauenflüsterer‹ sagte: »Mein Exmann hatte zwar schon immer einen übersteigerten sexuellen Appetit. (Haha!) Aber in der ›Ausführung‹ war er doch eher durchschnittlich. Im Grunde war der Herr Stiltfang in meinem Schlafzimmer weniger der Frauenflüsterer als vielmehr der mieseste Liebhaber der Welt!«
Das war wohl witzig gemeint, eine Pointe, das Studiopublikum klatschte amüsiert und Svenja lächelte auch ganz charmant dazu. Sie war sogar so frei, noch zu erwähnen, dass unser Sex gerade in der Hochzeitsnacht besonders mies gewesen sei, was stimmte. Aber allein meine Schuld war das nicht gewesen! Für die Aasverwerter aus der Glamour- und Revolverpresse war es trotzdem ein gefundenes Fressen. Die Häme schwappte in druckschwarzen Kübeln über mich herein, selbst Bohlen hätte mit einem erneuten Penisbruch Probleme bekommen, mich von der ersten Seite des Boulevards wegzuschubsen. Im Fernsehen wurde der Interviewschnipsel meiner Exfrau rauf und runter gezeigt, bei ›TV Total‹ erhielt ich von Raab einen eigenen Button, auf den der TV-Metzger eine Woche ausdauernd drückte und sich jedes Mal wieder über »den miesesten Liebhaber der Welt« amüsierte. Ganz Deutschland mailte, bloggte und twitterte sich einen iPhone-Ellbogen (der legitime Nachfolger des Tennisarms), meine Agentur musste zeitweise ihren überlasteten Server runterfahren. Haben Sie eine Ahnung, wie es sich anfühlt, wenn Sie in der ›Bild‹-Zeitung ein großformatiges Foto von sich sehen, das von der Überschrift »Ist der Frauenflüsterer in Wahrheit der mieseste Liebhaber der Welt?« begleitet wird? Wenn Sie zur Zielscheibe des kollektiven Spotts werden und Ihnen gleichzeitig Ihre professionelle Geschäftsgrundlage entzogen wird? Das Unangenehme und geradezu Bösartige an der Bemerkung meiner Exfrau (die ich wohl erst mal zum Geburtstag nicht mehr anrufen werde) ist doch, dass sie mich als den kleinen Herrn Stiltfang bloßstellte, der als Marcus Perry unter Vorspiegelung falscher Talente bei den Großen mitspielen wollte. Sie verwischte die Ebenen und riss »Marcus Perry« vor einer Fernsehkamera die Maske vom Gesicht. Live. Eine mediale Hinrichtung erster Klasse. Und diesmal war sogar mein Verlag not amused.
Es dauerte Monate, bis die Story in den Medien als ausgelutscht galt. Die Verkäufe meiner Bücher gingen zurück, die Anfragen wurden weniger. Der Frauenflüsterer war durch, in jeder Hinsicht. Und mit Ideen für neue Bücher wurde es auch schwierig. Meine Glaubwürdigkeit als Ratgeber war erst mal dahin. Mein Bekanntsheitsgrad allerdings stieg deutlich. Ständig wurde ich als Gast in Fernsehshows geladen, ›Genial daneben‹ oder ›Das perfekte Promi-Dinner‹, egal was – wenn man aus der Promi-B- oder -C-Liga noch eine dankbare Nase brauchte, wurde ich angefragt, das heißt: Marcus Perry. Das ist eine Zeitlang ja ganz lustig, aber wenn man den Zirkus ein Jahr mitmacht, wird es zur Tortur. Immer nur gesellige Abende mit Dirk Bach, Oli P. oder Michaela Schaffrath können einem ganz schön das Hirn verbrennen.
Verstehen Sie mich nicht falsch: Ich müsste im Grunde nicht mehr arbeiten gehen. Jedenfalls solange ich mir nicht in jedem Jahr einen neuen Ferrari zum Hummer (dem Auto, nicht dem Krebs) leisten würde. Doch sollte ich mich etwa jetzt schon zur Ruhe setzen, ein Häuschen auf Mallorca kaufen und Golf spielen?
Schließlich hatte mein Lektor dann die zündende Idee für ein neues Buch, das auch mit mir zu machen war. Oder besser: nur mit mir! Ich bin noch nicht sicher, ob sie genial war oder einfach nur daneben. Das wird sich zeigen, und zwar schon ziemlich bald. Wie wäre es, sprach er, wenn du deinem Publikum da draußen zeigst, dass du über ein breites Kreuz, Persönlichkeit und eine sympathische selbstironische Ader verfügst. Und ein Buch schreibst, das dein aktuelles Programm ganz groß auf dem Cover verkündet: ›Ich war der mieseste Liebhaber der Welt‹. Untertitel: ›Eine Beichte‹. Das sei doch wohl eine Meisterleistung in angewandter Dialektik. Möglicherweise hielt ich das im ersten Moment für einen Witz, doch mein Lektor war nicht zu bremsen:
»Ich sehe schon die Werbetexte vor mir: ›In seinem Buch erzählt der Frauenflüsterer die Geschichte seiner sexuellen Sozialisation – und warum die Frauen ihn als den miesesten Liebhaber der Welt einstuften.‹ Das verkauft, Marcus, das geht durch die Decke!«
Ich bin übrigens nicht sicher, dass ich wirklich so schlecht im Bett bin. Da hat Svenja einfach ein wenig übertrieben und mich für einen guten Gag verraten und verkauft. Ich bin vermutlich eher so normal. Möglicherweise sogar mit ein paar Erfahrungen mehr, als sie Willi Mustermann in seinem Männerleben gemacht hat. Die können Sie übrigens jetzt alle in meinem Buch nachlesen, von Anfang an. Ich musste ganz schön recherchieren, um das alles wieder auf die Reihe zu bekommen. Mein Lektor hat mir diesmal keine Kapitelüberschriften geliefert. Dafür aber wieder einen ganz ordentlichen Vorschuss.
»Ist Schmerzensgeld, falls dein Ruf hinterher total ruiniert und das unser letztes gemeinsames Projekt ist«, hat er geflachst. (Vermutlich aber genau so gemeint.) Der Verlag aber glaubt an den Titel. Wenn ich da also gleich mit einem Exemplar meines aktuellen Buches in der Hand zu Kerner rausgehe, um es im richtigen Moment in die Kamera zu halten, werde ich den Showmaster und sein Publikum vor der Kamera so augenzwinkernd wie möglich begrüßen: »Guten Abend, mein Name ist Marcus Perry, und ich bin der mieseste Liebhaber der Welt!« Ich nehme mal an, dass das immerhin kein langweiliger Einstieg ist. Aber ich hoffe dabei aus ganzem Herzen, dass dieser Satz eine gottverdammte Lüge sein wird, so wie auch der ›Frauenflüsterer‹ eine Lüge war. Aber sicher bin ich mir da schon lange nicht mehr.
I.Kapitel
1974, Angelique (Cordula)
Tags Adoleszenz, Schauspielerin, Scheidungskind, Sonnenöl, Swimmingpool
Soundtrack Teenage Rampage/ The Sweet
Film Frankenstein Junior/ Mel Brooks
Sheeni rollte sich auf den Rücken; das gelbe Bikini-Oberteil bedeckte ihre jungen Brüste. »Ich hoffe, du findest das nicht zu stimulierend, Nick.« »Ich werde schon damit fertig«, sagte ich.
C.D.Payne, ›Crazy Days – Die Tagebücher des Nick Twisp I.‹
Während ich Angelique dabei zusah, wie sie aufreizend langsam ihren braungebrannten Körper mit Kokossonnenöl eincremte, wusste ich, dass ich in beiden Fällen geliefert sein würde.
Ich war vierzehn Jahre alt und Angelique war so ziemlich das dümmste Mädchen, das ich bis dahin kennengelernt hatte. Allerdings auch das attraktivste. Sie war neunzehn und hatte nach der Volksschule als Verkäuferin in einer Parfümerie gearbeitet. Das sei aber nicht ihre Welt, ließ sie uns wissen. Nun wollte Angelique lieber Schauspielerin werden. Sie färbte sich ihr langes braunes Haar hellblond, ließ sich wallende Locken drehen und wartete auf den Tag, an dem es in Hollywood losgehen würde. Ich hätte an ihrer Stelle auf eine Karriere als Model gehofft – oder auf eine Renaissance des Stummfilms. Seit Kurzem besuchte sie Kurse bei einer renommierten privaten – und ziemlich teuren – Schauspielschule.
Wir lagen seit zwei Stunden gemeinsam am Pool des Bungalows, in dem ich aufgewachsen war. Ich spielte hin und wieder mit der Polaroidkamera herum, die mein Vater mir geschenkt hatte, und Angelique las in einer ›Frau im Spiegel‹. Meinem Vater gehörte ein großes Möbelhaus in unserer Stadt, die »Möbelwelt Stiltfang & Strube«. Ein Familienunternehmen in der dritten Generation. Die Strubes hatten das 1000-jährige Reich nicht überlebt. Mit Möbeln waren in den sechziger und siebziger Jahren gute Geschäfte zu machen, als die Nachkriegsgeneration nach der Fresswelle auch das Prinzip »Schöner Wohnen« entdeckte und Ikea noch nichts weiter als eine schwedische Spanplattenklitsche war. Wir konnten uns einen Pool im Garten leisten und noch so einige andere Dinge, die in einer Kleinstadt wie der unseren eher exotisch anmuteten. Einen roten Mercedes Pagode zum Beispiel, in dem mein Vater auch bei schlechtem Wetter mit geöffnetem Verdeck zur Arbeit fuhr. Den Pool hatte ich immer geliebt. Viele heiße Sommernachmittage lungerte ich hier mit meinen Freunden auf unseren blauen Schaumstoffliegen herum, immer den Chlorgeruch und diesen unverwechselbaren Dunst des Piz-Buin-Sonnenöls in der Nase. Vor uns stand meistens eine große Karaffe mit Selters und einer Tri-Top-Kirschmischung auf dem schweren rostroten Steintisch, dazu ein paar dreieckige, orange Sunkist mit Strohhalmen. Für unsere kulturellen Anregungen sorgten zerlesene Fix-&-Foxi- oder Kater-Felix-Comics. Hin und wieder plantschten wir ein wenig im Pool und spielten mit unserem Münsteraner Vico, der es liebte, von uns ins Wasser geworfen und dann »gerettet« zu werden.
Angelique taucht in diesen lebendigen Erinnerungen an sorglos dahinplätschernde Sommertage nicht auf. Damals kannten wir noch keine Angelique, niemand aus unserer Familie. Vermutlich nannte sie sich zu der Zeit noch Cordula, was Sinn machen würde, denn das ist ihr richtiger Name. Cordula Bartke, um präzise zu sein. Es dauerte etwas, bis ich erfuhr, dass Angelique in Wahrheit eine Cordula war. Da hielt ich sie allerdings schon für so beschränkt, dass ihr »Künstlername« auch keine Rolle mehr spielte.
Ich erinnere mich nur an diesen einen Tag mit ihr zusammen am Pool. Es war gleichzeitig der letzte, den ich dort unbeschwert verbringen sollte. Beinahe zwei volle Stunden hatte Angelique nun schon darauf verwandt, sich voller Hingabe ihrem Körper zu widmen. Es war ein Grundkurs in Zen: Erst schnitt sie konzentriert ihre Fußnägel und rieb mit einem dicken Bimsstein die Hornhaut unter ihren Füßen ab, wusch und cremte sie minutenlang ein. Das hier schien ein gewohntes Ritual zu sein, fasziniert sah ich ihr aus den Augenwinkeln dabei zu, wie sie in ihrem knappen kanarienvogelgelben Bikini routiniert an sich arbeitete wie an der Fassade eines Tempels. Unter dem strahlend blauen Himmel wirkte Angelique auf ihrem Liegestuhl wie eine zum Leben erweckte Postkarte. Nachdem auch noch Fuß- und Fingernägel in Seelenruhe lackiert worden waren (in einem merkwürdigen Rotton mit dem Namen »Framboise«), begann sie, sich von Kopf bis Fuß mit ihrem transparenten Kokossonnenöl einzureiben. Ich nehme an, das Zeug sollte bloß den broilerbraunen Teint unterstreichen, den Angelique sich bereits durch geduldiges Sonnenbaden angeeignet hatte.
Mir wurde langsam heiß. Angelique cremte sich von den Füßen bis zu den Oberarmen in einem Tempo ein, als habe sie erst wieder in einigen Monaten den nächsten Termin. Mit konzentrierter Miene schabte, strich und salbte sie selbstvergessen an sich herum. Ein faszinierendes Schauspiel. Ich konnte nicht wegsehen. Mehr noch, inzwischen starrte ich sie ohne jede Zurückhaltung an (vorsichtshalber hatte ich mich auf den Bauch gelegt, nur um sicherzugehen). Ich war knapp davor, meine Polaroid zu zücken und ein Erinnerungsfoto zu schießen. Sie musste meine Irritation bemerkt haben.
Ich wusste, es gab jetzt nur zwei Möglichkeiten. Ich hatte Angst vor beiden. Entweder sie fragte, warum ich denn so schmierig glotze, und dann würde ich rot werden und mich wegdrehen, ohne aufstehen zu können. (Ich möchte noch mal dran erinnern: Ich war vierzehn Jahre alt!) Oder sie fragte mich, ob ich ihr den Rücken einreiben könnte. Dann würde ich aufstehen müssen und mich der größten Herausforderung meiner noch recht frischen Pubertät stellen. Möglicherweise fragen Sie sich ja, wo das verdammte Problem ist. Wenn sich eine neunzehnjährige Schönheit mit einem perfekten Körper vor einem räkelt und eine Einladung ausspricht, sich etwas intensiver damit zu beschäftigen, werden doch normalerweise Jungsträume wahr. In meinem Fall war die Sache komplizierter. Als Angelique sich für Möglichkeit B entschied und mich fragte, nachdem der Rest ihres Körpers bereits feuchtgolden glitzerte: »Markus, kannst du mir bitte den Rücken eincremen?«, schaute ich ein letztes Mal Hilfe suchend zur Eingangstür. Wo zum Teufel blieb mein Vater? Das hier war schließlich seine Freundin.
Mit meinem Vater hatte Angelique das große Los gezogen. Für meine Mutter war Angelique dagegen eine Menge anderer Sachen mit -los hintendran, nämlich verantwortungs-, hirn- und hemmungslos. Eine Scheidung war Anfang der siebziger Jahre noch recht ungewöhnlich, zumal in einer Kleinstadt wie unserer. So wie ich das sah, kam ich allerdings ganz gut damit klar. Meine Eltern trafen sich hin und wieder, um organisatorische Dinge zu besprechen. (Hauptsächlich, wie man mich irgendwie bis zum Abitur durchschleppen könnte.) Ich wohnte mit meiner älteren Schwester bei meiner Mutter in einer großen Altbauwohnung in der Innenstadt. Mein Vater zahlte jetzt also für zwei Häuser und drei Kinder, wobei Angelique mit Abstand der teuerste Posten in seinen monatlichen Abrechnungen war. Manchmal fuhr sie mit seiner Pagode stundenlang durch die Stadt spazieren (vermutlich so eine Art Vorgriff auf die Zeit, in der sie auf einem roten Teppich Fotografen zuwinken würde). Meistens aber hing Angelique nur in unserem Bungalow herum, nachdem sie ihren Job aufgegeben hatte, und vertrieb sich die Zeit. Mit Frauenmagazinen hauptsächlich, vor der Höhensonne und mit einer Menge Cremetiegel. Ich besuchte meinen Vater gelegentlich am Wochenende. Da meine Schwester es vorgezogen hatte, den Kontakt zu ihrem »Erzeuger« bis auf Weiteres abzubrechen, war ich der letzte Anker seiner »Familie«. Meistens verschwand Angelique dann »in die Stadt« und bestückte ihren Kleiderschrank (der früher einmal das Zimmer meiner Schwester gewesen war). Sie schien meinen regelmäßigen Heimaturlaub nicht sonderlich zu schätzen, war aber bislang nie offen feindselig gewesen. Ich hielt es für Indifferenz. Aber ich muss sie unterschätzt haben.
An diesem besagten Tag am Pool verabschiedete sich mein Vater schon früh nach einem gemeinsamen Frühstück auf der Terrasse. Das Geschäft. An Samstagen brummte so ein Möbelladen. Er schlug mir vor, zu bleiben und den herrlichen Sommertag am Pool zu genießen. Ich willigte ein. Als Angelique früher als sonst von ihrer Einkaufstour zurückkehrte, verpasste ich die Chance, mich sofort aus dem Staub zu machen. Sie gesellte sich zu mir an den Pool und beim albernen Versuch, sich unter einem Handtuch in ihr Bikinioberteil zu winden, fielen Handtuch UND Bikini zu Boden, etwa zwei Meter von mir entfernt. Sie beeilte sich nicht gerade dabei, ihre Brüste wieder zu bedecken. Damit war mir der Rückweg abgeschnitten. (Ich frage mich seit ein paar Jahren, warum Mutter Natur vierzehnjährige Knaben mit zähen Erektionen quält, während wir über Vierzigjährigen neben den schönsten Frauen liegen und uns dabei über die Nebenwirkungen von Viagra Gedanken machen müssen. Das macht doch keinen Sinn!?)
»Wirst du mir nun den Rücken einreiben oder nicht?«
Angelique kann schnell ungeduldig werden.
»Ich komm ja schon.«
Gespielt missmutig wand ich mich so unauffällig wie möglich von meiner Liege. Doch Angelique wusste offenbar genau, was sie da tat. Statt sich vor mir auf den Bauch zu legen, stand sie auf und drehte sich mit dem Rücken zu mir. Dabei glitt ihr Blick spöttisch bis hinunter zu meiner knappen blauen Trigema-Badehose.
»Hübscher Schlüpfer!«, kommentierte sie. »Bist du aber langsam rausgewachsen, oder?«
»Geht noch«, antwortete ich knapp und spürte, wie mir das Blut ins Gesicht schoss. (Immerhin machte sich wenigstens ein kleiner Teil zurück auf den Heimweg.)
Ich begann, das Kokossonnenöl auf ihren Schultern zu verteilen.
»Fester, Markus, kannst du das bitte richtig einmassieren.«
Dabei drehte sie sich so abrupt zu mir herum, dass ich fast über ihre Brust gestrichen hätte.
»Holla, das war knapp«, grinste die Blondine, die gleichzeitig meine Stiefmutter in spe war, und knüpfte sich den Bikini auf dem Rücken auf.
»Kannst du mal kurz helfen?«
Ich zwirbelte mit steifen Fingern an den Knoten der Strippen herum, mit denen das Bikinioberteil zusammengehalten wurde. Als das nicht sofort funktionierte (mit meinem motorischen Feingefühl hätte ich in dieser Situation nicht mal einen Backstein aufheben können), stülpte sie sich das Oberteil kurzerhand über den Kopf.
»Aber nicht spinxen, Markus!«, informierte sie mich kokett und drehte sich dabei schon wieder zu mir um. (In diesen Minuten lernte ich eine Menge über den Begriff »mixed messages«, ohne ihn überhaupt zu kennen).
Ich hätte schon die Augen schließen müssen, um ihre Brüste zu übersehen. Ich schluckte. Meine Mundhöhle war eine Kolonie der Sahelzone. Ich rieb ihr mit dem Öl mechanisch den nackten Rücken ein und drehte dabei fast durch.
»Sei nicht so sparsam mit dem Öl, Markus, meine Haut braucht die Feuchtigkeit!«
Ich begann noch einmal von vorn und strich langsam an ihrem glatten, braungebrannten Rücken hinunter bis zum Ansatz ihrer festen kleinen Hinterbacken. (Ich sehe sie manchmal heute noch vor mir.)
»Da komm ich selber hin, danke!«, ließ sie mich wissen und bedachte mich mit einem Blick, der zu gleichen Teilen Belustigung und Aufforderung spiegelte. DAS hier war reinste Folter.
»Sag mal, Markus, hast du eigentlich auch schon eine Freundin?«
Was sollte das denn jetzt?
»Nein, im Moment nicht.«
Angelique lachte auf.
»So, im Moment nicht…«
Das stimmte. Mein Interesse für Mädchen war eher sprunghaft und noch nicht von allzu gezielten Annäherungsversuchen geprägt. Ich begann gerade erst, mich ein wenig konkreter für sie zu interessieren. Klar, ich war scharf auf Brigitte Bardot und Uschi Obermaier (jedenfalls auf die Nacktbilder der beiden in der ›Neuen Revue‹ oder der ›Praline‹). Aber meine Kontakte zu Mädchen in der richtigen Welt konnte man an einer Hand abzählen. Auf einer Klassenfete in der 7A hatte ich beim Flaschendrehen mitgemacht und ein paar Mädchen geküsst. Das hatte mir zwar ein Gefühl dafür vermittelt, was für ein Aroma Leberwurstbrötchen und Zwiebelfrikadellen in einer Mundhöhle hinterlassen. In erotischer Hinsicht hatten diese flüchtigen Berührungen aber kein großes Verlangen ausgelöst. Die knapp bekleideten Mädchen in der ›Bravo‹ fand ich durch die Bank anziehender als die knapp bekleideten Mädchen in unserem Freibad. (Angelique an unserem Pool spielte da in einer ganz anderen Liga. Sie hätte auch mit dem Raumschiff Enterprise anreisen können, so wenig passte sie zu den normalen Bildern in meinem kleinen Leben.) Ich hatte den Eindruck, dass Mädchen meine subtilen Botschaften einfach nicht verstanden. Manchmal sehnte ich mich danach, eines von ihnen näher kennenzulernen und mit ihm befreundet zu sein. Aber ich wusste nicht so genau, wie ich das anstellen sollte. Und diese Sehnsucht kannte auch noch keinen geeigneten Adressaten. Es war ein unbestimmtes Verlangen nach irgendeinem Mädchen. Wenn ich tagträumte, stellte ich mir vor, wie ich an einem windigen Herbsttag auf einer Parkbank unter zwei großen Bäumen mit goldroten Blättern saß und einsam in einem Buch las, und wie dann plötzlich, wie aus dem Nichts, ein wunderschönes Mädchen auftauchen würde und mich in ein Gespräch verwickelte. (Allein der Teil mit dem Gespräch war schon unwahrscheinlich genug, denn wenn ich eine Sache gut konnte, dann waren das wenige und kurze Sätze…) Hin und wieder lungerte ich tatsächlich auf einsamen Parkbänken herum, aber bevor sich ein wunderschönes Mädchen zu mir setzen konnte, wurde mir entweder langweilig oder kalt.
Ein einziges Mal war ich selbst in die Offensive gegangen. Das war in der vierten Klasse, als ich mit meinem Freund Fredi einen Plan ausheckte, um mich bei Marion Wollweber einzuschleimen. Fredi sollte Marion den Schultornister abnehmen und damit weglaufen. Mein Job bestand darin, von Fredi den Ranzen zurückzuerobern und wieder an die hübsche Marion auszuliefern. Markus, der Retter! Leider funktionierte nur der erste Teil unseres ausgefuchsten Plans. Marion lief heulend nach Hause, nachdem Fredi ihr den Tornister abgenommen hatte, und ich trottete ihr dann mit dem guten Stück hinterher. Statt von Marion wurde ich auf halbem Weg von ihrer Mutter empfangen, und zwar nicht mit einem strahlenden Lächeln, sondern einer Ohrfeige und ziemlichem Gebrüll. So viel zu meiner Flirt-Premiere. (Dass ich mal der »Date Doctor« werden würde, dürfte Marion Wollweber damals nicht geahnt haben, vom »Frauenflüsterer« mal ganz abgesehen.)
»Warst du überhaupt schon mal mit einem Mädchen zusammen?«
Angelique wollte dieses Thema wohl nicht so schnell aufgeben. Ich schüttelte den Kopf und begann, das Sonnenöl noch ein wenig fester auf ihrem Rücken zu verreiben. Angeliques Haut schien das Zeug zu schlürfen.
»Du bist doch ein gut aussehender Junge, ich versteh das gar nicht.«
»Kein Interesse«, sagte ich abfällig.
Dass ich gut aussehend sei, hörte ich gern, wenn auch zum ersten Mal. Ich schätze, dass meine fast weißblonden Locken ein paar Punkte machten. Meine Mutter behauptete, ich hätte ein nettes, offenes Lachen. Das war’s aber auch schon. Meine Nase war ein bisschen krumm, so als sei ich schon in der Vorschule vom Dreirad gefallen. Außerdem war ich für mein Alter viel zu schnell gewachsen. Wenn ich lief, wirkte das, als würde ein klappriges Holzgerüst für die Bundesjugendspiele trainieren.
»Kein Interesse? Das glaube ich dir nicht.«
Angelique lächelte mich verschwörerisch an.
»Jungs in deinem Alter haben doch IMMER Interesse an Mädchen.«
Dabei drehte sie sich frontal zu mir um, so als ob sie sichergehen müsse, dass ihr grandioses Argument auch bei mir angekommen war.
Ich stoppte in der Bewegung, hielt meine rechte Hand aber weiter massierbereit in Brusthöhe.
»Nö, danke, die habe ich schon eingeschmiert…«, kommentierte das Angelique und lächelte wieder auf diese kühle und gleichzeitig aufreizende Weise, dabei packte sie wie selbstvergessen ihre beiden Brüste und verrieb noch einmal ein paar imaginäre Cremereste darauf. (Heute bezahlt man in Läden wie dem »Dollhouse« für so etwas viel Geld und nennt es »Exotic Dance«.)
Das war’s. Länger ertrug ich das hier nicht mehr. Es gab zwei Möglichkeiten: Ich griff der Freundin meines Vaters an die Brüste, würde umgehend in meine Hose ejakulieren und müsste anschließend das Land verlassen. Das war ein ziemlich hoher Preis, das realisierte ich sogar mit einem Riesenständer in der Badehose.
»Ich muss kurz rein, duschen!«, rief ich Angelique (und mir!) zu und machte schnell, dass ich Land gewann. Neben den Eingang zum Garten hatte mein Vater schon vor Jahren eine kleine Sauna und einen Ruheraum mit einer offenen Dusche hingebaut. Von außen war der Raum nur einzusehen, wenn man die große Holzflügeltür öffnete und nach außen aufklappte. Worauf ich aber damals aus nahe liegenden Gründen verzichtete. Ich stellte schnell die Brause an und lenkte den harten, halbwarmen Strahl auf meinen Unterleib. Als ich die Schritte vor der Tür hörte, stützte ich mich bereits mit dem Rücken an der Wand ab. Es war perfektes Timing. Angelique erreichte die Tür, sah, wie ich eingeknickt unter der Dusche stand, und lächelte fein. Es war Triumph in diesem