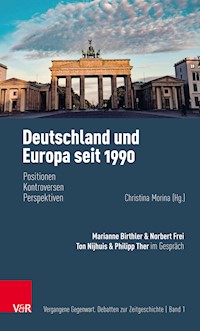
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Vandenhoeck & Ruprecht
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Vergangene Gegenwart
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2021
Die Einheit brachte Vielfalt – Freiheit, aber auch Unsicherheit. 30 Jahre nach dem Mauerfall und der Vereinigung Deutschlands ist es an der Zeit, die vielfältigen Umbrüche und Entwicklungen neu zu vermessen. Sie prägen – und belasten – die politische und gesellschaftliche Gegenwart und stellen gerade auch die zeithistorische Forschung vor enorme Herausforderungen. Wie hat sich Deutschland seit 1990 verändert? Welche Bilanz lässt sich hinsichtlich der politischen, sozialen und kulturellen Folgen der Vereinigung ziehen? Und wie sind diese mit der Entwicklung in Europa und der Welt verbunden? Darüber debattieren Marianne Birthler, Norbert Frei, Philipp Ther und Ton Nijhuis, eingeleitet und kommentiert von Christina Morina und Konrad H. Jarausch. Der Band bildet den Auftakt zur Reihe "Vergangene Gegenwart", die zentrale Themen und Kontroversen der Zeitgeschichte aufgreift, vielstimmig diskutiert und um neue Perspektiven erweitert.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 212
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Vergangene Gegenwart. Debatten zur Zeitgeschichte |
Deutschland undEuropa seit 1990
Positionen, Kontroversen, Perspektiven
Marianne Birthler & Norbert Frei Ton Nijhuis & Philipp Ther im Gespräch
Herausgegeben von Christina Morina
Vandenhoeck & Ruprecht
Die Veröffentlichung dieses Bandes wurde durchdie Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur gefördert.
Die Aufzeichnungen der diesem Buch zugrunde liegenden Gespräche sind im Internet aufzurufen unter
https://vimeo.com/609582728
https://vimeo.com/609583372
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über https://dnb.de abrufbar.
© 2022 Vandenhoeck & Ruprecht, Theaterstraße 13, D-37073 Göttingen, ein Imprint der Brill-Gruppe (Koninklijke Brill NV, Leiden, Niederlande; Brill USA Inc., Boston MA, USA; Brill Asia Pte Ltd, Singapore; Brill Deutschland GmbH, Paderborn, Deutschland; Brill Österreich GmbH, Wien, Österreich) Koninklijke Brill NV umfasst die Imprints Brill, Brill Nijhoff, Brill Hotei, Brill Schöningh, Brill Fink, Brill mentis, Vandenhoeck & Ruprecht, Böhlau, Verlag Antike und V&R unipress.
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk und seine Teile sind urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung in anderen als den gesetzlich zugelassenen Fällen bedarf der vorherigen schriftlichen Einwilligung des Verlages.
Umschlagabbildung: © picture alliance/dpa/dpa-zb-zentralbild | Paul Zinken
Korrektorat: Johanna Körner, Karlsruhe
Satz: textformart, Göttingen
Umschlaggestaltung: SchwabScantechnik, GöttingenEPUB-Produktion: Lumina Datamatics, Griesheim
Vandenhoeck & Ruprecht Verlage | www.vandenhoeck-ruprecht-verlage.com
ISSN 2749-6198
ISBN 978-3-647-99443-7
Inhalt
Einleitung30 Jahre Gegenwart (Christina Morina)
Teil 1Fragen an die Deutsche Einheit 30 Jahre danachMarianne Birthler & Norbert Frei im Gespräch mit Christina Morina
Impuls I: Jenseits deutsch-deutscher Befindlichkeiten (Marianne Birthler)
Impuls II: Über die »Zumutungen« des Umbruchs aus westdeutscher Sicht (Norbert Frei)
Gespräch
Teil 2Perspektiven auf die europäische GegenwartPhilipp Ther & Ton Nijhuis im Gespräch mit Benno Nietzel
Impuls I: Europa hat mehr als eine (vergangene) Zukunft (Ton Nijhuis)
Impuls II: Neoliberale Reformen, die antiliberale Gegenrevolution und die Herausforderung der Pandemie (Philipp Ther)
Gespräch
KommentarEin transatlantischer Blick auf eine deutsche Diskussion(Konrad H Jarausch)
Anmerkungen
Literaturverzeichnis
Dank
Über die Autorinnen und Autoren
Personenregister
Einleitung30 Jahre Gegenwart
Christina Morina
Jahrestage kommen und gehen. Manchmal kommen sie gelegen, manchmal völlig ungelegen. Der 30. Jahrestag der Deutschen Einheit im Herbst 2020 fiel mitten in die zweite Welle der Corona-Pandemie, wodurch die üblichen Gedenk- und Debattenrituale, die inzwischen zu einer eigenen Tradition geworden sind, gründlich durcheinandergerieten. Doch in paradoxer Weise haben diese außergewöhnlichen Umstände eine unerwartet klare Sicht auf die politischen und gesellschaftlichen Grundlagen der Bilanzierungen und Ausblicke ermöglicht. Gerade weil viele der öffentlichen Feierlichkeiten in kleinem Rahmen oder als digitale Formate stattfinden mussten, ist die Vielfalt und Reichhaltigkeit der inzwischen vorhandenen wissenschaftlichen und politisch-kulturellen Auseinandersetzungen mit der jüngsten Zeitgeschichte deutlicher denn je zu Tage getreten.
Deutschland in Europa, Deutschland und Europa, haben sich seit 1990 fundamental gewandelt. Der hier unternommene Versuch, die Entwicklung in den 30 Jahren seit der Vereinigung in zeithistorischer Perspektive zu rekapitulieren und zu bewerten, ist von der Einsicht getragen, dass diese gerade vergehende Gegenwart noch keineswegs Geschichte ist. Zugleich wird sie – und darin steckt ein enormes geschichtswissenschaftliches und gesellschaftliches Erkenntnispotential – zunehmend Gegenstand historischer Analysen und ist nicht mehr länger vorrangig ein Feld sozial- und politikwissenschaftlicher Forschung oder publizistischer Betrachtung. Der Titel der Reihe, in der dieser erste Band erscheint, Vergangene Gegenwart, öffnet in leiser Anspielung auf Reinhart Kosellecks Studien zum Zukunftsdenken vergangener Gesellschaften einen dezidiert jetztzeitigen Blick auf die Gegenwart als Zeitgeschichte. Was ist damit gemeint? Koselleck hat mit Blick auf die Neuzeit argumentiert, dass in dem Maße, in dem »die eigene Zeit als eine immer neue Zeit, als ›Neuzeit‹ wahrgenommen wurde, die Herausforderung der Zukunft immer größer geworden ist.«1 Zu Beginn des 21. Jahrhunderts, nach dem Ende des Zeitalters der erschöpften Utopien, scheint jedoch die Gegenwart zur größten Herausforderung geworden zu sein. Diese »Banngewalt des Jetzt«2 ist vielleicht nicht zuletzt deshalb so mächtig, weil vom Gelingen der Gegenwart abhängt, wie lange es eine – vielfach nur noch als Katastrophenszenario denkbare – Zukunft überhaupt noch geben kann. Dafür steht paradigmatisch der völlig ironiefreie Titel des Buches, mit dem die erste grüne Kanzlerkandidatin der deutschen Geschichte, Annalena Baerbock, in den Bundestagswahlkampf 2021 gezogen ist: »Jetzt«. Vor dem Hintergrund dieser allgegenwärtigen Gegenwart scheint es wiederum ebenso folgerichtig wie klärungsbedürftig, in welchem Maße auch die Zeitgeschichte, die »Problemgeschichte der Gegenwart«3, als ein Feld betrachtet werden kann und sollte, das (neben vielen anderen) mit dazu beiträgt, Gegenwart zu »denken«.4
In diesem kritischen Verständnis der äußerst problem- und konfliktreichen Gegenwart als jetztzeitiger Vergangenheit, und damit zugleich als zeithistorischer und gesellschaftlicher Herausforderung, nähern sich die beiden hier dokumentierten Debatten der Geschichte Deutschlands in Europa seit 1990 auf zwei Ebenen: Einerseits geht es um die Vereinigung der beiden deutschen Staaten als Umbruchsprozess, den viele der damals erwachsenen Zeitgenossen als äußerst geballten, vielschichtigen Erfahrungsschub wahrgenommen haben. Zwar wurden 1989/90 stets auch Fragen der zukünftigen Gestalt des vereinten Deutschlands verhandelt, doch in dieser verdichteten Zeit rückte vorübergehend die Gegenwart und ihre Deutung, ihr unmittelbares Begreifen und Bewältigen, in das Zentrum der Aufmerksamkeit, und für einige Monate schien die Gegenwart alle Fragen von Vergangenheit und Zukunft zu überwölben. Andererseits ist diese damalige Gegenwart inzwischen Teil unserer Vergangenheit und damit immer weniger ein Erfahrungsgegenstand, sondern zunehmend ein Feld der distanzierteren Beobachtung und historiografischen Analyse. Nach Ablauf der 30-Jahres-Frist öffnen sich für die Zeitgeschichte mit dem Zugang zu staatlichem Schriftgut von nun an die Jahre ab 1990 – allmählich, aber kontinuierlich und eben gesamtdeutsch.5 Für die historische Forschung wirft diese Zeit einige höchst komplexe Fragen auf, die nicht selten durch die Konflikte unserer Gegenwart in ganz besonderer Weise aufgeladen sind.
Dieses Problem- und Konfliktpotential wurde gerade im Corona-bedingt stark reduzierten Gedenkbetrieb des Herbstes 2020 sehr deutlich. Statt eines großen »Bürgerfestes« am 3. Oktober konnte man in Potsdam, der Hauptstadt des diesmaligen Gastgeberbundeslandes, vier Wochen lang die Freiluftausstellung »Einheits-Expo« besuchen. Am Eingang zu dieser im Stil einer Tourismusmesse gehaltenen Schau deutscher Länder, Institutionen und historischer Momente sollte ein riesiges schwarz-rot-goldenes Pappmaché-Herz das inzwischen »Ziemlich einig Vaterland«6 symbolisieren. Dasselbe Herz zierte die Titelseite des Berichts der Kommission »30 Jahre Friedliche Revolution und Deutsche Einheit«, die 2019 im Bundesinnenministerium eingerichtet worden war. Diese ausnahmsweise einmal mehrheitlich mit Ostdeutschen besetzte Kommission hatte den Auftrag, Handlungsempfehlungen zur »Ausgestaltung eines zeitgemäßen Jubiläumskonzepts« zu unterbreiten und »Bürgerdialoge« zu veranstalten, die »sowohl das Bewusstsein über das Erreichte stärken als auch bestehende Herausforderungen und schmerzliche Erfahrungen offen thematisieren sollten«. Schließlich sollte sie auch die »Idee eines Zentrums in Ostdeutschland« diskutieren, »das sich im Geiste der Freiheitsbewegung von 1989 dem weiteren Zusammenwachsen von Ost und West im internationalen Kontext widmet«. Eine ganze Reihe der geplanten Aktivitäten konnten auch hier aufgrund der Corona-Pandemie nicht umgesetzt werden, doch der im Dezember 2020 vorgelegte Kommissionsbericht hatte es vor allem in geschichtspolitischer Hinsicht in sich: Zur Stärkung des demokratischen »Stolzes« des Landes sollte der 9. November zum »nationalen Gedenktag« erhoben werden, womit man die gedenkpolitischen Grundachsen der Bundesrepublik klar verschieben würde – weniger »1938«, mehr »1918« und »1989«. Überhaupt mehr »Schwarzrotgold«: Zur Erinnerung an die legendäre Leipziger Großdemonstration vom Oktober 1989, schlug die Kommission weiterhin vor, dass rund um den 9. Oktober als »Tag der Demokratie« zukünftig öffentliche Einrichtungen in den Bundes- und EU-Farben erstrahlen, am 3. Oktober Fahrgäste mit Kleidung in den Nationalfarben ermäßigt Busfahren können und in den Schulen fortan nicht nur das Grundgesetz, sondern auch die Nationalflagge verteilt werden.7 Auch wenn offen ist, ob und in welcher Form diese Vorschläge, gepaart mit einigen vagen strukturpolitischen Empfehlungen, die Angela Merkel im Frühjahr 2021 als »sehr, sehr sinnvoll«8 bezeichnete, umgesetzt werden, zeigt diese Kommissionsarbeit exemplarisch sowohl die perspektivenreichere Offenheit als auch die hohe Ambivalenz und Widersprüchlichkeit des derzeitigen einheitsbezogenen Entwicklungs- und Diskussionstandes.
Doch noch einmal zurück zu den Oktober-Feierlichkeiten im Herbst 2020. Denn obwohl oder gerade weil das große Bürgerfest ausfiel, mutete der öffentliche Diskurs umso realistischer an: Eine Mischung aus Zuversicht angesichts des Erreichten und Verdruss über die mangelnde Fähigkeit, dies auch anzuerkennen, durchzog die meisten Zeitungskommentare ebenso wie eine Vielzahl aufwändig gestalteter Sonderseiten, Hochglanzmagazine und Talkshowdiskussionen.9 Ambivalent waren auch die wie üblich zum Anlass gehaltenen Reden von Bundespräsident und Bundesratspräsident. Frank-Walter Steinmeier bemühte sich um eine wirklichkeitsnahe Sicht auf die 30-jährige Gegenwart: »Ossis und Wessis gibt es weiterhin, aber diese Unterscheidung ist für viele längst nicht mehr die entscheidende. Durch das Zusammenwachsen von Ost und West, durch Zuwanderung und Integration ist unser Land in den letzten dreißig Jahren vielfältiger und unterschiedlicher geworden.«10 Diese mitunter schwierige, spannungsgeladene Vielfalt als »Aufgabe« zu meistern, sei nicht einfach. Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke fasste in seiner Rolle als Bundesratsvorsitzender den Stand der politischen Diskussion anno 2020 mit der salomonischen Formel zusammen: »Die Deutsche Einheit ist ein großer Erfolg und den- noch ist sie keine reine Erfolgsgeschichte.«11
Vergleichbar durchwachsen war schließlich auch die dem Jahrestag gewidmete Bundestagsdebatte. Sie fand am 2. Oktober wegen eines EU-Sondergipfels ohne die Bundeskanzlerin statt12 und mutete mitunter wie ein Kammerstück über eine ewig zerstrittene Hausgemeinschaft an. Entsprechend das mediale Resümee: »Mit einer emotionalen Debatte haben Abgeordnete im Bundestag an die Friedliche Revolution in Ostdeutschland erinnert und erklärt, was nach 30 Jahren Deutsche Einheit noch zu tun sei. Finanzminister Scholz sprach von einer ›Erfolgsgeschichte‹, Co-AfD-Bundessprecher Chrupalla forderte eine ›Sonderwirtschaftszone Ost‹ und Linken-Fraktionschef Bartsch nannte es einen ›Skandal‹, wie wenig Ostdeutsche in wichtigen Positionen seien. Unionsfraktionschef Brinkhaus entschuldigte sich bei den Ostdeutschen«, so etwa die Bilanzierung des MDR.13 Bemerkenswert daran war, dass ostdeutsche Abgeordnete aller Fraktionen über ihre (oft eher kurzen) DDR-Biografien sprachen und dabei von Erfahrungen berichteten, die über die normalerweise geltenden Parteiengrenzen hinweg durchaus vergleichbar – oder zumindest aufeinander beziehbar – waren. In der öffentlichen Resonanz spielten diese Teile der Debatte jedoch bezeichnenderweise kaum eine Rolle.
Bemerkenswert an dieser Debatte war zudem, dass der aus Westfalen stammende CDU/CSU-Fraktionschef Ralph Brinkhaus dafür um Entschuldigung bat, dass »wir im Westen« zu spät »kapiert« und »vielleicht zu lange nicht gesehen haben«, wie schwer der Nachwendealltag für viele Ostdeutsche war. Er bedanke sich bei den »vergessenen Helden der Wiedervereinigung«, deren Leben von so vielen Problemen geprägt gewesen sei, »ob das nun Arbeitslosigkeit, der Verlust der eigenen Biografie oder auch die Legitimation der Identität war.«14 Die Bemühtheit, ja Unbeholfenheit dieser Rede deutet darauf hin, dass hier Versäumnisse zwar benannt, aber noch immer nicht wirklich durchdrungen werden. Der Redebeitrag des sozialdemokratischen Bundesfinanzministers zeichnete sich ebenso wenig durch ein überzeugendes Problembewusstsein aus. Olaf Scholz, der bei dieser Gelegenheit erwähnte, er habe in den 1990er Jahren als junger Anwalt »im Osten Deutschlands viele Betriebsräte und Gewerkschaften vertreten«, wies hinsichtlich der anhaltenden Unterschiede im Lohn- und Rentenniveau (beinahe wie im Selbstgespräch) darauf hin, dass es doch »spannend« sei und man »noch viel stärker erzählen« müsse, dass die zwei »größten sozialpolitischen Maßnahmen der letzten beiden Legislaturen [Grundrente und Mindestlohn] helfen, ostdeutsche Biografien stärker zu wertschätzen und Unterschiede zu beseitigen.«15 Tatsächlich war eine solche Zuspitzung oder Lesart dieser Maßnahmen seitens der Bundesregierung zu keinem Zeitpunkt zu hören – und auch gar nicht zu erwarten, denn die Angleichung der verbleibenden strukturellen Ost-West-Unterschiede war ja gerade nicht ihr zentraler Anspruch und Sinnzusammenhang.
Bemerkenswert war aber auch der Beitrag der thüringischen SPD-Abgeordneten Daniela Kolbe, die 1990 zehn Jahre alt war und sich in der Debatte weit abseits der üblichen Frontlinien für eine andere ostdeutsche Selbstwahrnehmung und Partizipationsperspektive aussprach. »Manche Ostdeutsche haben sich im Verletztsein ganz schön eingerichtet und manche Westdeutsche auch ganz schön in einer gewissen Gleichgültigkeit«, gab sie zunächst zu Protokoll. Dann mahnte sie vor allem die Ostdeutschen: »[H]ört zu, wenn die Leute aus dem Ruhrpott von dem Strukturwandel, den sie durchgemacht haben, erzählen, von den maroden Kommunen und den leeren Kassen, das ist ja ein Leichtes für jeden Ostdeutschen, sich da hineinzuversetzen.« Vor allem müssten sie sich viel aktiver um ihre Interessenvertretung im Rahmen der bestehenden Mitbestimmungsmöglichkeiten kümmern, sich zum Beispiel stärker in den Gewerkschaften engagieren. »Macht da endlich mit! Werdet mutig und kämpft für eure eigenen Rechte!«16 Die strukturellen Ursachen vieler Problemzusammenhänge in Ostdeutschland, die Kolbe hier anspricht – die mangelnde Präsenz von und Mitgliedschaft in Parteien, der niedrige Organisationsgrad von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern oder die geringere Bereitschaft, die ganze Breite der im Verfassungsgefüge vorhandenen Partizipationsmöglichkeiten zu nutzen –, spielen in den politischen Entscheidungsprozessen und gesellschaftlichen Diskussionen rund um die Vereinigungsfolgen noch immer eine viel zu geringe Rolle.17
Bemerkenswert war diese Bundestagsdebatte schließlich auch deshalb, weil sie eine nahezu ausschließlich nach innen gerichtete Debatte war, die der Vielfalt der Gesellschaft kaum Rechnung trug: Keine einzige migrantisch geprägte Stimme kam beziehungsweise meldete sich in dieser Aussprache zur Entwicklung Deutschlands seit 1990 zu Wort.
Insgesamt lässt sich aus dieser kleinen Rückschau auf den merkwürdigen Gedenkherbst 2020 schließen, dass in den innerdeutschen Debatten über die Geschichte der Vereinigung und die Transformation Ostdeutschlands eine zwar durchaus kontroverse, aber letztlich produktive Unruhe und prinzipielle Offenheit für viele, wenn auch längst nicht alle, hierbei relevanten Perspektiven herrscht. Auch wenn der gesamte politische Diskurs noch immer zutiefst durchdrungen ist von dem Bedürfnis, die Lage der vereinten Nation am Grad der bereits erreichten (und noch zu erreichenden) Angleichung und Vereinheitlichung zu messen18, fallen die jubiläumsbezogenen Zeitdiagnosen differenzierter und problemfokussierter aus. Das ist nicht zuletzt wohl eine Folge der seit 2015 stark zunehmenden politischen Polarisierung und demokratischen Verunsicherung, mit dem sich »der problematische Osten« – gewissermaßen als eine Gegenwart, die nicht vergehen will – nachhaltig in die politische Kultur der gesamten Republik eingeschrieben hat.19
Die umrissene produktive Unruhe und prinzipielle Perspektivenoffenheit treten noch deutlicher zu Tage, wenn man parallel zum politischen Geschehen die zeithistorische Forschung der letzten Jahre in den Blick nimmt. Anders als noch zum 20. Jahrestag von Mauerfall und Einheit 2009/2010 fällt diese im 30-Jahre-Reigen weniger durch standardisierende Gesamtdarstellungen oder zuversichtgesättigte Meistererzählungen20 auf, sondern durch problematisierende Zugriffe, transnationale oder kulturgeschichtliche Frageperspektiven und deutlich kritischere transformations- und demokratiegeschichtliche Ansätze (und auch das jüngste Standardwerk zur deutsch-deutschen Teilungsgeschichte zeichnet sich durch deutungshoheitliche Zurückhaltung aus21). Allein in den letzten zwei, drei Jahren sind wegweisende zeithistorische – d. h. empirisch fundierte, auf Primärquellenforschung beruhende – Studien erschienen, so dass das Feld der Vereinigungsgeschichte ab 1990 und deren Deutung nicht länger nur mehr der Politik- und Sozialwissenschaft und Essayistik überlassen bleibt.22
Dabei kommen die Bedingungen, Dynamiken, Logiken und Folgen der politischen, wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Transformation in den Blick; die diversen Akteure, Expertinnen und Erfüllungsgehilfen von der Bundes- und Behördenebene23 über die Gewerkschaften24 bis hin zu lokalen, höchst spannungsreichen Aushandlungsprozessen etwa in Bezug auf Wohn- und Eigentumsverhältnisse25 sowie ideen-, verfassungs- und demokratiegeschichtlichen Fragen – in ost-, west- und gesamtdeutscher Perspektive.26 Diese Vervielfältigung und Erweiterung der Perspektiven, gerade auch in die westdeutsche und europäische Zeitgeschichte hinein, birgt ein beträchtliches Erkenntnispotential, etwa in Bezug auf die Demokratie- und Gesellschaftsgeschichte der »alten« Bundesrepublik. Schaut man sich beispielsweise näher an, mit welchen Demokratie- und Wirtschaftsordnungsvorstellungen westdeutsche Lehrer, Beamtinnen und Wirtschaftsberater ab 1990 nach Ostdeutschland kamen, um dort diese »alte«, für bewährt erachtete Ordnung – weitgehend unverändert – zur »neuen« Ordnung zu machen, erlaubt dies auch vielfältige Rückschlüsse über die längere bundesrepublikanische Gesellschaftsgeschichte. Die inzwischen auf breiter Front in die Kritik geratene Erfolgserzählung von der »geglückten Demokratie« (Edgar Wolfrum) dürfte dabei sicher weitere Blessuren erleiden. Für Anhänger einer kritischen Geschichtsschreibung wäre dies freilich kein bedauerns-, sondern vielmehr ein begrüßenswerter Umstand.
Dennoch ist die produktive Unruhe und Vielfalt auch in der zeithistorischen Forschung noch kein Beleg dafür, dass Zeitgeschichte nach 1990 nun vorrangig als integrierte deutsche Nachvereinigungsgeschichte geschrieben wird – womit sie, so meine ich, ihrer (erhofften) Rolle als Orientierungswissenschaft ein Stück gerechter würde. Es bleibt zu beklagen, mit welcher Selbstverständlichkeit ostdeutsche Aspekte der deutschen Nachkriegs- und Zeitgeschichte unterbeleuchtet oder völlig ausgeblendet bleiben. So finden gerade in Büchern, die seit 2019 im Zusammenhang mit den runden Jahrestagen der Weimarer Verfassung und des Inkrafttretens des Grundgesetzes erschienen und zudem noch mit dem Anspruch eines Standardwerks versehen sind, spezifisch ostdeutsche Demokratie- und Verfassungserfahrungen und deren konkrete wie übergeordnete Relevanz im gesamtdeutsch-europäischen Kontext so gut wie keine Berücksichtigung.27
Dieser Befund erscheint in geschichtskultureller Perspektive als noch problematischer als aus rein zeithistoriografischer Sicht. Denn im Laufe von 30 Jahren »Berliner Republik«28 hat sich die »Sternstunden«-Erzählung der Revolution von 1989 als das Leitmotiv der erinnerungskulturellen Auseinandersetzung mit der DDR-Geschichte etabliert; sowohl der 17. Juni 1953 als auch der 13. August 1961 spielen eine im Vergleich dazu untergeordnete Rolle.29 Anders als das Gedenken an die nationalsozialistische Diktatur, das im Laufe der Jahrzehnte eine immer dunklere Konturierung gewonnen hat, scheint die Auseinandersetzung mit der Geschichte der SED-Diktatur vom Dunklen ins Hellere zu verlaufen. Dies mag einerseits eine natürliche (und gar notwendige) Begleiterscheinung des ostdeutschen Demokratisierungsprozesses sein: In dem Maße, in dem demokratische Widerstände und Aufbrüche öffentlich debattiert, repräsentiert und erinnert werden, kann auch die sich hierfür engagierende Gesellschaft für demokratisiert gehalten werden. Andererseits hat diese Entwicklung zweifellos zur Folge, dass eine ganze Reihe essentieller Fragen in Bezug auf die breiteren gesellschaftlichen Grundlagen des sogenannten Staatssozialismus, das alltägliche (Aus-)Handeln jedes und jeder Einzelnen, bis heute unbeantwortet, wenn nicht gänzlich ungestellt bleiben.30
Schließlich unterstreicht auch der jahrelange Streit um einen zentralen Erinnerungsort – das Berliner »Freiheits- und Einheitsdenkmal« – und die mit dem Aufstieg des Rechtspopulismus gerade in Ostdeutschland buchstäblich ins Wanken geratene geschichtspolitische Logik dieser »Einheitswippe« die hier nachgezeichnete produktive Unruhe und Offenheit der innerdeutschen Debatten. Zwar wird das Denkmal nun endlich gebaut; es markiert aber sicher nicht den Schlusspunkt einer an Unwägbarkeiten überreichen Entwicklung. Die vielstimmigen, schwankenden 30 Jahre Gegenwart bleiben politisch, gesellschaftlich und geschichtswissenschaftlich betrachtet eine veritable Herausforderung.
Die im Folgenden dokumentierte, von allen Gesprächspartnern für dieses Buch leicht überarbeitete Debatte zur Zeitgeschichte beschäftigt sich eingehend mit dieser Herausforderung. Die eben skizzierten historischen und historiografischen Entwicklungen kommen darin vielperspektivisch zur Sprache und finden einen mitunter auch ganz anders akzentuierten Widerhall. Die Debatte unterteilt sich in zwei Teile: Im ersten Teil diskutieren Marianne Birthler und Norbert Frei aus einer vorrangig innerdeutschen Perspektive über »Fragen an die Deutsche Einheit 30 Jahre danach«. Im zweiten Gespräch geht es zwischen dem Amsterdamer Politikwissenschaftler Ton Nijhuis und dem Wiener Historiker Philipp Ther um europäische Perspektiven auf die vergangene Gegenwart. Beide Gespräche werden jeweils durch Impulse der Diskutanten eingeleitet, die den Ausgangspunkt für die anschließenden Diskussionen bilden. Marianne Birthler und Norbert Frei beginnen ihre Impulse beide mit sehr persönlichen Rückblenden; der erfrischend unverhohlene »westdeutsche« Blick, den Norbert Frei zur Diskussion stellt, ist in den innerdeutschen Debatten über die Relevanz jener Jahre selten so offenherzig und auseinandersetzungsfreudig zu hören oder zu lesen. Ton Nijhuis und Philipp Ther wählten jeweils – teils bedingt durch ihre Herkunft, vor allem aber begründet durch ihre wissenschaftlichen Expertisen – eine Art Außenbeobachterperspektive mit erhellenden und durchaus auch überraschenden Einschätzungen der ost-, west- und gesamtdeutschen »Gemengelage«, die immer stärker europäisch und global geformt und entsprechend zu historisieren ist.
Teil 1Fragen an die Deutsche Einheit 30 Jahre danach
Marianne Birthler & Norbert Frei im Gespräch mit Christina Morina
Zur Einführung
In diesem ersten Gespräch geht es einerseits um die Einheit als erfahrenen und in diesem Sinne noch sehr gegenwärtigem Umbruchsprozess. Andererseits ist diese damalige Gegenwart inzwischen selbst Teil unserer Vergangenheit und damit zunehmend auch ein Feld historischer Betrachtung und Analyse. Zeithistoriker und Zeithistorikerinnen sehen sich mit Blick auf diese Phase mit einigen höchst komplexen politik-, wirtschafts-, sozial- und kulturgeschichtlichen Fragestellungen konfrontiert, die dazu nicht selten durch aktuelle Problemlagen gerahmt und aufgeladen werden – etwa in Bezug auf Aufstieg und Verfestigung des Rechtspopulismus insbesondere in Ostdeutschland oder die Diskussion um ein zeitgemäßes staatliches Gedenken an die Diktatur- und Demokratiegeschichte. Eben jenen Fragen wollen wir uns im Folgenden widmen. Vor unserer Diskussion stehen zwei kurze Impulse, in denen zunächst Marianne Birthler und anschließend Norbert Frei ihre Sicht auf die Ereignisse seit 1990 schildern – aus ganz persönlicher Perspektive, aber auch mit Blick auf die praktischen, geschichtswissenschaftlichen und -politischen Zusammenhänge, in denen sie jeweils wirken.
* * *
Impuls I: Jenseits deutsch-deutscher Befindlichkeiten
(Marianne Birthler)
Der 30. Jahrestag des Mauerfalls vor einem Jahr bildete – wenn man das mal als Event sieht: mit Licht-Spektakeln, Volksfesten, Festreden und Tagungen – so etwas wie den politischen Höhepunkt des Jahres. Interessant war, dass es weniger um den Fall der Mauer und das Ende der DDR ging. Vielmehr standen drei Jahrzehnte deutsche Einheit im Mittelpunkt. Deutsch-deutsche Befindlichkeiten. Und die Frage, was denn eigentlich da im Osten los ist. Worüber, fragte ich mich damals besorgt, würden wir ein Jahr später, also am 30. Jahrestag der Einheit, noch reden können? So gesehen hat es sein Gutes, dass der 3. Oktober 2020 – Corona sei Dank – auffallend still verlief und überwiegend in den Medien stattfand.
Seit drei Jahrzehnten wird die sogenannte innere Einheit – ein fragwürdiger Begriff – nun einmal ganz selbstverständlich am Puls der Ostdeutschen gemessen. Dabei spielen die Worte noch immer und schon eine zentrale Rolle. Mein Gott, sieht das hier noch immer »ostig« aus. Stimmt. Aber nach Erfurt müssen Sie mal fahren, da spüren Sie schon gar nicht mehr, dass das mal Osten war. Irgendwie merkt man dem schon noch an, dass er aus dem Osten kommt. Na ja, aber viele Jüngere haben das schon drauf. So wie die auftreten und aussehen, könnten sie auch aus Hamburg kommen.
Der Westen ist also Maß und Mitte. Aber genau das wollte die Mehrheit der Ostdeutschen damals. Im Westen ankommen und leben, einen bundesdeutschen Pass besitzen, nach »Malle« fliegen oder durch die Welt reisen. Frei sein, nicht bevormundet und überwacht werden. Gleich sein und für ehrliche Arbeit ehrliches Westgeld bekommen, brüderlich willkommen geheißen werden, wertgeschätzt werden und am Wohlstand teilhaben. Mit dem Pass hat es geklappt. Für die meisten früher oder später auch das mit der Arbeit und dem Geld. Ein bisschen schwieriger war es schon mit der Wertschätzung und dem Gefühl der Zugehörigkeit. Und vor allem: Wo war das eigene bisherige Leben geblieben? Zählte es überhaupt noch? Und durfte man zu Recht zufrieden damit oder sogar stolz darauf sein? Woher kam die weitverbreitete Unzufriedenheit, der Frust, die Enttäuschung?
Zumeist werden die Ursachen dafür in den 1990er Jahren gesucht und nicht in den Jahrzehnten davor. Fast scheint es einen Riss zu geben zwischen jenen Wissenschaftlerinnen und Publizisten, die sich bei diesem Thema auf die Verwerfungen nach 1990 konzentrieren, und jenen, die vor allem auf 40 Jahre DDR verweisen. Tatsächlich hatten die rasend schnellen Veränderungen der 1990er Jahre in fast allen gesellschaftlichen Bereichen gravierende Brüche in den Berufsbiografien der Ostdeutschen zur Folge. Weil ihre Ausbildung und ihre Studienabschlüsse für den bundesdeutschen Arbeitsmarkt nicht taugten, weil ihre Arbeitsplätze nicht mehr existierten oder weil sie in Konkurrenz mit aus dem Westen stammenden Bewerbern nicht mithalten konnten. Das wiederum lag an gänzlich anderen Berufserfahrungen, einer Arbeits- und Kommunikationskultur, die sich von der des Westens fundamental unterschied. Plötzlich wieder ganz am Anfang zu stehen mit dem Gefühl, dass 20 oder 30 Jahre Berufserfahrung nichts mehr wert sind – das ist schwer in einem Alter, in dem andere die letzten Stufen einer erfolgreichen Karriereleiter erklommen haben und sich eines entsprechenden Einkommens und Ansehens erfreuen.
Durchschnittlich verdienen die Ostdeutschen 20 Prozent weniger als ihre Landsleute im Westen und verfügen über weniger als die Hälfte an Geld und Immobilienvermögen. Und dort, wo in Deutschland Entscheidungen fallen, also die großen, wirklich wichtigen Entscheidungen, kann man die Ostler mit der Lupe suchen. Sie sind an der Spitze großer Unternehmen, überregionaler Medien, der Universitäten, Verwaltungen, Verbände, Kirchen oder Gewerkschaften deutlich unterrepräsentiert oder überhaupt nicht zu finden.
Wer von den heute existierenden Ungerechtigkeiten und vor allem den mentalen Mauern zwischen Ost und West spricht, darf aber nicht die vier Jahrzehnte der Teilung vernachlässigen. Bis 1990 hatten sich zwei Gesellschaftssysteme entwickelt, die politisch, wirtschaftlich und ideologisch extrem gegensätzlich waren. Das hatte natürlich auch seine Auswirkungen auf die Einstellungen und Leben der Einzelnen.
Im Osten leben bis heute Millionen Menschen, die die meisten Jahre ihres Lebens hinter realen und ideologischen Mauern verbracht haben. Viele von ihnen schätzen noch immer die Freiheit weniger als die vermeintliche Sicherheit der Diktatur und die Berechenbarkeit des Alltags. Wie fast jedes autoritäre System entlastete auch die SED-Diktatur ihre Untertanen von Verantwortung und den Risiken und Anstrengungen, die das Leben in einem freien Land mit sich bringt. Wenn man das hinnahm oder sogar gut fand, lebte man vergleichsweise unbehelligt. Wer sich nicht bewegt, spürt seine Ketten nicht. Kaum jemand im Osten Deutschlands wünscht sich heute, wirklich wieder in der DDR zu leben. Aber die Sehnsucht nach Sicherheit und die Angst vor Freiheit und Verantwortung sind immer noch spürbar.
Auch bezüglich der Frage, wie in beiden deutschen Staaten mit der NS-Zeit umgegangen wurde, verfolgten die Bundesrepublik und die DDR völlig verschiedene Wege. Im Westen dauerte es mehr als eine Generation, bis Holocaust, Kriegsverbrechen und die Verfolgung und Ermordung von Millionen Menschen zum öffentlich anerkannten Thema wurden. Erst in der letzten Phase der alten Bundesrepublik hatte sich dann aus der Bürgergesellschaft heraus eine Erinnerungskultur entwickelt, die diese Bezeichnung verdient. Die DDR hingegen verstand sich seit ihrer Gründung als antifaschistischer Staat. Als Kinder legten wir Blumen an den Wohnhäusern nieder, an denen sich Gedenktafeln für ermordete Widerstandskämpfer befanden. Freilich handelte es sich bei ihnen ausnahmslos um Kommunisten. Sozialdemokratischer, erst recht bürgerlicher oder christlich motivierter Widerstand spielten kaum eine Rolle. Auch vom Holocaust war etwa an den Schulen selten die Rede. Der Antifaschismus der DDR war zum politischen Mythos geworden und zu einer mächtigen Waffe im Klassenkampf. Nicht zuletzt aus diesem Grunde hieß die Mauer dann ja auch »antifaschistischer Schutzwall«. Die Nazi-Täter, so lernte ich in der Schule, waren inzwischen aus der DDR geflohen und lebten unbehelligt im Westen. Die Ostdeutschen waren die Guten. Hitler war Westdeutscher. Wie sollte unter diesen Umständen eine ehrliche Auseinandersetzung mit der deutschen Geschichte verbundenen Schuld und Verantwortung erfolgen?





























