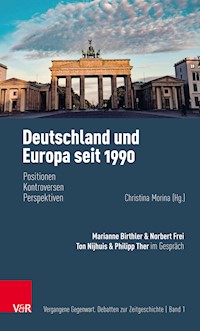Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Hanser Berlin
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2014
Marianne Birthlers Geschichte ist durch die doppelte Erfahrung des Lebens in der DDR und im wiedervereinten Deutschland gekennzeichnet. Aufgewachsen in Ost-Berlin, setzte sie sich schon als junge Frau für mehr Selbstbestimmung unter den Bedingungen der Diktatur ein. Ihre Haltung führte sie Mitte der achtziger Jahre in die Opposition gegen den SED-Staat und schließlich in das Zentrum der revolutionären Ereignisse von 1989. Als erste Kultusministerin im neuen Bundesland Brandenburg, erste Bundesvorsitzende von Bündnis 90/Die Grünen und als Bundesbeauftragte für die Stasiunterlagen bewies sie große Unabhängigkeit. Die Autobiographie einer Frau, die die jüngere deutsche Geschichte maßgeblich mitgeprägt hat.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 658
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Hanser Berlin E-Book
Marianne Birthler
Halbes Land
Ganzes Land
Ganzes Leben
Erinnerungen
Hanser Berlin
ISBN 978-3-446-24413-9
© Hanser Berlin im Carl Hanser Verlag München 2014
Alle Rechte vorbehalten
Schutzumschlag: Peter-Andreas Hassiepen, München, unter Verwendung einer Fotografie von © Ute Mahler/Ostkreuz
Satz: Greiner & Reichel, Köln
Unser gesamtes lieferbares Programm
und viele andere Informationen finden Sie unter:
www.hanser-literaturverlage.de
Erfahren Sie mehr über uns und unsere Autoren auf www.facebook.com/HanserLiteraturverlage oder folgen Sie uns auf Twitter: www.twitter.com/hanserliteratur
Datenkonvertierung E-Book:
Kreutzfeldt digital, Hamburg
Für meine Enkelkinder Juri, Kobie, Rosa, Ante, Henri und Noa
Inhalt
1 Stumme Zeugen: Rundgang durch ein Archiv
2 Eine Berliner Familie
3 Ost-Berlin, West-Berlin
4 Eingemauert
5 Neunzehnhundertachtundsechzig
6 Der Anfang vom Ende
7 Zurück in Berlin
8 Der Druck im Kessel steigt
9 Gethsemanekirche
10 Wahnsinn!
11 Frei gewählte Abgeordnete
12 Von Deutschland nach Deutschland
13 Ministerin in Brandenburg
14 An der Spitze der Partei
15 Zwischenzeit
16 Bundesbeauftragte I
17 Bundesbeauftragte II
18 Neue Freiheiten
Danksagung
Anmerkungen und Literaturhinweise
Bildnachweis
Personenregister
1
Stumme Zeugen: Rundgang durch ein Archiv
Die Erinn’rung ist eine mysteriöse
Macht und bildet die Menschen um.
Wer das, was schön war, vergißt, wird böse.
Wer das, was schlimm war, vergißt, wird dumm.
Erich Kästner
Die Blumensträuße sehen noch ganz frisch aus. Überall stehen Vasen – auf dem Schreibtisch, auf dem Fußboden, vor dem Fenster. Vor wenigen Tagen habe ich mein neues Amt angetreten. Die ersten Tage verliefen geschäftig, aber unaufgeregt: Begrüßungen, Terminabsprachen, erste Sitzungen, Entscheidungen und Unterschriften. Einladungen. Stapel von Briefen. Mein künftiger Alltag wurde sichtbar, der Alltag der Bundesbeauftragten für die Stasi-Unterlagen, korrekt: für die Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes der ehemaligen Deutschen Demokratischen Republik.
An diesem 17. Oktober 2000 ist es anders, und ich bin etwas beklommen, als mich der behördliche Fahrer am Morgen abholt. Wir fahren nicht in die Glinkastraße in mein Büro, sondern nach Lichtenberg. Heute werde ich das Archiv, das Herzstück der Behörde, besuchen. Meine Beklommenheit rührt von der Befürchtung her, nun mit jener Seite meines neuen Amtes in Berührung zu kommen, die für mich immer noch düster und bedrohlich ist.
Der Weg ins Archiv führt über das Gelände des früheren Stasi-Hauptquartiers. Die »Magdalenenstraße« – der Name war auch schon zu DDR-Zeiten ein Synonym für Staatssicherheit – war ein riesiger Gebäudekomplex, furchteinflößend und hermetisch abgeriegelt, von außen nicht einsehbar. In den achtziger Jahren arbeiteten hier bis zu 7000 Hauptamtliche. Ich war im Herbst 1988 schon einmal unter ganz anderen Bedingungen hier, nach einer Festnahme. Wir hatten im Zentrum Ost-Berlins gegen die Zensur kirchlicher Zeitungen demonstriert, das heißt, wir wollten demonstrieren, aber wir kamen nicht weit. Die Lastwagen, auf die wir verladen wurden, standen schon bereit und brachten uns in die Magdalenenstraße – in die zum Gelände gehörende Untersuchungshaftanstalt. Die Sache ging glimpflich aus. Ein paar Stunden Warten, ein Verhör, die Unterschrift unter ein Vernehmungsprotokoll, das keines war, weil ich nichts gesagt hatte, dann spät am Abend die Entlassung.
Das erste Haus, das bei der Fahrt auf das Gelände in den Blick kommt, ist das Haus 1, einst Sitz von Erich Mielke, mehr als drei Jahrzehnte lang Minister für Staatssicherheit. Seine letzte Rede vor der Volkskammer am 13. November 1989 war erbärmlich: »Ich liebe doch alle, alle Menschen.« Er wurde ausgelacht. Eine lächerliche Figur war aus ihm geworden, dem mächtigen und zu Recht gefürchteten Mann. Der hässliche Vorbau aus Betonformsteinen lässt auf notorisches Misstrauen schließen: Er sollte den Minister, seine Begleiter und Gäste vor neugierigen oder feindlichen Blicken schützen, wenn sie ihren Limousinen entstiegen und das Haus betraten oder wieder verließen.
Wir fahren rechts vorbei und halten direkt vor Haus 7 am Haupteingang. Ich werde von Birgit Salamon und Jochen Hecht begrüßt – die beiden leiten gemeinsam die Archiv-Abteilung. Zusammen mit ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern haben sie den heutigen Rundgang sorgfältig vorbereitet. Die neue Bundesbeauftragte soll einen möglichst umfassenden Eindruck vom Archiv und von der Arbeit, die dort geleistet wird, bekommen. Ich werde durch zahlreiche Gänge geleitet, die für mich alle gleich aussehen und in denen ich mich auch zehn Jahre später noch verlaufen werde, von Magazin zu Magazin, durch Karteisäle und Arbeitsräume. Ich gehe an den alten Hebelschubregalen und den Karteipaternostern entlang, in der Nase den etwas muffigen und säuerlichen Geruch alter Akten, vermischt mit den unverwechselbaren Ausdünstungen von DDR-Fußbodenbelag. Ich besichtige Kilometer von Regalen voller Aktenordner mit ihren typischen blassen Farben und endlose Reihen ordentlich beschrifteter Kartons, in denen nach allen Regeln der archivischen Kunst erschlossene Unterlagen sorgfältig verpackt sind. Ein Stück weiter ein ganz anderer Anblick: unzählige Bündel von Ordnern, Schnellheftern, Broschüren und losen Blättern, mit Bindfaden zusammengeschnürt – alles vor mehr als einem Jahrzehnt in den Büros der Stasi-Offiziere sichergestellt. Dann Papiersäcke mit zerrissenen Akten. Eigentlich hätten sie gänzlich vernichtet werden sollen: verbrannt, geschreddert oder verkollert, also zerkleinert und mit Wasser in Papierbrei verwandelt. Aus später aufgefundenen Befehlen vom Oktober 1989 ging hervor, was vorrangig zu beseitigen sei. Als dann aber das für die Obristen Unvorstellbare geschah und sie ihre Macht über das Land und ihre gutbezahlten Posten verloren, da herrschten Hektik und Angst, da wurde in den Schredder gesteckt, was griffbereit war, was im Schreibtisch und im Handregal lag oder was ihnen später womöglich zum Verhängnis werden konnte. Tage- und nächtelang wurden unzählige Unterlagen per Hand zerrissen und in Müllsäcke gestopft, um sie später endgültig zu vernichten. Dazu ist es glücklicherweise nicht mehr gekommen, und noch heute warten, verteilt auf Berlin und die Außenstellen, in mehr als 15.000 Säcken Berge von Fetzen und Schnipseln (die angesichts dieser Vorgeschichte in der ordentlichen Sprache der Archivare »vorvernichtete Unterlagen« heißen) darauf, dass aus ihnen wieder Akten werden – in mühseliger Puzzlearbeit von Hand oder später vielleicht mit Hilfe eines raffinierten Computerprogramms, das eigens für diesen Zweck geschaffen werden soll.
Überall erwarten mich kluge Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, manche etwas aufgeregt, erklären mir, was ich sehe, und beantworten alle meine Fragen. Auf beiden Seiten herrscht Neugier: Meine Gastgeber haben sich noch nicht daran gewöhnt, dass Joachim Gauck, der die Stasi-Unterlagen-Behörde aufgebaut und sie zehn Jahre lang geleitet und geprägt hat, nicht mehr da ist. Geht das überhaupt, die Gauck-Behörde ohne Gauck? Das fragen sich in diesen Wochen viele, auch manche Journalisten machen aus ihrem Zweifel keinen Hehl: Sind die Schuhe, die Gauck hinterlassen hat, nicht vielleicht doch etwas zu groß für die Neue? Ehrlich gesagt habe auch ich in stillen Stunden meine Zweifel, aber das wissen nur wenige.
Aufmerksame Blicke verfolgen mich, und natürlich werden die, die mit mir gesprochen haben, hinterher von ihren Kollegen gefragt werden: »Und, wie ist sie nun, die neue Chefin?« Ich bin ebenfalls neugierig – und auch etwas angespannt. Ich weiß, wie viel von dieser ersten Begegnung abhängt, und versuche gar nicht erst so zu tun, als wüsste ich über alles Bescheid. Vertrauen wird nicht entstehen, indem ich hier die Oberexpertin gebe, sondern wenn die Experten spüren, dass ich sie und ihre Arbeit respektiere und ihnen zuhöre.
Von Station zu Station wächst meine Faszination – obwohl das Thema Staatssicherheit nichts Neues für mich ist: Ich habe mich als Abgeordnete der Volkskammer für die Aktenöffnung und die Gründung einer Stasi-Unterlagen-Behörde eingesetzt. Ich habe als Ministerin die Überprüfung von 27.000 Brandenburger Lehrerinnen und Lehrern auf frühere Tätigkeit für die Staatssicherheit geleitet. Ich habe mit einigen meiner Freundinnen und Freunde immer wieder über das gesprochen, was sie in ihren Akten lesen konnten und lesen mussten. Immer wieder erreichten uns Nachrichten darüber, wer uns verraten und heimlich mit der Staatssicherheit zusammengearbeitet hatte. Und ich war enttäuscht, als ich nach meinem Antrag auf Akteneinsicht die Auskunft bekam, der zu mir angelegte Vorgang sei laut Karteikarte am 19. Dezember 1989 vernichtet worden. Im Laufe der nächsten Jahre fanden sich dann doch noch etliche mich betreffende Unterlagen – die Stasi hatte viele Informationen doppelt und dreifach aufbewahrt.
Die Akten – und die Menschen, um die es in ihnen geht – sind für mich von nun an allerdings nicht mehr nur eines von vielen Themen. Sie werden im Mittelpunkt meiner Arbeit stehen. Hier in diesen Regalen liegen in Kartons, Ordnern und Bündeln die Zeugnisse jahrzehntelanger Überwachung und Repression. Hier lässt sich nachlesen, wie die Staatssicherheit Menschen das Leben zur Hölle gemacht hat. Hier findet die unmittelbare Begegnung mit dem statt, was Menschen anderen Menschen angetan haben – und antun können.
Auf einer der Stationen meines Rundgangs komme ich mit Sylvia Kegel ins Gespräch. Ihre Aufgabe ist es, Tondokumente zu sichern und zu registrieren. Die Staatssicherheit hat nicht nur Akten hinterlassen, sondern auch Videos, Fotos und unzählige Tonbänder: Mitschnitte von Verhören, von Gesprächen zwischen Führungsoffizier und IM, von Telefonaten. Dann die Reden von Erich Mielke und schließlich Tondokumente von Gerichtsverhandlungen, manche davon fast ein halbes Jahrhundert alt. Frau Kegel bietet mir einen Platz an und schaltet ein Abspielgerät ein: Ich höre nicht zum ersten Mal Erich Mielke in vertrautem Kreis aggressiv und in unsäglichem Deutsch räsonieren, dass man seiner Ansicht nach heutzutage viel zu milde mit Verrätern in den eigenen Reihen umgehe. Wenn man dagegen auf ihn hörte – kurzen Prozess würde man da machen …
Wir sind nicht gefeit, leider, dass auch mal ein Schuft noch unter uns sein kann, wir sind nicht gefeit dagegen, leider. Wenn ich das schon jetzt wüsste, dann würde er ab morgen schon nicht mehr leben. Ganz kurz – Prozess. Aber weil ich Humanist bin, deshalb habe ich solche Auffassungen … All das Geschwafel von wegen nicht hinrichten und nicht Todesurteil – alles Käse is’ Genossen. Hinrichten den Menschen ohne [… unverständlich …], ohne Gerichtsbarkeit und so weiter.
Danach höre ich eine Aufnahme aus den frühen fünfziger Jahren, von einer Gerichtsverhandlung. Plötzlich erfüllt die Stimme von Hilde Benjamin den Raum, der »roten Hilde«, Vizepräsidentin des Obersten Gerichts und dann von 1953 bis 1967 gefürchtete Justizministerin, verantwortlich für zahlreiche politische Schauprozesse und auch Todesurteile. Benjamin beschuldigt den Angeklagten mit schneidender, fanatischer Stimme, herrscht ihn an, fordert Antworten auf Fragen, die gar keine sind. Die Stimme des Angeklagten klingt erstickt und ist kaum zu verstehen.
Etwas über Mielke und Benjamin gelesen zu haben ist das eine, ihre Stimmen zu hören und darin ihren Hass und ihre Brutalität zu erkennen, etwas ganz anderes. Ich frage Frau Kegel, wie sie das aushält, jahrelang, Tag um Tag, Woche um Woche solche Bänder anzuhören. Natürlich hat sie im Lauf der Zeit auch eine gewisse Routine entwickelt, professionelle Distanz. Aber manchmal nützt selbst die Routine nichts, da erreicht das, was sie hört, unmittelbar ihr Herz. Dann braucht sie jemanden zum Reden. Und manchmal, erzählt sie mir, hilft es einfach, joggen zu gehen, um die Stimmen aus dem Kopf zu bekommen.
Zum Glück, so erfahre ich, gibt es in den Akten auch die ganz anderen, die guten Geschichten. Sie werden mir in den kommenden Jahren immer wieder ein Trost sein, und von ihnen werde ich oft erzählen. Die Akten der Staatssicherheit bezeugen nicht nur Schande, Verrat und Leid. In ihrer unablässigen Jagd auf Feinde und alle, die sie dafür hielt, sammelte die Stasi unfreiwillig auch die Geschichten derer, die sie bekämpfte. Der Mut der Widerständigen, die Zivilcourage und die Phantasie der Unangepassten, die Würde jener, die sich nicht beugten und nicht bereit waren, ihren Nächsten zu verraten – all das ist zehntausendfach überliefert. Zwar in der unsäglichen, ja bösen Sprache der Staatssicherheit, aber wenn wir gelernt haben, sie zu ertragen und zu durchschauen, entdecken wir dahinter Menschen, deren Freiheitswillen und Würde uns noch heute berühren und beeindrucken.
Am Ende des Tages bin ich erschöpft, aber auch aufgeregt und glücklich. Beim Gang durch die Magazine und vor allem im Gespräch mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ist mir erneut bewusst geworden, wie wertvoll die Unterlagen sind, die hier verwahrt werden. Und ich empfinde wie in den kommenden Jahren bei jedem Besuch im Archiv Genugtuung, weil diese Akten vor der Vernichtung bewahrt wurden und zugänglich sind. Und nicht zuletzt Respekt vor dem, was hier Tag für Tag geleistet wird. In den folgenden Tagen und Wochen, wenn ich meine ersten Besuche in den anderen Abteilungen und den Außenstellen mache, wird es mir immer wieder so gehen.
Von nun an wird das Erinnern Dreh- und Angelpunkt meiner Arbeit sein. In den folgenden zehn Jahren als Bundesbeauftragte werde ich unzählige Vorträge halten, in denen ich erkläre, was die Staatssicherheit war und welche Bedeutung sie in der SED-Diktatur hatte. Ich werde erzählen, wie die Stasi-Akten in einem historischen Akt der Zivilcourage vor der Vernichtung gerettet wurden. Welche Proteste, politischen Konflikte und Kompromisse nötig waren, um sie auch im vereinten Deutschland zugänglich zu machen. Was es für die Opfer der Staatssicherheit bedeutet, mit Hilfe der Akten das eigene Schicksal zu rekonstruieren und Antworten auf Fragen zu finden, die sie jahrzehntelang gequält haben – und dass sie nun endlich die nötigen Beweise für ihre Rehabilitierung und Entschädigung in der Hand halten. Und wie wichtig die Akten für die Forschung oder für die öffentliche Aufarbeitung in den Medien sind.
Immer wieder spreche ich außerdem über den Wert des Erinnerns. Wie oft versuche ich, Menschen zu ermutigen, sich ihrer eigenen Geschichte bewusst zu werden! Gegen die weitverbreitete Neigung, das Vergangene zu vergessen oder zu verdrängen, weil es angeblich den Blick auf das Heute und die Zukunft verstellt, werbe ich dafür, Erinnerung als Reichtum anzusehen, als Ausdruck von Kultur und Selbstbewusstsein. Und dafür, auch die traurigen, unangenehmen, leidvollen Erinnerungen zuzulassen. Das ist schwer. Aber ich habe immer wieder erlebt, wie befreiend es sein kann, das Schweigen zu brechen.
Zwölf Jahre nach diesem denkwürdigen ersten Gang durch das Archiv habe ich mit dem Erinnern in eigener Sache begonnen. Ich hole meine Fotokisten hervor und meine alten Kalender, lese Briefe, darunter die, die meine Eltern einander im Krieg schrieben, und blättere in alten Zeitungen. Ich beneide alle, die jahrzehntelang ordentliche Tagebücher geführt haben, und frage meine ältere Schwester aus. Was würde ich gern noch alles von meiner Mutter und meiner Großmutter wissen! Sie leben nicht mehr, und ich habe nicht genug gefragt. Bei den jährlichen Treffen meiner Abiturklasse höre ich plötzlich viel genauer hin. Ich beruhige meine Kinder, die das Vorhaben ihrer Mutter zwar interessant finden, aber keinen Zweifel daran lassen, dass sie, wenn es um sie geht, größte Zurückhaltung erwarten. Ich sortiere die erhalten gebliebenen Fragmente meiner Stasi-Akte, meine Notizen, die ich als Brandenburger Ministerin gemacht habe, und besuche das Archiv Grünes Gedächtnis, um meine Zeit als Parteivorsitzende von Bündnis 90/Die Grünen zu rekonstruieren. Ich finde Schulaufsätze, Liebesbriefe und eine Mappe mit Bildern, die meine Kinder gemalt haben. Ich pinne alte Wahlplakate an meine Wände und lese noch einmal die Reden, die ich als Volkskammerabgeordnete gehalten habe. Auch in meiner Wohnung gibt es stumme Zeitzeugen: Ich befrage Bilder und Leuchter und den alten Korkenzieher meines Vaters danach, was sie mir erzählen können. Mein Videorecorder hat schon vor Jahren schlappgemacht – dabei ist da noch eine Kiste voller Videokassetten, die ich ansehen will. Ich frage mich, wie um alles in der Welt Menschen früher ihre Erinnerungen zu Papier gebracht haben, als es noch keine Recherchemöglichkeiten im Internet gab. Besonders wichtig ist mir der Austausch mit den langjährigen Weggefährten und Freunden, die ich aus der DDR-Opposition kenne, aus meiner Zeit im Ministerium und bei den Grünen.
Manchmal lachend, manchmal weinend, gelegentlich sentimental und ab und zu auch peinlich berührt tauche ich in vergangene Jahrzehnte ein. Verborgenes kommt zum Vorschein, und manchmal ist es schwierig oder schmerzhaft, mir selbst gegenüber wahrhaftig zu sein. Ich schreibe und schreibe, wohl wissend, dass meine Erinnerung nicht wiedergibt, was war, sondern was mir an Erlebtem zugänglich ist und wie es sich in meinem Bewusstsein und in meinem Herzen abgelagert hat.
Ich gehöre zur ersten Nachkriegsgeneration. Der politische Hintergrund meiner Kindheit, meiner Jugend und meiner ersten fünf Lebensjahrzehnte ist die zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts. Der Nachhall von Nationalsozialismus und Krieg, das eingemauerte Leben in der kommunistischen Diktatur und die Erfahrung der Befreiung durch die Herbstrevolution 1989 haben mich geprägt. Weil ich von früh an dazu erzogen wurde, politische Ereignisse wahrzunehmen, und dadurch zu einem politischen Menschen geworden bin, sind meine Erinnerungen, oft auch die ganz persönlichen, eng mit dem verwoben, was in der Welt geschah. Genau hier liegt zugleich ein Problem: Ich möchte eine politische Biographie schreiben. Aber wie viel Geschichte verträgt meine Geschichte?
Ein persönliches Buch über die DDR zu schreiben sei schwer bis unmöglich, beklagte ich mich bei einem Freund, dem Historiker Ilko-Sascha Kowalczuk. Was ich zum Beispiel über die Herbstrevolution von 1989 erzählen könne, sei ja längst in vielen Büchern nachzulesen, nicht zuletzt in seinem Buch Endspiel. Es gehe ja nicht um ein weiteres wissenschaftliches Werk, sondern um meine Erfahrungen, lautete seine Antwort. Insofern könne ich auch von Ereignissen berichten, an denen ich nicht beteiligt war, aber eben so, wie ich sie aus der Nähe oder Ferne erlebt hätte, und gerade nicht als reine Chronistin. Natürlich hätte ich mir wie in den letzten zwanzig Jahren in vielen öffentlichen Vorträgen oder in Diskussionen mit Schulklassen so etwas wie einen geschichtspolitischen »Auftrag« zu eigen gemacht. Es habe schließlich zu meiner Rolle gehört, vereinfachend, manchmal auch holzschnittartig oder oberflächlich zu argumentieren. Jetzt sei es freilich umgekehrt: Jetzt müsse ich in die Tiefe gehen, exemplarisch, aber differenziert erzählen, weniger das große Ganze, sondern von mir selbst mit meinen Erfahrungen, Wahrnehmungen, Hoffnungen.
Ilko hatte recht. Wenn ich in den zurückliegenden Jahren über meine persönlichen Erfahrungen berichtet hatte, stand dies zumeist im Dienste einer pädagogischen Absicht, eines politischen Ziels oder einer vergangenheitspolitischen Debatte. Würde es mir gelingen, die Routine meiner öffentlichen Rollen und meine geschichtspolitischen Ambitionen hinter mir zu lassen, ganz bei meinen Erinnerungen zu bleiben, meinen Hoffnungen und Enttäuschungen, meinen Niederlagen, Triumphen und Unsicherheiten? Wie auch immer – ich will einfach erzählen. Einfach erzählen …
2
Eine Berliner Familie
In der Unfreiheit muß die Freude ersticken. Die echte, unverstellte Freude ist eine Frucht der Freiheit. Ostberlin erfährt es an diesem Tag, Leipzig, Halle und Magdeburg erfahren es. Dieser Tag beschenkt die 18 Millionen mit der Auferstehung der Fröhlichkeit und des Lachens. Das ist die Wahrheit, die von einem Ende in Blut, Tränen und Haß nicht widerlegt werden kann.
Klaus Harpprecht, Klaus Bölling: Der Aufstand
Mein Vater ist mehr als besorgt. Er läuft unruhig in der Wohnung hin und her und tritt immer wieder auf den Balkon, um nach meiner Mutter Ausschau zu halten. Wo bleibt sie nur? Sie ist am Morgen losgefahren, um ihre Freundin, meine Patentante Charlotte, zu besuchen, die in Buckow in der Märkischen Schweiz, östlich von Berlin, lebt. Von Berlin-Friedrichshain nach Buckow ist man fast zwei Stunden unterwegs. Man muss zuerst mit der S-Bahn und dann mit einem Vorortzug fahren und abends den langen Weg zurück. Mein Vater ist wegen der Ereignisse in Berlin gegen diesen Ausflug gewesen, aber meine Mutter hat versprochen, rechtzeitig nach Hause zu kommen. In der Stadt herrschen zugleich Hoffnung und Furcht. In Ost-Berlin haben in den letzten Tagen unzählige Menschen gegen SED und Regierung demonstriert und Freiheit und Einheit gefordert. Meine Eltern gehören nicht zu den Demonstranten, beziehen ihre Informationen aber aus Gesprächen, Gerüchten und vor allem vom RIAS, dem »Rundfunk im amerikanischen Sektor«. »Jetzt wird alles anders«, höre ich aus den Unterhaltungen der Erwachsenen heraus – es klingt mal froh und hoffnungsvoll, mal besorgt und ängstlich. Von den Russen ist die Rede, und ob die sich das gefallen lassen würden. Ich bin fünf Jahre alt und habe keine Ahnung, worum es geht, aber wie alle Kinder bin ich hellwach für die Stimmung meiner Eltern, und die signalisiert Gefahr.
Seit mittags 13 Uhr herrscht »Ausnahmezustand«, und das scheint etwas sehr Schlimmes zu sein. Die »Sperrstunde« wird gleich beginnen, und meine Mutter ist noch immer unterwegs. Ist sie, wie meine Großmutter hofft, vorsichtshalber über Nacht bei ihrer Freundin in Buckow geblieben? Sicher nicht, denn sie weiß, dass wir auf sie warten. Was aber, wenn sie zum Beginn der Sperrstunde noch nicht zurück ist? So viel verstehe ich: Meine Mutter ist in Gefahr und mein Vater außer sich vor Sorge. In meiner Erinnerung fahren Panzer mit lautem Dröhnen direkt unter unserem Fenster vorbei; ob es wirklich so war, ist sehr zweifelhaft. Wie kommt es, dass das Bild von meinem nervös wartenden Vater in mir haftengeblieben ist, während ich so vieles aus derselben Zeit vergessen habe? Ist es, weil die wichtigsten Menschen in meinem Kinderleben außer sich waren vor Hoffnung und vor Angst? Oder weil derlei Erinnerungen zu dem Leben passen, das ich später geführt habe? Die besonders lebendigen und plastischen Erinnerungen, sagen die Gedächtnisforscher, geben Auskunft darüber, wer wir sind und warum wir so sind, wie wir sind.
Unsere Wohnung befand sich in der vierten Etage eines Hauses in der Warschauer Straße, wenige Minuten von der Oberbaumbrücke, also der Grenze nach West-Berlin, entfernt. Hier wurde ich im dritten Nachkriegsjahr geboren – mein Vater war davon überzeugt, dass Mutter und Kind zu Hause besser aufgehoben seien als auf einer Geburtsstation. Meine sechs Jahre ältere Schwester Monika liebt es zu erzählen, wie unser Vater sie an einem Januarmorgen weckte, auf den Arm nahm und mit ihr in das große Zimmer ging, um die in der Nacht auf die Welt gekommene kleine Schwester zu begrüßen.
Wir waren zu fünft in der Zweizimmerwohnung – die beiden Eltern, wir zwei Geschwister und unsere Großmutter. Wichtigster und im Winter wärmster und gemütlichster Raum war die nahe der Eingangstür gelegene Küche, in der meine Großmutter alle Verfügungsgewalt hatte. Dort stand der Familienesstisch, und dort wurde ich auch gebadet – in einer Zinkwanne, die auf zwei Stühlen stand. Hinter der Tür war mein Spielzeugregal und daneben der Stuhl, auf den ich zum An- oder Ausziehen gestellt wurde. Ich hasste die kratzenden langen Wollstrümpfe, die vorn und hinten mit Strumpfhaltern am Leibchen, einer Art Unterwäscheweste, befestigt waren. Strümpfe und Strumpfhalter mussten sein, denn lange Hosen gab es nicht, und meine Mutter war dagegen, dass meine Schwester und ich wie viele unserer Freundinnen unter unseren Röcken Trainingshosen trugen. Diese kratzigen Strümpfe waren der Hauptgrund, Jahr um Jahr dem Frühlingstag entgegenzufiebern, an dem wir endlich Kniestrümpfe tragen durften. Manche Eltern setzten dafür ein festes Datum an, bei uns musste das Thermometer mindestens 15 Grad Celsius am Morgen zeigen. Während Leibchen und Kratzstrümpfe zur unangenehmen Seite des Winters gehörten, gab es ein abendliches Ritual, das für mich bis heute Inbegriff von Wohlbehagen und Geborgenheit ist: Weil im Winter außer der Küche kein Raum beheizt war, wurde ich, auf meinem Anziehstuhl stehend, schon im Nachthemd und bettfertig, bis zum Hals in eine vorher am Ofen angewärmte Decke gewickelt und dann als warmes Bündel ins kalte Bett gesteckt.
Das Küchenfensterbrett war mein Tisch, an dem ich Bilder malte und später meine ersten Buchstaben übte. Dort saß ich und las meiner Oma immer wieder das Zentimetermaß vor, mal von vorn und mal von hinten – ich mochte Zahlen. Vom Küchenfenster aus hörten wir auch den Leierkastenmann, der von Hof zu Hof zog. Meine Großmutter ließ mich Zehnpfennigstücke in ein Stück Zeitungspapier einwickeln und aus dem Fenster werfen. Manchmal kam unten auch der Scherenschleifer vorbei. Der Schleifstein, der sich mit Hilfe eines Fußhebels drehte, kreischte laut und sprühte Funken – ein wahres Spektakel für alle Kinder im Haus.
Oma brachte uns Küchenlieder bei: »Lenchen ging im Wald spazieren / und sie war allein / und da stellt sich zum Verführen / gleich ein Jüngling ein.« Oder: »Mariechen saß weinend im Garten / im Grase lag schlummernd ihr Kind.« Es waren die Lieder ihrer Jugend, die von Sehnsucht, von großer Liebe, vom Verführt- und Verlassenwerden handelten. Die Mutter meiner Mutter, Martha Lepski oder, wie man in ihrer Heimat sagte, »die Lepski Martha«, stammte aus Bunzlau in Schlesien, heute Bolesławiec, und war 1907 mit 14 Jahren als Dienstmädchen nach Breslau »in Stellung« geschickt worden. Es erging ihr wie unzähligen Kindern armer Familien, denen zumeist ein schweres, arbeitsreiches Leben bevorstand, oft auch Ausbeutung und Demütigungen durch die »Herrschaft«. Das harte Leben nährte die heimliche Sehnsucht nach Zuwendung und Liebe. Doch wenn ein Dienstmädchen sich verliebte und sich »ihrer Ehre berauben ließ«, war das Risiko groß. Wurde sie schwanger, landete sie auf der Straße. Manche nahmen sich dann das Leben, andere gaben ihr Kind weg und suchten sich eine neue Stelle – so wie Anna, die Schwester meiner Großmutter. Als der Sohn des Bauern, bei dem sie als Magd arbeitete, die bildschöne Anna heiraten wollte, stellte sie eine Bedingung: Ihr Kind, das sie weggegeben hatte, um arbeiten zu können, wollte sie wieder bei sich haben. Der Bauer stimmte zu, allerdings unter dem Vorbehalt, dass das Kind im Haus versteckt würde. Der Junge trug durch diese Misshandlung offenbar schwere Schäden davon, denn später hieß es von ihm, er sei »nicht ganz richtig im Kopf«. Anna erkämpfte sich durch harte Arbeit die Achtung der Familie und brachte sechs weitere Kinder zur Welt, bekam von Hitler das Mutterkreuz verliehen und verlor bald darauf drei ihrer Söhne, die kurz nacheinander im Zweiten Weltkrieg fielen.
Meine Großmutter Martha hatte es besser getroffen, obwohl sie in ihren ersten Monaten als Dienstmädchen so kurz gehalten wurde, dass sie bald wegen Unterernährung ins Krankenhaus eingeliefert werden musste. Dann aber trat sie ihre zweite Stelle in Berlin an. Die neuen »Herrschaften« behandelten sie besser, sie bekam pro Woche einen Nachmittag frei und fünf Mark Taschengeld pro Monat. Mit neunzehn verliebte sie sich in den wie sie aus Bunzlau stammenden Schlosser Wilhelm Gotter, und als sie schwanger wurde, heirateten die beiden. Erika, meine Mutter, kam am 11.12.13 zur Welt – ich war von diesem Geburtsdatum immer fasziniert. Genau ein Jahr später wurde ihre Schwester Käthe geboren, und Wilhelm und Martha lebten mit ihren beiden Töchtern in der Gubener Straße in »Stube und Küche«. Über das beengte, bestimmt nicht sorgenfreie Leben der Familie habe ich stets nur fröhliche Geschichten gehört. Erst als die beiden Töchter erwachsen waren, zog die Familie in eine Zweizimmerwohnung in der Warschauer Straße. Diese Wohnung blieb für die nächsten fünfundzwanzig Jahre das Zuhause meiner Mutter.
Der vierzehnjährigen, wissbegierigen Erika blieb eine höhere Schulbildung versagt. Das Abitur, womöglich sogar ein Studium – für ein Mädchen aus einer Berliner Arbeiterfamilie war Ende der zwanziger Jahre des vorigen Jahrhunderts ein anderer Lebensweg vorgezeichnet. Die achtjährige Volksschule hatte zu genügen, danach folgten eine Lehre und mehrere Berufsjahre als Zuschneiderin. Ein Foto zeigt eine junge Frau in schwarzem Arbeitskittel und mit modischem Bubikopf, die ihrer Kollegin über die Schulter schaut, die linke Hand, in der sie ein langes Lineal hält, in die Taille gestemmt. Das Stehen auf dem Zementboden am Zuschneidetisch, vom Morgen bis zum Abend, ruinierte ihre Beine – die geschwollenen und schmerzenden Knöchel und Füße machten ihr zu schaffen, solange sie lebte. So entschloss sie sich, ihrem Traum, in einem Büro zu arbeiten, ein wenig näher zu kommen. Sie lernte in jahrelangen Abendkursen Stenographie und Schreibmaschine und trat schließlich 1938 bei der »Reichsstelle für technische Erzeugnisse« eine Stelle als Stenotypistin an. Wenn sie später über diesen Wechsel erzählte, war ihr anzumerken, wie stolz sie darauf war. Aber wie die meisten Frauen damals gab sie ihren Beruf auf, als die Geburt des ersten Kindes bevorstand.
Der Sport war für beide Schwestern Mittelpunkt ihres Lebens. Käthe spielte Handball, während meine Mutter an den Sommerwochenenden in einem Achter-Ruderboot auf Berliner Gewässern unterwegs war. Auf einem Foto steht sie in einer Reihe mit ihren Ruderkameradinnen vor der Hakenkreuzfahne, die Anführerin hat den rechten Arm zum Hitlergruß erhoben. Das passt nicht in das Bild, das ich von meiner Mutter habe. Sie war nie eine Anhängerin der Nazis und gehörte eher zu den vielen, die sich an die Verhältnisse anpassten und sich ihren Teil dachten. Zwiespältige Gefühle befallen mich auch angesichts der Begeisterung, mit der meine Mutter die Olympischen Spiele 1936 verfolgt hat, die von Hitler für seine maßlose Propaganda benutzt worden waren. Viele Monate vorher hatte sie sich schon Eintrittskarten besorgt und vorsorglich Urlaub beantragt, und als die Spiele stattfanden, verbrachte sie ganze Tage an den Schauplätzen der Wettkämpfe. Und dann jener Abend, an dem sie am Arm ihres Freundes, der ein paar Stunden zuvor eine Ruder-Bronzemedaille gewonnen hatte, durch die Stadt ging! Von diesem Abend hat sie noch erzählt, als sie eine alte Frau war.
Einige Zeit später lernten sich meine Eltern während eines Skiurlaubs kennen. Mein Vater, Andreas Radtke, wurde 1908 als zweitjüngstes Kind seiner sehr frommen protestantischen Eltern Marie und Ferdinand geboren. Die Familie lebte in Berlin-Reinickendorf schlecht und recht von der Uniformschneiderei des Vaters. Marie schenkte fünf Söhnen und vier Töchtern das Leben. Als ich heranwuchs, lebten nur noch vier der neun Geschwister. Von Tante Lydia habe ich das meiste über meine väterliche Familie erfahren. Sie, die sich als älteste Tochter um den Haushalt und ihre Geschwister zu kümmern hatte, bis alle aus dem Haus waren, blieb ledig: keine Zeit für eine eigene Familie. In großen Abständen besuchte uns ihr Bruder Gerhard und erzählte gruselige Geschichten aus seiner Internierungszeit. Gerhard war Polizist. Vor dem Krieg war er nach Sumatra ausgewandert, wo er Orchideen züchtete, und zwar zusammen mit seinem Lebensgefährten – ein sorgsam gehütetes Familiengeheimnis. Im Zweiten Weltkrieg wurde er von Engländern in Indien interniert. Nach Kriegsende kehrte er nach Europa zurück und war von da an mit einem wohlhabenden Holländer liiert. Die jüngste Schwester, Lotte, Jahrgang1915, war mit einem hohen Offizier und NSDAP-Mitglied verheiratet gewesen, der kurz nach Kriegsende gestorben war. Als Offizierswitwe konnte sie in West-Berlin ihre drei Kinder großziehen, ohne einem Beruf nachgehen zu müssen. Zwischen ihr und meiner Mutter hat es manchmal Zwist gegeben, vor allem wegen politischer Meinungsverschiedenheiten. So erzählte uns meine Mutter, ihre Schwägerin habe sich einst darüber mokiert, dass meine Eltern ihren Kindern keine »germanischen« Vornamen gegeben hätten.
Mein Vater besuchte bis zu seinem 14. Lebensjahr die Elementarschule und absolvierte anschließend eine kaufmännische Lehre. Offenbar schlug er sich danach mit unterschiedlichen Jobs durch. Als meine Eltern sich kennenlernten, war er Skilehrer, in der Heiratsurkunde hieß es, er sei Grundstücksvermittler, und in seinen Briefen ist von Vertretertätigkeit die Rede. Geschäfte zu machen gehörte zu seinem Leben.
Der Zweite Weltkrieg hatte begonnen. Der Vater meiner Mutter starb, ihre Schwester Käthe heiratete und wohnte fortan mit ihrem Mann in Bohnsdorf im Südosten Berlins. Meine Eltern heirateten im Mai1941, woraufhin Andreas zu Frau und Schwiegermutter in die Warschauer Straße zog. Ein halbes Jahr später, wenige Monate bevor sein erstes Kind zur Welt kam, wurde er Soldat. Das Familienleben, von dem meine Eltern träumten und das sie in den Briefen beschworen, die sie sich während des Krieges schrieben, sollte erst fünf Jahre später beginnen.
Nach seiner Einberufung im November 1941 war mein Vater im ostpreußischen Eydtkau an der Grenze zu Litauen stationiert und in der Schreibstube einer Entlausungsstelle beschäftigt. Wenige Monate zuvor, im Juni1941, hatte die Wehrmacht Litauen, das erst ein Jahr vorher von der Sowjetunion besetzt worden war, nach heftigen Bombardements eingenommen. In den darauffolgenden Monaten ermordeten und deportierten Einsatzgruppen und die Gestapo, unterstützt von einheimischen Helfern und der Wehrmacht, 90 Prozent der jüdischen Bevölkerung Litauens. Im August 1942 wurde mein Vater nach Belgrad verlegt. Auch in Serbien waren zu diesem Zeitpunkt bereits fast alle jüdischen Einwohner ermordet worden. Doch mein Vater erzählte in allen seinen Briefen – aus Litauen ebenso wie aus Serbien – lediglich von freundlichen Kontakten zu den Einheimischen, auch von Geschäften, die er mit ihnen machte. Ich suche in den Briefen vergeblich nach Spuren der entsetzlichen Geschehnisse. Kann er dort gelebt und mit Bewohnern oder anderen Wehrmachtsangehörigen gesprochen haben, ohne von dem Schicksal der jüdischen Bürger erfahren zu haben? Das ist mehr als unwahrscheinlich. Doch in keinem der Briefe ist auch nur eine Andeutung davon zu finden, und es gibt nicht den geringsten Anhaltspunkt dafür, dass er zu Hause darüber gesprochen hat.
Die letzten erhalten gebliebenen Briefe an meine Mutter, die sie allerdings erst viele Monate später empfing, schrieb er wenige Wochen vor Kriegsende aus Sarajevo. Den Berichten meiner Mutter zufolge verließ er dort die Truppe und schlug sich nach Hause durch – davon etwa 900 Kilometer zu Fuß. Als er wenige Wochen nach Kriegsende in Berlin ankam, war er seit fast einem halben Jahr ohne jede Nachricht von seiner Familie.
Meine Mutter war, um den Bombenangriffen in Berlin zu entgehen, Anfang 1944 mit meiner damals zweijährigen Schwester Monika und in Begleitung meiner Großmutter nach Sandow evakuiert worden, einem kleinen Dorf südöstlich von Frankfurt an der Oder. Schwägerin Lotte war mit ihren drei Kindern ebenfalls dort. In Sandow brachte meine Mutter ihre zweite Tochter zur Welt. Anfang Juni hatte die Rote Armee Sandow erreicht. Ein mehrere Kilometer breites Gebiet östlich der Oder wurde von allen dort lebenden Deutschen geräumt. In einem Brief an Lotte, die mit ihren Kindern rechtzeitig nach Berlin zurückgekehrt war, erzählt meine Mutter nach Kriegsende davon:
Was wir auf einen kleinen Leiterwagen bekamen, konnten wir mitnehmen. Lohmanns hatten ja ihren großen Wagen mit, da durften wir die Moni immer draufsetzen. Dann ging es in langem Treck Richtung Osten. Aufgrund der Naziverhetzung glaubten wir nun alle fest, es ist nun das Verschleppen in den großen Osten. 8 Wochen waren wir auf der Landstraße, in Scheunen und Ställen, ohne zu wissen, wozu und wohin. Es war grausam, so im Dreck zu leben, es ging bis zu dem Ort Schönow hinter Lagow. Dort hatte ich wenigstens endlich mal eine warme Stube für die Kinder und dort blieben wir bis zu den ersten Maitagen. Am 16.4., als der Angriff losging und die Flugzeuge stundenlang in Richtung Westen über uns hinwegrollten, starb mein Kleines, sie hatte einen Brechdurchfall, ich hatte keinen Tee und keine Medikamente.
Was meine Mutter in ihrem Brief nicht erwähnte: Unzählige Frauen wurden in diesen Wochen von Soldaten der Roten Armee vergewaltigt. Sie gehörte dazu. Ende April endlich durften die Frauen sich mit ihren Kindern auf den Weg nach Hause machen: »Am 8.5. trafen wir in Sandow ein, ich weinte Freudentränen, als ich an dem Tage von den Russen hörte, daß der unsinnige Krieg endlich aus ist … Nach 8 Tagen Sandow ging es mit den jungen Frauen und Kindern … nach Berlin, bis Frankfurt gelaufen und dann gefahren.«
Von der Rückkehr in die Warschauer Straße hat meine Mutter gelegentlich erzählt: Hatten sie, ihre Tochter und ihre Mutter überhaupt noch ein Zuhause? Die Erleichterung beim Anblick des unzerstörten Gebäudes muss überwältigend gewesen sein, ebenso wie die Heimkehr meines Vaters wenige Wochen später. Beide hatten mehrere Monate lang keinerlei Nachrichten voneinander bekommen, wussten nicht einmal, ob der jeweils andere noch am Leben war. Mein Vater hatte seine Tochter Marianne, die nur neun Monate alt wurde, nie gesehen, es existiert auch kein Foto von ihr. Wollten meine Eltern, als ich zweieinhalb Jahre später geboren wurde und sie mir denselben Namen gaben, damit das Geschehene vergessen machen? Gut möglich. Ich als Kind habe es anders gedeutet, und es hat mich belastet: Viele Jahre war ich der Ansicht, dass es mich nur gab, weil meine Schwester gestorben war.
Vom Krieg war bei uns zu Hause fast nie die Rede. Meine Eltern waren »noch einmal davongekommen« – sie wollten vor allem leben, und dies nach Möglichkeit gut. Das Erlebte miteinander zu teilen, den Nationalsozialismus und die Kriegserfahrung »aufzuarbeiten«, wie wir das heute nennen würden – davon konnte in diesen Jahren keine Rede sein. Vor allem mein Vater versuchte nachzuholen, was ihm in den Kriegsjahren versagt geblieben war: Unbeschwertheit, Familienleben und Feiern mit Freunden. Meine Mutter hätte, so klang es manchmal an, gern ruhiger gelebt. Sie hat nie darüber gesprochen, wie sie den Verlust ihres Kindes und die Vergewaltigung verkraften konnte. Einmal nur, als meine Schwester und ich längst erwachsen waren, erzählte sie uns, wie gekränkt sie war, nachdem sie ihrem Mann, unserem Vater, von der Vergewaltigung erzählt hatte und dann seine kaum verhohlenen Vorwürfe spürte. Trotz dieser Erfahrungen mahnte sie uns: »Wenn ihr hört, was die Russen in Deutschland gemacht haben, denkt immer daran, was deutsche Soldaten vorher in Russland angerichtet haben!« Für diese Einstellung, die ganz untypisch für ihre Generation ist, habe ich meine Mutter immer bewundert. Heute glaube ich, dass sie versucht hat, damit ihr eigenes Leiden zu mildern, vielleicht auch zu verdrängen.
Meine Großmutter, meine Schwester Monika und ich schliefen im kleineren Zimmer zum Hof. Die Eltern bewohnten das nach vorn gelegene Wohnzimmer und das mit Hilfe einer zusätzlichen Tür in ein Durchgangszimmer umfunktionierte letzte Ende des Korridors. Es war groß genug für einen Schrank und das Bett meiner Mutter, die zeit ihres Lebens der Auffassung war, getrennte Betten seien die wichtigste Voraussetzung einer glücklichen Liebe. Eine Couch im Wohnzimmer diente meinem Vater als Bett. Es interessierte uns Kinder nicht, ob die Eltern in einem oder in zwei Betten schliefen. Viel wichtiger war, dass die Couch im Wohnzimmer breit genug dafür war, dass wir dort an freien Tagen nach dem Aufwachen mit unserem Vater herumtoben konnten. Das begann regelmäßig damit, dass er seinen großen Zeh an ein Ölgemälde mit einer Meereslandschaft über dem Bett hielt und »Hu, ist das Wasser heute wieder kalt!« rief.
Er liebte es, andere zum Lachen zu bringen. Diesbezüglich waren er und seine Schwiegermutter ein großartiges Team mit wunderbaren Einfällen. Während unsere Mutter mit etwas bemühtem Lächeln kopfschüttelnd zusah, holten die beiden die Gardinen von der Stange, um sich damit zu verkleiden. Oder meine Großmutter bohnerte die Rückseite des Bügelbretts, damit wir Kinder eine Rutsche hatten. Nach irgendeinem Streit zwischen Oma und mir schlug mir mein Vater ein Rachekomplott vor, das darin bestand, einen vollen Wassereimer in den Flur zu stellen und die Sicherungen herauszudrehen, so dass Oma im Dunkeln bestimmt darüber fallen würde. Zum heimlichen Vergnügen der beiden Erwachsenen hielt ich es nicht aus und lief heulend los, um meine Großmutter zu warnen.
Von Zeit zu Zeit winkte mich mein Vater, wenn er nach Hause kam, verschwörerisch zu sich und zeigte mit geheimnisvoller Geste auf seine Aktentasche. Ich verstand sofort: Bücklinge. Keiner in der Familie mochte Bücklinge so wie wir beide, das verband uns. Ich mochte vor allem den Rogen, mein Vater tat so, als ob ihm die Milch das liebste wäre. Auf meine Frage, warum die einen Bücklinge Rogen und die anderen Milch hatten, antwortete er etwas ausweichend, dass es sich um Fischweibchen und Fischmännchen handle. Ich kombinierte: Die Milch kommt von den Müttern. Also waren diese Bücklinge die Fischweibchen, und die mit dem Rogen die Männchen. Niemand dachte auch nur daran, mich über meinen Irrtum aufzuklären, und meine große Schwester, die bei anderen Gelegenheiten für solche heiklen Fragen zuständig war, mochte keinen Fisch.
Zu Weihnachten legte sich mein Vater unglaublich ins Zeug. Der Baum reichte bis zur Decke und war mit vielen silbernen und einigen wenigen roten Kugeln geschmückt; hinzu kam Lametta, das nach den Festtagen sorgfältig abgesammelt, verpackt und für das nächste Jahr aufbewahrt wurde – das schwere, sogenannte Bleilametta gab es im Osten nicht zu kaufen, und es wäre Verschwendung gewesen, jedes Jahr Westgeld dafür auszugeben. Die Kerzenhalter hatte mein Vater anfertigen lassen. Sie waren auf verschieden langen, dünnen Metallstangen befestigt, die mittels eines Gewindes in den Baumstamm geschraubt wurden. Die Kerzen ließen sich auf diese Weise unabhängig von den Zweigen platzieren, was jeden, der schon einmal einen Weihnachtsbaum geschmückt hat, auf Anhieb überzeugen würde. Diese Kerzenhalterstangen sind bei mir bis heute in Gebrauch, und ich frage mich, warum es vor Weihnachten alles Mögliche zu kaufen gibt, nur nicht derart praktische Weihnachtsbaumkerzenhalterstangen.
Während unsere Eltern das Wohnzimmer in ein Weihnachtsparadies verwandelten, blieben wir in der Küche nicht untätig. Sämtliche Puppen wurden mit den – von unserer Oma genähten und gestrickten – Sonntagssachen feingemacht und in eine Reihe gesetzt. Dann waren wir dran. Oma hielt die Brennschere über die Gasflamme und drehte uns Löckchen. Schließlich probten wir ein letztes Mal unsere Weihnachtsgedichte – ohne Gedicht keine Bescherung.
Auch noch Jahre nach Kriegsende war Wohnraum knapp. Während wir wenigstens eine ganze Wohnung für uns hatten, waren Onkel Otto und Tante Ruth, eine Cousine meiner Mutter, mit ihren beiden Töchtern im vorderen Bereich einer geteilten Wohnung in der Kreuzberger Oranienstraße untergekommen. Im hinteren, nur durch einen Vorhang abgetrennten Teil lebte eine andere Familie. Die beengten Verhältnisse hinderten die Erwachsenen nicht, oft und ausgiebig zu feiern. Ich mochte es, irgendwann in der Zimmerecke auf zwei zusammengeschobenen Sesseln inmitten des Trubels einzuschlafen. Tief in der Nacht fuhren wir nach Hause – mit der Hochbahn von Kreuzberg über die Oberbaumbrücke bis zur Warschauer Brücke –, ich halb schlafend auf dem Arm meines immer noch sehr lustigen Vaters.
Höchstens 500 Meter waren es von unserem Haus bis zur Spree und zur Oberbaumbrücke, der vielleicht nicht schönsten, aber originellsten Brücke Berlins. So wie heute überquerten auch damals Fußgänger die Brücke auf ihrem unteren Teil, über ihren Köpfen der Hochbahn-Viadukt. Der »Magistratsschirm« – so wurden die Hochbahntrassen von den Berlinern genannt – bot bei schlechtem Wetter Schutz. Die damalige Linie B führte durch West-Berlin, nur ihre östliche Endstation lag jenseits der Grenze – bei uns in der Warschauer Straße. Die Grenzkontrollen zwischen Ost- und West-Berlin waren zumeist harmlos. Gelegentlich wurde das Vorzeigen der Ausweise verlangt, beim Gepäck wurde mehr auf das geachtet, was von Ost nach West transportiert wurde, als umgekehrt. Ulbrichts Regierung fürchtete nicht zu Unrecht, dass die im Osten stark subventionierten Grundnahrungsmittel von West-Berlinern aufgekauft wurden. Nach dem Mauerbau verwandelte sich die Endstation in einen Geisterbahnhof, ihre Gleisverbindung zur Oberbaumbrücke wurde abgerissen. Zu dem Zeitpunkt wohnten wir aber schon nicht mehr in der Warschauer Straße.
Die Oberbaumbrücke gehörte zu unserem Leben wie bei anderen Leuten das Gartentor. Meine Großmutter und meine Eltern überquerten sie, um Angehörige und Freunde zu besuchen, um im Westen ins Kino zu gehen oder einzukaufen. Ich liebte es, mit meinem Vater über die Brücke zum nahe gelegenen Markt in der Cuvrystraße zu laufen. Ein Teil unseres Familieneinkommens stammte in diesen Jahren aus dem Schmuggeln von Kaffee, und der Cuvry-Markt war der Ort, an dem mein Vater seine Geschäfte abwickelte. Er oder einer seiner netten Geschäftsfreunde spendierte mir Eis oder Wiener Würstchen, jene besonders langen und dünnen, die es nur im Westen gab.
Nur wenige Jahre nach Kriegsende hatte sich mein Vater seine zwei größten Träume erfüllt. Der erste war, ein Geschäft zu gründen. In vielen der Briefe, die er aus dem Krieg an seine Frau geschrieben hatte, war davon die Rede gewesen. »Andreas Radtke – Weine und Spirituosen« konnte man nun über dem Stand in der Markthalle am Alexanderplatz lesen, einem sehr lebendigen Ort, der jede Menge Kunden sicherte. Die Arbeitsbedingungen waren hart, die Stände klein und vollgestellt mit Waren, die Fußböden eiskalt. Toiletten und Wasseranschlüsse befanden sich im hintersten Winkel der Markthalle. Warennachschub musste aus dem modrig riechenden, von Ratten bewohnten Keller heraufgeholt werden. Doch das alles machte nichts – mein Vater war glücklich. Er liebte es, mit seinen Kunden und den anderen Standbesitzern zu plaudern, außerdem versorgte man sich wechselseitig mit sogenannter Bückware: Dinge, die es schwer zu kaufen gab und die unter dem Ladentisch für besondere Kunden und Geschäftsfreunde bereitgehalten wurden. Zu Hause kamen so Lebensmittel auf den Tisch, von denen andere in der Ostzone – so nannten meine Eltern die DDR – nur träumen konnten, darunter ein frischer Aal, der, kaum aus der Tasche genommen und eigentlich schon tot, vom Tisch glitt, durch die Küche zuckte und unter dem Küchenschrank verschwand. Als Retterin in der Not betrat die herbeigerufene Nachbarin, Fräulein Fröbel, die Szene und fing den Aal ein.
Der zweite in Erfüllung gegangene Traum meines Vaters war ein Segelboot, ein Jollenkreuzer mit 20 Quadratmetern Segelfläche und einer Kajüte. Meine Eltern liebten beide das Wasser. Meine Mutter war seit ihren Jugendjahren stolzes Mitglied in einem Ruderklub. Gelegentlich erwähnte sie, dass mein Vater – er war an den Wochenenden im Paddelboot unterwegs gewesen – sich in der Hierarchie der Wassersportler ein gutes Stück unter ihr befunden habe. Dieser Unterschied war mit dem Kauf des Jollenkreuzers Geschichte. Mein Vater legte sich eine Seglermütze und das Gebaren eines Kapitäns zu: Die Manöver erfolgten auf sein Kommando, und nach dem Anlegen ging er von Bord, um mit anderen Kapitänen ein Bier zu trinken. Den Frauen – meiner Mutter, meiner Schwester und mir – blieb die mühsame Aufgabe überlassen, das Boot in Ordnung zu bringen.
Wenn wir am Wochenende oder im Urlaub auf den Seen in Berlins südöstlicher Umgebung unterwegs waren, übernachteten unsere Eltern in der großen Kajüte; Monika und ich schliefen im Bug, einem kleinen Verschlag im vorderen Teil des Bootes, der von oben über eine hölzerne Klappe zugänglich war. Dort einzuschlafen war wunderbar: Das Boot schaukelte sanft, das Wasser schlug von außen leise an die Holzplanken, und im Hintergrund waren die Stimmen und das Gelächter der Erwachsenen zu hören. Tagsüber waren wir auf dem Wasser unterwegs oder wir legten irgendwo an, sammelten Pilze oder fingen Flusskrebse – beides ein vorzügliches Abendessen.
Mein Vater war liebevoll und amüsant, aber auch ein Pascha. Hausarbeit war ihm fremd, und den beschwerlicheren Teil der Arbeit im Geschäft überließ er gern seiner Frau. Dafür hatte er die Kontrolle über die Finanzen. Wenn meine Mutter sich oder den Kindern etwas kaufen wollte, musste sie ihn um das Geld dafür bitten. Den Sonntagvormittag verbrachte er gern in der Kneipe an der Ecke, wo er seine Freunde beim Frühschoppen traf, während unsere Großmutter das Mittagessen vorbereitete. Sobald die Kartoffeln auf dem Herd standen, wurde ich losgeschickt, meinem Vater Bescheid zu geben. Ich wurde von ihm und seinen Stammtischfreunden mit großem Hallo begrüßt und entweder auf seine Schultern oder mitten auf den Tisch gesetzt. So müssen sich Prinzessinnen fühlen. Voller Stolz aufeinander verließen Vater und Tochter schließlich die Runde – dem häuslichen Mittagstisch entgegen. Nichts würde uns je trennen können.
Ich war stolz darauf, endlich zur Schule zu gehen. Lesen konnte ich längst, was ich überwiegend meiner Schwester zu verdanken habe, die sehr gern mit ihren Freundinnen Unterricht spielte. Da die großen Mädchen alle Lehrerin sein wollten, war ich ihre einzige Schülerin. Ich hatte aufzustehen und zu grüßen, wenn sie den Raum betraten, und musste die von ihnen mit Hilfe einer Puppenküche zubereitete Schulspeisung aufessen. Nicht immer ein Vergnügen, aber da ich es als Ehre ansah, dass die großen Mädchen mit mir spielten, nahm ich die kleinen Leiden gern auf mich. Die richtige Schule war dann aber doch um einiges besser, vor allem, weil es außer mir noch andere Kinder gab. Mein einziges Problem bestand im Schönschreiben. Ich war Linkshänderin, aber darauf wurde selbstverständlich keine Rücksicht genommen. Schon meine Mutter achtete darauf, dass ich stets »das schöne Händchen« benutzte, und ließ sich von mir nur Bilder schenken, die ich mit der rechten Hand gemalt hatte. Welche Folgen diese Dressur hatte, weiß ich nicht, zum Glück hat sie mir aber die Freude am Lernen nicht genommen.
Der Schulweg führte mich an einem großen Trümmerberg vorbei. Berlin war im Jahr 1954 erst notdürftig aufgeräumt, und die Spuren der Bombenangriffe waren allgegenwärtig. Ruinen, Bunker und Trümmerberge lockten als attraktive Spielplätze, und ich wäre den großen Kindern, die dort ihre Abenteuer erlebten, sehr gern gefolgt. Doch meine Eltern hatten ein strenges Verbot verhängt und angedeutet, was in Ruinen schon alles passiert sei und noch passieren könne. Genaueres war von ihnen nicht zu erfahren, aber in meiner Phantasie wurden dort Kinder gefangen gehalten und vielleicht sogar ermordet. Und so sah ich zu, dass ich möglichst schnell an dem ebenso bedrohlichen wie faszinierenden Schuttgebirge vorbeikam.
Während die Aufräumarbeiten in der Stadt nur schleppend vorangingen, wurde nicht weit von uns mit großer Energie und noch größerem propagandistischen Aufwand die Stalinallee erbaut. Über die Prachtstraße, in der noch bis ins Jahr 1961 ein großes Stalin-Standbild zu bewundern war, sprach man bei uns zu Hause nur mit Zorn oder bestenfalls mit Spott. Die Architektur wurde belacht, die Propaganda verachtet. Wer bekommt da schon eine Wohnung?, fragten sich meine Eltern laut. Alles nur Funktionäre, vielleicht auch Familien, denen der Status »Opfer des Faschismus« zuerkannt worden war, und einige Bauarbeiter. Meine Eltern hatten weder Kontakt zu Funktionären noch zu Bauarbeitern oder zu jemandem, der von den Nazis verfolgt worden war, und so kannten wir niemanden von denen, die dort einziehen durften.
In Berlin waren es die Bauarbeiter der Stalinallee, die im Juni 1953 damit begannen, ihren Unmut öffentlich zu äußern. Anlass für den Protest waren die immer höheren Arbeitsnormen, die noch weniger Lohn zur Folge gehabt hätten. Doch bald rückten andere Themen in den Mittelpunkt. Die politische und wirtschaftliche Situation in der DDR spitzte sich immer weiter zu, die allgemeine Unzufriedenheit erreichte eine kritische Dimension, und mehr und mehr Menschen verließen die DDR. Schließlich verkündete die SED widerstrebend und nur auf Geheiß Moskaus am 10. Juni einen »Neuen Kurs«, der politische und wirtschaftliche Korrekturen vorsah. Die Versorgungslage sollte verbessert werden, Flüchtlinge sollten die Möglichkeit zur Rückkehr erhalten und ihr Eigentum zurückbekommen. Jugendliche, die wegen ihrer Zugehörigkeit zur Jungen Gemeinde von Schulen relegiert worden waren, konnten zurückkehren, auch Exmatrikulationen aus politischen Gründen sollten geprüft und nach Möglichkeit rückgängig gemacht werden. Es wurde zudem angekündigt, die in den Monaten zuvor ergangenen Gerichtsurteile zu überprüfen.
Der »Neue Kurs« entspannte die Lage jedoch nicht – den meisten erschien er vielmehr wie eine Bankrotterklärung des Systems. Deshalb kam es bereits vom 10. Juni an zu massiven Protestaktionen. Bald erhoben sich Menschen in über 700 Städten und Gemeinden. Sie riefen »Nieder mit der SED!«, forderten Demokratie, freie Wahlen, die Einheit Deutschlands, die Entlassung politischer Gefangener und soziale Reformen. Rund eine Million Menschen waren beteiligt. Sie demonstrierten, streikten, besetzten Gebäude von SED-Bezirks- und Kreisleitungen sowie MfS-Dienststellen und Reviere der Volkspolizei, setzten Bürgermeister ab und befreiten Häftlinge. Am 16. Juni wurde in Berlin über Lastwagenlautsprecher zum Generalstreik am nächsten Tag und zur Versammlung auf dem Strausberger Platz in der Stalinallee aufgerufen. Abends kam es zu Straßenkämpfen zwischen Demonstranten und Polizei. Am nächsten Morgen formierten sich in der ganzen Stadt Demonstrationszüge, die Polizei war machtlos und konnte die Ereignisse nicht mehr beeinflussen. Um 13 Uhr rief die sowjetische Stadtkommandantur den Ausnahmezustand aus, doch in den Straßen verschärften sich die Auseinandersetzungen. Dann fielen die ersten Schüsse, Hunderte sowjetische Panzer fuhren auf und verteilten sich über die Stadt. Etwa vierzig bis fünfzig Demonstranten kamen ums Leben, auf der Gegenseite fanden zehn bis fünfzehn Menschen den Tod. Tausende wurden in den Wochen danach verhaftet und verurteilt, zwei davon zum Tode. Zur Abschreckung verhängten außerdem sowjetische Standgerichte auf direkten Befehl aus Moskau mehrere Todesurteile, die umgehend vollstreckt wurden. Vielen gelang es, der Verhaftung durch Flucht in den Westen zu entgehen.
Nach der Niederschlagung des Volksaufstands im Juni 1953 wusste jeder, der es wissen wollte, dass die Herrschaft der SED nur auf Gewalt gegen das eigene Volk gegründet war. Hunderttausende weitere Menschen verließen bis zum Mauerbau 1961 die DDR in Richtung Westen.
In der DDR galt der 17. Juni offiziell als faschistischer Putschversuch; wer dazu eine andere Meinung äußerte, hatte mit Konsequenzen zu rechnen. Im Westen gab es verschiedene Sichtweisen. Einerseits wurde das Datum noch im selben Jahr zum Gedenktag erklärt, und viele engagierte Bürgerinnen und Bürger hielten die Erinnerung an die damaligen Ereignisse wach. Auf der anderen Seite wussten im Laufe der Jahre die Jüngeren immer weniger, was damals geschehen war. Immer mehr Menschen sahen in diesem Gedenktag auch ein Symbol des Kalten Krieges und forderten seine Abschaffung. Oft waren es dieselben Personen, die zwar weltweit Befreiungsbewegungen unterstützten, die Sehnsucht der Menschen in der DDR nach Freiheit aber missachteten. Die Bundestagsfraktion der Grünen im Bonner Parlament zum Beispiel verließ 1983 geschlossen den Plenarsaal, als die Feierstunde des Bundestages zum 17. Juni begann.
Inzwischen hat sich in der deutschen Öffentlichkeit das Bild vom Volksaufstand in der DDR 1953 gewandelt. Er steht nun in einer Reihe mit den zahlreichen Volksaufständen, die es von Beginn an in vielen kommunistischen Ländern gab und die alle blutig niedergeschlagen wurden.
Meine Mutter kam am Abend des 17. Juni 1953 übrigens doch noch rechtzeitig vor der Sperrstunde heim. Ein Motorradfahrer hatte sie mit in die Stadt genommen und bei uns in der Warschauer Straße abgesetzt. Anstatt seine Frau erleichtert in den Arm zu nehmen, machte mein Vater ihr entnervt eine Szene. Meine Mutter wehrte sich nicht, Großmutter schwieg bedrückt, und wir Kinder verstanden nicht, was los war. Warum freute er sich nicht darüber, dass unsere Mutter endlich zu Hause war?
3
Ost-Berlin, West-Berlin
Im halben Land und der zerschnittenen Stadt,
halbwegs zufrieden mit dem, was man hat.
Halb und halb.
City
Niemand hat mich darauf vorbereitet. Als ich am 13. Januar1956, wenige Tage vor meinem achten Geburtstag, von der Schule nach Hause komme und an der Tür klingle, öffnet meine Großmutter mit verweinten Augen. Etwas ist passiert, das fühle ich sofort. Sie steht mitten im Zimmer und sagt mit belegter Stimme den merkwürdigen Satz: »Dein Vater ist nicht mehr.« Das Einzige, was mir von diesem Tag später in Erinnerung sein wird, ist, dass ich mich vor einem Sessel fallen lasse, mein Gesicht in den Armen verstecke und laut und lange weine. Und dass ich irgendwann aufhöre und überlege, ob ich jetzt aufstehe oder nicht. Und wie es sein wird, wenn ich in der Schule erzähle, dass mein Vater gestorben ist. Warum ist meine Mutter nicht da? Wann sie nach Hause gekommen ist und ob wir uns gegenseitig in den Arm genommen und getröstet haben – daran können weder ich noch meine Schwester Monika uns später erinnern.
Der wichtigste Mensch in meinem Leben war tot. Die Tuberkulose, die mein Vater aus dem Krieg mitgebracht hatte und die zwischenzeitlich auskuriert schien, war seit einigen Monaten wieder akut gewesen, und sein Gesundheitszustand verschlechterte sich von Woche zu Woche. Bald lag er auch tagsüber auf seiner breiten Couch und hustete in einem fort, dann musste er schließlich ins Krankenhaus nach Berlin-Buch. Ab und zu durfte er für ein Wochenende oder einen Tag nach Hause kommen, so wie zum Geburtstag meiner Mutter im Dezember, als ich ihn zum letzten Mal sah. Danach war er zu schwach, um das Bett zu verlassen, und Kindern war der Zutritt zur Klinik nicht erlaubt.
Die Erwachsenen meinten, dass das achtjährige Kind besser nicht an der Beisetzung teilnehmen, sondern abgelenkt werden solle. Während Mutter, Schwester, Großmutter und alle anderen Angehörigen und Freunde von meinem Vater Abschied nahmen, lief ich in Begleitung einer Cousine durch das Kinderkaufhaus am Strausberger Platz und durfte mir etwas aussuchen. Natürlich war dieser unbeholfene Umgang mit meiner Trauer gut gemeint. Viele Jahre danach habe ich aber verstanden, wie sehr dieser frühe Verlust und der Umstand, dass ich nicht Abschied von meinem Vater nehmen durfte, meine Kindheit und auch mein späteres Leben überschattet haben. Jahrelang habe ich mir immer wieder Aufgaben gestellt, in der Hoffnung, dass mein Vater wiederkommen würde, wenn ich sie erfüllte. Von außen war das alles nicht zu merken. Ich galt als aufgewecktes und fröhliches Kind, kam gut mit meinen Klassenkameraden und Freundinnen aus, brachte gute Zeugnisse nach Hause und zeigte keinerlei auffälliges Verhalten. Ich gab mir wirklich große Mühe, meiner Mutter, von der die Erwachsenen sagten, wie schwer sie es als Witwe mit zwei Kindern und dem Geschäft jetzt habe, das Leben nicht noch schwerer zu machen.
Als im selben Frühjahr Monika konfirmiert wurde, gab es Tränen beim Auspacken der Geschenke: Das Opernglas, das meine Mutter ihr überreichte – Operngläser waren in diesen Zeiten ein beliebtes und wertvolles Konfirmationsgeschenk –, hatte mein Vater noch mit meiner Schwester zusammen ausgesucht, unter dem Vorwand, es sei für die Tochter eines Freundes bestimmt.
Als wir im Sommer 1955 umzogen, schien mein Vater noch gesund. Unsere neue Wohnung – drei große Zimmer und ein Bad –, die die Lungenfürsorgestelle uns vermittelt hatte, befand sich in der Boxhagener Straße im Stadtbezirk Friedrichshain. Vom Balkon aus schauten wir auf einen kleinen Platz mit einem Zeitungskiosk und einer Litfaßsäule. Meine Schwester und ich schliefen in einem Doppelstockbett in der Mädchenkammer, die neben der Küche lag – Monika unten, ich oben –, und unsere Großmutter hatte endlich ein Zimmer für sich.
Ein halbes Jahr später, im November1956, saßen meine Großmutter, meine Mutter und meine Schwester gebannt vor dem Radio und hörten halbstündlich RIAS-Nachrichten über die russischen Panzer, die in Budapest brutal gegen demonstrierende Menschen vorgingen. Wieder war eine Hoffnung gestorben. Unschuldige Menschen wurden erschossen oder verhaftet. Ich verstand wenig, spürte aber die Trauer um die ermordeten Menschen und die ohnmächtige Wut der Erwachsenen. Das hatte ich schon einmal erlebt, drei Jahre zuvor, als die Panzer durch Ost-Berlin und viele andere Städte der DDR rollten.
Und dann das erste Weihnachten ohne den Vater. Meine Großmutter und meine Mutter hatten sich große Mühe gegeben, alles so herzurichten, wie wir es kannten: den großen Weihnachtsbaum mit silbernen und roten Kugeln, die Gabentische, den traditionellen Kartoffelsalat mit Würstchen. Monika und ich hatten wie immer unsere Gedichte auswendig gelernt und unsere schönsten Kleider angezogen. Dann läutete die Glocke, mit der wir in jedem Jahr ins Weihnachtszimmer gerufen wurden. Mag sein, dass meine Mutter genau in diesem Moment, als sie die Glocke in die Hand nahm, die sonst stets unser Vater geläutet hatte, ihre Fassung verlor. Jedenfalls standen wir noch in der Tür, als plötzlich alle in Tränen ausbrachen, um dann eine Weile schluchzend und engumschlungen beieinanderzusitzen, todtraurig und doch geborgen und getröstet.
Von nun an waren wir ein Frauenhaushalt. Meine Mutter führte das von meinem Vater begründete Geschäft in der Markthalle weiter, wenn auch ohne Begeisterung. Aber wie hätte sie sonst den Lebensunterhalt für vier Personen aufbringen können? So war sie nun hinter dem Ladentisch wieder den ganzen Tag auf den Beinen. Ich kannte es nicht anders, als dass meine Mutter allabendlich erschöpft nach Hause kam und ihre geschundenen Füße stöhnend auf einem Hocker hochlegte. Unsere Großmutter versuchte sie zu entlasten, indem sie gelegentlich im Geschäft aushalf und ansonsten den Haushalt führte. Da sie das am liebsten allein machte, brauchten meine Schwester und ich nicht viel zu tun; immerhin war es aber meine Aufgabe, Kohlen aus dem Keller zu holen und manchmal einzukaufen. Bis 1958 brauchte man dafür Lebensmittelkarten. Waren die verbraucht, konnte man zu wesentlich höheren Preisen HO-Eier, HO-Milch oder HO-Butter bekommen. »HO« stand für »Handels-Organisation« – staatliche Geschäfte, Restaurants und Hotels, mit denen der private Handel zurückgedrängt wurde. Lebensmittel ohne Marken kosteten dort mehr als das Doppelte und waren für Normalverdiener kaum erschwinglich. Kartoffelkarten wurden bis 1966 ausgegeben, und Kohlekarten gab es unter der Bezeichnung »Hausbrandkarte« sogar bis zum Ende der DDR. Die Karten ermöglichten – je nach Familiengröße – den Kauf eines bestimmten Kontingents zum Niedrigpreis. Wer mehr benötigte, musste draufzahlen.
Um zu verhindern, dass West-Berliner die ohnehin knappen subventionierten Waren aufkauften, war bis zum Bau der Mauer beim Einkauf ein Personalausweis vorzulegen – wer keinen hatte, musste mit Westgeld bezahlen. Allerdings wurde diese Vorschrift oft nachlässig gehandhabt, auch von meiner Mutter. Wenn sich unter den Ladenbesitzern herumsprach, dass mal wieder Kontrollen durchgeführt würden, war man vorübergehend strenger.
Das Leben in der geteilten Stadt war inzwischen alltäglich geworden – spätestens seit der Blockade West-Berlins, als sowjetische Truppen fast ein Jahr lang, von Juni 1948 bis Mai1949, alle Zugänge zum Westteil Berlins blockiert hatten.
Immer sonntags kurz vor zwölf war im RIAS das Geläut der Freiheitsglocke im Turm des Rathauses Schöneberg zu hören, und dazu der immer gleiche Text: »Ich glaube an die Unantastbarkeit und an die Würde jedes einzelnen Menschen. Ich glaube, dass allen Menschen von Gott das gleiche Recht auf Freiheit gegeben wurde. Ich verspreche, jedem Angriff auf die Freiheit und der Tyrannei Widerstand zu leisten, wo auch immer sie auftreten mögen.« »Psst, Kinder, die Freiheitsglocke«, sagte meine Mutter jedes Mal, und wir hörten andächtig zu. Ich mochte den Klang dieser Glocke, die sonore Stimme des Sprechers, und ich ahnte, dass es um Wichtiges ging. Viele Jahre später, nach dem Mauerfall, erfuhr ich mehr über die Geschichte der Glocke. Sie ist eine Kopie der Liberty Bell, trägt die Inschrift »That this world under God shall have a new birth of freedom« und war im Jahr 1950 ein Geschenk amerikanischer Bürgerinnen und Bürger an die Stadt Berlin. Auf ihrer Reise durch 26 Städte von New York bis Los Angeles spendeten Amerikaner Geld für sie und unterschrieben ein Freiheitsgelöbnis. Dessen erste Sätze sind mittlerweile seit mehr als sechs Jahrzehnten an jedem Sonntag zusammen mit dem Geläut im Radio zu hören – nunmehr bei Deutschlandradio Kultur.
Dass die Glocke der SED ein Dorn im Auge war, versteht sich von selbst und war durchaus gewollt. Doch auch von den Linken im Westen wurde sie zunehmend beargwöhnt – als Symbol des Kalten Krieges, als Maßnahme der CIA und demzufolge als reaktionäres und imperialistisches Sinnbild. Als ich meinen Westfreunden in den 1990er Jahren begeistert von meiner Entdeckung, der Entstehungsgeschichte der Freiheitsglocke, erzählte, spürte ich eine gewisse Befremdung. Für mich zählte und zählt etwas anderes: Nur fünf Jahre nach dem Krieg, als viele Familien noch um ihre gefallenen Väter und Söhne trauerten, waren Millionen von Amerikanern bereit, mit ihren Geldspenden und Unterschriften ein Zeichen der Versöhnung und des Freiheitswillens zu setzen – und die Berlinerinnen und Berliner haben diese Botschaft angenommen. Die Glocke wurde am 24. Oktober1950,