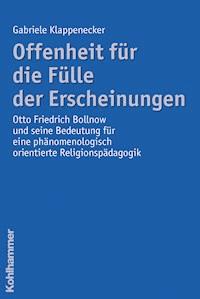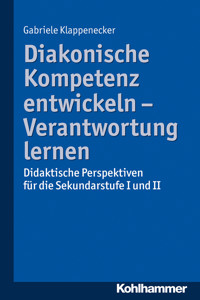
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Kohlhammer
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Sprache: Deutsch
Diakonische Bildungsprozesse werden traditionell von Schulen in kirchlicher Trägerschaft initiiert. Aber auch für staatliche Schulen ohne kirchliche Trägerschaft sind sie - als Formen der Bildung zur Verantwortung - bedeutsam. In der Diakonie-Didaktik ist bisher das sogenannte situated learning bestimmend. Es sind aber aus religionspädagogischer Sicht darüber hinaus auch Formen des service learning zu erschließen. Die Modelle des situated learning und des service learning werden hinsichtlich ihrer Plausibilität für die Bildung und das Lernen von Verantwortung entfaltet und die spezifischen Kompetenzen eines solchen Lernens aufgezeigt.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 148
Veröffentlichungsjahr: 2014
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Gabriele Klappenecker
Diakonische Kompetenz entwickeln – Verantwortung lernen
Didaktische Perspektiven für die Sekundarstufe I und II
Verlag W. Kohlhammer
1. Auflage 2014
Alle Rechte vorbehalten
© W. Kohlhammer GmbH, Stuttgart
Satz: Andrea Siebert, Neuendettelsau
Gesamtherstellung: W. Kohlhammer GmbH, Stuttgart
Print:
ISBN 978-3-17-025152-6
E-Book-Formate:
pdf: ISBN 978-3-17-025153-3
epub: ISBN 978-3-17-025154-0
mobi: ISBN 978-3-17-025155-7
Für den Inhalt abgedruckter oder verlinkter Websites ist ausschließlich der jeweilige Betreiber verantwortlich.
Die W. Kohlhammer GmbH hat keinen Einfluss auf die verknüpften Seiten und übernimmt hierfür keinerlei Haftung.
Inhalt
Vorwort und Dank
Erster Teil: Diakonische Bildung auf der Grundlage einer Ethik der Verantwortung
I. Einleitung
II. Verantwortung
1. Allgemeines
2. Der doppelte Verweisungszusammenhang des Verantwortungsbegriffs
3. Verantwortungsübernahme als Stellvertretung
III. Diakonische Bildung
1. Leitende Fragen
2. Verantwortung in diakonischer und diakoniedidaktischer Perspektive
2.1 Allgemein
2.2 Zwei grundlegender Modelle der Didaktik, die das Verantwortungslernen fördern
2.2.1 Einführung
2.2.2 Darstellung beider Modelle
2.2.2.1 Vertiefung: service learning
2.2.2.2 Vertiefung: situated learning
2.2.3 Kritik und Würdigung beider Modelle
3. Der doppelte Verweisungszusammenhang des Verantwortungsbegriffs in diakonie-didaktischer Perspektive
3.1 Verantwortung „vor“
3.2 „Verantwortung für“
IV. Zwischenergebnis
Zweiter Teil: Verantwortungslernen in diakonischer Perspektive: Ein Blick in die Praxis der Schule
I. Einleitung
II. Darstellung eines Projektes
III. Beschreibung der erworbenen Kompetenzen
IV. Konsequenzen
Dritter Teil: Darstellung von Kompetenzmodellen im Blick auf auf ihre Bedeutung für das Verantwortungslernen
I. Einleitung
II. Die Kompetenzmodelle
1. Der Bildungsplan des Landes Baden-Württemberg
2. Das „Michelbacher Modell“ in der Revision durch Christoph Gramzow
3. Das „Kerncurriculum für das Fach Evangelische Religionslehre in der gymnasialen Oberstufe“ und der Orientierungsrahmen zu „Kompetenzen und Standards für den Evangelischen Religionsunterricht in der Sekundarstufe I“
3.1 Wesentliche Inhalte des Kernkurriculums für die Oberstufe
3.2 Wesentliche Inhalte des Orientierungsrahmens für die Sekundarstufe I
4. „Religiöse Kompetenz als Teil öffentlicher Bildung“ – Ergebnisse der Forschungsprojekte an der Humboldt-Universität zu Berlin
4.1 Hinführung
4.2 Wesentliche Ergebnisse
Vierter Teil: Der Beitrag des diakonisch perspektivierten Verantwortungslernens zur Kompetenzbildung
I. Theologische und pädagogische Begründung des Verantwortungslernens
II. Kompetenz und Bildung durch Verantwortungslernen – Thesen
1. Verantwortungslernen erweitert Wissen und gibt ihm eine Orientierung
2. Verantwortungslernen ist ethosgenerierend
3. Verantwortungslernen ist gendersensibel konzipiert
4. Verantwortungslernen ist Sache der gesamten Schule
5. Verantwortungslernen fördert (religiöse) Partizipationskompetenz
6. Verantwortungslernen fördert (religiöse) Kommunikationskompetenz
7. Verantwortungslernen fördert religiöse Kompetenz
8. Verantwortungslernen verdeutlicht die Lebensbedeutsamkeit biblischer Aussagen
Literaturverzeichnis
Register
Vorwort und Dank
Diakonische Bildungsprozesse werden traditionell von Schulen in kirchlicher Trägerschaft initiiert, und dies mit nachhaltiger Wirkung auf die Persönlichkeitsentwicklung der Heranwachsenden. Versteht man unter diakonischer Bildung eine Form der Bildung hin zum Übernehmen von Verantwortung, wird diese auch für staatliche Schulen ohne kirchliche Trägerschaft bedeutsam. Diakonisches Lernen als Verantwortungslernen muss dann aber so konzipiert werden, dass es ohne konfessionelle Bindung plausibel ist. Hierzu muss eine Forschungslücke geschlossen werden: Das so genannte situated learning, eine Lernform, die die „Situierung“ in einem konfessionellen Kontext voraussetzt, ist bisher in diakonischen perspektivierten Formen des Verantwortungslernens bestimmend. Es müssten aber auch Formen des service learning religionspädagogisch erschlossen werden, wenn Verantwortung auch ohne explizite Kenntnisse der jüdisch-christlichen Tradition erlernt werden soll.
Ein so gefasstes Verantwortungslernen ist möglich, wie ein Seminarkurs am staatlichen Friedrich-List-Gymnasium in Asperg, Baden-Württemberg, zeigte, der in diesem Band dokumentiert wird. Diesem einzelnen, in der Praxis bewährten Beispiel sollen nun, um die Forschungslücke weiter zu schließen, Perspektiven für eine Didaktik diakonisch-sozialen Lernens zur Seite gestellt werden. Sie sind für Forschende, Lehrende und Unterrichtende gedacht in der Hoffnung, dass Verantwortungslernen innerhalb und außerhalb des Religionsunterrichts als interdisziplinäres, die Schule als Ganze betreffendes Projekt möglich wird. Dies soll in einer Weise geschehen können, in der Religionslehrerinnen und -lehrer ein interdisziplinäres Gespräch mit Kolleginnen und Kollegen anderer Fächer führen und außerschulische Einrichtungen ebenso zu Lernorten werden wie das Klassenzimmer und das Schulhaus. Die Rückmeldungen der Schülerinnen und Schüler auf den genannten Seminarkurs geben Anlass zu der Hoffnung, dass Verantwortungslernen eine besondere Tiefe erreicht, Spaß macht und eine die gesamte Persönlichkeit bildende Expedition ins außerschulische Umfeld, aber auch ins eigene Ich sein kann.
Diese Darstellung ist folgendermaßen aufgebaut: Zunächst wird der Begriff der Verantwortung theologisch, aber auch in seiner über die Theologie hinausgehenden Reichweite erschlossen.
Daraus ergibt sich eine spezifische Konzeption diakonischer Bildung. Die Modelle des service learning und des situated learning werden jeweils dargelegt und hinsichtlich ihrer Leistung für eine so gefasste Didaktik untersucht. Es lassen sich diakonische Bildungsintentionen herausarbeiten.
Auf der Basis des bisher Dargelegten wird der Seminarkurs als Praxisbeispiel entfaltet und es werden Konsequenzen für die weitere Entwicklung dieser Didaktik gezogen. Eine wesentliche Konsequenz ergibt sich darin, dass Verantwortungslernen daraufhin zu befragen ist, welche Kompetenzen es ausbildet und fördert. Hierzu ist es nötig, plausible Kompetenzmodelle zu sichten. Das Kompetenzmodell des baden-württembergischen Bildungsplans findet hierbei besondere Beachtung. Am Schluss der Untersuchung wird der Beitrag eines diakonisch perspektivierten Verantwortungslernens zur Kompetenzbildung dargelegt.
Ich danke den Mitgliedern des Beirates meines Projektes zum diakonisch-sozialen Lernen herzlich für ihre Begleitung und für ihre Anregungen:
Kirchenrätin Ingeborg Soller-Britsch, Geschäftsführerin des Evangelischen Schulwerkes in Württemberg, Pfarrerin Christa Epple-Franke, Geschäftsführerin des Evangelischen Schulwerkes Baden und Württemberg, Dr. Uta Hallwirth, Wissenschaftliche Arbeitsstelle Evangelische Schule, EKD, Pfarrerin Dr. Antje Fetzer und Pfarrer Dr. Joachim Rückle, beide vom Diakonischen Werk Württemberg, Abteilung Theologie und Bildung, Oberstudiendirektorin Dr. Sonja-Maria Bauer, Friedrich-List-Gymnasium Asperg. Beiratsmitglieder aus der Hochschule waren: Prof. Dr. Anne Sliwka, Prorektorin der Pädagogischen Hochschule Heidelberg, Prof. Dr. Heinz Schmidt, Diakoniewissenschaftliches Institut der Universität Heidelberg, Prof. Dr. Thomas Schlag, Universität Zürich, Praktische Theologie. Als Gäste waren eingeladen: PD Dr. Christoph Gramzow, Universität Leipzig, und Dr. Martin Horstmann, Sozialwissenschaftliches Institut der EKD, Hannover.
Besonders erwähnen möchte ich Frau Soller-Britsch. Sie hat als ehemalige Geschäftsführerin des Evangelischen Schulwerkes in Württemberg, jetzt: Evangelisches Schulwerk Baden und Württemberg, die finanziellen und organisatorischen Rahmenbedingungen ermöglicht und ist beratend tätig gewesen. Ihre Nachfolgerin, Frau Epple-Franke, hat in einem nahtlosen Übergang die Weiterführung der Geschäfte und der Beratung übernommen. Herr Prof. Schmidt hat die einzelnen Fassungen dieser Arbeit mit kritisch-konstruktiven Anregungen begleitet. Frau Dr. Uta Hallwirth hat keine Mühen gescheut, fast zu jeder einzelnen Beiratssitzung aus Hannover nach Stuttgart anzureisen. Sie brachte stets anregende Gedanken in die Diskussion ein sowie Einblicke in die aktuellen Entwicklungen aus meinem Forschungsgebiet.
Herrn Jürgen Schneider vom Kohlhammer-Verlag danke ich für die zuverlässige und vertrauenswürdige Betreuung des Manuskripts.
Den Leserinnen und Lesern wünsche ich eine anregende Lektüre und hoffe, dass die nun vorliegende Arbeit dazu ermutigt, eigene Wege diakonisch-sozialen Lernens zu beschreiten.
Asperg, im November 2013
Gabriele Klappenecker
Erster Teil: Diakonische Bildung auf der Grundlage einer Ethik der Verantwortung
I. Einleitung
Evangelischer Religionsunterricht ist nicht nur Hinführung zum religiösen Bekenntnis und Eingliederung in die kirchliche Gemeinschaft, nicht nur Sache einer Religionsgemeinschaft und ihrer Mitglieder, sondern auch der Schule und ihres gesellschaftsöffentlichen Bildungsauftrags.1 Seit der Aufklärung des 18. Jahrhunderts hat sich in Theologie und Religionspädagogik auch ein Verständnis von Religion entwickelt, das diese als zugehörig zu einer „sinnbewussten und zielgewissen menschlichen Lebensführung begreift“. 2 So hat die Religionspädagogik gute Gründe dafür, darauf zu bestehen, dass das Unterrichtsfach „Religion“ als vernünftiger Sachwalter bei der Auseinandersetzung mit der Frage nach einem „gelingenden Leben“3 und damit einem verantwortungsbewussten Leben gelten kann. Dies leistet Religion in der Schule auch außerhalb des „klassischen“ Fachunterrichts, etwa im interdisziplinären Verbund mit einem anderen Fach, oder im Rahmen eines dem diakonisch-sozialen Lernen verpflichteten Schulprojekts.
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!