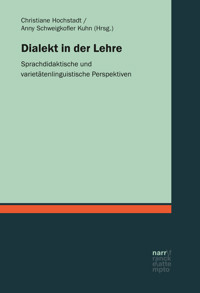
Dialekt in der Lehre E-Book
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Narr Francke Attempto Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Der Sammelband vereint verschiedene Sichtweisen auf das Thema Dialekt und darauf, wie er seinen Platz in der Lehre finden kann. Die Beitragenden aus Deutschland, Österreich, der Schweiz und Südtirol stellen Forschungsvorhaben und -ergebnisse, Projekte und grundsätzliche Überlegungen aus ihrer Region vor. Die Spannbreite reicht dabei vom Umgang mit regional sehr lebendigen Dialekten in diversen Lehr-Lern-Kontexten bis hin zur Wiederbelebung und Etablierung von wenig genutzten Dialekten. Die Beiträge liefern Einblicke in die aktuelle Auseinandersetzung mit dem Bairischen, Schwäbischen, Alemannischen und Niederdeutschen. Ziel ist es bei aller regionaler Varianz, gemeinsam einen Beitrag für die Ausbildung einer Dialektdidaktik zu leisten.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 897
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Christiane Hochstadt / Anny Schweigkofler Kuhn
Dialekt in der Lehre
Sprachdidaktische und varietätenlinguistische Perspektiven
DOI: https://doi.org/10.24053/9783381109029
© 2025 • Narr Francke Attempto Verlag GmbH + Co. KGDischingerweg 5 • D-72070 Tübingen
Das Werk ist eine Open Access-Publikation. Es wird unter der Creative Commons Namensnennung – Weitergabe unter gleichen Bedingungen | CC BY-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) veröffentlicht, welche die Nutzung, Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und Wiedergabe in jeglichem Medium und Format erlaubt, solange Sie die/den ursprünglichen Autor/innen und die Quelle ordentlich nennen, einen Link zur Creative Commons-Lizenz anfügen und angeben, ob Änderungen vorgenommen wurden. Die in diesem Werk enthaltenen Bilder und sonstiges Drittmaterial unterliegen ebenfalls der genannten Creative Commons Lizenz, sofern sich aus der am Material vermerkten Legende nichts anderes ergibt. In diesen Fällen ist für die oben genannten Weiterverwendungen des Materials die Einwilligung des jeweiligen Rechteinhabers einzuholen.
Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Verlages unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
Alle Informationen in diesem Buch wurden mit großer Sorgfalt erstellt. Fehler können dennoch nicht völlig ausgeschlossen werden. Weder Verlag noch Autor:innen oder Herausgeber:innen übernehmen deshalb eine Gewährleistung für die Korrektheit des Inhaltes und haften nicht für fehlerhafte Angaben und deren Folgen. Diese Publikation enthält gegebenenfalls Links zu externen Inhalten Dritter, auf die weder Verlag noch Autor:innen oder Herausgeber:innen Einfluss haben. Für die Inhalte der verlinkten Seiten sind stets die jeweiligen Anbieter oder Betreibenden der Seiten verantwortlich.
Internet: www.narr.deeMail: [email protected]
ISSN 0941-8105
ISBN 978-3-381-10901-2 (Print)
ISBN 978-3-381-10903-6 (ePub)
Inhalt
Einleitung: Dialekt in der Lehre
1Zur Entstehung des Bandes
Es ist kein Zufall, dass der vorliegende Sammelband von zwei Hochschullehrerinnen herausgegeben wurde, deren Arbeitsumfeld im oberschwäbischen Raum angesiedelt ist. Der erste Anstoß dazu, dass wir uns intensiver mit dem Thema Dialekt in der Lehre auseinandersetzten, kam von unseren Studierenden, die immer wieder, sei es in Lehrveranstaltungen, im Rahmen von Schulpraktika oder in Gesprächen mit Lehrenden, vor der Tatsache stehen, dass ihr noch vergleichsweise stark dialektal geprägter Sprachgebrauch zum Thema gemacht – und bisweilen auch als „wesentlicher Störfaktor“ (Zehetner 1980: 7), als „mundartliche[s] Handicap“ (ebd.) gesehen – wird. Darf oder soll ich sogar im Unterricht Dialekt sprechen? Was ist überhaupt Dialekt, wo liegt die Grenze zu dem, was man als HochdeutschHochdeutsch bezeichnet? Ist Dialekt falsches Deutsch? Wie thematisiere ich Dialekt im DeutschunterrichtDeutschunterricht? Solche und ähnliche Fragen werden regelmäßig an uns gestellt. Diskutiert man diese Fragen, wird deutlich, dass es auch innerhalb eines Kollegiums des Faches Deutsch sehr unterschiedliche Positionen zur Frage nach dem Umgang mit Dialekt in der Lehre gibt. Aus diesem Grund entschieden wir uns dazu, eine Tagungsreihe zum Thema zu initiieren, die sich in erster Linie an unsere Studierenden richten sollte. Entsprechend fanden in den Jahren 2022 und 2023 drei Tagungstermine statt, auf denen dieser Sammelband fußt. Die Tagungen setzten unterschiedliche Schwerpunkte:
Die Auftaktveranstaltung1 mit dem Schwerpunkt ‚Dialekt im Südwesten‘ im Mai 2022 zielte auf die Darstellung des Dialektbegriffes aus varietätenlinguistischer Sicht. Dabei wurde ein Vortrag von Tobias Streck (Universität Freiburg) durch Forschungsbeiträge von Studierenden ergänzt. Es zeigte sich hier wie bei der Thematisierung von Mundart und Dialekt in unseren Hochschulveranstaltungen, dass die Vielfalt des Schwäbischen im Alltag unserer Region sehr lebendig ist und es immer auch um Identität, um Wechsel zu anderen Sprachregistern und um einen Mehrwert beim Nachdenken über Sprache geht. Die zweite Veranstaltung im November 2022 betitelten wir aus diesem Grund als ‚Dialekt in der Lehre‘. Lehrende und Studierende, Lehrkräfte aus Schulen sowie Mitglieder von Mundartgesellschaften diskutierten über die Rolle und den Gebrauch von Dialekt in Schule und Hochschule. Hieran schloss im Mai 2023 eine dritte Veranstaltung an, die mit dem Schwerpunkt ‚Dialekt in der DeutschdidaktikDeutschdidaktik‘ online stattfand. Sie mündete in die Frage, wie Dialekt sinnvoll in unseren Klassenzimmern einen Platz finden kann. Zwei Fachvorträge von Birte Arendt (Universität Greifswald) und Gudrun Kasberger (Private Pädagogische Hochschule der Diözese Linz) zeigten: Der Umgang mit den wieder zu belebenden niederdeutschen Dialekten bereitet Bildungsinstitutionen scheinbar andere Herausforderungen als jener mit den lebendigen oberdeutschen Dialekten.
Die Tagungsreihe hat die Notwendigkeit verdeutlicht, den dialektdidaktischen Diskurs, der in den letzten Jahren wichtige Impulse erhalten hat (z. B. Janle/Klausmann 2020, Arendt/Langhanke 2021), weiter auszubauen. In mehreren Bundesländern – so auch in Baden-Württemberg – wurden zwar in den letzten Jahren bildungspolitische Initiativen zur Förderung von Dialekt gestartet und auch in den Bildungsplänen wird das Thema aufgegriffen. Jedoch liefern diese Vorstöße kein wissenschaftliches Fundament, damit Studierende und Lehrende umfassende Antworten auf ihre Fragen erhalten, um auf der einen Seite „selbstverantwortet“ (Ossner 2021: 21) ihre Sprache gebrauchen und auf der anderen Seite sinnvolle didaktische Entscheidungen treffen zu können. Dialekt nimmt im traditionellen DeutschunterrichtDeutschunterricht, wenn überhaupt, lediglich eine periphere Rolle ein und es wird ihm noch immer, trotz aller Bemühungen, die es aus der DeutschdidaktikDeutschdidaktik gibt, ein defizitärer Charakter angelastet, wie auch einige Beiträge des vorliegenden Sammelbandes zeigen. Es dominiert im schulischen Kontext – was nicht zuletzt durch die Fokussierung der so genannten ‚BildungsspracheBildungssprache‘ verstärkt wird – nach wie vor eine starre Normorientierung, die insbesondere im Grammatikunterricht spürbar wird (Hochstadt 2019, 2020; Kern 2019). Das Bild einer ‚richtigen‘ dialektfreien Sprache, eines schriftgeprägten Standard- bzw. HochdeutschHochdeutsch mit einer ‚richtigen‘ Grammatik, macht es Lehrenden, wie wir selbst in den hochschulischen Veranstaltungen erfahren, schwer, Sprache deskriptiv und varietätenorientiert zu betrachten und Normvorstellungen bei den Lernenden zu hinterfragen. Dabei gaben in einer 2009 durch die Projektgruppe SpracheinstellungenSpracheinstellungen des Instituts für Deutsche Sprache in Mannheim veröffentlichten, bundesweit durchgeführten Repräsentativumfrage zu Spracheinstellungen in Deutschland knapp 60 % der Befragten an, einen Dialekt zu sprechen (Gärtig et al. 2010: 135ff.). Der höchste Anteil an Dialektsprechern lag erwartungsgemäß in Baden-Württemberg, BayernBayern und im Saarland. Um der Diskrepanz zwischen der vielfaltsgeprägten Sprachrealität auf der einen und der monoperspektivischen Unterrichtsrealität auf der anderen Seite entgegenzuwirken, haben wir uns – als Ergebnis unserer Tagungsreihe – entschlossen, diesen Sammelband herauszugeben. Er richtet sich an Studierende, Lehrende an Schulen und Hochschulen, Forschende, aber ebenso an alle dialektinteressierten Menschen, und setzt sich zum Ziel, weitere Impulse für eine sinnvoll konzipierte DialektdidaktikDialektdidaktik zu geben. Es ist unser Anliegen, einen Einblick in die aktuelle dialektdidaktische Forschung zu bieten und dabei ganz unterschiedliche Regionen, Forschungssettings und thematische Schwerpunktsetzungen in den Blick zu nehmen.
2Zum Aufbau des Bandes
Der Band ist dreigeteilt: Zu Beginn finden sich zwei Beiträge, die wir als Grundlagenartikel ausweisen – einer aus fachwissenschaftlicher, der andere aus fachdidaktischer Sicht. Es folgen dann zunächst Beiträge mit konzeptionellem Schwerpunkt und schließlich – als dritte/s Kategorie/Themenfeld – solche, die empirisch ausgelegt sind.
2.1Grundlagenbeiträge
Einen fachwissenschaftlichen Überblick zum Thema Dialekt liefert der Beitrag von TobiasStreck. Am Beispiel der Beschreibung des Schwäbischen wird der Begriff Dialekt hier aus varietätenlinguistischer Sicht fokussiert. Ebenfalls grundlegend, allerdings aus fachdidaktischer Sicht, blickt FrankJanle auf das Thema Dialekt: Er diskutiert die Rolle von Dialekt im Schulkontext und wirft einen kritischen Blick auf die aktuelle Situation in der Lehre.
2.2Konzeptionelle Beiträge
Die konzeptionellen Überlegungen umfassen zunächst die Bedingungen einer Etablierung einer Didaktisierung von Dialekten: Dazu gehört die u. a. von AlexanderGlück und Mara Maya Victoria Leonardi aufgezeigte Unterscheidung von ‚Dialekt als UnterrichtsgegenstandUnterrichtsgegenstand‘ und ‚Dialekt als UnterrichtsspracheUnterrichtssprache‘: Erkenntnisse über die jeweilige Verwendung werden in ihrem Beitrag an Bedingungen und Kategorien festgemacht. Grundsätzlicher Art kann auch der Beitrag von Alexandra Schiesser und Stefan Hauser eingeordnet werden, die dem nach ihrer Ansicht noch ungeklärten Verhältnis der Schule in der DeutschschweizDeutschschweiz zum Thema Dialekt auf den Grund gehen und sich dabei durch vier Thesen leiten lassen. In den Beiträgen von IrmtraudKaiser und Gudrun Kasberger, Birte Arendt sowie Robert Langhanke hingegen stehen Bedingungen der Konstituierung einer ‚DialektdidaktikDialektdidaktik‘ im Vordergrund: Während für Irmtraud Kaiser und Gudrun Kasberger die Begriffe der ‚Norm‘ und ‚Variation‘ im Kontext der Förderung einer umfassenden reflexiven Sprachlichkeit des Menschen einen Angelpunkt darstellen, um die DeutschdidaktikDeutschdidaktik als solche neu zu konzeptualisieren, plädiert RobertLanghanke für die Neuetablierung einer an einer Mehrsprachigkeitsdidaktik orientierten Disziplin. Eine Dialektdidaktik sieht er für die niederdeutschen Dialekte zwischen der Deutschdidaktik und der modernen Fremdsprachendidaktik angesiedelt. Neben diesen Fragestellungen zur Konstitution einer Disziplin stellt sich Birte Arendt die Frage nach dem Ausmaß und den Auswirkungen der IntegrationIntegration von Dialekt in den schulischen Kontext. Digitale Lehr-Lernpraktiken eröffnen für die niederdeutschen Dialekte neue Räume und vernetzen wichtige Interakteure bei der Ausbildung von Lehrkräften, der Erstellung von Materialien und der Konzeption von Unterricht. Die Digitalisierungdigital im Dialektkontext spielt auch im Beitrag von EmilySiviero, Birgit Alber und Joachim Kokkelmans eine zentrale Rolle. In ‚VinKiamo SüdtirolSüdtirol‘ geht es um ein Citizen-Science-Projekt zum CrowdsourcingCrowdsourcing für eine Dialektdatenbank, bei dem die Schule als Ausgangsort fungiert.
Wie sich Dialekt als Gegenstand der Betrachtung methodisch-didaktisch im Unterricht gestalten lässt, zeigen die Beiträge von Ann-MarieMoser, Gerrit Helm und Florian Hesse sowie Ulrike Freywald. Ann-MarieMoser gibt Vorschläge für eine interfachliche Zusammenarbeit in der Schule zum UnterrichtsgegenstandUnterrichtsgegenstand Dialekt. Gerrit Helm und Florian Hesse plädieren für eine Betrachtung von Dialekt als Sprachsystem, dessen RegularitätenRegularitäten und Phänomene zu analysieren seien. An einem Beispiel wird deutlich, welche Implikationen für eine neue Aufgabenkultur und Professionalisierung von Lehrkräften damit einhergehen. UlrikeFreywald schlägt schließlich vor, die regionalsprachlicheRegionalsprache bzw. dialektale Kompetenz von Schülerinnen und Schülern im Grammatikunterricht mit dem Ansatz des forschenden Lernens und mit Hilfe eines Gesprächskorpus zu integrieren. Sie stellt ihr Konzept anhand eines syntaktischen und eines phonologischen Phänomens des RegiolektsRegiolekt im Ruhrgebiet vor.
2.3Empirische Beiträge
Die letzte Gruppe umfasst Beiträge, die empirisch ausgerichtet sind. Teils beziehen sie sich auf Einstellungen, Haltungen und Erfahrungen von Sprecherinnen und Sprechern zum Dialekt, teils liefern sie Befunde zum Gebrauch und zur Vermittlung von Dialekt. Des Elementarbereichs nimmt sich FranziskaKeller an und untersucht, welche Standpunkte Gymnasiastinnen und Gymnasiasten zur SprachverwendungSprachverwendung von DeutschschweizerDeutschschweiz Kindergartenkindern im Spannungsfeld von Dialekt und Standardsprache einnehmen. Dabei fokussiert sie auch emotional geprägte Einstellungen. Auch bei DanielaZenz und Stephan Elspaß geht es um Einstellungen von Lernenden: Die Autorin und der Autor stellen die Frage, wie Schülerinnen und Schüler Varietäten konzipieren und wie sie MehrsprachigkeitMehrsprachigkeit im schulischen Kontext wahrnehmen. Den Blick ‚von der anderen Seite‘ nimmt Maria LenaWeinkam ein: Sie untersucht, wie dialektale Varietäten durch Lehrkräfte bewertet und vermittelt werden, und legt den Schwerpunkt hierbei auf den Bereich Deutsch als FremdspracheDeutsch als Fremdsprache im Hochschulkontext. Dass es in Bezug auf Einstellungen und auf den Sprachgebrauch signifikante Unterschiede zwischen verschiedenen Regionen gibt, wird bei EugenUnterberger und Cordula Pribyl-Resch deutlich: Der Beitrag untersucht die Sprachverwendung von Schülerinnen und Schülern mit gemeinsamem BasisdialektBasisdialekt in ÖsterreichÖsterreich und BayernBayern. Ebenfalls dem österreichischenösterreichisch Raum widmet sich KlausPeter, der die Funktion und die Rolle von Varietäten in Gesprächen im Rahmen kooperativen Schreibens zeigt und deutlich macht, dass Dialekt eine wesentliche Bedeutung bei der gemeinsamen Ausgestaltung von Schreibprozessen zukommt. Um Schreibprozesse geht es auch bei FranziskaBuchmann, die niederdeutsche LehrwerkeLehrwerk in Bezug auf die darin enthaltenen SchreibaufgabenSchreibaufgaben analysiert. JeanetteHoffmann, mit deren Artikel der Sammelband schließt, untersucht, welchen Beitrag Bilderbücher zum Sprach- und Literaturerwerb in deutschsprachigen GrundschulenGrundschule SüdtirolsSüdtirol leisten und wie Bilderbuchgespräche im Kontinuum zwischen Dialekt und Standardsprache gestaltet sein können.
Dank
Einen großen Dank möchten wir an dieser Stelle unserer studentischen Hilfskraft Jelena Rosic aussprechen, die durch ihren Überblick und ihre Zuverlässigkeit wesentlich am Gelingen des Bandes beteiligt war.
Literatur
Arendt, Birte/Langhanke, Robert (Hrsg.) (2012). NiederdeutschdidaktikNiederdeutsch: Grundlagen und Perspektiven zwischen Varianz und Standardisierung. Berlin u. a.
Gärtig, Anne-Kathrin/Plewnia, Albrecht/Rothe, Astrid (2010). Wie Menschen in Deutschland über Sprache denken: Ergebnisse einer bundesweiten Repräsentativerhebung zu aktuellen SpracheinstellungenSpracheinstellungen. Herausgegeben vom Institut für deutsche Sprache. Mannheim 2010. Abrufbar unter: https://ids-pub.bsz-bw.de/frontdoor/deliver/index/docId/560/file/Gaertig_Wie_Menschen_in_Deutschland_2010.pdf (Stand: 27/05/2025)
Hochstadt, Christiane (2020). Inklusion im Grammatikunterricht? Der DeutschunterrichtDeutschunterricht, H. 2/2020, 53–61.
Hochstadt, Christiane (2019). Sprachliche Vielfalt. In: Hochstadt, Christiane/Olsen, Ralph (Hrsg.) Handbuch DeutschunterrichtDeutschunterricht und Inklusion – Überblick und Kritik. Weinheim, 111–127.
Kern, Friederike (2019). Grammatikunterricht. In: Hochstadt, Christiane/Olsen, Ralph (Hrsg.) Handbuch DeutschunterrichtDeutschunterricht und Inklusion – Überblick und Kritik. Weinheim, 338–352.
Janle, Frank/Klausmann, Hubert (2020). Dialekt und Standardsprache in der DeutschdidaktikDeutschdidaktik: Eine Einführung. Tübingen.
Ossner, Jakob (2021). Grammatik: verstehen – erklären – unterrichten. Theorie und Praxis der Schulgrammatik des Deutschen. Paderborn.
Zehetner, Ludwig (1980). Der Lehrer im Spannungsfeld zwischen Hochsprache und Dialekt. Schulreport: Tatsachen und Meinungen zur aktuellen Bildungspolitik in BayernBayern (1980/5), 7–9.
Innere MehrsprachigkeitMehrsprachigkeit und das SpektrumSpektren des raumgebundenen Sprechens
Abstract: Dieser Beitrag befasst sich mit arealer Variation und vertikalen SpektrenSpektren im Deutschen. Es wird darauf eingegangen, wie sich eine objektive Dialektdefinition von dem unterscheidet, was subjektiv mitunter als Dialekt bezeichnet wird. Es wird im Überblick dargestellt, wie heute die regionalen Spektren im Deutschen aussehen, in welchem Verhältnis die Dialekte zum Standarddeutschen stehen und welche Varietäten und SprechlagenSprechlage sich zwischen diesen beiden Polen befinden (können). Weiterhin werden verschiedene Repertoire-/Sprechertypen und deren spezifische Ausprägungen von innerer MehrsprachigkeitMehrsprachigkeit beschrieben. Abschließend wird die Bedeutung von Variations-/Varietätenkompetenz sowohl für Schülerinnen und Schüler als auch für Lehrkräfte thematisiert.
Keywords: areale Variation/Varietäten, vertikale SpektrenSpektren, RegionalakzentRegionalakzent, GebrauchsstandardGebrauchsstandard, Repertoire-/Sprechertypen, innere MehrsprachigkeitMehrsprachigkeit, Variations-/Varietätenkompetenz
1Einleitung
Bis heute sind erstaunlicherweise diverse ‚Mythen‘ über Dialekte – und deren Sprecherinnen und Sprecher – im Umlauf, d. h. in den Köpfen vieler Menschen verankert. Zu diesen Mythen, die immer wieder zutage treten, zählt beispielweise der Mythos, Dialekte seien eine Art ‚schlechtes HochdeutschHochdeutsch‘.1 Weiterhin sind seit langem – und offenbar auch noch im 21. Jahrhundert – nicht wenige sprachwissenschaftliche Laien der Meinung, dass Dialektsprecherinnen und -sprecher schlechtere Bildungs- und Karrierechancen bzw. Probleme beim Erwerb der Standard(schrift)sprache hätten (Beispiele werden u. a. in Neuland 2023: 119f. oder Meune 2022: 159 zitiert, s. auch Korecky-Kröll 2020: 1382, Janle/Klausmann 2020: 110) oder gar grundsätzlich weniger gebildet seien (s. z. B. die in Gärtig et al. 2010: 133 dargestellten Umfrageergebnisse – mit regionalen Unterschieden). Zugleich findet Befragungen zufolge in Deutschland eine Mehrheit der Befragten ein „dialektal gefärbtes Deutsch ‚(sehr) sympathisch‘“ (ebd.: 155); und ebenfalls gibt in Befragungen regelmäßig mindestens die Hälfte der Befragten (und teilweise bis zu über 70 %) – durchschnittlich, aber regional, ‚sozial‘ und auch situativ durchaus unterschiedlich – an, „einen deutschen Dialekt zu beherrschen“ (ebd. 135) bzw. „die Mundart hier aus der Gegend“ (Allensbacher Archiv 2008: 4ff.) zumindest ‚ein wenig‘ zu sprechen (s.a. das ebd. abgedruckte Schaubild). Offen bleibt bei solchen und ähnlichen Befragungen allerdings in der Regel, was die Befragten eigentlich unter Dialekt bzw. Mundart verstehen (siehe hierzu Abb. 1). Kehrein fasst dieses Problem folgendermaßen zusammen: „Was manche Sprecher als (ihr bestes) ‚Hochdeutsch‘ ansehen, betrachten andere in derselben Region als (ihren besten) ‚Dialekt‘, während objektsprachlich beidem eine SprechlageSprechlage des RegiolektsRegiolekt entsprechen kann.“3 (2019: 124)
Ich werde im Folgenden zunächst darstellen, wie in der Linguistik definiert wird, was ein Dialekt ist und in welchem Verhältnis die deutschen Dialekte – historisch betrachtet – zur deutschen Standardsprache stehen. Anschließend werde ich darauf eingehen, dass wir es heutzutage in Deutschland keineswegs nur mit den beiden Varietäten Dialekt und Standardsprache zu tun haben, sondern dass in den allermeisten Gegenden ein ganzes SpektrumSpektren raumgebundenen Sprechens existiert, das regional ganz unterschiedlich ausgeprägt sein kann. Außerdem werde ich erläutern, was man sich unter einer sogenannten inneren MehrsprachigkeitMehrsprachigkeit vorzustellen hat und welche unterschiedlichen Sprecher-/Repertoiretypen die variationslinguistische Forschung in den vergangenen Jahren in verschiedenen Regionen in Deutschland identifiziert hat. Ich werde mich dabei – auch aufgrund des Themas des vorliegenden Bandes – in erster Linie, wie oben bereits erwähnt, auf den Bereich des regionalen/raumgebundenen Sprechens konzentrieren. Im Wesentlichen stellt dieser Beitrag einen komprimierten und stark vereinfachten Forschungsüberblick dar, der keinen Anspruch auf Vollständigkeit erheben kann oder möchte.
Vergleich zwischen Sprecherbewertungen und objektsprachlichen Analysen von SprechlagenSprechlage/Varietäten (aus Kehrein 2019: 124)
2Was ist eigentlich ein Dialekt?
Begibt man sich auf die Suche nach wissenschaftlichen Definitionen für ‚Dialekt‘, dann begegnet man recht unterschiedlichen Ansätzen mit ganz verschiedenen Komplexitätsgraden. Allen gemein ist jedoch – sozusagen als der kleinste gemeinsame Nenner –, dass Dialekte Erscheinungsformen von Sprache sind, die (a) bestimmte charakteristische (sprachliche) Merkmale aufweisen und (b) an den geographischenGeographie Raum gebunden sind. Gewissermaßen sind Dialekte ‚Sprachen in der Sprache‘, sie sind Varietäten einer Gesamtsprache (Elspaß 2023: 22ff.). Wenn man sich dem Begriff Varietät aus linguistischer Sicht nähert, dann könnte eine Definition folgendermaßen aussehen: Varietäten sind „partiell systemisch differente Ausschnitte des komplexen Gesamtsystems Einzelsprache, auf deren Grundlage Sprechergruppen in bestimmten Situationen interagieren“ (Schmidt/Herrgen 2011: 51). Wir haben es also mit Erscheinungsformen einer Sprache mit speziellen – von der Standardsprache abweichenden – prosodisch-phonologischen, morpho-syntaktischen sowie gegebenenfalls auch lexikalischenLexik Merkmalen zu tun, die von bestimmten Sprechergruppen in bestimmten Situationen verwendet werden. Für Dialekte gilt überdies, dass sie besonders standardfern und nur lokal oder kleinregional verbreitet sind (ebd.: 59), ihre Sprecherinnen und Sprecher also klar in einer bestimmten Kleinregion zu verorten sind und die kommunikative ReichweiteKommunikation räumlich eng begrenzt ist. Hinzu kommt, dass es sich bei Dialekten vorwiegend um gesprocheneGespräch Varietäten handelt (z. B. Elspaß 2023: 43). Vieles, was u. a. Befragte in Umfragen als Dialekt bezeichnen („Ja, ich kann einen deutschen Dialekt“ o.ä.) oder sprachwissenschaftliche Laien beim Hören anderer Sprecherinnen und Sprecher als Dialekt einschätzen, ist dagegen aus variationslinguistischer Sicht kein Dialekt, sondern lediglich ein bestimmter Akzent, eine Variantenkonfiguration, „die nur wenige lautliche oder intonatorische Merkmale“ (ebd.: 23) umfasst. Dazu später mehr (siehe auch oben Abb. 1).
Wenn nun hier ‚besonders standardfern‘ als ein Charakteristikum von Dialekten genannt wird, könnte man ja doch auf die Idee kommen, dass Dialekte eine Art ‚schlechtes HochdeutschHochdeutsch‘ seien (s. Einleitung). Solchen Ideen bzw. diesem immer noch weit verbreiteten Mythos liegt allerdings ein ganz grundsätzliches Missverständnis zugrunde, das die Diachronie betrifft. Was wir heute alltagssprachlich als ‚Hochdeutsch‘ bezeichnen – und in der Linguistik aus guten Gründen Standarddeutsch genannt wird –, ist historisch betrachtet viel jünger als alle deutschen Dialekte.1 Wenn in einer Definition also die Rede davon ist, dass man unter einem Dialekt „diejenige Varietät einer Sprache, die an einem gegebenen Ort am stärksten von der Standardform abweicht“ (Barbour/Stevenson 1998: 314), verstehe, dann muss man sich dessen bewusst sein, dass die Dialekte Formen aufweisen, „die älter als diejenigen der Standardsprache sind; die Entstehung der Standardsprache vollzog sich, als bestimmte für die späteren Dialekte charakteristische Formen bereits da waren“ (Bausinger 1989: 102). Unser heutiges Standarddeutsch ist historisch gewachsen – in einem Prozess, der etwa im 15. Jahrhundert begann und in den von Mitgliedern privilegierter Gesellschaftsschichten und zum Teil auch von Sprachwissenschaftlerinnen und Sprachwissenschaftlern steuernd eingegriffen wurde. Durch Selektion und Kodifizierung von Varianten aus bestimmten – zunächst insbesondere ostmittel- und auch ostoberdeutschen – Dialekten entstand eine überregionale Verkehrssprache, die über Jahrhunderte hinweg weiterentwickelt wurde und letztlich eine Kompromissform darstellt. Lange Zeit war sie praktisch ausschließlich eine SchriftspracheSchriftsprache (Elspaß 2023: 49f., ausführlicher Eichinger 2015). Von einer mündlichenMündlichkeit Verwendung – für das öffentliche Auftreten – kann erst allmählich ab dem 19. Jahrhundert die Rede sein. Und erst mit der Entwicklung und Verbreitung der Massenmedien im 20. Jahrhundert bot sich eine regelmäßige Möglichkeit, sich an überregional gesprochener Standardsprache zu orientieren und eine Vertrautheit mit dieser zu erlangen (Eichinger 2015: 176f.).
3Das SpektrumSpektren des raumgebundenen Sprechens
Noch zu Beginn des 20. Jahrhunderts war also die mündlicheMündlichkeit Kommunikation in Deutschland von Varietäten mit verhältnismäßig geringer kommunikativer Reichweite geprägt – und das Standarddeutsche war hauptsächlich für das Schreiben und Lesen reserviert (= mediale DiglossieDiglossie, Auer 2005: 12ff.). Nur bestimmte Sprechergruppen hatten bis dato damit begonnen, nach der als hochwertig betrachteten SchriftspracheSchriftsprache zu sprechen. In diese neue Sprechweise hatten sie (unbewusst) viele Merkmale ihres jeweiligen Dialekts übernommen, wodurch sich allmählich ‚Zwischenvarietäten‘ zwischen der überregionalen Schriftsprache und den Dialekten zu entwickeln begannen (Kehrein 2012: 18ff., Elspaß 2023: 48). Diese Entwicklung beschleunigte sich durch die spätestens ab der dritten Dekade des 20. Jahrhunderts massenmedial präsente Standardsprache, die in den folgenden Jahrzehnten die Dialekte immer stärker beeinflusste (s. Strobel 2021: 158f., dort weitere Literaturhinweise). Daneben entstanden mit zunehmender Mobilität der Bevölkerung durch intensiven Kontakt zwischen Sprecherinnen und Sprechern verschiedener lokaler Dialekte auch großräumigere RegionaldialekteRegionaldialekt, indem Sprechweisen aus verschiedenen Gründen zu einem gewissen Grad aneinander angeglichen wurden. Es kam zu einer neuen Varietätenkonstellation, in der zwischen der Standardsprache bzw. standardnahen SprechlagenSprechlage und den Dialekten auch sogenannte RegiolekteRegiolekt verwendet werden, wobei in manchen Regionen die Übergänge in beide Richtungen fließend sind (= DiaglossieDiaglossie, s. Auer 2005: 22ff., Elspaß 2023: 48, jeweils mit Modelldarstellung1).
[Heute ist] unstrittig, dass im 21. Jahrhundert einschneidende Veränderungen zu konstatieren sind: Im Wesentlichen die gesellschaftliche Modernisierung (Veränderungen der Arbeitswelt, Steigerung der Mobilität, Veränderungen des Wertesystems u. a.) und die dynamische Entwicklung der Medien (Rundfunk, Fernsehen, Online-Medien) haben im 20. Jahrhundert und bis heute völlig neue kommunikative Bedingungen geschaffen, die die sprachlichen Varietäten von Grund auf verändert haben. […] [An] die Stelle der standardfernen BasisdialekteBasisdialekt [treten] mehr und mehr großräumige RegiolekteRegiolekt. Zudem entwickelt sich eine markante Regionalität auch in den standardnahen RegisternRegister (‚RegionalakzentRegionalakzent‘, ‚GebrauchsstandardGebrauchsstandard‘). Ein ganzes SpektrumSpektren des raumgebundenen Sprechens hat die traditionellen Basisdialekte abgelöst. (Herrgen/Schmidt 2019: V f.)
Die Dialekt-Standard-SpektrenSpektren (= vertikale Spektren) sind in den verschiedenen Regionen des deutschen Sprachraums jedoch unterschiedlich strukturiert, weil „die hochdeutscheHochdeutsch SchriftspracheSchriftsprache bestimmten Dialektverbänden und -regionen strukturell ähnlicher ist als anderen“ (Kehrein 2019: 121). Das wiederum hat historische Gründe:
Es ist [..] eine gewisse Ironie der Sprachgeschichte, dass sich im Laufe der Standardisierung des Deutschen das HochdeutscheHochdeutsch (mit stark ostmitteldeutscher, v. a. des Meißnisch-Sächsischen, und ostoberdeutscher Prägung) gegenüber dem Niederdeutschen durchgesetzt hat […], sich aber in der Geschichte der Kodifizierung der Aussprache weitgehend eine norddeutsche Aussprache des Schriftdeutschen durchgesetzt hat. (Elspaß 2023: 57)2
Kehrein (2019) beschreibt vier Typen vertikaler regionalsprachlicher SpektrenSpektren (bei denen man jeweils noch die Standardsprache, die ja nicht als regionale Varietät aufzufassen ist, als zusätzliche ‚überdachende‘ Varietät und Vergleichspol mitdenken muss). Beim ersten Spektrumstyp gibt es zwei regionalsprachlicheRegionalsprache Varietäten, zwischen denen eine relativ stabile Trennung vorliegt und keine wesentliche gegenseitige Beeinflussung erfolgt. Dieser Typ eines Spektrums wird in der Regel als (regionalsprachliche) DiglossieDiglossie bezeichnet und ist charakteristisch für die deutschsprachige Schweiz (hier mit den beiden Varietäten ‚Schweizerhochdeutsch‘ und Dialekt, ebd. 128f.) sowie für Teile des niederdeutschen Sprachraums und für das Mittelbairische (hier jeweils mit den beiden Varietäten RegiolektRegiolekt und Dialekt).
Beim zweiten Typ ist ein ausgebautes SpektrumSpektren mit zwei regionalsprachlichenRegionalsprache Varietäten (Dialekt und RegiolektRegiolekt) vorhanden, innerhalb derer wiederum zumeist verschiedene SprechlagenSprechlage identifiziert und voneinander abgegrenzt werden können. Diese Varietätenkonstellation gilt laut Kehrein (ebd.: 126) für das Mittelfränkische, das Hochalemannische in Deutschland, das Zentralhessische sowie für das Mittelbairische in Ostösterreich. Bohnert-Kraus (2020: 320ff.) weist diesen Spektrumstyp auch für Orte im Mittelalemannischen nach und ordnet auch das Schwäbische im Raum Ulm (auf Basis der Arbeit von Schaub 2011) hier ein. Je nach Region können bei dieser diaglossischenDiaglossie Varietätenkonstellation für die Varietät Regiolekt die Sprechlagen RegionalakzentRegionalakzent sowie mittlerer und unterer Regiolekt und für die Varietät Dialekt die Sprechlagen oberer und mittlerer RegionaldialektRegionaldialekt sowie BasisdialektBasisdialekt identifiziert werden, deren linguistischer Abstand zum Standarddeutschen in dieser Reihenfolge zunimmt (ebd.: 321, Kehrein 2012: 101, 208, s. dazu auch oben Abb. 1).
Als dritten Spektrumstyp beschreibt Kehrein (2019: 126) ein regionalsprachliches Kontinuumregionalsprachliches Kontinuum zwischen Dialekt bzw. Dialektresten (= standardfernste SprechlageSprechlage) und RegionalakzentRegionalakzent (= standardnächste regionalsprachlicheRegionalsprache Sprechlage), bei dem sich die Sprechweisen dazwischen nicht mehr systematisch unterscheiden lassen. Regionalsprachliche Kontinua wurden laut Kehrein (ebd.) für Orte im Ostfränkischen sowie im erweiterten Rhein-Main-Gebiet nachgewiesen und ebenfalls verschiedentlich in Untersuchungen zum Mittelbairischen in Ostösterreich angegeben.
Beim vierten regionalsprachlichenRegionalsprache Spektrumstyp ist die Varietät Dialekt bereits nicht mehr nachweisbar. Der Dialekt ist geschwunden, das SpektrumSpektren besteht lediglich aus der Varietät RegiolektRegiolekt (auch hier natürlich überdacht von der Standardsprache). Dieser Typ ist laut Kehrein (ebd.: 127) für Teile des Niederdeutschen, im rheinfränkisch-zentralhessischen Übergangsgebiet und auch im Ostmitteldeutschen festgestellt worden.
Vergleich einiger Beispiele für vertikale VariationsspektrenSpektren verschiedener Dialektregionen (aus Kehrein 2019: 128, Beschriftung der Beispiele für die vier Typen ergänzt von TS)
In Abbildung 2 sind einige Beispiele für vertikale VariationsspektrenSpektren aus verschiedenen deutschen Dialektregionen nebeneinander dargestellt. Im direkten Vergleich ist der jeweilige Abstand der Varietäten von der sie überdachenden Standardsprache gut zu erkennen. Auch die unterschiedliche vertikale Ausdehnung der einzelnen Spektren sowie der verschiedenen Varietäten ist in der Vergleichsdarstellung leicht zu erfassen.3 Wie sich die oben genannten Spektrumstypen im deutschen Sprachgebiet verteilen, ist auf einer Karte in Kehrein (ebd.: 127) dargestellt. Die phonologischen, morphologischen und syntaktischen Raumstrukturen, die sprachdynamischen Prozesse und vertikalen RegisterRegister sowie die areale LexikLexik der Dialekt(groß)räume im deutschen Sprachgebiet und auch die areale Variation im Standarddeutschen werden in den einzelnen Artikeln im Handbuch Sprache und Raum. Band 4: Deutsch (Herrgen/Schmidt 2019) ausführlich behandelt. Auf diese sehr empfehlenswerten Handbuchartikel wird hiermit ausdrücklich hingewiesen (ohne hier jeden Artikel des Handbuchs einzeln aufzuführen).
4Innere MehrsprachigkeitMehrsprachigkeit
MehrsprachigkeitMehrsprachigkeit ist auch für die deutschsprachigen Länder seit jeher der Normalfall. Es wurden hier neben Deutsch schon immer auch andere Sprachen gesprochen und geschrieben. Das kann man als ‚äußere Mehrsprachigkeit‘ bezeichnen (s. Elspaß 2023: 15). Die deutsche Sprache selbst zeichnet sich, wie wir oben bereits gesehen haben, jedoch auch durch Heterogenität aus:
Sie ist ein Gesamtsprachsystem, das sich aus verschiedenen Ausschnitten oder Subsystemen zusammensetzt, den sogenannten Varietäten. Einzelne Varietäten sind beispielsweise Dialekte, Jugendsprachen oder Fachsprachen. Die Sprecher/innen verfügen in unterschiedlichem Maße über eine aktive bzw. passive Kompetenz dieser Varietäten. Indem sie verschiedene Varietäten aktiv oder passiv beherrschen, verfügen die Sprecher/innen über eine besondere Form von MehrsprachigkeitMehrsprachigkeit. (Girnth 2007: 187)
Die im Zitat beschriebene „besondere Form von MehrsprachigkeitMehrsprachigkeit“ (ebd.) kann man entsprechend als ‚innere Mehrsprachigkeit‘ bezeichnen (Christen et al. 2020: 91, Elspaß 2023: 15). In diesem Beitrag geht es in erster Linie um einen bestimmten Ausschnitt aus dieser inneren Mehrsprachigkeit, das SpektrumSpektren des raumgebundenen Sprechens. Selbstverständlich ist aber raumgebundenes Sprechen nicht unabhängig von der sozialen und situativen und auch nicht von der medialen Dimension sprachlicher Variation. Dialekte und RegiolekteRegiolekt werden von verschiedenen Menschen in unterschiedlichen Situationen verwendet (in der Regel gesprochen, eher selten geschrieben), in denen sie – in Abhängigkeit vom FormalitätsgradFormalitätsgrad – deren Verwendung und ggf. die Entscheidung für eine bestimmte SprechlageSprechlage innerhalb dieser Varietäten für angemessen halten.1 Sprachliche Variation hat meist eine soziale Bedeutung, denn mit dem, wie man etwas sagt, teilt man (oft auch unbewusst) etwas über sich selbst mit. „[S]chon wer isch(t) sagt und nicht ist oder is, wird von Kommunikationspartner:innen einem bestimmten Sprachraum zugeordnet“ (Elspaß 2023: 17).
Hinter den oben umrissenen Typen vertikaler SpektrenSpektren ‚verbergen‘ sich regional unterschiedliche Repertoire-/Sprechertypen. Insbesondere in oberdeutschen Regionen sind laut Kehrein (2012: 349f.) noch diglossischeDiglossie Sprecherinnen und Sprecher zu finden, die in der mündlichenMündlichkeit Alltagskommunikation praktisch ausschließlich die Varietät Dialekt (individuell und situativ jedoch mitunter verschiedene SprechlagenSprechlage) verwenden. Die Standardsprache wird hingegen für die schriftliche Kommunikation genutzt. Sie kann zwar als ‚gesprochenes Schriftdeutsch‘ von diesen Sprecherinnen und Sprechern auch mündlich umgesetzt werden, was allerdings faktisch fast nicht vorkommt (ebd. 350). Daneben gibt es Sprecherinnen und Sprecher, die in ihrer alltäglichen Kommunikation auch regiolektaleRegiolekt Sprechlagen neben dem Dialekt verwenden. In Situationen mit höherem FormalitätsgradFormalitätsgrad vollziehen diese Sprecherinnen und Sprecher in der Regel einen VarietätenwechselVarietätenwechsel vom Dialekt zum Regiolekt. Kehrein (ebd.) nennt sie Sprecherinnen und Sprecher mit bivaretärer Kompetenz oder bivarietärebivarietär Switcher.
Im niederdeutschen Sprachraum gibt es ebenfalls dialektkompetente Sprecherinnen und Sprecher mit bivarietärerbivarietär Kompetenz. Aufgrund der im Vergleich zum oberdeutschen Raum sehr geringen Zahl an Dialektsprecherinnen und Dialektsprechern spielt hier allerdings der RegiolektRegiolekt eine weitaus wichtigere Rolle im kommunikativen Alltag als der Dialekt, weil letzterer nur in ausgewählten KommunikationssituationenKommunikation verwendet werden kann (ebd.).
Nahezu im gesamten Bundesgebiet sind (insbesondere in der mittleren und jungen Generation) Sprecherinnen und Sprecher mit monovarietärermonovarietär Kompetenz im RegiolektRegiolekt zu finden, die – aus verschiedenen Gründen – keine DialektkompetenzDialektkompetenz mehr ausgebildet haben. Im mittel- und niederdeutschen Raum scheinen sie sogar den überwiegenden Anteil der Sprecherinnen und Sprecher auszumachen. Es lassen sich grundsätzlich zwei Untertypen differenzieren, die monovarietären Shifter, die je nach Situation zwischen verschiedenen regiolektalen SprechlagenSprechlage wechseln, und solche Sprecherinnen und Sprecher, die das nicht tun, also keine situationsbedingte Variation zeigen (ebd.: 350f.).
Schlussendlich gibt es auch Sprecherinnen bzw. Sprecher, die praktisch über keine regionalsprachlicheRegionalsprache Kompetenz (bzw. lediglich eine passive) verfügen und deren Sprechweisen „durch das Fehlen salienter regionalsprachlicher Merkmale charakterisiert“ (ebd.: 351) sind. Kehrein nennt sie „Standardsprachesprecher“ (ebd.).
Insgesamt scheinen die Sprecherinnen und Sprecher mit monovarietärermonovarietär Kompetenz im RegiolektRegiolekt einen besonderen Anteil an den in allen Regionen zu beobachtenden vertikalen sprachdynamischen Prozessen in Richtung auf die Standardsprache zu haben:
Es ist in keinem Fall zu beobachten, dass Sprecher einer Generation im Vergleich zu Sprechern älterer Generationen eine standardfernere Varietät oder SprechlageSprechlage beherrschen oder verwenden würden […]. Der Ausbau der regionalsprachlichenRegionalsprache SpektrenSpektren in Richtung Standardsprache erfolgt in der Regel durch (jüngere) Sprecher, die nicht mehr im Dialekt, sondern im RegiolektRegiolekt sprachlich primärsozialisiert wurden. (Kehrein 2019: 150)2
Heutzutage werden in der Tat in vielen Regionen in Deutschland (mit Ausnahme des Bairischen sowie von Teilen des alemannischen Sprachraums) die meisten Sprecherinnen und Sprecher nicht mehr im Dialekt primärsozialisiert, sondern im RegiolektRegiolekt (Christen et al. 2020: 116, Elspaß 2023: 45), und sie haben von frühester Kindheit an über die Medien Kontakt mit der Standardsprache. Der Regiolekt hat hier wichtige sozio-pragmatische Funktionen der alten Dialekte übernommen, insbesondere die „sprachliche Signalisierung von interindividuell-sozialer NäheNähe“ (Christen et al. 2020: 117) und dadurch auch zugleich die Markierung der Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe.
In Bezug auf die Repertoiretypen und die Typen vertikaler SpektrenSpektren ist allerdings nicht unumstritten, wo eigentlich der regionalsprachlicheRegionalsprache Bereich endet und ‚die Standardsprache‘ beginnt bzw. wie eng oder weit man ‚Standarddeutsch‘ fassen sollte (z. B. Knöbl 2012: 19). Ist gesprochenes Standarddeutsch tatsächlich dadurch gekennzeichnet, dass es keine salienten (also ‚auffälligen‘) regionalsprachlichen Merkmale enthält (z. B. Kehrein 2012: 351, basierend auf Schmidt/Herrgen 2011: 62)? Oder gibt es auch areale Variation im Standarddeutschen? Wie/wo ist ‚der Standard‘ eigentlich normiert – und wer bestimmt diese Normen für den Bereich der gesprochenen Sprache? Mit diesen Fragen sind wir bei einem weiteren Mythos angekommen, nämlich dem, es gebe so etwas wie ein ‚akzentfreies HochdeutschHochdeutsch‘ (Elspaß 2023: 56). Tatsächlich ist es aber so, dass es sich bei dem, was offenbar viele als ‚akzentfrei‘ betrachten, eigentlich nur um einen bestimmten Akzent handelt, und zwar um einen, der weitgehend einer nord(west)deutschen Aussprache der geschriebenen Standardsprache entspricht und sich gegenwärtig schnell ausbreitet – was auch mit einer sozialen Bewertung dieses Akzents gegenüber anderen Akzenten zusammenhängt (ebd.) und „über audiovisuelle Medien wie Rundfunk, Film und Fernsehen beschleunigt“ (ebd.: 57) wird. Das kann dazu führen, dass jemand, der/die in seinem/ihrem ‚Hochdeutsch‘ beispielsweise das Wort sagen als [ˈsɒːgn̩] realisiert, bereits als Sprecher/Sprecherin eines (bairischen) Dialekts eingeordnet wird – und zwar nur, weil er oder sie das wortinitiale <s> als stimmloses [s] und den Vokal der Stammsilbe, das <a>, ‚verdumpft‘ ausspricht (ebd.: 53 u. 23).3
Wenn man allerdings davon ausgeht, dass nicht nur professionelle bzw. geschulte Sprecherinnen und Sprecher standarddeutsch oder standardnah sprechen, sondern
z. B. auch Politiker:innen in Parlamentsreden, Schüler:innen bei mündlichenMündlichkeit Abschlussprüfungen oder Bürger:innen, die (hörbar) fremden Tourist:innen eine Wegbeschreibung geben, dann vergrößert sich der Kreis der potenziellen Standardsprecher:innen schlagartig. Und wenn man sich darüber hinaus am Konzept des GebrauchsstandardsGebrauchsstandard orientiert, so erhöht sich auch das zu berücksichtigende Ausmaß an Variation erheblich. (ebd.: 57)4
Erfreulicherweise berücksichtigt das Duden-Aussprachewörterbuch seit seiner 7. Auflage (2015) den GebrauchsstandardGebrauchsstandard von Sprecherinnen und Sprechern und ist somit seither deutlich variantenreicher als frühere Auflagen.5 In Christen et al. (2020: 114ff.) ist ein zusammenfassender Überblick über typische, ausgewählte lautliche Merkmale dessen, was manche als RegionalakzentRegionalakzent und andere als Gebrauchsstandard (oder ‚bestes HochdeutschHochdeutsch‘ oder ‚intendierte Standardsprache‘) von Sprecherinnen und Sprechern einzelner Dialektregionen in Deutschland bezeichnen würden, zu finden. Für diejenigen Regionen in Deutschland, die dem alemannischen Raum angehören, sind das beispielsweise (laut ebd.: 115, s. aber auch Spiekermann 2008, hier auch mit regionaler Differenzierung innerhalb von Baden-Württemberg) die gehobene Realisierung von Kurzvokalen (wie in [koχ, bet] ‚Koch, Bett‘), die Palatalisierung von /s/ (wie in [ˈma̠ɪ̯ʃtəns] ‚meistens‘), die Tilgung von /t/ in /st/ bei Verbalformen (wie [ha̠ʃ, bɪʃ] ‚hast, bist‘), die Desonorisierung von /z/ im Anlaut (wie in [ˈsɔnə] ‚Sonne‘) sowie mitunter die Verdumpfung von -er in Nebensilben (wie in [ˈmʊtɔ] ‚Mutter‘).6
5Variationskompetenz
Wie weiter oben bereits erwähnt wurde, ist der Faktor Raum natürlich nur ein Faktor im gesamten sprachlichen Variationsraum. Auch die Wahl einer bestimmten SprechlageSprechlage zwischen den Polen Dialekt und Standarddeutsch wird von persönlichen, sozialen und situativen Faktoren bestimmt. Für Kinder ist es wichtig, frühzeitig eine Variations- bzw. RegisterkompetenzRegister1 als Teil ihrer allgemeinen kommunikativen Kompetenz zu erwerben (s. z. B. Neuland 2023: 319).
Unter dem Terminus Variationskompetenz wird eine Kombination mehrerer Teilkompetenzen subsumiert, und zwar die Fähigkeit, verschiedene Varietäten verstehen zu können (rezeptive Kompetenz), worauf die Fähigkeit aufbaut, die Varietäten zu unterscheiden (diskriminieren) und die Situationsadäquatheit von Sprechweisen zu erkennen (= perzeptive Seite der Variationskompetenz), was letztlich zur Fähigkeit führt, die entsprechenden Varietäten auch selbst (mehr oder weniger) bewusst realisieren und soziopragmatisch einsetzen zu können (= produktive Seite der Variationskompetenz). (Kaiser/Kasberger 2020: 161)
Laut Kaiser/Kasberger (ebd.: 165) belegen Untersuchungen, dass schon vor einem Alter von fünf Jahren komplexe Muster von Variation erworben werden. Der sprachliche Input, den Kinder erhalten, beeinflusst den Erwerb der Variationskompetenz erheblich. Neben den Eltern spielen dabei auch der Kindergarten und die Schule eine wichtige Rolle, da Kinder dort mit immer mehr Varietäten in Berührung kommen und die Peer Group und deren Sprachgebrauch und SpracheinstellungenSpracheinstellungen zunehmend an Einfluss gewinnt. Beim Ausbau der RegisterkompetenzRegister und dem Erwerb von Einstellungen gegenüber Sprache und Varietäten verbinden sich gerade in der Schule Normen, Normalitätserwartungen, sozio-indexikalische Bewertungsmuster, Leistungsaspekte (Kompetenzerwartungen) und anderes mehr zu einem komplexen Ganzen (ebd.: 166). „Eine balancierte, reflexive und flexible innere MehrsprachigkeitMehrsprachigkeit darf daher als Ziel sprachlicher Bildung angenommen werden“ (ebd.: 167). In ihrer eigenen Untersuchung stellen Kaiser/Kasberger (ebd.: 186) fest, dass die innere Mehrsprachigkeit im Altersbereich von drei bis zehn Jahren erheblich ausgebaut wird und dabei ein deutlicher Sprung im Alter von sieben bis acht Jahren stattfindet.
Variations- und RegisterRegister-/Varietätenkompetenz muss jedoch nicht nur von Kindern entwickelt werden, sondern auch bei Lehrpersonen vorhanden sein. Wie Hove et al. (2020) im Überblick sowie anhand einer eigenen Studie zeigen, kann sich beispielsweise der jeweilige Typ des in einer Region vorhandenen vertikalen Variationsspektrums auf den Orthographieerwerb auswirken. In einer Diglossiesituation, wie in der DeutschschweizDeutschschweiz, erleichtern die klar voneinander getrennten Varietäten den Kindern offenbar den Erwerb und die Anwendung der alphabetischen Strategie. Bei einem ausgebauten SpektrumSpektren zwischen der Standardsprache und dem Dialekt (wie in Südwestdeutschland) machen die Kinder (im Alter von sieben Jahren) mehr orthographische Fehler (ebd.: 262).
Die Auswertung eigener Daten von Hove et al. (ebd.: 267ff.) ergibt, dass die Schweizer Kinder (erste bis sechste Klasse) aufgrund ihrer schweizerhochdeutschen Aussprache in manchen Fällen Vorteile beim Erwerb der schriftsprachlichen Kompetenzen (gegenüber einer deutschen – nicht nur süddeutschen – Kontrollgruppe) haben. Das betrifft beispielsweise die Schreibung von <r>, langem <ä> sowie auslautendem <b>, <d>, <g>, wo die Aussprache der Schweizer Kinder näher an der Schrift ist (weil die DeutschschweizDeutschschweiz die Vokalisierung von /r/ nicht mitgemacht hat, weil ein Zusammenfall der Aussprache von langem <ä> und <e> in der Schweiz viel seltener vorkommt als in weiten Teilen Nord- und Mitteldeutschlands und in ÖsterreichÖsterreich, und weil die sogenannte AuslautverhärtungAuslautverhärtung laut Hove et al. (ebd.: 268) in der Schweiz nicht üblich ist). Basierend auf ihren Ergebnissen sprechen Hove et al. folgende Empfehlung aus:
Insgesamt erscheint es auf Basis der Forschungslage ein lohnenswerter Ansatz zu sein, Lehrpersonen sowie Logopädinnen und Logopäden stärker für linguistische Merkmale der in der betreffenden Region verwendeten Varietäten und deren Beziehung zur geschriebenen Sprache zu sensibilisieren. (ebd.: 273)
Eine solche SensibilisierungSensibilisierung sollte idealerweise bereits in der ersten Phase der Ausbildung von Lehrerinnen und Lehrern beginnen, indem sowohl Variationslinguistik als auch Sprachgeschichte bundesweit zu den obligatorischen Bestandteilen des Lehramtsstudiums für alle Klassenstufen gehören sollten (Fischer/Hofmann 2019: 374). Der eben als Beispiel angeführte Orthographieerwerb betrifft vorrangig den Beginn der Schulbildung, aber auch in der weiteren schulischen Laufbahn spielt (regionale) sprachliche Variation eine wichtige Rolle. Lehramtsstudierende müssen dazu befähigt werden, Varianten richtig einordnen zu können und einen differenzierten Normbegriff zu entwickeln, damit die eigenen sprachlichen Unsicherheiten nicht „zu einem restriktiven Umgang mit Normfragen in der Bewertung von Schülertexten im Berufsalltag führen“ (ebd.). Dazu gehört auch, dass die Lehrkräfte an Schulen (und auch Studierende) in die Lage versetzt werden, sich selbstständig und ohne großen Aufwand über die regionale Verteilung von Varianten informieren zu können (s. ebd. sowie die dortige Tabelle 3 mit einer Auswahl erprobter und empfehlenswerter Recherchewerkzeuge).
Fischer/Hofmann (2019: 371ff.) stellen auf Grundlage einer Zusammenschau von Festlegungen in den BildungsstandardsBildungsstandard der Sekundarstufe I und II ausgewählter Bundesländer fest, dass die Schülerinnen und Schüler der gymnasialen Oberstufe sprachliche Variation vorwiegend analytisch an Fremdtexten und nicht in der Reflexion ihrer eigenen Sprachkompetenz beziehungsweise im Schreibprozess und/oder bei der Analyse eigener Texte erfahren. Sie kommen zu dem Schluss, dass stattdessen eine stärkere Fokussierung auf die eigene Sprachproduktion der Schülerinnen und Schüler sowie auf eine kontrastive Darstellung von Dialekt/RegiolektRegiolekt und der Standardsprache (s. hierzu auch Freywald in diesem Band sowie Janle/Klausmann 2020: 126ff.) im schulischen Alltag notwendig sei. Sie plädieren außerdem dafür, dass auch für den schulischen Umgang eine SensibilisierungSensibilisierung für Variabilität und Dynamik von Sprache und deren NormierungNormierung stärker im Fokus stehen sollte, und dass die bisherigen Kriterienkataloge (vor allem für die Oberstufe) um eine Differenzierung nach AngemessenheitAngemessenheit erweitert werden sollten, da die Kategorie der passenden bzw. unpassenden sprachlichen Mittel für die jeweilige KommunikationssituationKommunikation eine klare Ausdruckserweiterung und eine Stärkung der RegisterkompetenzRegister der Schülerinnen und Schüler ermögliche.
Auf die Frage, welchen Wert es hat, Schülerinnen und Schülern nicht allein die standardsprachlichen Regeln und Inventare zu vermitteln, sondern sie darüber hinaus durch eine Kontrastierung mit regionalsprachlichenRegionalsprache Varianten und Formen für die Eigenständigkeit und Unterschiedlichkeit der Varietäten zu sensibilisieren, entwickeln Fischer/Hofmann (2019: 377ff.) mehrere Antworten, denen ich mich hiermit abschließend vollkommen anschließen möchte:
Wenn regionalsprachlichenRegionalsprache Formen (und die meisten Schülerinnen und Schüler wachsen auch heute in einem regionalsprachlichen Kontext auf und verwenden regionale Sprechweisen erfolgreich in ihrer Alltagskommunikation außerhalb der Schule) Wertschätzung entgegengebracht wird, gleichzeitig aber die Domänenbezogenheit verdeutlicht wird, dann sind diese Formen nicht einfach ‚falsch‘, sondern lediglich in bestimmten (an eine standardsprachliche Norm gebundenen) Kontexten möglicherweise der Situation weniger bzw. nicht angemessen. Eine den Schülerinnen und Schülern vertraute und natürlich erscheinende Form wird somit nicht als ungenügend eingestuft. Eine SensibilisierungSensibilisierung für die Kontraste zwischen Varietäten kann das Selbstbewusstsein der Schüler/innen hinsichtlich ihrer sprachlichen Fähigkeiten fördern.
Da Kommunikation nie ausschließlich dem Informationsaustausch dient, sondern immer auch der Beziehungsgestaltung, können regionalsprachlicheRegionalsprache Sprecherinnen und Sprecher die Variationsmöglichkeiten zwischen Dialekt und Standard zum Ausdruck von sozialer NäheNähe beziehungsweise DistanzDistanz nutzen, sich flexibel den situativen Erfordernissen anpassen und entsprechend ihrer kommunikativen Ziele handeln. Mit einer SensibilisierungSensibilisierung für VarietätenkontrasteVarietätenkontraste kann diese Kompetenz der Schülerinnen und Schüler gefördert werden.
Dialekte und RegiolekteRegiolekt sind keineswegs minderwertige Formen der deutschen Sprache. Sie haben vielmehr als Varietäten einen ebenso systemischen Status wie die Standardsprache. Es gibt nicht nur ‚ein richtiges Deutsch‘, sondern jede Varietät hat ihre Eigenständigkeit und auch ihre kommunikative Berechtigung. Dementsprechend macht eine SensibilisierungSensibilisierung der Schülerinnen und Schüler für die VarietätenkontrasteVarietätenkontraste die Eigenständigkeit der regionalsprachlichenRegionalsprache Systeme für sie erfahrbar und fördert deren Bewertung als grundsätzlich gleichwertige Sprachformen.
Die normierte und insbesondere medial schriftlich in Erscheinung tretende Standardsprache und der RegiolektRegiolekt, der heute in vielen Regionen des Deutschen die (mündlicheMündlichkeit) Alltagssprache dominiert, sind sich in der Regel strukturell viel näher als die traditionellen Dialekte und der Standard. Dadurch kann es mitunter schwierig sein, die entsprechenden Varianten auseinanderzuhalten und kontrolliert zu verwenden. Eine explizite Kontrastierung kann das Erlernen einer kompetenten Verwendung der Varianten und der sich daraus gegebenenfalls ergebenden kommunikativen Vorteile erleichtern.
Literatur
Standardsprache und Dialekt in Schule und Hochschule
Fragen, Probleme und Perspektiven
Abstract: Ausgehend von Ergebnissen einer GrundschulstudieGrundschule, die im Jahr 2019 vom Ludwig-Uhland-Institut der Universität Tübingen durchgeführt wurde, beschäftigt sich der Beitrag mit der Zukunft der Dialekte in Deutschland. Dabei wird die zukünftige Entwicklung des dialektalen Sprechens unter besonderer Berücksichtigung der Institutionen Schule und Hochschule reflektiert, wobei im Zentrum der Überlegungen die historische Begründung, Erläuterung und Problematisierung vorherrschender sprachlicher Ideologien rund um die deutsche Hoch- bzw. Standardsprache steht. Daraus wiederum werden Perspektiven für ein dialektfreundliches Konzept sprachlicher Kompetenz und Perspektiven für einen Neuansatz im Umgang mit Dialekten entwickelt.
Keywords: GebrauchsstandardsGebrauchsstandard, GrundschulstudieGrundschule, HannoverismusHannoverismus, HörkompetenzHörkompetenz, HomogenismusHomogenismus, innere MehrsprachigkeitMehrsprachigkeit, plurizentrischeplurizentrisch Sprache, sprachemanzipatorischer Ansatzsprachemanzipatorischer Ansatz, sprachliche IdeologienSprachideologie, SprachspielkompetenzSprachspielkompetenz, StandardismusStandardismus
1Einführung
Im Jahr 2019 führte das Ludwig-Uhland-Institut der Universität Tübingen eine Studie zur DialektkompetenzDialektkompetenz in baden-württembergischen GrundschulenGrundschule durch, deren Ergebnisse im Juni 2022 für ein breites Medienecho sorgten. Die Studie war Teil der vom baden-württembergischen Ministerpräsidenten und bekennenden Dialektsprecher Winfried Kretschmann 2018 ins Leben gerufenen Dialektinitiative. Mit Hilfe eines FragebogensFragebogen beurteilten darin 705 Lehrerinnen und Lehrer 13.591 Kinder in 697 Klassen der ersten und zweiten Grundschulklasse im Hinblick auf deren SprachverwendungSprachverwendung im Unterricht und in der Pause. Darüber hinaus wurde die Sprachverwendung der beteiligten Lehrkräfte selbst in die Studie einbezogen, wobei bei diesen zwischen der Sprachverwendung im privaten Bereich und während des Unterrichts unterschieden wurde. Auch die Einstellung der Lehrkräfte zur DialektverwendungDialektgebrauch bei den Kindern war eine der Fragen, die die Forschenden dabei interessierte.
Das Ergebnis gibt wenig Anlass zur Hoffnung, was die Zukunft der Dialekte in Baden-Württemberg und – man darf wohl sagen – deutschlandweit anbelangt. Der im weiteren Verlauf der Überlegungen verwendete alltagssprachliche Begriff HochdeutschHochdeutsch steht synonym für den Begriff der (deutschen) Standardsprache; im Rahmen der GrundschulstudieGrundschule wurde jedoch mit dem – unter Laien üblichen – Begriff Hochdeutsch gearbeitet, deshalb wird er auch im Rahmen dieses Beitrags für die weiteren Überlegungen verwendet, insbesondere, wenn von der Grundschulstudie die Rede ist (Klausmann 2023: 14ff.). Es folgen einige der wichtigsten Erkenntnisse: Im Unterricht sprechen 34,5 % der Kinder Hochdeutsch, 41,9 % ein regional gefärbtes Hochdeutsch, 17,6 % einen nicht so starken Dialekt und lediglich 12,4 % Dialekt (ebd.: 23). Ähnlich verhält es sich in der Pause: Da sprechen 32 % Hochdeutsch, 37,1 % ein regional gefärbtes Hochdeutsch, 16,4 % einen nicht so starken Dialekt und 15,3 % Dialekt (ebd.: 24). Auffällig ist außerdem die starke Diskrepanz zwischen dem städtischen und dem ländlichen Raum: Während im städtischen Raum bei den Kindern klar Hochdeutsch oder ein regional gefärbtes Hochdeutsch dominiert, gibt es im ländlichen Raum noch einen erheblichen Anteil von Kindern, die eine mehr oder weniger stark regional gefärbte Sprechweise haben. Das Bild, das sich bei den befragten Lehrkräften ergibt, ist vergleichbar: Die überwiegende Mehrheit der Lehrkräfte spricht sowohl privat als auch im Unterricht entweder Hochdeutsch oder ein regional gefärbtes Hochdeutsch (ca. Dreiviertel). Damit ist klar: Die alten Ortsdialekte sind im Aussterben begriffen, die sprachliche Entwicklung geht, wie Hubert Klausmann, der Leiter der Studie, feststellt, „eindeutig in Richtung Dialektverlust“ (ebd.: 64). Lediglich in einigen ländlichen Regionen, insbesondere im Ostschwäbischen, konnten die alten Ortsdialekte bis heute überleben.
So stellt sich die Frage, ob es tatsächlich erstrebenswert und realistisch ist, sich um den Erhalt der Dialekte zu bemühen, wenn sie doch ohnehin am Verschwinden sind. Das Aussterben der Dialekte ist dabei kein natürlicher, sondern ein kultureller Prozess. Dies zeigt auch einer der interessantesten Befunde der GrundschulstudieGrundschule: Die Einstellungen gegenüber dem Dialekt beeinflussen den DialektgebrauchDialektgebrauch (ebd.: 62f.). Das heißt: Je dialektfreundlicher eine Lehrkraft im Unterricht agiert, z. B., indem sie als Sprechvorbild selbst ein mehr oder weniger dialektal gefärbtes HochdeutschHochdeutsch spricht und dem Dialekt der Schülerinnen und Schüler mit prinzipiellem Wohlwollen und Respekt entgegentritt, desto größer sind die Chancen, dass der Dialekt überlebt.
Im Folgenden wird im Wesentlichen der Frage nachgegangen, welche Schlüsse aus den zentralen Befunden der GrundschulstudieGrundschule aus der Perspektive einer dialektfreundlichen Sprachdidaktik zu ziehen sind und welche Voraussetzungen es dabei besonders zu bedenken gilt. Dabei beschäftigt sich der Beitrag zunächst mit der Frage, was für (den Erhalt der) Dialekte spricht (Kap. 2). Im Anschluss (Kap. 3) werden kulturwissenschaftliche, sprachgeschichtliche und didaktische Ausgangspunkte dargestellt, bevor in Kapitel 4 sprachliche IdeologienSprachideologie und das Problem der Kompetenzmodellierung im Zentrum stehen. Der Beitrag endet mit Schlussbemerkungen (Kap. 5).
2Was spricht für (den Erhalt der) Dialekte?
Wer im Kontext von Schule und Hochschule für den Erhalt und die Förderung der Dialekte plädiert, muss zunächst einmal Gründe dafür nennen, weshalb dies so sein soll; zugleich muss klar sein, was mit ‚Erhalt‘ und ‚Förderung‘ eigentlich konkret gemeint ist. Es bedarf somit eines tragfähigen sprachdidaktischen und pädagogischen Konzepts, das den eingangs skizzierten kulturellen und sprachgeographischenGeographie Entwicklungen in angemessener Weise Rechnung trägt. Der Schwerpunkt der folgenden Überlegungen liegt dabei auf der Situation in Deutschland und hier ganz besonders auf der Situation in Baden-Württemberg; Bezüge zu anderen Ländern innerhalb des deutschsprachigen Raums (ÖsterreichÖsterreich, Schweiz) werden lediglich punktuell und zu Vergleichszwecken hergestellt.
Prinzipiell lassen sich für den Erhalt und die Förderung des dialektal geprägten Sprechens verschiedene Gründe anführen, insbesondere die folgenden:
Die regionalen Varianten des Deutschen sollten zum Zwecke des Erhalts der sprachlichen Vielfalt geschützt und gefördert werden: ‚Diversität‘ und ‚Vielfalt‘ sind heute insbesondere in Deutschland Hochwertbegriffe, die es nicht zuletzt mit Blick auf die Frage nach den regionalen Facetten der inneren MehrsprachigkeitMehrsprachigkeit des Deutschen ernst zu nehmen gilt. Gibt man bei Google beispielsweise die Wörter ‚Vielfalt retten‘ ein, erscheinen über 4 Millionen Treffer; Naturschutz und die Förderung der Biodiversität gehen Hand in Hand; die Zuwanderung von Menschen aus anderen Kulturkreisen mit anderen Sprachen betrachten wir als Bereicherung. Deshalb lohnt es sich, auch die Dialekte zu schützen, so ein wichtiges sprachenpolitisches Argument.
Dialekt als Herkunfts- und Identitätsmarker: Wer Dialekt spricht, hat damit die Möglichkeit, seine Zugehörigkeit zu einem bestimmten Kulturraum zum Ausdruck zu bringen, wobei zu einem Kulturraum neben der regional geprägten Aussprache auch geschichtliche und bauliche Besonderheiten sowie bestimmte Traditionen in der (Be-)Kleidung, traditionelle Feste etc. gehören. Gerade die ländlich geprägten Regionen Baden-Württembergs sind, wie die GrundschulstudieGrundschule (Klausmann 2023: 63) zeigt, Rückzugsräume für stärker dialektal geprägtes Sprechen (und man darf wohl annehmen, dass dieses dialektale Stadt-Land-Gefälle auch in anderen Bundesländern gilt). Diese Begründung wird gerne von Menschen hervorgebracht, die sich dem Erhalt und der Pflege der Dialekte verschrieben haben (Dialektvereine, Menschen, die stark in ihrer ländlichen Heimat verwurzelt sind).
Gesetzliche Vorgaben: In Art. 3,3 GG wird der Benachteiligungsschutz auf Grund von Sprache grundsätzlich garantiert. Maitz und Elspaß plädieren aufgrund der zahlreichen Diskriminierungen und Benachteiligungen, die Dialektsprechende insbesondere in der Schule und im Berufsleben bis heute in Deutschland erfahren, deshalb sogar für die „(nachträgliche) Verankerung eines solchen Schutzes im Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz“ (Maitz/Elspaß: 2011a: 9, 16). Mit der Ratifizierung der Europäischen ChartaCharta der Regional- und Minderheitensprachen im Jahre 1998 hat sich Deutschland außerdem zum Schutz seiner Regional- und Minderheitensprachen verpflichtet (ebd.: 9).
Sprachförderung: Schließlich gibt es sprachwissenschaftliche und sprachdidaktische Gründe, sich für den Erhalt der Dialekte stark zu machen, weil dies ein wichtiger Beitrag zur Förderung der sprachlichen Kompetenz ihrer Sprecherinnen und Sprecher ist. So zeigt beispielsweise der Blick in die Schweiz, dass eine innersprachliche Multi- bzw. Bilingualität für Heranwachsende nicht etwa schädlich, sondern im Gegenteil sogar förderlich ist, da sie Lernende in die Lage versetzt, je nach Situation und Bedarf zwischen unterschiedlichen sprachlichen Codes hin- und herzuwechseln (im Alltag wie in der Schule werden verschiedene Varianten des Schwyzerdütsch gesprochen, in den Medien und in der Kommunikation mit Menschen, die diese regionale Variante des Deutschen nicht beherrschen, greift man auf das Schweizer StandarddeutschSchweizer Standarddeutsch zurück, die gerne mit ‚dem Schwyzerdütsch‘ verwechselt wird). Nicht zuletzt die PISA-Ergebnisse der Schweiz machen deutlich, dass ihr BildungssystemBildungssystem mindestens ebenso leistungsfähig wie das anderer OECD-Länder ist (Erzinger et al. 2019: 25, 82).
Doch welches sind nun die sprachgeographischenGeographie und kulturellen Besonderheiten Deutschlands und welche Konsequenzen sollten daraus mit Blick auf die Förderung der Dialekte (in Schule und Hochschule) resultieren? Auf diese Fragen sollen in den folgenden Kapiteln in Grundzügen ein paar erste Antworten gegeben werden.
3Kulturwissenschaftliche, sprachgeschichtliche und didaktische Ausgangspunkte
Mit dem Beginn der Moderne in den Jahrzehnten um 1900 ging die Auflösung mehr oder weniger stabiler Lebensverhältnisse einher, wie sie für die Zeit der Vormoderne charakteristisch waren: Die Menschen verließen ihre Dörfer, um in den Städten Arbeit zu finden, an die Stelle der Landwirtschaft trat zunehmend die Industrie, die Mobilität nahm sprunghaft zu und die Städte entwickelten sich zu pulsierenden Zentren von Kunst und Kultur. Der Titel der bekannten Fernsehserie Babylon Berlin steht dabei sinnbildlich für die AmbivalenzAmbivalenz vieler dieser Entwicklungen: Mit der bereichernden Vielfalt und den scheinbar unbegrenzten Möglichkeiten gingen zugleich ungesicherte Lebensverhältnisse und ein Anstieg der Gewaltkriminalität einher; das Durcheinander der vielen Dialekte und Sprachen bedeutete für viele Menschen zugleich den Verlust von Heimat, Identität und Orientierung. Wie passt das zu der Erkenntnis, dass heute gerade die Städte Zentren des HochdeutschenHochdeutsch sind (siehe GrundschulstudieGrundschule)? Tatsächlich wussten bereits im 19. Jahrhundert viele Menschen auf dem Land, wie man ‚richtig‘ spricht, wenn man es mit einem ‚Gebildeten‘ bzw. gesellschaftlich Höhergestellten zu tun hat: Hochdeutsch. Theodor Fontanes in den frühen 1830er Jahren spielende und noch heute gerne im DeutschunterrichtDeutschunterricht





























