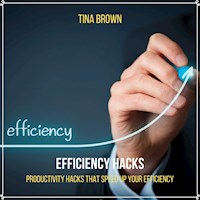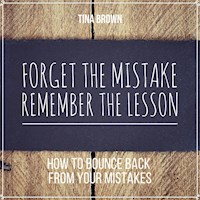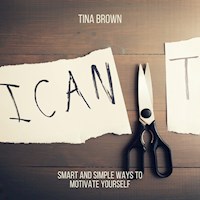9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Knaur eBook
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Auch Jahre nach ihrem Tod wird sie verehrt, ja vergöttert: Lady Di lebt. Wirklich gerecht wird ihr nur die definitive Biographie der international renommierten Journalistin Tina Brown. Ihr großartiges Porträt gewährt uns mitreißende neue Einblicke in das große Drama eines Frauenlebens. Die britisch-amerikanische Star-Journalistin Tina Brown hat zeitlebens Dianas Werdegang verfolgt, Hunderte von Gesprächen geführt und unvoreingenommen nachgefragt. Mit scharfem Blick entlarvt sie bisher verborgene Wahrheiten und bringt uns Diana nahe wie niemand zuvor: ihre Zerrissenheit zwischen den eigenen Gefühlen und den Pflichten der Ehefrau eines zukünftigen Monarchen; ihre Verzweiflung in dem nur scheinbar goldenen Käfig ihrer Ehe; ihre Sehnsüchte und Hoffnungen; ihre Reaktion auf das überwältigende Interesse der Medien und auf die Verführungskraft des Glamour. Wir verstehen, wie Diana weltweit die Menschen für sich einnehmen konnte und warum sie, verstoßen aus der Welt der Royals, Zuflucht beim Jetset suchte – was letztlich ihren tragischen Tod bedeutete. Und wir begreifen, wie sie noch heute als Königin der Herzen eine Wirkung entfaltet, der wir uns nicht entziehen können.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 1075
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
Tina Brown
Diana
Die Biographie
Aus dem Englischen von Sylvia Höfer, Barbara Heller, Andrea von Struve und Rudolf Hermstein
Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.
Über dieses Buch
Sie wird verehrt, ja vergöttert: Lady Di lebt. Wirklich gerecht wird ihr jedoch nur die definitive Biographie der international renommierten Journalistin Tina Brown. Ihr großartiges Porträt gewährt uns mitreißende neue Einblicke in das große Drama eines Frauenlebens, und wir begreifen, wie sie noch heute als Königin der Herzen eine Wirkung entfaltet, der wir uns nicht entziehen können.
Inhaltsübersicht
Widmung
Vorwort zur Neuausgabe
Erstes Kapitel
Zweites Kapitel
Drittes Kapitel
Viertes Kapitel
Fünftes Kapitel
Sechstes Kapitel
Siebtes Kapitel
Achtes Kapitel
Neuntes Kapitel
Zehntes Kapitel
Elftes Kapitel
Zwölftes Kapitel
Dreizehntes Kapitel
Vierzehntes Kapitel
Fünfzehntes Kapitel
Sechzehntes Kapitel
Siebzehntes Kapitel
Achtzehntes Kapitel
Neunzehntes Kapitel
Zwanzigstes Kapitel
Einundzwanzigstes Kapitel
Zweiundzwanzigstes Kapitel
Nachwort
Nachspiel
Anhang
Danksagung
Bibliographie
Für Harry, immer
Vorwort zur Neuausgabe
Sie wollen ein Märchen? Dann legen Sie dieses Buch zur Seite, denn Tina Brown wird Ihnen keines erzählen, sie weiß es besser.
Die Geschichte der Diana Spencer, die als blauäugige Zwanzigjährige den künftigen König von England heiratete, sich fortan durch ungeahnte Abgründe eines royalen Lebens litt und mit nur 36 Jahren starb, ist für die Zunft der Biografen geradezu verführerisch in ihrer Tragik.
Die ganze Welt glotzte romantisch, als Diana 1981 in der St. Paul’s Cathedral zum Traualtar schritt, ein hübsches, naives Mädchen aus bestem Hause, das sich anspruchslos als Putzhilfe und Kindermädchen verdingt hatte, während es auf seinen Prinzen wartete. Nun gab die Braut, hold errötend, in jenem ultimativen Hochzeitskleid aus bauschender cremefarbener Seide ihr Ja-Wort. Es war der Beginn einer innigen Liebe, allerdings nicht zwischen den Eheleuten, sondern zwischen der reizenden Diana und den Objektiven der Kameras.
Im Spätsommer 1997 endete das Leben dieser strahlenden und doch so oft unglücklichen »Königin der Herzen« jäh, banal und brutal zugleich, bei einem Crash in einem Autotunnel in Paris, verursacht durch eine enthemmte Pressemeute und die rasende Fahrt eines angetrunkenen Chauffeurs.
Die meistfotografierte Frau ihrer Zeit, die aufgrund ihrer medialen Dauerpräsenz jahrzehntelang zum Alltag unzähliger Menschen gehört hatte, war tot. Vor Londons Palästen wuchsen Ozeane aus Blumensträußen, Passanten weinten auf offener Straße. Eine ganze Generation schien überwältigt vom Verlust Dianas, als sei mit ihr eine Verheißung, auch für das eigene Leben, dahin.
Zehn Jahre später legte Tina Brown erstmals ihre Diana-Biographie vor, zu einer Zeit also, als die Wucht des globalen Abschiedsschmerzes noch nachhallte. Wie sollte man angesichts einer fast hysterischen Verehrung für die Popkultur-Prinzessin Diana von deren Leben erzählen? Wie einer Frau Rechnung tragen, die gleichzeitig eine mit kitschigen Klischees überfrachtete Projektionsfigur war?
Tina Brown schreibt Tacheles. Sie entrückt Diana nicht in die Eindimensionalität einer Opferrolle, sondern zeigt vielmehr – maliziös und sehr unterhaltsam –, dass die von Elton John denkwürdig beschluchzte »englische Rose« durchaus ihre Dornen hatte. Brown entzaubert das Märchen, und das ist gut so.
Browns Karriere war früh mit Dianas Weg in die Windsor-Familie verknüpft. Die Journalistin übernahm mit Mitte zwanzig die Chefredaktion des englischen Edelklatschblattes »Tatler«, kurz bevor sich Thronfolger Charles mit Diana Spencer verlobte. Tina Brown machte den siechen »Tatler« wieder zur Lieblingspostille der Londoner Society – obwohl oder gerade weil sie so scharfsinnig wie boshaft über die britische Oberschicht, also ihre Stammleserschaft, berichtete.
Brown scheint der vermeintlichen Lovestory zwischen Charles und Diana von Anfang an misstraut zu haben. Sie beschreibt, wie blass und langweilig Diana auf die »Tatler«-Redaktion wirkte, als sie Anfang der achtziger Jahre so unvermittelt auf die Weltbühne geschubst wurde. Großbritannien war in Aufruhr, seit 1979 regierte die Eiserne Lady Margaret Thatcher. Staatliche Unternehmen wurden privatisiert, die Banken entfesselt, gesellschaftliche Ordnungsprinzipien für obsolet erklärt. Hohe Arbeitslosigkeit, Streiks und Polizeieinsätze, schließlich der Krieg um die Falklands – es war eine brutale Zeit, deren programmatischer Kaltherzigkeit sich der Punk lärmend entgegenwarf.
Das Mädchen Diana schien damals wie aus der Zeit gefallen. Eine unberührte Debütantin in Rüschenbluse, ohne intellektuelle Neugier, die gerade erleichtert ihre Schulzeit – ohne Abschluss – hinter sich gelassen hatte und aus fehlgeleitetem romantischem Impuls heraus davon träumte, Prinz Charles zu ehelichen. Eine Idee, die vor allem ihre Großmutter Lady Fermoy, Hofdame der Königinmutter, nach Kräften unterstützte. Charles, der ewige Zauderer, hatte bereits die 30 überschritten und machte keine Anstalten, sich endlich zu verheiraten und die Dynastie zu sichern. Also verkuppelte man ihn mit shy Lady Di – und kettete zwei Menschen aneinander, die, wie sich bald zeigte, rein gar nichts miteinander anzufangen wussten.
Beim »Tatler« versuchte man damals, über eine der Mitbewohnerinnen, die sich mit Diana ein Apartment im schicken Londoner Stadtteil Kensington teilten, Zugang zur Prinzessin in spe zu erhalten. Allerdings musste der Reporter schließlich draußen bleiben, weil die jungen Wohngenossinnen gerade in Tränen aufgelöst waren: Der WG-Goldfisch hatte just sein Leben ausgehaucht.
So zart und unschuldig aber, wie sie wirkte, war Diana nicht. Brown beschreibt die Adlige, deren Eltern sich per Rosenkrieg getrennt hatten, als sie acht Jahre alt war, als Scheidungskind, das früh lernte, wie man andere manipulierte. »Wenn sie etwas haben wollte, klimperte sie bei ihrem Vater mit den Wimpern und jagte ihrer Mutter mit Tränen Schuldgefühle ein.«
Die anfangs schwer in Charles verliebte Diana wurde sehr bald aus ihren Träumen gerissen. Charles war kein zärtlich-aufmerksamer Gatte, sondern ein vergrübelter Eigenbrötler, der sich nicht von seiner Geliebten Camilla Parker-Bowles zu lösen vermochte und Diana die emotionale Sicherheit, die sie stürmisch einforderte, nicht bieten konnte. Auf Unterstützung der Schwiegereltern und anderer ausgewählter Windsors konnte sie genauso wenig rechnen. Die hatten nur den prosaischen Schlachtruf parat, mit dem man in englischen Palästen von jeher persönliche Krisen der Staatsraison unterordnet: »Buck up«, reiß dich zusammen. Dianas neues Leben in der königlichen Familie war eine Hölle aus kalter Gleichgültigkeit, bleiernem Protokoll und Langeweile.
Doch diese Zeit erster Enttäuschungen bringt auch eine Erkenntnis: Diana hat Starqualitäten. Inmitten all der faden Protagonisten eines verknöcherten Königshauses wirkt der unfertige royale Neuling elektrisierend authentisch. Dianas Interesse an den Menschen, denen sie begegnet, ist aufrichtig und ungekünstelt. Diana ist spontan, herzlich und bescheiden, sie hat, mit einem Wort, Charme. Die Kameras bekommen nicht genug von ihr, die Zeitungsleser sind hingerissen. Charles ist es weniger, er fühlt sich ins Abseits gedrängt.
Bei Staatsbesuchen kann er noch so geistreiche Tischreden halten – die Medien sehen nur Diana. Er kann brav die Spaliere der Winkenden abschreiten – die aber schreien nach Diana. Er kann Aufsätze über Naturschutz und Architektur verfassen – was sich verkauft, sind Modejournale mit Diana auf der Titelseite. Ein Königshaus im 20. Jahrhundert, dessen Daseinsberechtigung ständig hinterfragt wird, braucht gute Presse. Im Wettstreit um große Aufmacher bietet Charles höchstens putzige Verschrobenheit, Diana bietet Gefühl – und gewinnt. »Solange Diana lebte«, sagt später der »Vanity Fair«-Chefredakteur Graydon Carter so lapidar wie zynisch, »hat sie verkauft.«
Diana entdeckt die Macht, die mit ihrer Medienpräsenz einhergeht. Sie beginnt, sich zu inszenieren. Ihr unnachahmlicher Augenaufschlag ist bald nicht mehr ihrer Schüchternheit geschuldet, die hat sie längst überwunden, sondern kamerabewusstem Kalkül. Ihr Engagement für die Zurückgelassenen der Gesellschaft – Aids-Kranke, Obdachlose – folgte ursprünglich einem echten Helferethos. Doch auch diese Herzenssache wird zur Waffe: Diana wählt für ihre Schirmherrschaften Projekte aus, um die andere Royals einen Bogen machen. Das lässt sie umso menschlicher erscheinen, progressiv, modern.
Als ihr Ehemann sich endgültig der Geliebten zuwendet und um Verständnis heischt, indem er Diana als psychisch labil darstellen lässt, sinnt sie auf Rache und tut schließlich etwas Ungeheuerliches: Sie paktiert mit der Boulevardpresse, um ihre unverblümte Version der gescheiterten Ehe zu verbreiten. Heimlich bespricht sie Tonbänder für den Journalisten Andrew Morton, die sie ihm über einen Mittelsmann zukommen lässt. Sie erzählt von der emotionalen Kälte ihres Mannes, der ihr eine Ménage-à-trois zumutete, von Selbstmordversuchen, Essstörungen und bitteren Kränkungen. Doch erst als Mortons Buch »Diana – Her True Story« tatsächlich im Juni 1992 als Vorabdruck in der »Sunday Times« erscheint, wird der Prinzessin die Tragweite ihres Handelns bewusst: Sie hat eine heilige Regel des Königshauses gebrochen, sie hat sich mit der Presse, dem Feind, verbündet, um der Monarchie zu schaden.
Dianas Leben als Royal war damals quasi am Ende. Es vergingen noch quälend lange Monate bis zur Trennung, schließlich wurde die Ehe mit Charles im August 1996 geschieden. Eine finale Kränkung hatten die Windsors für die Abtrünnige noch in petto: Der Titel »Königliche Hoheit« wurde Diana aberkannt.
In den letzten Monaten ihres Lebens hatte Diana gerade begonnen, sich neu zu erfinden: Mitsamt ihrer ausrangierten Garderobe warf sie endgültig das Image des fremdbestimmten Lämmchens über Bord. Pailletten und Schottenkaros verschwanden, ihre Kleidersäume wurden kürzer, ihre Haare blonder, sie war nicht mehr nur eine atemberaubend schöne Frau, sondern selbstsicher genug für Sexappeal.
Die Hypothek, die sie mitnahm in diese neue Zeit, war jedoch gewaltig: Die Presse kannte nun kein Halten mehr, hungerte nach weiteren Skandalen, wollte immer dichter dran sein an einem neuen Kapitel der Seifenoper Diana. Auf Schritt und Tritt wurde Diana verfolgt und bedrängt, Begleitschutz durch den staatlichen Sicherheitsdienst lehnte sie ab, aus Angst, ausspioniert zu werden.
Tina Brown schildert, wie Diana 1997 eine Sommerliebelei an der Côte d’Azur inszenierte; als Gespielen hatte sie sich ausgerechnet den Playboy Dodi Al-Fayed ausgesucht, Sohn des im britischen Königshaus verhassten Milliardärs und »Harrods«-Eigentümers Mohamed Al-Fayed. Ein letztes Mal gab Diana ausgewählten Paparazzi Tipps, wo und wann die besten Schnappschüsse von ihr zu machen seien – und beschwerte sich hinterher über die miese Bildqualität.
Dann die letzten Szenen dieses Lebens, die nächtliche Wahnsinnsfahrt durch Paris. Diana, die nicht angeschnallt war, erlitt beim Aufprall der Limousine gegen einen Betonpfeiler so schwere innere Verletzungen, dass sie kurz darauf im Krankenhaus Pitié-Salpétrière starb.
Unter dem Eindruck dieser Tragödie rangen sich das britische Königshaus und die Presse zum Friedensschluss durch. Szenen wie jene aus Dianas Todesnacht sollten sich niemals wiederholen.
Ein fragiler Pakt. Zwei Jahrzehnte nach Dianas Tod sah sich ihr ältester Sohn William erstmals mit einer Aggressivität an den Pranger gestellt, die Erinnerungen an die Neunzigerjahre wachrief. Britische Webseiten präsentierten Anfang 2017 heimlich in einem Nachtclub gemachte Aufnahmen, die den Prinzen ausgelassen beim Feiern zeigten, ohne seine Gattin Kate. Dann wurde nachgerechnet, wie viele öffentliche Engagements der Prinz jüngst absolviert hatte – deutlich weniger als die greise Queen, so das Ergebnis. »Ist William arbeitsscheu?«, hieß das Motto der sofort losgetretenen Debatte, und dass man die Windsors damit an der Ehre packte, nämlich am Stolz auf ihr Arbeitsethos, ist kein Zufall, sondern eine gezielte Provokation. Warum? Revanche, weil William und Kate die öffentlichen Auftritte ihrer beiden Kinder strenger dosieren, als es den Medien lieb ist?
Und so stellt sich nun die Schlüsselfrage wieder drängender, ob die britische Monarchie und ihre Nemesis, die Boulevardpresse, dauerhafte Lehren aus der tragischen Geschichte Dianas, der unvollendeten Prinzessin, ziehen.
Patricia Dreyer, Ressortleiterin Panorama und Chefin vom Dienst, SPIEGEL ONLINE
Erstes Kapitel
Ein Tunnel in Paris
»Hätte ich Diana an meiner Seite, ich würde mit ihr in den Dschungel gehen, und nicht ins Ritz.«
Hassin Yassin, Dodi Al Fayeds Onkel, 2006
31. August 1997. In dem Auto, das dreiundzwanzig Minuten nach Mitternacht in den Pariser Pont-de-l’Alma-Tunnel raste, saß die berühmteste Frau der Welt. Die blonde Ikone, die ihre langen Beine auf dem Rücksitz des schwarzen Mercedes übereinandergeschlagen hatte, war am Ende einer chaotischen Nacht angelangt und schlechter Laune. Wie missmutig sie war, konnte man an ihrem angespannten Gesichtsausdruck sehen, den die Überwachungskameras am Vorderausgang des Hotel Ritz am Place Vendôme festgehalten hatten.
Arthur Edwards, der Doyen der auf die Königsfamilie spezialisierten Fotografen, kannte diese Miene gut. Allein der Gedanke daran macht ihm noch heute zu schaffen. Sechzehn Jahre hatte es keine Stimmung der Prinzessin gegeben, die nicht eingefangen, aufgezeichnet, studiert, vergrößert und jeder Presseagentur auf diesem Planeten übermittelt worden war. Und in den meisten Fällen war Edwards vor Ort, der zerknittert aussehende, Cockney sprechende Reporter der Boulevardzeitung Sun mit dem gelichteten Haupthaar. Er hatte ein Jahr vor ihrer Hochzeit mit Prinz Charles das erste heimliche Bild von Lady Diana Spencer bei einem Polospiel in Sussex aufgenommen, und er war einer der ersten britischen Bildreporter, der vor den Toren des Krankenhauses Pitié-Salpêtrière in Paris eintraf, in dem sie starb. Edwards sagt, er habe diesen beunruhigten Gesichtsausdruck bei ihr zuletzt im Februar 1992 während eines Besuchs im Kinderkrankenhaus Great Ormond Street gesehen. Dianas niedergeschlagene Stimmung hatte sich damals auf die wartende Pressemeute übertragen: Als sie herauskam, weigerte sie sich, in die Kameras zu schauen. Edwards und seine Kollegen wurden erst belohnt, als sie auf den Pfiff eines Bauarbeiters hin reflexartig den Kopf hob. Klick. Wie jeder andere Fotograf in der Fleet Street lebte Edwards während der ganzen achtziger und neunziger Jahre für – und von – Dianas Lächeln.
In dieser letzten Nacht mit Dodi Al Fayed in Paris wusste die Prinzessin, dass die Dinge aus dem Ruder gelaufen waren. Daran erinnert sich Edwards heute in einer Londoner Bar. Er war einer von Dianas Lieblingsfotografen gewesen. Sein onkelhaftes Gesicht legt sich in Falten vor Bedauern, als hätte er etwas daran ändern können, wäre er nur dabei gewesen. »Sie wollte nach Hause fahren. Sie wollte ihre Jungs sehen. Sie war kein Popstar. Sie war eine Prinzessin. Sie war an den Vordereingang, an einen roten Teppich gewöhnt. Diese ganze Sache mit Dodi – Zweitautos als Lockvögel, die Hintereingänge – das war nicht Dianas Stil.«1
Hier irrt sich Edwards. Seit der Scheidung entsprach das Chaos, das in ihrem letzten Abend gipfelte, immer mehr Dianas Stil. Sie hatte sich von der abgeschirmten Prinzessin in einen ungebundenen internationalen Star verwandelt. Die Tatsache, dass sie Ende August mit einem sprunghaften Playboy wie Dodi durch Paris hastete, war nur ein weiterer Beweis dafür. Nicht einmal der britische Botschafter wusste, dass sie sich in der Stadt aufhielt. Ebenso wenig waren die französischen Behörden informiert worden. Im August reisen die meisten Angehörigen der Pariser Hautevolee nach Norden, nach Deauville, wegen der Poloturniere und der Pferderennen, oder in die kühlen Wälder ihrer Landsitze an der Loire oder bei Bordeaux. In einem der Häuser, die seinem Vater gehörten, hatte Dodi eine großzügige Wohnung – in der Rue Arsène Houssaye mit Blick auf die Champs Elysées – zu seiner Verfügung. Warum brauchten die beiden dann überhaupt eine Hotelsuite? Sie waren an diesem Abend nur im Ritz, weil Dodi entschlossen war, mit dem ungeheuren Reichtum seines Vaters anzugeben und vor aller Öffentlichkeit die Hotelbediensteten zu immer neuen Shopping-Touren auszusenden. Kein Mensch, der von Paparazzi verfolgt wird, würde sich sonst ausgerechnet diesen Ort als Versteck aussuchen. Das renommierteste Hotel von Paris wimmelt zu dieser Zeit des Jahres nur so von Touristen mit Kamera vor dem Bauch und Schaulustigen. Gegen Ende des sommerlichen Exodus aus der Stadt strahlen selbst die exklusiveren Bereiche des Hotels – wie etwa das Restaurant L’Espadon – ein seltenes Flair extravaganten Nomadenlebens aus. Dann kann man südamerikanische Callgirls und stark behaarte Unternehmer aus prosperierenden Schwellenländern oder reiche alte Damen mit ihren gierigen Neffen unter dem Trompe-l’Œil der opulent gestalteten Decke über der Weinkarte brüten sehen. Für ein Abendessen zu zweit muss man gut und gern siebenhundert Dollar hinblättern.
Genau die Art von Ambiente also, wie Diana es nicht ausstehen konnte. Zum Beweis dafür hatte sie soeben all die prächtigen und glitzernden Kleider ihres früheren Lebens bei Christie’s in New York für wohltätige Zwecke versteigern lassen. Als sie im Juni 1997 anlässlich der Eröffnung der Vorbesichtigung den Atlantik überquerte, gingen Anna Wintour, die Chefredakteurin der Vogue, und ich mit ihr im Four Seasons zum Lunch; dieses an der Park Avenue gelegene Restaurant diente den leitenden Angestellten von Condé Nast als inoffizielle Dependance. »Ein paar Sachen habe ich behalten«, sagte Diana über die bevorstehende Auktion. »Aber kennen Sie dieses Zeug von Catherine Walker mit den vielen Stiftperlen? In England trägt keiner mehr so was.«2
Was mir beim Mittagessen auffiel, war, wie sehr die Starexistenz Dianas äußere Erscheinung verändert hatte. Ich bin mittlerweile zu der Überzeugung gelangt, dass die Tatsache, ständig von Unbekannten angegafft zu werden, die Proportionen von Gesicht und Körper verändert. Und ich meine damit nicht nur die offensichtlichen Veränderungen – ein gesteigertes Modebewusstsein oder neue Tricks in Sachen Charme und Selbstbeherrschung –, sondern die schiere Illusion von Größe. Die Köpfe globaler Berühmtheiten scheinen sich buchstäblich aufzublähen. So ist beispielsweise Hillary Clintons Kopf seit der Zeit, als sie nur die Ehefrau des Gouverneurs von Arkansas war, enorm gewachsen. Er nickt, wenn sie mit einem spricht, wie ein gasgefüllter Luftballon. Die Jahre im Rampenlicht hatten auch den Umfang von Jackie O.s Schädel dermaßen vergrößert, dass es den Anschein hatte, als müsse ihr wahres Gesicht hinter einer überdimensionalen Halloween-Maske versteckt sein. Wenn man ihr in die Augen blickte, konnte man sie irgendwo da drinnen förmlich schreien hören.
Im Fall von Diana hatte man den Eindruck, alles wäre in die Länge gezogen und handkoloriert worden. Die hochgewachsene englische Rose mit den zarten Wangen, die ich zum ersten Mal 1981 in der amerikanischen Botschaft als Frischvermählte getroffen hatte, schillerte wie eine Cartoonfigur. Als sie auf ihren Acht-Zentimeter-Stöckeln den Hauptspeisesaal des Four Seasons durchquerte, wirkte sie unter der hohen Decke wie eine überdimensionale Barbarella. Ihr Chanel-Kostüm war in leuchtendem Mintgrün gehalten und die Bräunung ihrer Haut so makellos wie mit der Spritzpistole aufgetragen. Ihr leicht geröteter Teint erinnerte nicht nur an einen Pfirsich; die Haut war weicher als das Kuscheltier eines Babys. Kein Wunder, dass sie an der Bettkante kranker Kinder stets einen so tiefen Eindruck hinterließ. Wenn sie im blitzenden Kegel eines Scheinwerferlichts auftauchte, muss sie ihnen wie ein schimmernder Engel erschienen sein, der gekommen war, um hienieden die Leiden zu lindern. Ihr Instinkt, der sie nach Amerika zog, war goldrichtig. Sie würde sich jetzt nur noch in jener Kultur zu Hause fühlen, in der man den Starrummel erfunden hatte. »Man spürt die Energie regelrecht, wenn im Juli die Amerikaner wegen Wimbledon kommen«, schwärmte sie mir vor.
Diana machte sich während des Mittagessens bereits Gedanken darüber, wo sie im August hinfahren könnte. Einen Liegestuhl in ihrem großen Garten im Kensington-Palast aufzustellen war für jemanden mit einer Aversion gegen Bücher schlicht undenkbar. Außerdem würde sie dort einsam sein. »Es wird so schwer ohne die Jungs«, sagte sie. Für eine geschiedene Prinzessin vergrößerte ein Monat ohne jeden Glamourauftritt nur die gähnende Leere, die der Oberschicht von ihrem pädagogischen Brauch aufgezwungen wird, die Kinder ab dem achten Lebensjahr ins Internat zu schicken. Für ihre beiden Söhne, William und Harry, bedeutete August schlicht Balmoral und das Zusammensein mit ihrem Vater, und für die Mutter ein Herumvagabundieren der Luxusklasse. Alle Leute aus ihrem früheren Leben hatten sich in spartanische Familiencottages in der schottischen Heide oder in weitläufige Villen in der Toskana zurückgezogen, spielten mit ihren Kindern Monopoly und lasen Romane von Frederick Forsyth. Diana war, nachdem sie ihre Verbindungen zur Königsfamilie gekappt hatte, in solchen Kreisen nicht unbedingt willkommen. Aber auch die betuchten Mitglieder der Londoner High Society, unter denen sie zuletzt verkehrte, rissen sich nicht gerade darum, sie im August zu sich einzuladen. Wer hätte den ganzen Zirkus auf sich nehmen wollen? Madonna als Hausgast zu haben könnte nicht schlimmer sein. Nicht etwa weil Diana selbst verwöhnt oder anspruchsvoll gewesen wäre. Im Gegenteil, ihr Inbegriff von Hedonismus war, ihre Kleider und die ihrer Gastgeberinnen eigenhändig zu bügeln. (»Ich bin mit meinen Sachen fertig, jetzt kann ich eure bügeln, wenn ihr wollt«, rief sie Lady Annabel Goldsmith und Jemima Khan zu, als sie im Februar 1996 mit ihnen in Pakistan auf Privatbesuch weilte.)3 Sich in dem Glanz zu sonnen, den die Prinzessin von Wales in London bei einem Dinner ins Haus brachte, war eine Sache. Eine ganz andere war es, länger als ein Wochenende den Ansprüchen zu genügen, die sie als Hausgast stellte. Inzwischen bedurfte es schon einer Festung, die so sicher war wie Alcatraz, um ihr die Presse und die ganz Durchgeknallten vom Leib zu halten. Und hinterher durchwühlten einem die Boulevardblätter auf der Suche nach irgendwelchen Anhaltspunkten mit Neuigkeitswert den gesamten Hausmüll. Nur Dodis Vater, Mohamed Al Fayed, war verwegen und reich genug, um all dies auf sich zu nehmen. Der ägyptische Kaufmann, der 1985 Harrods, das Mekka der Londoner Einkaufswelt, in der Hoffnung erworben hatte, das britische Establishment in die Knie zu zwingen, träumte immer noch von Verbindungen zum Königshaus. Seine Jacht, sein Anwesen an der südfranzösischen Küste und sein Hotel Ritz in Paris waren Dianas neue Luftschlösser. »Er besitzt einfach alle Spielsachen«, sagte sie zu einer Freundin.4
Prompt gerieten ihre beiden letzten Wochen mit Dodi zu etwas, was an eine eigens für das Fernsehen inszenierte Kitschversion ihrer Flitterwochen mit Prinz Charles 1981 erinnerte. Statt der königlichen Jacht Britannia mit ihren Marinekapellen und der zweihundertzwanzigköpfigen Besatzung, war es jetzt die Berieselung mit Julio-Iglesias-Schnulzen auf Mohamed Al Fayeds in fieberhafter Eile aufpolierter Jonikal, die er erst einen Monat zuvor für zwanzig Millionen Dollar erworben hatte, um der Prinzessin zu imponieren. Statt eines Essens in Abendgarderobe an Bord der Britannia zu Ehren des ägyptischen Präsidenten Anwar el-Sadat und seiner Frau Jihan, den Privatsekretär Francis Cornish an ihrer Seite, gab es jetzt – im Beisein des exaltierten Butlers René Delorm – Geturtel mit dem ägyptischen Salonlöwen Dodi Al Fayed bei Kerzenlicht und Kaviar. Statt der disziplinierten, auf dem Wasser schwimmenden Privatsphäre mit einem für die Royals gut bewachten Zielhafen, war es jetzt eine nervenaufreibende Kreuzfahrt im Mittelmeer mit Besuchen der mondänsten Urlaubsorte, das Ganze inmitten eines Haifischbeckens voller Paparazzi, die ihre Teleobjektive auch dann auf die Fenster der Jonikal richteten, wenn das urlaubende Paar aß oder schlief.
Überdies waren da die Ähnlichkeiten zwischen dem ersten und dem letzten Mann in Dianas Leben. Beide standen unter der Knute mächtiger Väter. Der Erbe von Harrods war wie der Prinz von Wales hauptsächlich deshalb hinter Diana her, weil sein Vater es so wünschte. Selbst die beiden Leibwächter auf dieser Reise, Trevor Rees-Jones und Alexander »Kez« Wingfield, erstatteten nicht Dodi, sondern seinem Vater Bericht. »Wenn Dodi etwas machte, was gegen den Willen seines Vaters verstieß, musste ich das seinem Vater melden«, sagte Rees-Jones.5 Dodi war fest entschlossen gewesen, am 9. August ein Model von Calvin Klein namens Kelly Fisher zu heiraten, bis ihn sein Vater am 14. Juli, dem Tag der Erstürmung der Bastille, aus Paris zu sich zitierte, damit er beim ersten Urlaub mit der Prinzessin zugegen war, und ihn dazu verdonnerte, ihr den Hof zu machen. Die verdatterte Kelly Fisher wurde außer Sichtweite auf die Cujo abgeschoben, Al Fayeds B-Klasse-Schiff, einen ehemaligen Cutter der US-Küstenwache. Dodi besuchte sie heimlich in der Nacht, bis sie das ganze Spielchen schließlich durchschaute und versuchte, ihn wegen Vertragsbruchs zu verklagen.
Der Unterschied bei dieser Neuauflage ihrer Flitterwochen-Kreuzfahrt war, dass es Diana nicht störte, ob Dodi Wachs in den Händen seines Vaters war oder nicht, solange er nur zahlte und nett zu ihr war. Sie fühlte sich so »umsorgt«6, erzählte sie einer ihrer Vertrauten, Lady Elsa Bowker, der kosmopolitischen Glamour-Oma und Witwe des britischen Diplomaten Sir James Bowker. Und genau das war es, was Diana brauchte. Im Juli hatte Prinz Charles zum fünfzigsten Geburtstag von Camilla Parker Bowles, die seit vierundzwanzig Jahren seine Geliebte war, in aller Öffentlichkeit eine Coming-out-Party veranstaltet, und zwar ausgerechnet auf Highgrove in Gloucestershire, wo er früher mit Diana residiert hatte. Und in demselben Monat hatte der pakistanische Herzchirurg Hasnat Khan, seit zwei Jahren der Liebhaber der Prinzessin, klargestellt, dass er die Beziehung nicht öffentlich machen wollte. Nach diesen beiden Tiefschlägen war Dodi das perfekte Gegengift: charmant, sexuell interessiert, intellektuell ungefährlich – und eine Zwischenlösung. »Er verlangt überhaupt nichts von mir«7, vertraute die zufriedene Diana einer Freundin an, der Modedesignerin Lana Marks. Eine andere Freundin von Diana, die Peeress Margaret Jay von der Labourpartei, fasste die Romanze mit weiblicher Klugheit so zusammen: »Wir hatten doch alle unsere Dodi Al Fayeds.«8
Im August 1997 versuchte Diana, das Prinzessinnendasein durch die Superstar-Version desselben zu ersetzen: ein Leben in bewachter Isolation. Sie hatte die steife Förmlichkeit von Höflingen und Dienern gegen das Hollywood-Äquivalent eingetauscht, nämlich die um die Stars herumscharwenzelnde Klasse der Heilpraktiker, Astrologen, Akupunkteure, Friseure, Darmspüler, Aromatherapeuten, Schuhdesigner und Modeschöpfer. Diese führen heutzutage selbst das Leben Prominenter, was es ihnen ermöglicht, sich so zu präsentieren, als stünden sie mit ihren Kunden auf einer Stufe. Sie vertrieben Diana die Zeit zwischen den Streicheleinheiten, die ihr eine tröstende Schar fürsorglicher Ersatzmütter verabreichte. Selbst ihre bei der Scheidung vereinbarte Abfindung von siebzehn Millionen Pfund konnte angesichts dieses stetig wachsenden Netzwerks von guten Geistern knapp bemessen erscheinen. Sie hatte bisweilen nicht weniger als vier Behandlungstermine zu je zweihundert Pfund an einem Tag. Paul Burrell, ihr Butler im Kensington-Palast, und seine Frau Maria gehörten zu den wenigen, die sie aus ihrem früheren Hofstaat mitgenommen hatte. Während seines Trainings im Haushalt der Queen zuvor auf eine respektvolle Distanz beschränkt, mutierte Burrell nach Dianas Scheidung vom Diener der Königsfamilie zum Berater eines Weltstars.
Und zwischen diesen beiden Rollen gab es einen gewaltigen Unterschied. Ein Diener geht auf leisen Sohlen davon, ein Berater bleibt. Ein Diener erhält Anweisungen, ein Berater gibt sie weiter. Burrell brachte nicht nur das Frühstückstablett herein und öffnete Dianas Freunden die Tür. Er gab seinen Senf zu ihrer Kleiderauswahl und bestimmte so den »Wow-Faktor«. Wenn sie allein im Palast waren und sich rührselige Videos ansahen, reichte er ihr einzeln die Papiertaschentücher.9 Während ihrer heimlichen Liebesaffäre mit Khan fungierte er als Postillon d’amour. Er belauschte ihre Telefonate, tuschelte über seine Kollegen, verkaufte sich der Presse als der Mann, den Diana »my rock«, also »mein Fels« genannt hatte. (»Was sie tatsächlich zu ihm gesagt hatte, war: ›You’re wearing my frock‹«,10 so viel wie »Sie haben ja mein Kleid an«, witzelte ein verärgertes ehemaliges Mitglied des Personals der Königinmutter über Burrells hochgejubelte Rolle im Leben der Prinzessin.)
Dianas Problem war nun, dass ihr neuer Hof zwar ihr Ego, nicht aber ihre Person schützen konnte. Weil sie sich beharrlich weigerte, das Personal der königlichen Sicherheitswache zu behalten, das für sie aus Spitzeln des feindlichen Lagers bestand, war sie dazu verdammt, Schutz bei den Reichen und Paranoiden zu suchen. »Mit dem Tag ihrer Scheidung«, sagte ihr Chauffeur, der ehemalige königliche Personenschützer Colin Tebbutt, »verloren wir den Dienstwagen. Das war das Übelste, was die Regierung je getan hat.«11 Das Angebot, die Ferien mit Dodi zu verbringen, schien eine hundertprozentige Garantie für ihren Schutz einzuschließen. Mohamed Al Fayed hat immer einen kostspieligen Apparat aus Leibwächtern, Überwachungskameras und Informanten unterhalten. Auf seinen Reisen nach Paris war er mit einem aus acht Bodyguards bestehenden Gefolge unterwegs und wurde ab dem Flughafen Le Bourget in einem kugelsicheren Mercedes befördert, begleitet von einem Fahrzeug, das für medizinische Behandlungen ausgerüstet war. Dodi hatte, wie es schien, diese Obsession von seinem Vater geerbt. Eine seiner Ex-Freundinnen, ein Model aus Hawaii namens Marie Helvin, hatte sich immer darüber amüsiert und zugleich geärgert, was es bedeutete, abends mit Dodi auszugehen: Zu so einem Ereignis gehörten Rausschmeißertypen, die Taschen vollgestopft mit Schmiergeld, ganzen Bündeln von Banknoten, mit denen sie wedelten, wenn Probleme aus dem Weg zu räumen waren. Dieselben Typen kündigten einander über Walkie-Talkies stets Dodis unmittelbar bevorstehende Ankunft oder Abfahrt an, als wäre er ein Staatsoberhaupt mit einer ganzen Schar gefährlicher Feinde und nicht ein freundlicher, etwas hoffnungsloser Partylöwe mit einem großen Kreis mütterlicher Bewunderinnen. Auf Diana, die Gejagte, übte dieser Sicherheitsapparat eine starke Anziehung aus. Ebenso die unkompliziert-fröhliche Atmosphäre der weitverzweigten Familie Al Fayed. Da sie sich ihrer eigenen Familie entfremdet hatte, wirkte deren Warmherzigkeit auf sie ebenso beruhigend wie der Reichtum.
Für Frauen über fünfunddreißig hat der Pfad des Glamours drei Leidensstationen: Sie heißen Leugnen, Überspielen und Sich-Arrangieren. Als Diana siebenunddreißig Jahre alt wurde, sagte sie sich, dass sie Liebe suche. Doch wonach sie wirklich auf der Suche war, das war ein Mann mit einem Gulfstream-Flugzeug. Ihre Bedürfnisse hatten zu diesem Zeitpunkt schon mehr mit denen von Sternchen wie Elizabeth Hurley gemein als mit denen irgendeiner Person, die sich zur gleichen Zeit auf Balmoral aufhielt. Sie näherte sich unaufhaltsam dem Punkt, an dem sie sich nicht mehr vormachen konnte, dass seriöse Männer mit bescheidenen Mitteln – wie Doktor Hasnat Khan oder selbst ihr früherer Verehrer, der gutaussehende Gardeoffizier James Hewitt – imstande wären, sie aus ihrem Dasein als Berühmtheit in ein normales Leben wegzuzaubern. Sie hatte die eskapistische Idylle mit beiden Männern genossen, die nur möglich gewesen war, solange und weil sie geheim blieb. Hewitt entführte sie nach Devon, wo sie seiner Mutter in dem gemütlichen Cottage beim Abspülen half. Khan, in Paul Burrells Wagen auf dem Weg in den Kensington-Palast unter einer Decke versteckt, traf mit einem Grillhähnchen von Kentucky Fried Chicken zu einem romantischen Dinner mit der Prinzessin ein. Wenn er sie ausführte, setzte sie sich eine schwarze Perücke und eine Brille auf und freute sich wie ein Schneekönig darüber, dass sie unerkannt in einer Schlange vor dem Jazzclub Ronnie Scott’s standen. Einmal rief sie vor dem Club ihre »Heilpraktikerin« Simone Simmons an und sagte ihr, wie viel Spaß es ihr mache, in der Schlange zu stehen. Sie gab zu, noch niemals zuvor für irgendetwas angestanden zu haben. »Ich stehe in einer Schlange!«, jauchzte sie in ihr Handy. »Es ist wunderbar! Mit wie viel verschiedenen Leuten man in einer Schlange zusammenkommt!«12 Diana sah darin ein Zeichen, dass sie sich in ihrem künftigen Leben mit Khan wohl fühlen würde. Aber, wie Khan erkannte, war das einer Marie Antoinette würdig: ein Tagtraum, der beim ersten Zusammenprall mit der Wirklichkeit zerplatzen würde. Im Multimediazeitalter war ein Rückzug gar nicht möglich. Außerdem wäre sie vor Langeweile gestorben.
Wie ihr Rollenvorbild Jackie, die versuchte, die Festung der Präsidentengattin mit den Spielzeugklötzen von Aristoteles Onassis neu aufzubauen, war Diana in ihren letzten Tagen auf der Suche nach einer neuen Art von Prinz, nach jemandem, der die Bedürfnisse einer weltberühmten Frau befriedigen konnte. An Bord der Jonikal, wo sie in den Traum gelullt werden sollte, Mrs. Al Fayed zu werden, dachte Diana über die Zukunft nach und ließ jene Verehrer Revue passieren, die ihr langfristig bessere Perspektiven boten als der nette Dodi, der seinen Vater um alles bitten musste. Noch immer telefonierte sie mit Khans Onkel und versicherte ihm stets, dass sie mit Dodi ein rein freundschaftliches Verhältnis verbinde. Sie zog jedoch auch andere Möglichkeiten in Betracht. So etwa den New Yorker Finanzier Teddy Forstmann, der nicht nur eine Gulfstream besaß, sondern gleich die ganze Firma, die diese Flugzeuge herstellte. Von der Jacht aus war sie mit ihrem Freund, dem chinesischen Unternehmer David Tang, in Pläne für einen dreitägigen Trip nach Hongkong im September vertieft. Tang, für seine Freunde »Tango«, ein umtriebiger Typ aus der Londoner Szene, arrangierte in Hongkong für sie Wohltätigkeitsgalas und Termine mit Regierungsvertretern. Hinzu kam, dass Dianas neues Interesse an China von Gulu Lalvani befeuert wurde. Der achtundfünfzig Jahre alte Unternehmer im Bereich Elektronik war Gründer und Generaldirektor von Binatone, einer Firma mit Hauptsitz in Hongkong, deren Wert 2003 auf ungefähr fünfhundert Millionen Dollar geschätzt wurde. Am Montag vor dem Unfall schmiedete die Prinzessin von der Jonikal aus Pläne, sich nach ihrer Rückkehr in London mit Lalvani zu treffen. Sie hatten im Mai 1997 in der Nacht von Tony Blairs Wahlsieg miteinander gefeiert und sich jede Woche ein paarmal gesehen. »Es gibt nichts, was sie mir nicht anvertraut hätte beziehungsweise was ich ihr nicht anvertraut hätte«,13 sagte Lalvani im Dezember nach ihrem Tod. Als Lalvani im Januar 1997 in ihr Leben trat, war er der Grund für Dianas letzten Krach mit ihrer Mutter. Am Telefon empörte sie sich, dass ihre Tochter »Beziehungen mit muslimischen Männern« pflegte. In Wirklichkeit war Lalvani ein Sikh aus dem Punjab, aber für Mrs. Shand Kydd war seine Hautfarbe so oder so inakzeptabel.14 Von seiner Clique wurde er wegen seiner coolen Art und seiner narbigen Gesichtshaut »Krater der Ruhe« genannt. Diana führte Lalvani im Juni ins Annabel’s aus, den Nachtclub am Londoner Berkeley Square, in der Hoffnung, damit Hasnat Khan eifersüchtig zu machen. Sie wusste nicht, dass sich ihr Arzt-Schwarm genau über diese Art, sich in der Öffentlichkeit auszuleben, am meisten mokierte – und sie am meisten fürchtete. Wäre ihr das klar gewesen, hätte Diana sich im Sommer vielleicht mit dem Mann, den sie wirklich liebte, auf einer Sonnenterrasse in Südfrankreich befunden, und nicht mit einer Ersatzfigur. Die Flut kitschiger Bilder von der Jonikal muss den seriösen Hasnat Khan weniger mit Bedauern als mit Erleichterung darüber erfüllt haben, dass er in dem Tollhaus nicht mehr mitspielte. Es war allein die Aussicht auf solche karriereschädigenden Fotos gewesen, die ihn hatten wachsam werden lassen.
Diana erschien der zweiundvierzigjährige Dodi perfekt geeignet für eine Romanze, mit der sie sich sowohl an ihrem Ex-Liebhaber als auch an ihrem Ex-Ehemann rächen konnte. »Sie wollte nur die Leute in Balmoral so wütend wie möglich machen«15, erzählte mir ihr Freund, der Multimillionär und Kunstsammler Lord Palumbo. Der von ihr gewählte Agent provocateur war im Grunde ein netter Kerl, dessen Kindheit in Ägypten und in teuren europäischen Internaten ebenso einsam verlaufen war wie die von Prinz Charles. Dodis Eltern ließen sich scheiden, als er zwei Jahre alt war. Mohamed Al Fayed bekam zwar das Sorgerecht zugesprochen, war aber fast nie zu Hause. »Er verwöhnte Dodi, was nicht dasselbe ist wie für ihn da zu sein«16, sagte der Filmproduzent und jetzige Peer von der Labourpartei David Puttnam. Dodi gehörte zu jener Spezies von Einzelgängern, die ständig von Leuten umgeben sind. Er kochte gern mit seinem Butler Spezialitäten des Nahen Ostens, brannte in seiner Wohnung Fliederduftkerzen ab, pflegte zu Füßen von Filmstars zu sitzen und diesen aufmerksam zuzuhören und er kokste. Als er vierundzwanzig war, richtete Al Fayed für seinen Sohn eine Filmfirma namens Allied Stars ein, was bedeutete, dass er mit Schauspielerinnen Beziehungen eingehen und sich selbst »leitender Produzent« nennen konnte. Dodi hatte Glück mit seinem ersten Filmprojekt, Puttnams Stunde des Siegers, das einen Oscar gewann und in das sein Vater drei Millionen Dollar gesteckt hatte. Das gab Dodi das Recht, auf dem Set herumzulungern, bis Puttnam ihn hinauswarf, weil er die Crew mit Kokain versorgte. Daraufhin war ihm nicht mehr viel Erfolg beschieden, aber der vage Charakter des Filmgeschäfts passte zu seinem amorphen Temperament. Dodis Haus in Beverly Hills war Hauptpartytreff und zugleich ein Magnet für Schnorrer, Goldgräber und Geschäftemacher, die seine kindliche Freigebigkeit ausnutzten. Im Schnitt schmiss er vier Partys pro Woche. »Er war gut im Reichsein«, erinnerte sich Marie Helvin liebevoll. »Er schickte mir immer langstielige Rosen und Kisten voller Mangos.«17 Im Laufe seiner sechswöchigen Beziehung mit Diana überschüttete Dodi sie mit Schmuck und schenkte ihr ein mehrreihiges Saatperlenarmband mit einem Verschluss aus edelsteinstarrenden Drachenköpfen, eine rechteckige, diamantenübersäte Jaeger-LeCoultre-Armbanduhr, einen silbernen Fotorahmen mit romantischer Inschrift und jenen goldenen Ring mit Pavé-gefassten Diamanten, den sie zum Zeitpunkt des Unfalls am Finger trug.
Dodis Barschaft stammte von seinem Vater, nicht aus eigenem geschäftlichem Erfolg. Dazu war er wie viele Kokser unfähig, sich zu einer Entscheidung aufzuraffen. Sein Butler René Delorm wartete einmal drei Monate in einer Wohnung in der Schweiz, bis Dodi zu einem Entschluss kam, ob er nun lieber in Paris, London oder Gstaad leben wollte. Seine Freundinnen saßen den ganzen Tag auf ihrem Gepäck und warteten auf Dodi, der sie abholen und mit seinem Privatflieger nach L. A. bringen sollte. Das erboste Marie Helvin ebenso wie seine Flirterei mit Londoner Damen. Was private Abendgesellschaften anbelangte, so legte Dodi Restaurantmanieren an den Tag: Er hatte die Gewohnheit, im letzten Augenblick abzusagen, als wäre eine solche Einladung eine schlichte Reservierung im Bistro an der Ecke. Einer von Al Fayeds Leibwächtern erklärte einmal Dianas Chauffeur Colin Tebbutt: »Vergessen Sie nicht, wir haben hier drei Zeiten: die englische Zeit, die arabische Zeit und die Dodi-Zeit.«18 Während des Urlaubs mit Diana empfanden die Bodyguards Kez Wingfield und Trevor Rees-Jones die immer unberechenbareren Entschlüsse ihres Arbeitgebers zunehmend als irritierend. Für Dodi zu arbeiten war bestenfalls ein Alptraum. »Er steckte mitten in der Stoßzeit in einem Stau«, sagte Rees-Jones. »Und dann hieß es: ›Warum haben Sie diesen Weg genommen?‹ Er hasste es, im Verkehr festzusitzen, wollte sich immer vordrängeln, Abkürzungen nehmen und so schneller ans Ziel gelangen. Er befahl mir, Gas zu geben, obwohl ich genau wusste, dass wir gleich geblitzt würden.«19 Da war dieser chaotische Abend an Land in Monte Carlo. Dodi hatte spontan beschlossen, die Prinzessin auf einen Spaziergang mitzunehmen. Doch nachdem sie lange in dem Versuch, die Paparazzi abzuhängen, bergauf gekeucht waren, verliefen sie sich. Da kauerten nun die Lieblingsobjekte jedes Yellow-Press-Fotografen allein an einer Bushaltestelle und versuchten herauszufinden, wo sie waren. Rees-Jones fing an, die Prinzessin zu bedauern; er glaubte, dass sie etwas Besseres verdient hätte. Er war beim ersten Al-Fayed-Urlaub auf Mohameds Anwesen in St. Tropez im Juli, mit William und Harry im Schlepptau, gerührt gewesen, wie sorglos und liebevoll Diana auf einem Rummelplatz herumgeschlendert und mit den Kindern Karussell gefahren war, bis die Presse ihnen den Spaß verdarb. »Sie war wunderbar«, sinnierte er. »Und ihre Kinder waren fantastisch … Du meine Güte, sie war viel besser als dieser Typ!«20
Prinz William teilte Rees-Jones’ Meinung. Er fühlte sich von der Beziehung seiner Mutter mit Dodi zunehmend peinlich berührt, und auch die protzige Prestigeentfaltung der Al Fayeds erfüllte ihn mit Unbehagen. Seinen Freunden sagte er, dass er während der Ferien im Juli das Gefühl hatte, »getestet« zu werden. »Plötzlich führte sich eine Gruppe von Leuten, die er kaum kannte, wie eine Art Ersatzfamilie auf.«21 Die Kussbilder von der Jonikal im August hatten eine telefonische Auseinandersetzung mit seiner Mutter zur Folge. Der fünfzehnjährige Prinz fürchtete sich vor den Kommentaren seiner Mitschüler, wenn er für das neue Schuljahr nach Eton zurückkehren würde. Es ist fraglich, ob Dodi angesichts von Williams Missbilligung lange durchgehalten hätte. Auch hätte Diana selbst jeden Hinweis auf Dodis erneuten Drogenmissbrauch mit Argwohn betrachtet, denn solche Dinge verabscheute sie. Unzuverlässigkeit jeglicher Art ging ihr auf die Nerven. In ihrer Rolle als Prinzessin hatte sie ihre Pflichten stets pünktlich und gewissenhaft erfüllt.
Was war nun im Laufe dieser ausgedehnten Sommereskapade mit jener anderen Diana geschehen? Im Juli, bei unserem Essen in New York, war sie noch selbstbeherrscht und bemerkenswert konzentriert gewesen. Für sie war Tony Blairs Wahl zum Premierminister wie ein neuer Besen. Er würde ihr altes Leben hinwegfegen, und es würde ihr eine humanitäre Mission anvertraut werden. Blair sagte mir, er habe Diana im Hinterkopf gehabt, als er über die Ankurbelung seiner Afrika-Initiative samt Auslandshilfe und Schuldenerlass nachdachte, aus der dann die Millennium-Kampagne werden sollte. Blair und seine Frau Cherie hatten Diana und William zum Mittagessen nach Chequers, auf den Landsitz der Premierminister, eingeladen, und sie hatten auf dem Rasen miteinander Fußball gespielt. Nur Monate bevor die Jonikal zu ihrer Vergnügungsfahrt auslief, hatte sie sich auf die mutigste Mission ihres Lebens eingelassen: die Kampagne gegen Tretminen.
Noch am 8. August war sie nach Bosnien-Herzegowina geflogen, zusammen mit Bill Deedes, dem ehrwürdigen Herausgeber des Daily Telegraph. Er war beeindruckt von ihrer »schweigenden Gefasstheit, und wie gut sie darin war, zuzuhören und mit dem Leiden anderer umzugehen, indem sie einfach eine Hand ausstreckte, jemanden berührte und ihm den eigenen Stempel entspannender Ruhe aufdrückte«.22 Immer wieder gewann Diana skeptische Pressevertreter durch die besondere Art ihrer Empathie für sich. Im Januar war die Kriegsreporterin der Sunday Times, Christina Lamb, in Angola Zeugin, wie nahe Diana an Landminenopfer herantrat. Es beeindruckte sie, dass Diana niemals den Kopf abwandte von Verletzungen, die so grauenhaft waren, dass sie selbst nicht hinsehen konnte, obwohl sie schon seit Jahren aus der Dritten Welt berichtete. »Sie hatte etwas, was ich zuvor nur bei Nelson Mandela beobachtet hatte«, schrieb Lamb, »eine Art Aura, die die Leute veranlasste, bei ihr sein zu wollen. Dazu ein vollkommen natürliches, allem Anschein nach direkt von Herzen kommendes Gefühl dafür, wie man jenen Hoffnung bringen kann, die wenig haben, wofür es sich zu leben lohnt.«23
Und jetzt, nur drei Wochen nach ihrem bravourösen Auftritt in Bosnien, war sie hier, in einer heißen Augustnacht, wie gefangen in einem Taumel, einem regelrechten Highlife-Flash, und verfolgt von den allgegenwärtigen Motorrädern der internationalen Presse.
Seit 15.20 Uhr an diesem Nachmittag, dem Augenblick, als Al Fayeds Gulfstream IV nach neunzigminütigem Flug von Sardinien in Le Bourget landete, waren sieben Paparazzi hinter Dianas und Dodis Mini-Autokolonne hergejagt. (Sie bestand aus zwei Fahrzeugen: dem Mercedes und einem Landrover, dem Begleitfahrzeug für das Gepäck.) Um sie abzuhängen, wies Dodi seinen Chauffeur an, aufs Gaspedal zu treten und sie nicht, wie geplant, zum Ritz zu bringen, sondern zu einer anderen Al-Fayed-Trophäe, der ehemaligen Residenz des Herzogs und der Herzogin von Windsor im Bois de Boulogne. Seine Gespielinnen in diesem Haus herumzuführen gehörte zu Dodis romantischem Standardprogramm. Nur einen Monat zuvor hatte er Kelly Fisher dorthin mitgenommen.
Das Anwesen, eine Villa aus dem 19. Jahrhundert mit vierzehn Zimmern, umgeben von einem Garten mit reichem Baumbestand, war Teil von Mohamed Al Fayeds grenzenloser Huldigung an den Mythos der Monarchie. Als Sohn eines Schulinspektors in Alexandria zu einer Zeit aufgewachsen, als Ägypten noch unter britischer Herrschaft stand, war der kämpferisch gesinnte Al Fayed mit seiner Krummdolchnase immer davon besessen gewesen, seine Kindheitsfantasien von imperialer Größe auszuleben. Sein Streben nach Akzeptanz beim Londoner Establishment hielt der britischen Oberschicht einen für beide Seiten wenig schmeichelhaften Spiegel vor – erinnerte er doch daran, wie sehr Snobismus und kolonialer Rassismus die Psyche von Tätern wie Opfern gleichermaßen verbiegen können. Er träumte davon, eines Tages in das Oberhaus einzuziehen. Und im Gegenzug fand ein großer Teil der Elite ein fast schon sadistisches Vergnügen daran, ihn zurückzuweisen. (Private Eye, die witzige, alle zwei Wochen erscheinende Zeitschrift voller Pennälerwitze und Fleet-Street-Klatsch, verspottete ihn als »Falschen Pharao«.)
Im Laufe der Jahre hatte Al Fayed auf solcherart Ablehnung zunächst mit Enttäuschung, dann mit Wut reagiert. Es bereitete ihm Genugtuung, erlauchte britische Institutionen entweder zu erwerben oder sie rüde an das Niveau zu erinnern, das er von ihnen erwartete – ob es nun Harrods war, das altehrwürdige Satiremagazin Punch oder die Königsfamilie. (Als Kronanwalt Geoffrey Robertson seine Theorie zu Al Fayeds Beweggründen dem Mann selbst darlegte, strahlte Al Fayed: »Ach, Sie haben meinen Idealismus begriffen!«24) Im Oktober 1994 ließ Al Fayed eine gegen John Majors Tory-Regierung gerichtete Bombe platzen: den »Cash for Questions«-Skandal. Unverfroren enthüllte er, dass er 1985 bei der Übernahmeschlacht um Harrods Abgeordnete bestochen hatte, darunter den Staatssekretär im Ministerium für Handel und Industrie, Neil Hamilton. Die Abgeordneten sollten im Parlament in seinem Auftrag Fragen stellen. Lobbyist Ian Greer sagte angeblich zu Al Fayed, als dieser ihn mit dem Auftrag anheuerte, die Fragen vorzuformulieren: »Sie mieten ein Taxi, ein Londoner Taxi, Sie mieten ein Mitglied des Parlaments.«25
Al Fayed bediente sich der linksgerichteten Zeitung Guardian, um seine Korruptionsvorwürfe im richtigen Moment herauszuposaunen, nämlich unmittelbar nachdem Premierminister John Major vor dem Unterhaus der Korruption den Kampf angesagt hatte. Al Fayeds Motiv war Rache. Er hatte das Gefühl, dass die konservative Regierung ihn hintergangen hatte, als sie das Ministerium für Handel und Industrie anwies, die finanziellen Hintergründe seines Kaufs von Harrods zu untersuchen. Dass er sich drei Jahre später noch Hoffnungen auf rettende Beziehungen zum Königshaus machte, könnte fast rührend anmuten – hätte er seine gesellschaftlichen Ambitionen nicht mit so durchsichtigen Manövern verfolgt. Die Überprüfung durch das Ministerium für Handel und Industrie brachte ans Tageslicht, dass Mohamed Al Fayed über sein Vermögen, seine Herkunft, ja sogar in Bezug auf sein Geburtsdatum gelogen hatte. Der Erwerb des Pachtvertrags für die Villa der Windsors in Paris war eine weitere Station auf seinem Weg, Bastionen des Establishments zu erstürmen und zu plündern. Doch wie üblich hatte er die Sache entschieden von der falschen Seite her angepackt. Le Bois, seit 1953 Domizil des im Exil lebenden Herzogs und der Herzogin von Windsor – Edward VIII. und Mrs. Simpson –, war keineswegs ein Symbol königlicher Lebensart, sondern stand für Ächtung und Versagen. Vielleicht identifizierte sich Al Fayed unbewusst mit dem Paria-Status von Mrs. Simpson. Die geschmackvoll eingerichteten Zimmer der Villa erinnern noch immer daran, was der Herzog aufgab, als er sich seinen Pflichten entzog – die eigene Würde, seine Familie und das Land, das er liebte. Diana fand das Haus »unheimlich« und blieb nur dreißig Minuten. Im Gegensatz zu dem, was Al Fayed später zwei amerikanischen Mitarbeitern der Zeitschrift Time mitteilte, traf sich Diana am 30. August nicht mit einem anonym gebliebenen italienischen Designer, und sie verbrachte auch keine zwei Stunden damit, durch das Haus zu wandern und jedes Zimmer und jeden Schrank zu inspizieren.26 Es ging ihr zu sehr gegen den Strich, ausgerechnet an einem Ort königlichen Exils zu verweilen, während ihre Jungs sich in Balmoral in den Schoß der Familie Windsor kuschelten und sie, ähnlich wie Wallis Simpson, auf der Suche nach Amüsement im Mittelmeer herumschipperte. Die Gespenster im Haus der Windsors verstärkten nur Dianas Sehnsucht, Paris so schnell wie möglich den Rücken zu kehren und nach Hause zu fahren.
Doch als der Abend anbrach, hob sich der Vorhang zum letzten, von Chaos und Mythos geprägten Akt, in dessen Verlauf Diana unaufhaltsam in die posthume Scharade einer ewigen Verlobung mit Dodi Al Fayed getrieben wurde. Während sie sich von der wahnsinnigen Verfolgungsjagd der Paparazzi mit einem beruhigenden Hairstyling in der Präsidentensuite des Ritz erholte, war Dodi unterwegs, um einen weiteren Einkauf zu tätigen, mit dem er ihr imponieren wollte: Es ging um den Kauf von noch mehr Schmuck, und zwar bei dem Nobeljuwelier Repossi, gegenüber dem Hotel, an der Place Vendôme. Der Chef dieses erlesenen Neppladens, Monsieur Alberto Repossi persönlich, und seine Frau Angela erwarteten ihn bereits. Mohamed Al Fayeds Märchenerzählung zufolge hatten Diana und Dodi in Repossis Filiale in Monte Carlo einen Verlobungsring aus der Serie »Sag ja zu mir« erspäht mit der Absicht, ihn passend machen zu lassen und dann in Paris abzuholen.27
Tatsächlich wusste der ewig unschlüssige Dodi nicht, was er wollte. Er schien nur unklare Vorstellungen von dem Ring gehabt zu haben, auf den er und Diana im Schaufenster des Geschäfts in Monte Carlo einen flüchtigen Blick geworfen hatten. Später sollten sich auch die Bodyguards nicht an einen Besuch im Laden dort erinnern. Jetzt allerdings breiteten die beflissenen Repossis zu Dodis Vergnügen eine ganze Palette funkelnder Uhren, Ringe und Armbänder aus, aber nichts davon gefiel ihm. Er griff sich einen Katalog mit anderen Pretiosen nach Dianas Geschmack und stürmte nach einer Rekordzeit von sieben Minuten und siebenundzwanzig Sekunden aus dem Laden.28 Wo war also der legendäre Verlobungsring, mit dem die Prinzessin »ja zu ihm sagte«? Er befand sich am Finger der findigen Angela Repossi! Dreißig Minuten nachdem Dodi das Geschäft verlassen hatte, kam der stellvertretende Geschäftsführer des Ritz, Claude Roulet, zurück, um das aus dem Katalog ausgewählte Stück abzuholen. Da bemerkte Roulet, dass Madame Repossi selbst etwas trug, was noch besser passte als alles, was Dodi bislang angeboten wurde. Auf seine Bitte zog sie sich den Ring vom Finger, reinigte ihn, und Roulet kaufte ihn zur Ansicht. Erst jetzt sollte Dodi also tatsächlich etwas von der Existenz eines »Sag ja zu mir«-Verlobungsrings hören.
Es mag Dodis Absicht gewesen sein, die entscheidende Frage zu stellen – das behauptet jedenfalls auch sein Butler René Delorm. Es ist jedoch unwahrscheinlich, dass Diana ihre Meinung so schnell um hundertachtzig Grad gedreht hätte, die sie Paul Burrell und Rosa Monckton gegenüber geäußert hatte, noch bevor Dodi ihr an Bord der Jonikal einen Bulgari-Ring überreichte. Zu ihrer Freundin Rosa hatte sie gesagt: »Er hat mir ein Armband geschenkt. Er hat mir eine Uhr geschenkt. Ich weiß, dass als Nächstes ein Ring folgen wird.« Dann hatte sie gelacht und gesagt: »Rosa, der bleibt fest am Ringfinger meiner rechten Hand«29 – eine Methode, einer Verlobung auszuweichen: Diese Version wird auch von Burrell in seinem Buch »Die Zeit mit ihr. Erinnerungen an Diana« gestützt. Ebenfalls unwahrscheinlich ist ein geheimes Einverständnis zwischen Mohamed Al Fayed (der die Rechnung schließlich bezahlte) und Monsieur Repossi, dass Dodi der Prinzessin einen Heiratsantrag machen und ihr dabei ein Schmuckstück für elftausend Dollar überreichen sollte, das derart überstürzt gekauft wurde. Ein Verlobungsring für Diana, dessen Foto an jedem Kiosk der Welt gezeigt würde, hätte gewiss ein ausgefalleneres Stück sein müssen, mit einem Diamanten so groß wie – na ja, so groß wie das Ritz eben. War die Prinzessin etwa weniger wert als Dodis sitzengelassene Verlobte, das Model Kelly Fisher? Auf ihrer tränenreichen Pressekonferenz am 14. August 1997 in Los Angeles stellte Kelly Fisher einen Verlobungsring von Dodi mit Saphiren und Diamanten zur Schau, der auf zweihunderttausend Dollar geschätzt wurde. Darüber hinaus war es ungemein wichtig, die Windsors um eine Nasenlänge zu schlagen. Selbst die notorisch knauserige Queen Elizabeth II. hatte dem englischen Hofjuwelier Garrard für einen mit Saphiren und Diamanten besetzten Ring, den Charles Diana zur Verlobung schenken sollte, über achtundzwanzigtausendfünfhundert Pfund gezahlt. Glaubt denn ernsthaft jemand, Al Fayed hätte sich bei einer für seine Verhältnisse kleinen Transaktion ausstechen lassen? Außerdem sagte Monsieur Repossi selbst in dem ersten Interview, das er dem Fernsehproduzenten Martyn Gregory gab, der Ring, den er Dodi an jenem Abend verkaufte, sei kein Verlobungsring gewesen.30 Erst später änderte er seine Geschichte und bestand nunmehr darauf, dass es doch einer gewesen sei – dabei darf man nicht vergessen, dass Mohamed Al Fayed und die Gäste des Hotel Ritz zu Repossis besten Kunden zählen.
Heute kann der Verlobungsring, der keiner war, in der Vitrine der Dodi-und-Diana-Gedenkstätte bei Harrods besichtigt werden, neben einer Champagnerflöte aus der Präsidentensuite, einem plätschernden Springbrunnen und zwei Kameen des Paars, flankiert von unablässig flackernden weißen Kerzen. Die Tatsache, dass der Ring in der Vitrine von Harrods nicht zu Repossis Beschreibung dessen passt, was er für Diana anfertigte, ist nur ein weiteres der Geheimnisse in Mohamed Al Fayeds vernebelnder Welt aus Geschäft und Fantasie.
Soweit wir wissen, trug Diana diesen Ring ohnehin nie. Was an diesem Abend auf seinen Kauf folgte, war das Crescendo einer Wahnsinnshektik. War Dodi in seine alte Gewohnheit zu koksen zurückgefallen, deretwegen er von David Puttnams Filmset geflogen war? Dianas Freunde haben berichtet, ihr seien seine häufigen Gänge ins Badezimmer verdächtig gewesen.31 Die Blutuntersuchung, die 1997 in London durch den Pathologen an Dodi (oder an Diana) posthum durchgeführt wurde, ergab jedoch keine Hinweise auf Spuren von Kokain. Vielleicht waren Dodis Unruhe und das Hin und Her seiner Anweisungen in dieser Nacht nur der Beweis für seine Panik angesichts der Tatsache, dass er nun als der Welt gefragtester Romeo galt. Thierry Rocher, der Nachtportier des Ritz, berichtete der französischen Presse: »Seine Nerven waren zum Zerreißen gespannt … und meiner Ansicht nach könnte das Henri Pauls Verhalten am Steuer des Wagens beeinflusst haben.«32Der Countdown bis zur Katastrophe verlief wie im Zeitraffer. Man beachte die Abfolge.
19 Uhr: Inmitten eines Schwarms von Paparazzi bricht das Liebespaar vom Hotel Ritz auf in Richtung von Dodis Wohnung in der Rue Arsène Houssaye. Die Prinzessin ist wütend über das Geschrei und Gedränge der Fotografen draußen. Aber bleibt das Paar im Haus und turtelt? Nein.
21.35 Uhr: Die beiden treten, umringt von der Meute, aus dem Haus, um zum Abendessen zu fahren, das sie sich problemlos auch dort hätten servieren lassen können. Sie fahren los, über die Champs Elysées, hinter sich ein dröhnender Pressekonvoi. Die Leibwächter im Begleitfahrzeug sind stocksauer – nicht auf die Journalisten, die ihnen folgen, sondern auf ihre eigene kostbare Fracht. Sie sind angestellt, um Dodi und Diana zu beschützen, haben aber nicht den geringsten Hinweis erhalten, wohin die Fahrt gehen soll. Dodi sagt seinem Chauffeur, er solle zu Chez Benoît fahren, einem schicken Bistro in der Nähe des Centre Pompidou. Dorthin hat er Monsieur Roulet vom Ritz vorausgeschickt, um sicherzustellen, dass ihnen dort ein Fünf-Sterne-Willkommen bereitet wird. Die hinter ihnen herjagenden Motorräder und Vespas kleben an dem Mercedes »wie die Teufel«, so jedenfalls ein Zeuge. Diana ist an ihre Aufdringlichkeit gewöhnt, aber Dodi gerät in Panik. Mit wirklichem Ärger kann er nicht umgehen, nur mit vorgeblichem. Was ihn völlig aus dem Konzept bringt, ist die Tatsache, dass die Paparazzi von allen Seiten auf sie einstürmen und nicht nur hinter ihnen herhetzen. Jetzt will er plötzlich doch nicht ins Chez Benoît, Monsieur Roulet und all die Hebel sind vergessen, die dieser inzwischen in Bewegung gesetzt hat.
21.45 Uhr: Dodi befiehlt dem Fahrer, zum Ritz zurückzufahren – sie wollen dort speisen. Das ist eine schlechte Nachricht für den Oberkellner des dortigen Restaurants L’Espadon. Das Lokal ist gerammelt voll, und die fünfzehn Minuten, die Dodi ihm gelassen hat, einen freien Tisch zu organisieren, sind ein einziger Alptraum. Es besteht die Gefahr, dass der Sohn des Besitzers und die Prinzessin von Wales keinen Platz finden!
21.53 Uhr: Diana betritt das Hotel, gefolgt von Dodi. Das Paar wird nicht am diskreteren Hintereingang in der Rue Cambon abgesetzt, sondern am zwangsläufig öffentlichen Vordereingang. François Tendil, der Sicherheitsbeamte in dieser Nacht, ist wegen der sich versammelnden Fotografen so beunruhigt, dass er den Sicherheitschef des Ritz herbeizitiert, Henri Paul, der eigentlich dienstfrei hat. Unterdessen tauchen plötzlich zwei Schnappschussjäger aus dem Nichts auf und bedrängen Diana. Dodi dreht durch und brüllt Monsieur Tendil an, das Ganze sei »große Scheiße«. Das Paar geht in Richtung Speisesaal. Dodi hält Kez Wingfield eine Standpauke, die sich, wie Wingfield sich erinnert, »gewaschen« hat, weil er ihnen nicht vorausgefahren ist, um die Straße freizuhalten und Hindernisse aus dem Weg zu räumen – eine Unmöglichkeit für den Bodyguard, da die ganze Nacht für ihn ohnehin eine einzige »Magical Mystery Tour« gewesen ist.33 Am hastig gedeckten Tisch im Speisesaal verliert jetzt auch Diana die Fassung. Eines der erschütterndsten Bilder ihrer letzten Stunden ist das einer schönen Frau, die vor den Augen aller Gäste im Restaurant L’Espadon sitzt und leise vor sich hin weint.
22.03 Uhr: Das Paar, das inzwischen sein Abendessen bestellt hat, wartet nicht, bis es eintrifft. Die beiden kapitulieren vor dem unangenehmen Angestarrtwerden und bitten, man möge ihnen das Dinner oben in der Präsidentensuite servieren, die sie drei Stunden zuvor verlassen haben. Während sie speisen, warten die beiden Leibwächter in der Bar des Hotels, der Bar Vendôme, wo sich Henri Paul zu ihnen gesellt. Dieser kippt zwei gelbliche Drinks. Die Bodyguards halten sie für Ananassaft, doch handelt es sich, wie sie später feststellen sollten, um den alkoholhaltigen, bei den Franzosen so beliebten Pastis Ricard. Draußen wird jetzt der Vordereingang des Hotels belagert. Von Fernsehreportern darauf aufmerksam gemacht, dass sich Diana im Hotel befindet, haben Hunderte neugieriger Fans das Bataillon der Paparazzi verstärkt. Jedes Mal, wenn eine Blondine das Hotel betritt oder verlässt, bricht wilder Jubel los, wie in der Oscar-Nacht am Rand des roten Teppichs. Dass Diana und Dodi nicht einfach von Anfang an für einen romantischen Abend hinter verschlossenen Türen in ihrer Suite bleiben – und dass sie jetzt, nachdem sie an diesen Zufluchtsort zurückgekehrt sind, nicht lieber die ganze Nacht dort verbringen, sondern sich anschicken, sich zum dritten Mal in den Strudel des Medienrummels zu stürzen –, das alles lässt auf ein fast zwanghaftes Bedürfnis schließen, gesehen zu werden.
Es war ein Bedürfnis, das sie offensichtlich beide verspürten. Zufällig war einer von Dodis Onkeln auch in Paris, der saudi-arabische Geschäftsmann Hassan Yassin. Dodi hatte ihn auf einen Drink in die Bar eingeladen, damit er Diana kennenlernte. Yassin hatte sich verspätet, und als er eintraf, war das Paar schon wieder weg und befand sich gerade auf seiner letzten Fahrt, auf dem Weg zu Dodis Wohnung. Yassins Meinung heute: »Beide waren öffentlichkeitssüchtig. Hätte ich Diana an meiner Seite, ich würde mit ihr in den Dschungel gehen, und nicht ins Ritz.«34
Aber wäre sie mitgegangen? Das ist fraglich. Dodi war in dem Spiel mit den Medien ein Neuling, aber Diana war auf diesem Gebiet der geschickteste Profi unter den Lebenden. Sie war ihren Zeitgenossen weit voraus, indem sie eine Welt antizipierte, in der Berühmtheit praktisch als klingende Münze dient. Wir haben uns inzwischen an das Phänomen gewöhnt, dass Filmstars die Kanäle beherrschen, sich zu Darfur oder zum Umweltschutz äußern. Journalisten, Künstler und Experten in Sachen Außenpolitik stehen Schlange, um Brad Pitt oder George Clooney für eine Schirmherrschaft zu gewinnen, wenn sie wollen, dass ihre Ideen von den Mächtigen ernst genommen werden, genau wie ihre Kollegen im siebzehnten Jahrhundert um die Patronage des Earl von Southampton buhlten. Diana, selbst Aristokratin, wusste, dass der erbliche Adel nichts mehr bedeutete. Allein der Publicity-Adel zählte.
Leider missbrauchte sie infolge der Irrungen und Wirrungen ihres Herzens diese Publicity. Auf Diana übte die Kamera stets eine fatale Anziehungskraft aus. Sie hatte einen sechsten Sinn dafür entwickelt und wusste, wann eine auf sie gerichtet war, auch wenn sie sie nicht sehen konnte. Die Kamera hatte das Image geschaffen, das ihr so viel Macht verliehen hatte, und Diana war süchtig nach ihrer Magie, auch wenn es wehtat. Nun war ihr Leben bestimmt von der Frage, wie der Geist unter Kontrolle gebracht werden konnte, den sie aus der Flasche gelassen hatte. Den ganzen Urlaub über hatte sie mit der Presse einen gefährlichen Tanz aufgeführt. Als sie erfuhr, dass Charles auf Highgrove eine Geburtstagparty für Camilla veranstalten wollte, sagte sie zu Lady Bowker: »Elsa, weißt du, was ich neulich gedacht habe? Was für eine großartige Idee es wäre, meinen Badeanzug anzuziehen, mich in der Geburtstagstorte zu verstecken und dann plötzlich herauszuspringen!«35 In gewisser Weise tat sie das auch. Der »Schnappschuss« von ihren langen Beinen und dem nach vorn gebeugten Körper in einem zartblauen Einteiler, im Begriff, einen eleganten Hechtsprung von der Jonikal auszuführen, hatte auf der ganzen Welt die Herzen der Zeitungsverleger höher schlagen lassen. Nach ihrem Tod wurde enthüllt, dass die sensationellsten Bilder ihres letzten Sommers – zum Beispiel die berühmte Titelseite des Sunday Mirror mit der Balkenschlagzeile »DER KUSS« und einem Foto, das sie zeigte, wie sie den barbrüstigen Dodi vor der Küste von Korsika umschlungen hielt, und für den die Zeitung dem Fotografen Mario Brenna eine viertel Million Pfund zahlte – direkt auf Tipps von Diana selbst zurückgingen. Nachdem erste Bilder der Verliebten erschienen waren, die sie auf Deck zeigten, wo sie auf einer Liege mit gelben Kissen schmusten, als das Schiff in Portofino vor Anker lag, rief die Prinzessin persönlich den Fotografen Jason Fraser an, der mit Brenna unter einer Decke steckte – nicht etwa, um zu protestieren, sondern um ihn zu fragen, warum sie so körnig herausgekommen seien.36 An ihrem letzten Abend in Paris erreichte sie Richard Kay, ihren Vertrauten bei der Daily Mail, auf dem Handy, als dieser gerade in Knightsbridge einkaufen war. Sie wollte herausfinden, was in der Presse über sie zu lesen sei, und sagte, wie sehr sie sich vor dem Erscheinen der Sonntagszeitungen fürchtete.37 Der Gedanke, sie einfach zu ignorieren, kam ihr überhaupt nicht.
Was sie unterschätzte, war wiederum Mohamed Al Fayeds Gier danach, im Rampenlicht zu stehen. Während des ganzen Urlaubs war Diana verblüfft darüber, dass die Presse immer über ihren Aufenthaltsort informiert war. Wie sie Kay berichtete, verdächtigte sie Al Fayed, diese Informationen weitergegeben zu haben, und gewiss war dem auch so.38Al Fayed beauftragte einen Presseagenten namens Max Clifford damit, der Klatschpresse das Urlaubstechtelmechtel als romantische Liebe des Jahrhunderts zu verkaufen. Der zusätzliche Medienrummel verschärfte die Situation weiter.
Dianas letzte Stunden sind so gründlich durch die Mühle miteinander konkurrierender Beschuldigungen gedreht worden, dass man leicht vergisst, warum sie die Einladung, die Ferien mit den Al Fayeds zu verbringen, überhaupt angenommen hatte: Sie glaubte, sie würden ihr Schutz bieten. Trotzdem starb sie, weil vier Männer in Mohamed Al Fayeds Reich sich nicht richtig um sie kümmerten: Weder Dodi, dessen Pläne ebenso chaotisch waren wie er selbst; noch Mohamed Al Fayed, der seinen Segen zu der hirnrissigen Idee seines Sohnes gab, den Sicherheitschef des Ritz, Henri Paul, als Fahrer einzusetzen, statt einen ausgebildeten Chauffeur; noch Henri Paul selbst, der, wie sich herausstellen sollte, einen Medikamentencocktail eingenommen hatte und dessen Blutalkoholwerte ein Dreifaches des gesetzlich erlaubten Promillewerts aufwiesen; noch der Leibwächter Trevor Rees-Jones, der – aus welchen Gründen auch immer – nicht dafür sorgte, dass seine verletzlichen Schützlinge angeschnallt waren. Kein Wunder, dass Mohamed Al Fayed in seiner Trauer über den Verlust seines Sohnes mit Schuldzuweisungen so heftig um sich warf.
0.06 Uhr: Sechs Minuten nach Mitternacht. Das Liebespaar verlässt die Präsidentensuite und geht zum Personalaufzug im ersten Stock. Selbst hier kann Diana die Anwesenheit eines Beobachters förmlich spüren. Es ist die Videoüberwachungsanlage – instinktiv blickt sie auf dem Weg zum Personaleingang zu der versteckten Kamera auf und lächelt.39
Ich stelle mir Diana in dieser letzten Stunde vor in ihrem adretten Blazer, der kurzen weißen Sommerhose und den hochhackigen Versace-Schuhen, wie sie durch den Flur des Ritz eilt, vorbei an den Schaukästen der Boutiquen. Sie wirft kaum einen Blick auf die glänzenden Vitrinen, die dekoriert sind mit Hermès-Tüchern, glitzernden Uhren, verführerischen Dessous und protzigen Broschen, Aushängeschilder für das Luxusleben eines eurokitschigen Dolcefarniente. Sie hetzt mit Dodi und den Leibwächtern durch den prächtigen Salon, der zur schicken Hemingway Bar und dem eleganten Nachtclub des Ritz führt. Auf dem Gehsteig vor dem Hintereingang des Hotels in der Rue Cambon, wo der Parkwächter Henri Pauls schwarzen Mercedes vorgefahren hat, ist inzwischen der korpulente Mann eingetroffen, den seine Kollegen als »triste et solitaire