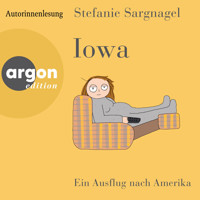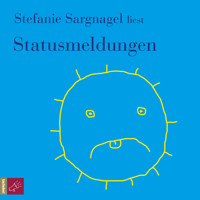9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Stefanie Sargnagel ist im Internet groß geworden, aber auf der Straße aufgewachsen. Daher drehen wir mit ihrem zweiten Band bei Rowohlt das Rad der Geschichte nun noch einmal zurück – aber lesen Sie selbst: «Die kindliche Doris mit ihren zwei Mäusen kam auch immer mal wieder vorbei. Sie erzählte Sarah und mir, dass sie schwanger sei, seit mehr als einem Jahr habe sie ihre Regel nicht mehr. Sie meinte, ein Menschenkind brauche ja nur 9 Monate, um geboren zu werden, deshalb sei sie sich ziemlich sicher, dass es ein Alien werde. Möglicherweise aber auch ein Engel. Ein Engel sei auch daher wahrscheinlich, weil ihr nämlich vor zwei Wochen im Flex einer erschienen sei. Wir trauten uns nicht zu fragen, ob sie etwa ungeschützten Sex mit einem Engel hatte und schauten stoisch ihren Mäusen beim Durchdrehen zu.» Stefanie Sargnagel hat eine Form des Erzählens gefunden, die lustig und brutal ist, eigensinnig und populär. Hier legt sie ihren ersten (beinahe klassischen) Coming-of-Age-Roman vor. Für «Iowa» ist Stefanie Sargnagel für den Deutschen Buchpreis 2024 nominiert.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 278
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Stefanie Sargnagel
Dicht
Aufzeichnungen einer Tagediebin
Über dieses Buch
«Ich fühl mich, als hätte ich alle Gedanken auf einmal.»
Stefanie Sargnagel ist im Internet groß geworden, aber aufgewachsen ist sie auf der Straße. Sex, Drugs and Rock’n’Roll werden in diesem beinahe klassischen Coming-of-Age-Roman zu Phlegma, Hasch und Schokobons. «Dicht» porträtiert die Rückseite Wiens, eine räudige Welt aus Beisl, Psychiatrie und Bruchbude, bevölkert von größtenteils überaus liebenswerten Antihelden: Das ist lustig, brutal, widerborstig, Literatur.
«Dass es so was noch gibt, ich glaub’s nicht! Ein wirklich neuer Ton in der Literatur: Hier ist er.»
Elfriede Jelinek
Vita
Stefanie Sargnagel, geb. 1986, studierte in der von Daniel Richter angeleiteten Klasse der Akademie der Bildenden Künste Wien Malerei, verbrachte aber mehr Zeit bei ihrem Brotjob im Callcenter, denn: «Immer wenn mein Professor Daniel Richter auf Kunststudentenpartys auftaucht, verhalten sich plötzlich alle so, als würde Gott zu seinen Jüngern sprechen. Ich weiß nie, wie ich damit umgehen soll, weil ich ja Gott bin.» Seit 2016 ist sie freie Autorin – und verbringt seitdem mehr Zeit bei ihrem Steuerberater. Sie erhielt den BKS-Bank-Publikumspreis beim Wettbewerb zum Ingeborg-Bachmann-Preis 2016 und 2017 den Sonderpreis des Österreichischen Kabarettpreises.
Impressum
Veröffentlicht im Rowohlt Verlag, Hamburg, November 2020
Copyright © 2020 by Rowohlt Verlag GmbH, Hamburg
Liedtext auf Seite 249 aus: Das Beste, Georg Kreisler
Text und Musik: Georg Kreisler, 1975
Foto auf S. 251 Copyright © privat
Covergestaltung Anzinger und Rasp, München
Coverabbildung Motiv der Autorin
ISBN 978-3-644-00177-0
Schrift Droid Serif Copyright © 2007 by Google Corporation
Schrift Open Sans Copyright © by Steve Matteson, Ascender Corp
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Alle angegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf die Printausgabe.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
www.rowohlt.de
Die Leut, die was draufhaben, geben so viel von sich her.
Da machen sie ein Buch und noch ein Buch und noch ein Buch, oder eine CD und noch eine und noch eine, noch eine, noch, noch und noch und noch und noch und noch
und nöcher
am Ende sind sie dann wohl Löcher.
Wollen die den andern beweisen, dass sie gern unsterblich wären?
Wobei unsterblich sein, is ja schon cool.
Hey, hallo! Wir haben uns doch das letzte Mal vor 2000 Jahren gesehen … Tschüs!
hahahaha.
Michael Stanger
Kein Prolog
Denkst du eigentlich, du wärest nun bereit dafür, ein Buch in einem längeren Fließtext zu schreiben?
Ich weiß nicht, das impliziert schon wieder, dass das das Endziel wäre. Ich würde fast lieber Richtung Kunstbuch gehen: mehr Zeichnungen, weniger ausgewählte Texte. Aber vielleicht arbeite ich auch noch meine Jugend auf. Ich habe einen alten Blog voller verrückter Jugendgeschichten. Den müsste man textlich aber noch stark bearbeiten für eine Buchform. Die Geschichten sind aber sehr abenteuerlich – mein Alltag zwischen 15 und 20 Jahren. Da habe ich viele arge Sachen erlebt.
Das könnte sicherlich auch als eine gute Einordnung für deine darauffolgenden Texte dienen.
Ja, aber es ist wirklich nicht so schön aufbereitet wie meine Statusse. Ich müsste schon daran herumfeilen und auch ein bisschen mit dem Verlag sprechen. Da würde ich mir zwei Jahre Zeit lassen. Es wäre aber schon gut, und ich fände es auch sehr spannend. Ich bin viel alleine gereist, und es waren schon interessante Geschichten. Einmal hat mich ein Verrückter versucht umzubringen, wovon ich immer noch eine große Messernarbe auf der Hand habe.
Das hattest du mir schon einmal erzählt – arge Geschichte.
Mein Alltag jetzt ist halt sehr langweilig, da müssen jetzt die anarchischen Jugendjahre herhalten. Wo ich mich sehr wiedererkannt habe, ist das Comic «Heute ist der letzte Tag vom Rest deines Lebens» von Ulli Lust. Kennst du das?
Nein, noch nie gehört.
Das find ich ganz toll, und es beschreibt eine ähnliche abenteuerlustige Scheiß-drauf-Mentalität, die ich damals auch hatte. Mit der man einfach in die ärgsten Situationen gerät, weil man jung und neugierig ist.
«Der spaßige, also autonomere Teil meiner Jugend begann, als ein Mädchen aus Zürich neu in meine Klasse kam. Sein Name war Sarah, und es erinnerte mit seinem breiten Grinsen an eine Art Pippi Langstrumpf. Sie schien sich vor wenig zu fürchten, war schnell, vorlaut, selbstbestimmt und schwere Kifferin. Ich war nach einem kurzen Abstecher auf eine Modeschule gerade an das Gymnasium im 18. Bezirk zurückgekehrt: Nachdem ich mir beim Nähen (15 Stunden die Woche) mehrmals in die Finger gestochen hatte und trotz tagelangen Übens immer noch die Schlechteste der ganzen Stufe war, sahen meine Mutter und ich ein, dass eine eher humanistische Ausbildung vielleicht doch besser für mich war, und ich ging zurück in das spießige Sprachgymnasium, an dem ich schon von 10 bis 14 gewesen war. Die Lehrerschaft nahm meine Rückkehr mit Entsetzen auf. Viele waren froh gewesen, mich endlich losgeworden zu sein. Ich bestand auf dem Recht, meine Gedanken zu äußern, und war damit in der Klasse so gut wie allein. Meine besten FreundInnen waren mittlerweile an anderen Schulen, kreativer oder gemütlicher (sogenannten Maturafabriken), und so war ich nun ohne eine verschworene Gemeinschaft zurück in diesem, wie es mir schien, gewalttätigen Polizeistaat.
Sarah und ich lernten uns eines Nachmittags kennen, da wir eine gemeinsame Feindin hatten, mit der wir beide unfreiwillig befreundet waren. Nicole war eine, im Nachhinein betrachtet, intrigante Soziopathin, die sich konsequent jedem aufdrängte, und zwar nicht aus Sehnsucht nach Freundschaft, was einen zumindest rühren hätte können, sondern weil sie Leute suchte, um sie zu unterdrücken und zu demütigen. Wir waren zwar zu alt, um uns auf diese Machtspielchen einzulassen, die sie durchaus geschickt einige Jahre durchgezogen hatte, aber gleichzeitig war uns langweilig, und unterhaltsam konnte Nicole in ihrer durchtriebenen Bosheit schon sein. Außerdem hatte Nicole von ihrem Nachbarn aus der gehobenen Wiener Vorstadt ein Gramm Gras geschenkt bekommen. Wir rauchten also Nicoles Zeug gemeinsam, dann musste sie schon los in ihre zweistöckige Vorstadtvilla mit Pferden und dem Golden Retriever. So blieben Sarah und ich im Park zurück und entdeckten sehr schnell etwas, das uns verband. Wir beide hielten Nicole eigentlich für einen fürchterlichen Menschen und ertrugen ihre Gesellschaft nur aus Mangel an Alternativen. Überhaupt war Sarah voller ausgeprägter Überzeugungen, über die wir angeregt diskutieren konnten. Ab diesem Tag trafen wir uns jeden Nachmittag im Türkenschanzpark, rauchten gemeinsam einen Joint, redeten über die Ungerechtigkeit der Gesellschaft, zeichneten manchmal und überlegten, wie wir gemeinsam die Welt verbessern könnten. Es war von Anfang eine eher intellektuelle Freundschaft, wir redeten kaum über Emozeug, wie man es bei einer Mädchenfreundschaft erwartet, da blieben wir distanziert. Wenn wir ein paar Euro einstecken hatten, kauften wir uns auch mal einen Eristoff Ice in einem Lokal neben der Schule, in dem man auch unter 16 leicht an Alkohol kam. Es hieß Abgrund, und genauso sah es dort aus, vollgestopft mit Snobs. Alkohol tranken wir so gut wie nie, er schmeckte uns eigentlich nicht, also blieben wir bei typischen süßen Mischgetränken. Sarah hatte 20 Euro von ihrem Stiefvater zugesteckt bekommen, einem bekannten österreichischen Philosophen, und so gingen sich sogar drei Flaschen für jede aus. Wir hatten uns mal wieder in Rage diskutiert. Unser Hauptfeind war nicht mehr Nicole, sondern das Schulsystem. Und wir wollten den ganzen Kapitalismus abschaffen, obwohl ich mir nicht sicher bin, dass wir dieses Wort damals überhaupt schon benutzten. Gemeinsam brüteten wir verschiedenste Szenarien aus, wie wir diesem Stumpfsinn entrinnen konnten. Am Höhepunkt unseres Pathos wussten wir plötzlich, was zu tun war: Wir würden aussteigen aus dem Scheißsystem! Wir würden abhauen nach Granada! Freaks aus aller Welt hatten sich dort ihren Lebensmittelpunkt mit dem Nötigsten eingerichtet, das hatten wir irgendwo aufgeschnappt, und hier würde unsere widerständige Zukunft beginnen, davon waren wir in dem Moment zutiefst überzeugt. Wir wussten beide, es ging hier nicht um morgen, nicht um ein Demnächst, sondern wir mussten es auf der Stelle tun: per Autostopp nach Granada fahren. Wir zahlten unsere Rechnung und brachen entschlossen auf. Zuerst gingen wir zu Sarah, in ihre Dachwohnung in Währing. Alle Lichter waren schon aus. Danach spazierten wir die 20 Minuten zu mir nach Hernals in die kleine Wohnung, in der ich mit meiner Mutter lebte. Im Gegensatz zu Währing war mein Wohnbezirk schon abgefuckter, am Weg in die Geblergasse kamen wir an Peepshows, Bordellen und Spielhallen vorbei. Auch hier schlichen wir leise in der dunklen Wohnung herum, um das Wichtigste zusammenzupacken: den Reisepass, ein bisschen Wäsche, einen Rucksack, das Zahnputzzeug, Tampons und eine Rolle Klopapier. Behutsam schlossen wir die Türe und machten uns auf den Weg. Am sinnvollsten schien es uns, Richtung Westbahnhof zu gehen, da Spanien ja bekanntlich eher westlich von Wien liegt. Es war wenig Verkehr, am Gürtel standen ein paar Prostituierte, und mit unseren Rucksäcken spazierten wir durch die Gassen wie Pioniere auf dem Weg zur Welteroberung, zu Fuß und schnellen Schrittes, weil die Öffis nicht mehr fuhren. Bei der Josefstädter Straße legten wir eine kurze Pause ein, um uns im nächstgelegenen Gassipark mit einem Joint für die weitere Reise zu stärken. Der Park bestand aus einem Baum, einer Betonfläche und einer Bank, auf der im gelben Licht einer Laterne alleine ein besoffener Student mit unfrisierten, langen Haaren saß. Als wir näher kamen, rief er uns zu: «Hey, ihr! Was ist Zukunft?» Wir musterten ihn und setzten uns dazu. Immer wieder wiederholte er euphorisch lallend seine Frage: «Was ist die Zukunft?» Sarah sagte voller Inbrunst: «Wir fahren heute Nacht noch nach Granada, wir hauen ab, das ist die Zukunft!» Nachdem wir den Joint fertig gedreht hatten, teilten wir ihn mit dem Studenten und unterstützten ihn circa eine Stunde lang bei seinem Projekt, den wenigen Passanten wahllos die Frage zuzurufen: «Hey! Was ist Zukunft?» «Gusch!», rief ein Mann zu uns. «Sie is’ meine Zukunft!», sagte ein junger Typ, der seine Freundin beeindrucken wollte. Mittlerweile war es drei Uhr nachts. Wir wurden immer bekiffter und müder und müder. Mit der Schläfrigkeit kamen uns erste Zweifel an unserem Reiseplan. Mussten wir wirklich unbedingt heute nach Granada? Während einer kurzen Besprechung wurde klar, dass die Moral beidseitig gesunken war und keine die andere mehr recht überzeugen konnte. Wir entschieden uns, doch erst nächstes Jahr nach Granada auszuwandern, vielleicht weniger abrupt. Es wäre auch sehr rücksichtslos gegenüber unseren Müttern gewesen, heimlich in der Nacht für immer abzuhauen.
In der Schule hatte ich mal wieder eine Strafe abzubüßen. Täglich sollte ich um 7:45 Uhr vorm Konferenzzimmer stehen, weil ich zu oft zu spät im Unterricht erschienen war. Verschlafen und mit kleinen Augen stand ich da und schaute mir das Ein- und Ausgehen im Konferenzzimmer an. In diesen Momenten empfand ich sogar Mitleid mit den Unterrichtenden, für die ich ansonsten nur tiefe Verachtung empfand. Es roch stickig, wenn die Tür sich öffnete, nach einer Mischung aus Angstschweiß und alten Büchern. Die Möbel sahen aus wie aus den 70ern, und die Schreibtische waren überladen mit Heftstapeln. Es herrschte eine unangenehme Enge. Ich ekelte mich. Die Strafe empfand ich als Demütigung: minutenlang vor diesem Raum zu stehen und darauf zu warten, dass sich eine dieser neurotischen Figuren in der Morgenhektik dazu herabließ, meinen Wisch zu unterschreiben als Bestätigung dafür, dass ich gehorsam war. Mein Hass wuchs, nicht auf die Menschen, sondern auf das System. Dabei war mir doch alles wichtiger, als diese Leute zu ärgern: Zeichnen, Freunde, Abenteuer, Diskussionen. Dass ich mich täglich angestrengt dazu aufraffen musste, mich in diesen Hort der Sinnlosigkeit zu schleppen, und dass es mir physische Schmerzen bereitete, meine Zeit unter diesen biederen, tyrannischen Wapplern abzusitzen, rang den sogenannten Pädagogen nicht das geringste Verständnis ab. Sobald ich konnte, stürzte ich sofort in den Park, wo meiner Meinung nach das wahre Leben stattfand. Sarah wartete schon mit einem fertig gebauten Joint in der Hand auf mich, und wir phantasierten uns davon. An diesen Nachmittagen lernte ich mehr als in einer Woche Unterricht, das war zumindest meine Ansicht. Wenn es kalt und dunkel wurde und wir unsere Finger nicht mehr spürten, bot uns das «Café Stadtbahn», ein alternatives Refugium im stockbürgerlichen 18. Wiener Gemeindebezirk, eine Herberge. Täglich um 19 Uhr sperrte es auf, und oft warteten wir schon 15 Minuten vorher ungeduldig vor der Türe, dass die Besitzerin den Schlüssel herumdrehte. Waltraut kannte uns schon sehr gut, sie begrüßte uns emotionslos, sie war sehr tolerant. Dort saßen wir dann bis zu fünf Stunden bei einem Glas Soda um einen Euro, und es störte sie nicht. Wenn wir selbstgebrannte CDs mit Hippie-Weltmusik mitbrachten, durften wir diese über ihre Anlage spielen, das rang ihr so etwas Ähnliches wie ein Lächeln ab. Waltraut war um die 60, hatte kurze graue Haare, eine dicke Hornbrille und immer denselben schlabbrigen, abgefuckten Pullover an. Drunter trug sie keinen BH, ihre Brüste baumelten dynamisch beim Servieren herum. Ihre Ausstrahlung war streng, aber im Grunde war sie gutmütig. Sie rauchte eine filterlose «A3»-Zigarette nach der anderen, und angeblich schlief sie sogar im Lokal. Das Café Stadtbahn war fast 100 Jahre alt, und Waltraut hatte es von ihrem Vater übernommen. Vor 30 Jahren war es angeblich wirklich mal ein Kaffeehaus für schachspielende Herren gewesen, doch inzwischen war es ein schummriges Beisl, eine heimelige Spelunke für Währinger Sonderlinge. Die Decken waren über vier Meter hoch, und über jedem Tisch hing ein farbiges Lämpchen, das mit seinem warmen Licht jedes noch so fertige Gesicht aufweichte. Die Poster an den Wänden erzählten Geschichte der letzten Jahrzehnte, und der Rauch stand so dicht, dass unsere Augen nach zwei Stunden zu tränen anfingen. Das hörte aber meistens auf, wenn man selbst dagegen anrauchte. Gegen 21 Uhr kam immer derselbe Obdachlose ins Lokal: der Willi, ein Typ mit einem rabenschwarzen Bart. Dem stellte Waltraut die Bierreste hin, die sie während des Abends in einem großen Glas für ihn gesammelt hatte. Es waren die übriggelassenen, mit Speichel vermengten Reste der Gäste, die dickflüssig in einem Halbliter-Glas auf ihn warteten. Der Typ freute sich sichtlich, sein Körper gewann wieder Spannung, und er schüttete den schalen Schlatz in sich rein. An den meisten Tagen geisterte auch Friedrich durchs Lokal. Er war Waltrauts Mann. Friedrich hatte lange, graue Haare, die flaumig wie Federn abstanden, sein Gesicht war hohlwangig und blass. Er bewegte sich langsam und fließend und wirkte fast durchsichtig, als könne er eins mit dem stehenden Zigarettenrauch werden. So schwebte er fast unbemerkt wie ein Geist von Tisch zu Tisch und räumte schweigend die Aschenbecher ab. Wenn er die Gäste wirr anredete, befahl Waltraut ihm grantig, er solle die Leute in Ruhe lassen, und verwies ihn in sein Eck. In dem Eck stand er dann, als wäre er außer Betrieb, bis es wieder Aschenbecher zu leeren gab, auf die er wie ferngesteuert zuging. Bei uns wusste sie allerdings schon, dass uns Friedrich nicht störte, wir unterhielten uns gerne mit ihm. Vor allem Sarah stellte ihm philosophische Fragen, zum Beispiel: «Was ist die Zukunft?» Angeblich hatte Friedrich Hepatitis C im Endstadium. Seine Aura war aufgeweicht von Opiaten. Er war wie eine wandelnde Schwade.
Nach wie vor träumten Sarah und ich davon, die Schule hinzuschmeißen und gemeinsam die Welt zu bereisen. Wir klapperten die Reisebüros im Bezirk ab und fragten nach Katalogen über Südamerika, Afrika, Asien. Dann schnitten wir die Bilder von alten, dunkelhäutigen Menschen, die zahnlos lachten, aus und klebten sie an die Wände. Hatte ich das Vorjahr noch deprimiert in meinem Zimmer verbracht und Tocotronic gehört, befand ich mich nun auf dem besten Weg, ein ideell verballertes Hippiemädchen zu werden: Ethnoromantik statt Hamburger Schule. Vom Avantgardefaktor her war das eine eher regressive Entwicklung, aber als verlauster Straßenhippie erlebte man halt doch mehr als als zynischer Indiesnob, und Punks gab es in Währing nicht. Cool sein und irgendwas darstellen wollen war, darauf einigten wir uns schnell, ein Armutszeugnis. Mir half diese Einsicht gleich einige Entwicklungsstufen weiter. Wir motivierten einander dazu, uns nicht zu leicht beeindrucken zu lassen, und bestätigten uns darin, einfach alles kapiert zu haben. Sarah und ich flanierten nach der Schule den ganzen Tag durch den Bezirk. Ich war noch nicht so geübt im Kiffen, während die Zürcher Waldorfschule aus ihr einen richtigen Profi gemacht hatte, der sein Wissen gerne an mich weitergab. Außerdem erklärte sie mir, dass wir das zur Bewusstseinserweiterung und nicht zum Posen taten. Natürlich war ich trotzdem sehr stolz, als ich die ersten Öfen endlich selbst drehen konnte. Ich liebte Posen! Aus Prinzip rauchten wir nur Joints. Bongrauchen fanden wir asozial, weil uns der Aspekt des Teilens sehr wichtig war. Die anderen Kiffer, mit denen wir manchmal herumhingen, waren meist pubertierende Typen, die schweigend ihre Bong stopften und halbkomatös Computerspiele spielten. Sie boten uns wenig Unterhaltung, geschweige denn Liebe.
Liebe und Typen waren generell kein Gesprächsthema, mit dem wir uns beschäftigten. Die Weltrevolution zu planen, nahm einfach zu viel Zeit in Anspruch, vielleicht war es uns auch einfach peinlich voreinander, oder wir waren Spätzünderinnen. Verliebt war ich in der Zeit nie, und angemacht wurde ich hauptsächlich von Volltrotteln. Unser Tag bestand aus gemeinsamem Rumhängen, Erforschen der Stadt und der Organisation von Gras. Wenn man, wie wir, keine private «Connect» hatte, musste man sein Gras in Wien damals in sogenannten «Hittn» besorgen. Die Hittn waren kleine Beisl, die keine 60 Quadratmeter groß waren. Von außen wirkten sie unscheinbar und hießen «Cafe 69», «Espresso König» oder «Cheers». Hinter der trashigen Bar stand meistens eine junge Serbin in engem Outfit. Der Grammpreis dort war zwar völlig überteuert, aber es war immer alles verfügbar. Unsere erste Hittn war das «Black Appache», ein kleines Tschocherl am Nussdorfer Gürtel, dessen Logo ein alter Indianer mit Friedenspfeife war. Dort musste man als Erstes einen Eistee Pfirsich bestellen, als wäre man ein ganz normaler Gast. Der Eistee Pfirsich war in allen Hittn der Code für das Kaufinteresse an Gras. Am Eistee nippend, wartete man dann, und im Black Appache wartete man sehr lange. Normal waren 30 Minuten, unsere Höchstwartezeit lag bei fünf Stunden. Also machten wir währenddessen unsere Hausübungen, lernten Lateinvokabeln oder Französisch. Jedes zweite Mal setzte sich «Mikey» zu uns. Er trug unabhängig von den Lichtverhältnissen immer Sonnenbrille, eine fette Goldkette und sah aus wie ein Kind, das sich als Zuhälter verkleidet hat. Als harter Straßengangster warb er um unsere Gunst. Wir rauchten ihm seine Zigaretten weg und ließen ihn sitzen. Trotzdem probierte er es jedes Mal wieder.
Wenn wir nach Stunden aufgeben wollten, kam tatsächlich der Dealer: ein 20-jähriger Typ, gehetzt, paranoid, mit aufgerissenen Augen. Er huschte in ein kleines, durch einen Vorhang abgetrenntes Hinterzimmer, und die wartenden Gäste gingen nach und nach zu ihm. Weil wir Mädchen waren, bekamen wir, wenn wir nett lächelten, meistens ein halbes Gramm mehr.
Während wir kiffend die Weltrevolution planten, fokussierten wir uns zunehmend auf das Schulsystem als Kern des ganzen Problems. Sarah war eben in Zürich auf einer Waldorfschule gewesen, und ich war von Geburt an antiautoritär veranlagt. Sarah war entsetzt über die hierarchischen Strukturen, der, wie sie es nannte, «Staatsschule», und ich fühlte mich endlich verstanden, auch die Härte des Begriffs «Staatsschule» gefiel mir gut.
Eines der Dinge, die Sarah am meisten ärgerten, war, dass der Zeichenlehrer in unsere Zeichnungen reinzeichnete. Das war für sie ein absoluter Skandal und an ihrer alten Schule undenkbar. Es war dann ja nicht mehr die eigene Zeichnung. Als der Professor das erste Mal in ihr Bild reinkritzelte, hielt sie eine zornige Brandrede, und er wagte es nie wieder. Sie brachte mir bei, freier zu zeichnen. Hatte ich vorher Figuren im Disneystil gemalt oder naturalistisch, erklärte sie mir, die besten Zeichnungen entstünden, wenn man sein Denken ausschalte und nichts Bestimmtes versuche. Man solle einfach sein Unterbewusstsein aufs Papier rinnen lassen. Das wisse schon, was es tue. Von da an wurden meine Zeichnungen viel interessanter.
Wir analysierten die Strukturen der Schule, wir erzählten uns jede Ungerechtigkeit, die uns widerfuhr, schaukelten uns gegenseitig hoch und waren uns sicher, eines Tages als große Reformerinnen zu Berühmtheit zu gelangen, denn nur wir könnten die Welt nachhaltig zu einem besseren Ort machen. Wir spielten auch mit dem Gedanken, Umweltaktivistinnen zu werden. Unabhängig voneinander hatten wir im ORF eine Dokumentation über Greenpeace gesehen und erzählten einander euphorisch davon. Auf Schiffen bei hohem Wellengang todesmutig gegen den Walfang kämpfen, Ölkonzerne unterwandern, in Tierfabriken einbrechen, das System sabotieren – das war die Art von kämpferischem Aktivismus, nach der wir uns sehnten. Noch am selben Abend registrierten wir uns auf der Greenpeace-Webseite. Damit war der erste Schritt zu einem Leben im Widerstand getan. Schon wenige Tage später flatterte eine Broschüre in unsere Postkästen: eine bunt illustrierte Einladung zu einer von Greenpeace organisierten Jugenddemonstration für Umweltschutz in Den Haag. Die Aktion hieß «Save the Planet» und beinhaltete eine kostenlose Reise nach Holland samt viertägigem Aufenthalt. Angehängt war ein Brief an die jeweiligen Schuldirektionen, uns für dieses hochgradig relevante Vorhaben freizustellen, gemeinsam mit anderen europäischen Jugendlichen den Planeten zu retten. Wir meldeten uns sofort an. Zu unserer Überraschung ließ sich auch unsere Direktorin vom Sinn der Reise überzeugen, und so durften wir fahren. Die einzige Bedingung war, danach einen Aufsatz über «unsere Erfahrungen» zu schreiben. Aufsätze schreiben war eines der wenigen Dinge, die ich noch gern machte, also war das okay.
Mit einem Reisebus wurden wir in einen Ort namens Wassenaar gebracht, der an der Nordsee lag und zwölf Stunden Fahrt entfernt war. Untergebracht waren wir mit 500 anderen Kindern und Jugendlichen, die aber zu unserem Bedauern meist deutlich jünger als wir waren. Sie sahen eher wie Kinder aus und nicht wie die heldenhaften Anarchisten, die wir uns ausgemalt hatten. Auf einem ausgestorbenen Campingplatz namens «Duinrell» waren drei riesige Zelte mit Stockbetten aufgebaut. Duinrell war eigentlich ein Campingplatz für Familien mit integriertem Vergnügungspark, dessen Maskottchen ein Frosch namens «Rick» war, der am Eingang stand und den ganzen Tag monoton über das leere Gelände quakte. In ein paar lose verteilten Zelten standen verschiedene Workshops zur Auswahl, in denen angeregt diskutiert wurde oder bei denen man bunte Transparente für die große Demonstration malte. Das interessierte uns doch überraschend wenig, also verschoben Sarah und ich die Rettung des Planeten und checkten lieber die Gegend aus. Dabei entdeckten wir, dass alle Vergnügungsattraktionen fuhren, obwohl der Park ansonsten komplett leer war. Unser Umweltaktivismus beschränkte sich also in den folgenden Tagen darauf, zu zweit mit den verschiedenen Achterbahnen zu fahren, bis uns schlecht wurde. Den Rest der Zeit spazierten wir zum anliegenden Strand, beobachteten Ebbe und Flut, ließen uns den Wind um die Nasen wehen und aßen Pommes. Mit der Gruppe nahmen wir erst wieder Kontakt auf, als wir hörten, dass ein Tagesausflug nach Amsterdam geplant war. Amsterdam, das klang für uns nach Mekka. Ab einem Alter von 15 durfte man zwei Stunden lang alleine durch die Stadt spazieren, bis man sich zum gemeinsamen Abendessen wieder traf. Die Gruppenleiter bläuten uns unter Androhung nicht genauer beschriebener Konsequenzen ein, uns von Coffeeshops fernzuhalten. Sarah, ich und Janina, eine Punkerin aus Bremen mit rosa Haaren, mit der wir uns kurzfristig angefreundet hatten, liefen gemeinsam los, um in der kurzen Zeit so viele Coffeeshops wie möglich abzuklappern. Die meisten wollten uns wohl wegen unseres jugendlichen Äußeren nichts verkaufen, sodass wir sehr viele Türen einrennen mussten, die Zeit lief uns davon. Am Ende der Tour hatten wir 10 Gramm der unterschiedlichsten Sorten Gras und Haschisch zusammen, die sorgfältig in Alufolie verpackt in unseren BHs steckten. Die restliche Woche genossen wir glückselig die Fahrgeschäfte und die doppelt frittierten Pommes, während im Hintergrund ununterbrochen das psychedelische «Quaaak» von Rick, dem Riesenfrosch zu hören war. Von Umweltaktivismus bin ich seither begeistert.
Zurück in Wien, verlegten wir unsere Nachmittage vom eher am Stadtrand gelegenen gutbürgerlichen Türkenschanzpark auf die studentischere Votivwiese. Schon vorher waren wir, wenn mal ein, zwei Euro übrig blieben, gerne auf ein McSunday ein paar Straßenbahnstationen in den 1. Bezirk gefahren. Und irgendwann blieben wir einfach da. Immer öfter kam jetzt auch Jakob mit uns mit, ein Typ, der sitzengeblieben und neu in unserer Klasse war und daher ganz gut zu uns passte. Natürlich mussten wir ihn erst ein bisschen erziehen. Jakob dachte anfangs nämlich noch, dass er sein Taschengeld einfach für sich behalten konnte. Wir mussten ihm erst erklären, dass allen alles gehörte, wenn er mit uns unterwegs sein wollte. Das war auch viel sinnvoller, denn irgendjemand von uns hatte immer 10 Euro, und so hatte jeder zumindest etwas Geld für ein bisschen Gras und ein Eis. Jakob war ein lethargischer Typ, unkompliziert, mit Sinn für Humor, und er fügte sich nach anfänglichem Widerstand schnell unseren Regeln. Die Votivwiese ist eine große, rechteckige Wiese mitten im Zentrum, gleich neben der Universität Wien. Daneben steht eine gewaltige gotische Kirche. Täglich saß dort, neben kleinen Grüppchen von Studenten, auch eine große Runde Afrikaner und Südostasiaten zusammen. Es war eine Mischung aus Intellektuellen und Künstlern, die am afroasiatischen Institut der Universität arbeiteten, aber auch anderen Leuten mit ganz gewöhnlichen Jobs, die es nach Wien verschlagen hatte. Von Woche zu Woche lernten wir die Runde besser kennen: beim Schnorren von Zigaretten oder Papers kam man ins Gespräch, und jeden Nachmittag wurde man herzlicher begrüßt. Diese entspannte Ansammlung von Menschen aus aller Welt fanden wir aufregend. Sobald gegen Mittag die ersten Leute eintrafen, schob man die Parkbänke, die man ringsum auf der Wiese fand, zu einem großen Kreis zusammen. So war die Routine. Im Laufe des Nachmittags setzten sich Alte und Junge, Männer und Frauen und Kinder in die Runde. Wenn kleine Kinder dabei waren, spielten sie in der Mitte auf der Wiese, eingekreist und im Schutz der Leute, die ein dankbares Publikum für ihren Kleinkinderslapstick waren. Sarah und ich setzten uns meistens zu Jamal und Aziz, zwei tiefenentspannten Marokkanern um die 50. Jamal war Koch und wegen seiner Frau nach Österreich gekommen. Mit lässig überschlagenen Beinen saßen die beiden auf ihrem Stammplatz und philosophierten, während sie uns dabei immer wieder unauffällig große Klumpen Hasch zusteckten. Im Gegenzug schickten sie uns gerne kaltes Bier holen. Mit 20 Euro gingen wir zum nächsten Supermarkt, brachten ihnen die Dosen und konnten das Restgeld behalten. Das war eine Symbiose, die vor allem uns zugutekam, denn natürlich hatten wir meistens keinen Cent in der Tasche, aber ein starkes Bedürfnis nach Softeis. Alles, was man in die Runde brachte, wurde fair geteilt, das schätzten wir und versuchten, nicht mit leeren Händen aufzutauchen, zumindest hin und wieder Kekse oder Chips von zu Hause dabeizuhaben. Manchmal setzte sich auch Lisi zu uns. Sie war 18, hatte 20 Piercings im Gesicht, war kahlrasiert und wirkte ziemlich drogensüchtig. An der Leine führte sie ihren riesigen Punkerhund «Sidney» spazieren. Meistens schaute sie nur schief und schwieg, bis sie irgendwann wegtrickerte. Das störte niemanden.
Im Türkenschanzpark waren Sarah und ich die Einzigen gewesen, die sogar bei Regen hartnäckig dablieben. Irgendwo fanden wir immer einen Verschlag, der uns vor Unwettern schützte. Auf der Votivwiese hingegen blieben alle sitzen, wenn es zu regnen begann. Die ungefähr 20 Leute standen dann einfach auf, schnappten sich die Parkbänke und trugen sie gemeinschaftlich unter die dichtesten Baumkronen. Wenn es zu arg schüttete, gingen aber auch sie. Nur Sarah, Jakob und ich hatten für diesen Fall die anliegende Tiefgarage für uns entdeckt. Dort saßen wir zu dritt drei Stockwerke unter der Erde, bis es spät wurde. Wir tranken billigen Wein und sangen Lieder, die sich durch den Hall des Gewölbes zu experimentellen Sounds verstärkten.
Einer, der auch täglich auf die Wiese kam, war «König Mao». Über sich selbst sagte er: «Ik bin der König vom Sudan. King Pharao Mao Antony Stevenson.» Er war meistens schwer betrunken und hielt ausufernde Monologe, entweder über die Weltpolitik oder darüber, wie gequält er von seiner Geilheit war. Dabei trug er ausnahmslos immer einen schwarzen Anzug und eine rote Krawatte. Er war fast zwei Meter groß, hatte riesige Hände, ein schönes Gesicht und jammerte volltrunken: «Niemand liebt mich. Wem liebt mich?» Dann machte er meistens Sarah an, er schwärmte von ihren blonden Haaren, und sie nahm es mit Humor. Wenn sie ihn abwies, holte er einen großen Schlüsselbund aus der Hosentasche. Er klimperte damit vor ihrem Gesicht und sang: «Peppi, Peppi, Peppi! Peppi immer da. Das ist unsre Peppi. Ja, ja, ja!» Er war eindeutig irre, hatte aber durchaus seinen Charme. Einmal war er schlecht gelaunt, weil Senegal bei der Fußball-WM verloren hatte. Mit zwei jungen Türken, die eher zufällig vorbeikamen, begann er, lauthals zu streiten. Er sprach gebrochenes Türkisch mit ihnen, und die anderen Afrikaner auf der Wiese, die ihn schon lange kannten, erzählten, dass er zwölf verschiedene Sprachen spreche. Das wirkte nicht unplausibel, immer wieder stellte er unterschiedlichste Sprachkenntnisse unter Beweis. Angeblich war er hochgebildet und früher erfolgreich als Jurist tätig gewesen. Er habe sich damals für humanitäre Einsätze im Kosovo engagiert. Seit der Scheidung von seiner Frau sei es bergab gegangen, er habe exzessiv zu saufen begonnen und seinen Verstand verloren, so sagte man sich. Manche sagten auch, er sei manisch-depressiv und immer schon so. Ein weiterer Mythos über ihn war sein monströser Schwanz: «30 Zentimeter», sagten die Leute aus der Runde und lachten. Irgendwann saß er mir mal breitbeinig gegenüber, und ich sah plötzlich auf Höhe des Knies etwas in seiner Hose zucken. Ich war komplett waach und blieb hängen. Er bemerkte meinen verdutzten Blick und lachte dreckig. Das sei keine Maus in seiner Hose gewesen, sondern sein «Peppi». Bis zum heutigen Tag bin ich mir nicht sicher, was das war. Wenn man den stockbesoffenen König noch nicht so gut kannte, wusste man nicht genau, wie man mit ihm umgehen sollte. So auch die zwei ratlosen Türken, mit denen er in Streit geraten war. Sie riefen, dass er sie in Ruhe lassen solle. Der König wurde noch wütender. Er blies sich auf wie ein Gockel vorm Hahnenkampf und packte eine Parkbank. Dabei wurde einem erstmal klar, wie viel Kraft dieser Mann in einem einzelnen Arm hatte. Meistens war auch er es, der am Anfang des Tages die Bänke für alle Stammbesucher in einem Kreis aufstellte. Mit der Bank unterm Arm rannte er den verwirrten Türken jetzt brüllend nach. Er blieb zwar irgendwann stehen und lachte brüllend, aber die Armen liefen bestimmt noch Hunderte Meter weiter um ihr Leben.
Weil wir alle wussten, dass der König in Wirklichkeit harmlos war, mussten wir in der großen Runde darüber lachen und konnten auch lange nicht aufhören. Noch heute, 20 Jahre später, begegne ich dem König vom Sudan oft auf den Straßen Wiens. Er sieht fast unverändert aus, nur etwas heruntergekommener. Überhaupt ist es phänomenal, wie gut sich so stadtbekannte Verrückte oft halten. König Mao erkennt mich meistens sofort, fragt mich dann, wo Sarah ist. Ich antworte ihm, dass sie jetzt drei Kinder hat und er fragt, ob ich auch Mutter geworden sei, weil ich so viel dicker wäre als früher.
Nach der Action mit der Parkbank ging ich zur öffentlichen Toilette. Am Rückweg sprach mich ein älterer, verdrehter Mann im Rollstuhl an. Zusammengeknautscht stand er am Rand der Wiese und rief mich zu sich. Mit einem Hundeblick fragte er mich, ob ich nicht mit ihm reden könne, er sei so einsam. Ich dachte mir, okay, wieso nicht, und setzte mich neben ihn auf eine Bank.
Er fragte mich: «Kann ich mit dir über alles reden?»
«Ja klar, wenn du magst.»
«Auch über meine Gefühle?»
«Fix.»
«Auch über meine intimen Gefühle?»
«Äh … na ja. Muss nicht sein.»
Trotzdem begann er, mir von seinem sexuellen Elend zu erzählen, wie gerne er eine Frau hätte, und ich dachte mir: Okay, ich hör halt ein bisschen zu. Was soll’s. Dann streckte er seine knöcherne Hand nach mir aus. Er wollte mich streicheln, während er mich sehr direkt fragte: «Kannst du mir den Schwanz massieren?»
Angewidert sprang ich auf und meinte nur: «Ich kann dir echt nicht weiterhelfen.»
Zurück bei Sarah und den anderen in der Parkbankrunde, erzählte ich von meinem Erlebnis, was einen etwa 50-jährigen Typen, der in losen Abständen vorbeikam, nicht davon abhielt, mich auch noch anzumachen. Er meinte, er wolle mir unbedingt seine Wohnung zeigen, so ein schönes Schlafzimmer hätte ich noch nie gesehen. Die älteren Frauen in der Runde sagten ihm, er solle mich in Ruhe lassen. Ich konnte nur den Kopf schütteln. Nie wieder bin ich von so skurrilen alten Männern bedrängt worden wie mit 15. In keinem anderen Alter laden diese Männer häufiger uneingeladen ihren sexuellen Frust an einem ab wie als Teenagerin.
Hin und wieder zählte auch Doris zu unserem Kreis. Doris war eine mollige, junge Frau mit Kindergesicht und hellen, fettigen Haaren. Sie sprach alle Leute der Runde nacheinander an: «Magst du mich eh?» Dabei sprach sie mit zarter und leiser Stimme, wie ein kleines, verängstigtes Mädchen. Alle antworteten ihr bestärkend, dass sie eh lieb sei. Einmal hatte sie zwei Mäuse dabei. Sie zog sie aus ihrer schmutzigen Westentasche und zeigte sie uns. «Die habe ich auf der Straße gefunden. Die gehören jetzt mir.» Mit großen Augen strahlte sie uns an, ging wortlos weiter, und man konnte sich nur wundern, wohin.
K