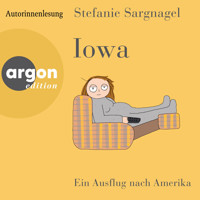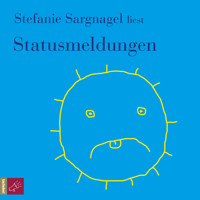9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 17,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 17,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
2022 tauscht Stefanie Sargnagel widerstrebend das bequeme Wiener Sofa gegen ein Flugticket in die USA ein. In Iowa soll sie an einem kleinen College mitten im Nirgendwo Kreatives Schreiben unterrichten. In der Kleinstadt mit 8000 Einwohnern gibt es außer endlosen Maisfeldern: nichts. Begleitet wird sie in der ersten Zeit von der Musiklegende Christiane Rösinger, gemeinsam machen sie sich auf, das Nichts zu erkunden. Sie finden schlechtes Essen, übergewichtige, freundliche Einheimische, Aasgeier und eine alte k.u.k.-Nostalgikerin. Einfach «die spezielle Elendskombi aus Einöde, Fastfood und Sonnenuntergängen hinter Tankstellen». Stefanie Sargnagels Blick auf die USA ist so einzigartig wie ihr Schreiben; kompromisslos, sarkastisch und schonungslos ehrlich berichtet sie in ihrem typischen Sound über die amerikanische Einöde des Midwest und über die Lebensnotwendigkeit von Freundschaften.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 379
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Stefanie Sargnagel
Iowa
Ein Ausflug nach Amerika
Mit korrigierenden Fußnoten von Christiane Rösinger
Über dieses Buch
2022 tauscht Stefanie Sargnagel widerstrebend das bequeme Wiener Sofa gegen ein Flugticket in die USA ein. In Iowa soll sie an einem College mitten im Nirgendwo Creative Writing unterrichten. In der Kleinstadt Grinnell mit ihren 8000 Einwohnern gibt es außer endlosen Maisfeldern: nichts. Mit von der Partie ist Musiklegende Christiane Rösinger, und gemeinsam machen die beiden sich auf, das Nichts zu erkunden. Sie finden übergewichtige freundliche Einheimische, traditionelle Geschlechterrollen, Riesensupermärkte, unglaubliche Würstchen und ein Glas voller eingelegter Truthahnmägen.
Stefanie Sargnagels Blick auf die USA ist so unverwechselbar wie ihr Schreiben: Sarkastisch, schonungslos ehrlich und doch voll Sympathie bringt sie uns das ländliche Amerika nahe und berichtet nebenbei herzerwärmend über die Lebensnotwendigkeit von Frauenfreundschaften.
Vita
Stefanie Sargnagel, geb. 1986, studierte in der von Daniel Richter angeleiteten Klasse der Akademie der bildenden Künste Wien Malerei, verbrachte aber mehr Zeit bei ihrem Brotjob im Callcenter, denn: «Immer wenn mein Professor Daniel Richter auf Kunststudentenpartys auftaucht, verhalten sich plötzlich alle so, als würde Gott zu seinen Jüngern sprechen. Ich weiß nie, wie ich damit umgehen soll, weil ich ja Gott bin.» Seit 2016 ist sie freie Autorin – und verbringt seitdem mehr Zeit bei ihrem Steuerberater. Sie erhielt den BKS-Bank-Publikumspreis beim Wettbewerb zum Ingeborg-Bachmann-Preis 2016. Ihre beiden Bücher Statusmeldungen und Dicht waren Bestseller, Statusmeldungen wurde für das Kino verfilmt.
Impressum
Veröffentlicht im Rowohlt Verlag, Hamburg, Januar 2024
Copyright © 2024 by Rowohlt Verlag GmbH, Hamburg
Foto © Apollonia Theresa Bitzan
Covergestaltung Cordula Schmidt Design, Hamburg, nach einem Entwurf von Anzinger und Rasp, München
Coverabbildung Stefanie Sargnagel
ISBN 978-3-644-01578-4
Schrift Droid Serif Copyright © 2007 by Google Corporation
Schrift Open Sans Copyright © by Steve Matteson, Ascender Corp
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Alle angegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf die Printausgabe.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
www.rowohlt.de
Ich hab das Plumpsklo renoviert. Jetzt macht es richtig Spaß draufzugehen, schreibt Christiane per Whatsapp-Nachricht. Ein Besuch ihres Kleingartens ist geplant, eine Siedlung am Rande Berlins, in Pankow.
«Da gibt’s keine Hipster, und du musst mir beim Kirschenernten helfen», hat sie neulich angekündigt. «Kannst du auf Bäume klettern?»
«Nicht besonders gut, aber ich werd’s probieren.»
Christiane baut Kartoffeln und Erbsen an, rote Rüben, Zucchini, auch Möhren und Bohnen. «Das wird dich als Stadtkind sicherlich überfordern, kein Internet. Und duschen musst du mit dem Gartenschlauch.» Keine Gelegenheit lässt sie aus, um mir die Rolle des verweichlichten Millennials überzustülpen. Dabei war ich als Kind viel am Land, ich kenne das bäuerliche Leben. Wochenlang wurde ich damals bei Verwandten am Hof abgegeben, das hat an meinem Körper epigenetische Spuren hinterlassen; durch niedrigen Wuchs und starke Beine ist er perfekt an die Kartoffelernte angepasst. Nur meine zierlichen Künstlerhände sind für die Arbeit am Feld ungeeignet.
«Ihr jungen Leute seid so überpflegt, ihr duscht ja viermal pro Tag.» Dabei muss man laut Christiane überhaupt nicht jeden Tag unter die Dusche.[1] Früher habe man das auch nicht gemacht, das Grobe könne man einfach mit dem Waschlappen abmachen.
«Blödsinn», verteidige ich mich vehement. «Ich bin doch voll der Straßenhippie. Ich war oft wildcampen und Auto stoppen und mag ja Wagenplätze und so einen Scheiß. Von mir aus brauchen wir uns überhaupt nicht zu waschen, wir können gern einen Wettbewerb machen, wer mehr verwahrlost. Wer den härteren Filz im Intimbereich bildet.»
Das ist ihr wiederum zu eklig. «Ihr Österreicher seid immer gleich so arg. Das mag ich ja an euch, das Abgründige, aber ihr wisst auch nie, wann es zu unappetitlich wird.» Dass sie jeden zweiten Satz zerlegt, den man von sich gibt, muss man tapfer aushalten; man muss sie zu schätzen wissen, diese Ehrlichkeit, die nichts beschönigt. «Ich geb mir eh Mühe, lieblich-woke zu sein», sagt sie, aber auf harmoniesüchtige Unaufrichtigkeit braucht man bei ihr nicht hoffen.
Es gibt einiges zu besprechen im Garten. Ich soll in Christianes neuem Theaterstück mitspielen. «Deine Rolle ist nur ganz klein, dann musst du nicht für die kompletten Proben in Berlin sein, außerdem kommen mehr Leute, wenn du auf Instagram die ganze Zeit Stories machst. Stories. Stories. Stories.» Die Unterstellung, ich sei socialmediageschädigt und handysüchtig, akzeptiere ich. «Ich hab noch nie jemanden getroffen, der so viele Stories macht.»
Wir fahren vom Ostbahnhof los, da holt sie mich immer ab. Es ist ein Wochentag im Sommer, und die Berliner lungern im öffentlichen Raum herum. Schon vor zwanzig Jahren habe ich mich gefragt, wie die sich das alle leisten können, dabei war es damals viel einfacher, in den Tag zu leben, eine billige Wohnung zu haben und Sterni um einen Euro zu trinken. Wenn Christiane nach Wien kommt, hole ich sie auch immer gerne ab, da fühlt sie sich wohl verpflichtet. Das Leben als Auftrittskünstlerin, das wir beide führen, birgt neben dem ganzen Glamour auch Einsamkeit, da ist es aufmunternd, wenn man beim Unterwegssein auch mal abgeholt wird. Besonders nach erfolgreichen Touren, wenn man sich wochenlang im Publikumsapplaus gesuhlt hat, ist es niederschmetternd, wenn am Heimatbahnhof keiner wartet und man vom Popstar-Olymp direkt auf den Boden der privaten Probleme platscht. Die mit den normalen Berufen haben keine Zeit für einen, da müssen eben wir Künstlerinnen zusammenhalten. It’s lonely at the top. Top bedeutet in unserem Fall zwar keine ausverkauften Stadien, sondern eher Publikumszahlen zwischen 100 und 500, ein Spartenpublikum aus einkommensschwachen Intellektuellen, Feministinnen, Hipstern und Punks. Marktwirtschaftlich orientierte Stimmen würden sagen: Nischenkünstlerinnen. Aber wir wollen den Mainstream ja gar nicht, wenn er uns nicht will. Eine Haltung, die mich an einen meiner Lieblingssongs von Christiane erinnert: «Mein Freund hat mit mir Schluss gemacht, ich kann ihn nicht mehr leiden.»
Als ich gerade aus der Apotheke am Bahnhof komme, schallt es mir schon entgegen: «Hallo! Was ist denn das für ein Sexbombenlook? So kenn ich dich gar nicht. Machst du jetzt einen auf Hot Goth Girl?»
Weil es über dreißig Grad hat, trage ich Shorts und ein schwarzes T-Shirt. Meint sie das ernst oder macht sie sich über mich lustig? Verstohlen schaue ich auf mein Spiegelbild in der Glastür. Ein sexy Hexi? Ich betrachte meinen Hintern. Seit zehn Jahren wird Arschfett in der Popwelt immer positiver konnotiert, weshalb ich wie viele andere Frauen auch mehr Zuneigung gegenüber meinem eigenen Zellgewebe entwickelt habe. Man ist viel beeinflussbarer, als es die Würde erlaubt. Leider bin ich zu sehr Ästhetin, als dass es mir entgangen wäre, dass es in Wirklichkeit nicht um dicke Hintern an sich geht, sondern um das Verhältnis zur Taille. Das Fett ist nur an wenigen Stellen erlaubt.
«Ich hab noch Mückenspray gekauft», sage ich.
«So was brauchst du nicht, gegen die Mücken können wir ein großes Feuer machen.»
«Ich liebe Feuermachen!»
Wie zwei Kinder vor dem Pfadfinderlager. Zwei Lausbuben. Vor dem Bahnhof steht ihr blauer VW-Bus breit im Halteverbot und ich soll schnell einsteigen. Christiane startet die Zündung, ein heiseres Geräusch, der Motor brummt, die Karosserie rumpelt. Ein richtiges Auto, ohne Automatik, Neunziger-Jahre-Autogeruch, die Kette am Rückspiegel peitscht wild durch die Gegend. Der Tour-Bus einer Punkerin. Vor mir auf dem Armaturenbrett liegen die Badehose des Enkels und schokoladenverklebtes Cornettopapier. Quietschend kurbelt Christiane die Fensterscheibe hinunter und befiehlt mir, es ebenfalls zu tun. Ein Gefühl aus der Kindheit.
«Ich hab total die Sommerdepression», sagt sie. «Grad erst die Frühjahrsmüdigkeit überwunden, und jetzt bei dem Wetter lieg ich nur zu Hause rum und hab nicht die geringste Lust, an dem Theaterstück zu schreiben. So eine drückende Hitze.» Es ist tatsächlich sehr heiß. «Ein Unterhaltungsprogramm habe ich mir jetzt nicht überlegt, weil du ja meintest, du müsstest schreiben. Aber wie ich dich kenn, schreibst du keinen einzigen Satz und kuckst nur auf dein Handy.» Sie bremst knapp für eine Radfahrerin. «Ich will ja auch nicht, dass du jetzt glaubst, ich wäre total die alte, langweilige Frau, die nichts mehr unternimmt. Wir können auch die ganze Nacht ausgehen in die angesagtesten Bars.»
«Ach, ich will echt am liebsten im Garten herumsitzen und schwimmen gehen. Schrebergarten ist grad perfekt für meine Bedürfnisse.»
Christiane ist 62, auch wenn sie darauf besteht, dass sie wie 54 aussieht.[2] Ich bin 37, fühle mich wie 16, trotzdem habe ich nur in Ausnahmefällen das Gefühl, ich hätte es mit jemand Älterem zu tun. In kurzen Momenten etwa, wenn sie kulturpessimistische Anfälle bekommt, bezüglich Wassertrinken zum Beispiel. Ich nehme einen Schluck Wasser aus meiner Trinkflasche, und schon heißt es: «Immer Wasser trinken. Es ist wie eine Religion für eure Generation. Das haben die Supermodels in den Neunzigern eingeführt. Die haben in den Interviews ständig gesagt: Mein Geheimnis? Viel Wasser trinken. Darauf seid ihr reingefallen.» Ich stecke die Flasche wieder ein. «Seitdem giltst du als total selbstzerstörerisch, wenn du nicht dauernd an der Wasserflasche hängst. Früher hat niemand Wasser getrunken, und wir waren nie durstig.» Da hilft es auch nicht, zu argumentieren, dass Menschen Wasser trinken müssen, um zu überleben, dass Wasser die Grundlage unseres Organismus ist und dass es laut App 32 Grad hat (Apphörigkeit!). In Christianes Anwesenheit wird Wassertrinken zu einer Unterwerfung unter Modetrends. «Einmal waren wir mit den Flüchtlingen, denen ich Deutschkurse gebe, nachmittags im Park, und meine Kollegin hat alle ermahnt, auch ja wirklich genug Wasser mitzunehmen. Mindestens zwei Liter. Verstehste? Voll maternalistisch. Da sind die wochenlang durch Subsahara und die Sahara gelaufen, aber auf dem Weg zum Görlitzer Park werden sie dann verdursten.» Sie kurvt wild durch Kreuzberg und deutet hierhin und dorthin. «Die Markthalle 9, das ist das Allerschlimmste. Da geht man einfach rein, um das Zehnfache für Essen zu bezahlen wie zwanzig Meter weiter. Das ist das degenerierteste Gebäude von ganz Kreuzberg, der Gentrifizierungsmotor für die ganze Gegend.»
So wie ich die Königin von Wien bin, denke ich mir, ist Christiane die Königin von Berlin. Wir sind die Royals, die Speerspitze feministischer Kunst. Während sie beim Nörgeln also durchaus mal alt wirkt, verwandelt sie sich im nächsten Moment wieder in ein Kind. «Ach, kuck mal, da, das ist Dimitri», sagt sie, als ein Mann mit weißen Haaren gerade gemütlich den Zebrastreifen überquert. «Ich bleib mal kurz stehen.» Sie bremst mitten auf der Kreuzung. «Die hinter mir werden sich ärgern. Hehe.» Die Fahrerin hinter ihr hupt und überholt sie schimpfend. «Ach, die Alte soll sich nicht so anstellen.»
Der Mann bleibt stehen, lehnt sich mit dem Arm entspannt ans Auto, und die beiden führen durch das Fenster ein kurzes Update durch. Wo sie waren, was sie vorhaben und dass man sich doch mal auf einen Kaffee treffen könne, «wie alte Leute das eben so tun». In jeder anderen Stadt wäre dieser Mann Pensionist, vielleicht ein Beamter in Rente, der gerne in der Pfalz wandert und historische Romane liest. Aber wir sind in Berlin, und der 69-Jährige ist natürlich eine Techno-Legende und Besitzer eines Clubs. Dimitri wirft ein paar eloquente Witzchen ins Fenster, er weiß, wie man flirtet. Dann geht die Fahrt weiter. «Der ist voll oft in Detroit wegen seiner Technoschule dort. Als wir beide in Iowa waren, war er gerade auf Fastenkur in Kalifornien. Das habe ich dir ja damals erzählt.»
Damals in Iowa, das liegt jetzt tatsächlich schon ein Jahr zurück. «Dimitri ist der erste Mensch, den ich in Berlin kennengelernt habe, vor fast vierzig Jahren. Wir waren sogar kurz zusammen, und gleichzeitig war Almut mit ihm zusammen.» Sie meint Almut Klotz, mit der sie in den Achtzigern ihre erste Band gegründet hat, die Lassie Singers, eine der ersten Indiegruppen mit reiner Frauenbesetzung. Eine prägende Band für mich, für die ganze deutschsprachige Szene. Jetzt suchen wir aber erst mal einen Parkplatz. Dass es immer weniger davon gibt, daran sind laut Christiane die Grünen schuld. Hauptsache überall Restaurants.
«Der hat jetzt echt ausgesehen wie 69, oder? Voll verrückt.» Als sie einander kennenlernten, erzählt sie, war Berlin ja noch total roh, verzweifelt und düster. Mittendrin stand die Mauer, und es gab noch den Schießbefehl bei versuchter Republikflucht. Da seien nur die wirklich argen Leute in die Stadt gezogen, die, die dem Desolaten etwas abgewinnen konnten, nicht wie jetzt, wo alles schon aufbereitet ist für die Kreativen. Wohnungsnot gab’s allerdings auch damals schon, aber nicht so wie jetzt, wo man sich Wohnen nicht mehr leisten kann, während Immobilienkonzerne Rekordgewinne einfahren. «Aber was erzähl ich dir, du bist ja selber Eigentumswohnungsbesitzerin.»
Scham. Seit ich eine kleine Eigentumswohnung kaufen konnte, bin ich zu meinem eigenen Feindbild aufgestiegen. Ein Klassenfeind. Wenigstens habe ich nicht geerbt. Leute, die Wohnungen erben, denken ja oft, sie seien Prekariat. Sie wollen gemeinsam übers Künstlerprekariat klagen, vergessen dabei aber immer ihren Besitz, der für arbeitende Menschen auch in zwei Leben nicht erwirtschaftbar wäre. «In Berlin hätte ich mir eh keine leisten können», verteidige ich mich lahm. Christiane ist mit Anfang zwanzig als alleinerziehende Mutter in die Stadt gekommen, zum Studieren, direkt vom Land geflüchtet, mit Aussicht auf Bafög statt ihrem Job als Buchhändlerin.
«War das nicht voll schwer, so früh ein Kind zu haben?»
«Ach, ich dachte, wenn ich ein Kind bekomm, dann muss ich wenigstens nicht mehr arbeiten gehen, aber Steffi, meine Biografie schreib ich schon selber.»
Abitur hat Christiane auf dem Abendgymnasium gemacht. Ich war auch auf der Abendschule, nur dass ich nie abgeschlossen habe.[3] Dann die Kunstuni, ebenfalls abgebrochen.
Erster Halt: Eiscafé. Ein Päuschen, bevor wir das Gepäck in ihre Kreuzberger Wohnung tragen. Da wohnt sie seit dreißig Jahren. Ein doppelter Espresso für mich, Vanilleeis für Christiane. Wie in Berliner Szenevierteln üblich sitzen lauter Eltern mit Kindern im Eiscafé. Man richtet sich ein, schaut sich um, dann knüpft man an den aktuellen Gossip an.
«Diese Rammsteinsache macht mich total wütend, besonders der Blödsinn, den man von Leuten lesen muss, die man kennt.»
«Ja, das geht eh allen Frauen um mich herum so. Das nimmt alle mit, weil ja jede solche Geschichten kennt. Ich hab aufgehört, irgendwas dazu zu lesen, weil’s mich nur aufwühlt.»
«Mir geht es besonders nahe, weil das meine Branche ist als Musikerin, weißte, und die leben ja auch in Berlin, die kennt man ja über Ecken, und klar, alle von uns haben so was ja schon mal mitbekommen.» Aus Christianes Rucksack rinnt ein aufgeplatztes Joghurt. Die Kellnerin weist sie darauf hin, und wir beseitigen den Unfall. «Eine Freundin in meiner Jugend wurde beim Trampen vergewaltigt, und als sie Anzeige erstatten wollte, hat der Polizist eine Nadel und einen Faden vor ihr Gesicht gehalten. Er hat dann die Nadel so bewegt und erklärt: Sehen Sie, wenn die Nadel nicht will, geht der Faden auch nicht rein.»
«Als ich nach einer Vergewaltigung beim Autostoppen im Spital war, hatte ich beide Arme im Gips, und der Arzt hat mich gefragt, ob ich mir sicher sei, dass es ein Übergriff war.» Kurzes Schweigen. «In Wien sind nie so viele Kinder im Café.»
«Ja, das ist so typisch hier, dass die Kinder nach der Kita ein Eis bekommen. Früher hätten wir nicht jeden Tag ein Eis gekriegt, aber ich kling schon wieder wie so eine Trümmerfrau. Früher mussten wir uns das Eis verdienen.»
«Früher gab’s halt weniger Gelegenheiten für Genuss und Spaßhaben. Da war Hedonismus noch was Progressives, eine Verweigerung vor der Leistungsgesellschaft, und nicht eine Triebkraft des Konsumkapitalismus.»
«Berliner Kleinfamilien beim Eisessen würde ich jetzt nicht als entfesselten Hedonismus bezeichnen.» So ist Christiane. Hauptsache dagegen.
Ich lenke zurück aufs Thema. «Es ist ja umgekehrt gar nicht denkbar. Also wenn man das Geschlecht umdreht. Stell dir vor, wir würden das bei Veranstaltungen machen.» Wir sind in den letzten Jahren ein paarmal gemeinsam auf Tour gewesen. Unserer Show gaben wir den bescheidenen Namen Legends of Entertainment.
«Es gibt ja gar keine männlichen Groupies», wirft Christiane ein. «Das ist im heteronormativen Rollenverhältnis nicht vorgesehen.»
«Also wir würden dann auf Tour deinen Gitarristen Martin ins Publikum schicken, und der müsste dann die hübschesten und jüngsten Männer für später zusammensuchen. Er würde sagen: Na, wollt ihr Christiane und Steffi kennenlernen? Seid ihr wirklich große Fans? Und dann, wenn Denice ihren Auftritt hat, gehen wir schnell runter in die Leckbox.»
«Boah, wäre das eklig.»
«Ja, würde man einfach nicht machen, oder?»
«Würde vor allem nicht funktionieren.»
«Gut, dass es nicht funktionieren würde. Das schützt uns vor uns selbst.» Auf uns warten keine jüngeren Männer vor der Halle. Talent macht Frauen für Männer nicht attraktiver. Talent erzeugt keine Blutzufuhr in Penissen, ein starker Charakter schreckt ab, die Frau muss dominierbar bleiben, um begehrenswert zu sein. Während daher Kunst von Männern immer auch von dem Wunsch angetrieben ist, sexuell begehrt zu werden, ist Kunst von heterosexuellen Frauen reine Kunst, pure Schöpfung, allein angetrieben durch den Genius. Man opfert sein ganzes Game für das Œuvre.
Denice, unsere Bühnenkollegin und die dritte Künstlerin der Legends of Entertainment, ist lesbisch und hat immer Groupies. Junge Frauen warten nach der Show auf sie mit großen Augen. Natürlich gibt es auch männliche Bewunderer, doch der männliche Bewunderer schickt dem Lob immer auch Verbesserungsvorschläge nach, quasi zur Wiederherstellung der geschlechtlichen Ordnung. Oder er stellt die Erniedrigung vorne an: Eigentlich fand ich dich immer scheiße, aber dieser Auftritt hat mir gefallen. Habe ich schon oft gehört. Es gibt auch männliche Bewunderung in Form von Stalkern, die einen in Angst versetzen und umbringen wollen. Aber Groupies im herkömmlichen Sinne, Groupies gibt es nicht.
«Ich glaube, weibliche Pornostars haben Groupies», werfe ich ein. Aber die sind ja auch für die eigene sexuelle Verfügbarkeit berühmt. «Oder diese Girlbands aus Korea.» Allerdings sind diese Frauen kaum volljährig, äußern keine Meinungen, und die älteren Männer wollen sie sammeln wie Puppen und in ihre Junggesellenwohnungen stellen.
Der Garten ist größer, als ich dachte. Christiane kommt mit Tablett aus der Laube und stellt mit den Worten «Ich bin die perfekte Hausfrau» geschnittene Melone, Kaffee und ein Kännchen mit aufgeschäumter Milch auf den Tisch. «Wie im Romantikhotel. Das hab ich extra schön angerichtet, damit du so eine Instagram-Story machen kannst. Dann glauben alle, ich bin total häuslich.»
«Bäckst du eigentlich etwas? Also mit den vielen Kirschen? Kirschkuchen oder so?»
«Spinnst du? So was würd ich nie tun.» Ich fotografiere den Tisch, und Christiane sagt nachdenklich: «Ich glaub, ich hab das immer so vehement als etwas Weibliches abgelehnt. Kuchen backen, das hätte ich niemals gemacht. Oder einem Mann einen Kaffee kochen, nie im Leben. Und dem dann den Kaffee so hinstellen wie dir? Niemals.»
«Ich muss dann echt viel schreiben hier», wechsle ich das Thema. «Ich find den Text bis jetzt so blöd.»
«In einem blöden Text will ich aber nicht vorkommen. Wenn der Text blöd wird, dann streich mich bitte raus.»
«Vielleicht kannst du mir helfen, die Erinnerungen an Iowa aufzufrischen.»
«Ich hab das längst alles verdrängt.»
Mit zwei großen Koffern stehe ich vorm McDonald’s am Flughafen München. Ich rauche und schaue erwartungsvoll auf die Rolltreppe, die die Leute vom Flughafenbahnhof hochbefördert. So richtig erkennen kann ich niemanden. Eine neue Brille, das war einer der Punkte auf meiner To-do-List, an denen ich gescheitert bin, neben Unterricht vorbereiten, Bücher über den Mittleren Westen lesen, alle Filme zum Thema anschauen, Führerschein machen, meinem Freund sagen, dass ich bald ein Kind will, weil die biologische Uhr tickt. Wenn die Zeit knapper wird, verliere ich das Gefühl für Prioritäten und ergehe mich tagelang in Nebensächlichem. Vielleicht sollte ich mir ADHS diagnostizieren lassen, das machen gerade alle Kreativen. Alle Begleiterscheinungen von Kreativität pathologisieren, um leistungssteigernde Medikamente auf Amphetaminbasis zu bekommen.
Meine Begleitung für die bevorstehende Reise müsste jeden Moment ankommen. Sie wird mich stabilisieren im Strudel neuartiger Erfahrungen und sie gemeinsam mit mir reflektieren. Früher wollte ich möglichst viel erleben, aber je älter ich werde, desto mehr versuche ich mich vor neuen Erfahrungen zu schützen. Die grenzgängerische Leidenschaft weicht immer mehr solider Bequemlichkeit.
Das ist sie jetzt aber. Ja, das ist sie. Schwarze Hose, offene Jacke, etwas zerzaust, sichtlich gestresst und mit einem iPhone in der Hand steuert sie auf mich zu. Ein Ladekabel baumelt ihr aus der Tasche, ein anderes Kabel hängt aus dem Koffer. Ich bin um fünf Uhr früh in Wien losgefahren, sie ist ungefähr zur gleichen Zeit in Berlin gestartet. Ein Treffen in der Mitte zum gemeinsamen Abflug, das ist fair. Gerechtigkeit ist Christiane wichtig. Mit dem typischen Christiane-Rösinger-Gang groovt sie mir entgegen, und ich schaue mich stolz um, ob auch alle sehen, dass die berühmte Sängerin aus Berlin auf mich (die berühmte Schriftstellerin) zukommt. Ich muss schon lachen, obwohl sie noch gar nichts gesagt hat.
Seit ich es als Künstlerin mit kurzen Texten im Internet zu Bekanntheit gebracht habe, konnte ich einige meiner Vorbilder persönlich kennenlernen. Viele Enttäuschungen. Die Männer meist alte Chauvinisten, die, wenn sie sich unbeobachtet wähnen, erklären, dass Frauen ja gar nicht lustig sein können. Außerdem waren sie, egal wie alt und vergreist, fast immer mit dreißig Jahre jüngeren Frauen zusammen, während sie aber nie Freundschaften mit dreißig Jahre jüngeren Menschen pflegten. Über manche war zu hören, sie würden Prostituierte in den Backstage bestellen, um sich nach Auftritten weniger einsam zu fühlen. Denn das männliche Leid ist schwer und universell und muss auf dem Rücken der Frauen ertragen werden. Moralische Entgleisungen sind mir zwar selbst nicht fremd, aber im Gegensatz zu mir schämten die sich zu wenig. Es verlangte auch niemand von ihnen, in Würde zu altern. Man erwartet es von den Frauen und meint damit, dass sie sich ab fünfzig in Luft auflösen sollen.
Christiane Rösinger jedenfalls hat mich nie enttäuscht, sondern meine Erwartungen übertroffen. Ich habe in den späten Neunzigern pubertiert und verehrte sie als Sängerin, Autorin und Entertainerin, ich saß im Kinderzimmer am Teppichboden vorm Radio, immer in der Hoffnung, dass auf FM4 eins ihrer Lieder gespielt würde. Es gab noch kein richtiges Internet, man war aufs Radio also angewiesen. Spielten sie «Die Pärchenlüge», «Die melancholische Kompanie» oder «Sinnlos», warf ich den Kassettenrecorder an und spielte die Lieder später meinen Freundinnen vor. Damals hat man nicht viel über Feminismus gesprochen, mir war gar nicht klar, dass man feministische Lieder schreiben kann; ich fand sie einfach rührend, lustig und anarchistisch. Der heitere Trübsinn, den sie verbreiteten, fühlte sich intuitiv richtig an.
Auch jetzt, während sie auf mich zugeht, strahlt sie eine Aura aus Ironie und Verdrossenheit aus, deshalb muss ich so lachen. Ich hebe die Fäuste über den Kopf und rufe ihr: «USA! USA! USA!» entgegen. Sie schüttelt den Kopf und antwortet verzweifelt: «Frau Sargnagel! Mein Akku ist fast leer. Ich hab aus Versehen die Stoppuhr gestellt seit acht Stunden. Ach Mensch, ich brauch doch den Impfpass, wie mache ich das bloß? Ich hab alles extra runtergeladen, und jetzt finde ich es nicht. Du musst mir helfen wie so einer verwirrten alten Frau!»
Ich habe aus Vorsicht alle Unterlagen und Informationen vorher ausgedruckt. «Wir finden das schon alles», sage ich wie eine Zivildienerin.
«Nein, das ist komplett weg, und das Handy geht auch nicht mehr.» Völlig überfordert sieht sie mich an. Das Ladegerät fällt zu Boden.
«Zur Not können wir das Handy doch bestimmt irgendwo laden», beruhige ich sie.
«Aber wo denn, wie soll das denn gehen?», ruft sie weinerlich. Ich hebe das Ladegerät auf und rede ihr weiter gut zu. Das fängt ja großartig an. Eine Stewardess am Schalter erklärt sich bereit, das iPhone kurz zu laden. «Am Morgen war es ganz voll!», rechtfertigt Christiane sich vor ihr. «Wirklich.»
Mit fünf Prozent Akku werden wir nach Amerika fliegen. Chicago. Dort müssen wir erst einmal umsteigen und eine Maschine nach Des Moines nehmen, das ist die Hauptstadt von Iowa. Iowa ist das Endziel. In Iowa werden wir gemeinsam leben, schaffen und uns entfalten. Im ländlichsten Staat der USA, der Kornkammer der Vereinigten Staaten, dem Zentrum der Mastschweinzucht. Über 90 Prozent Iowas sind landwirtschaftliche Flächen. Wir werden zusammen im Maisfeld stehen, Slipknot hören, einander zunicken und dann mit Waffen auf rostige Bohnendosen schießen.
Außerdem sollen wir unsere Kunst ein paar DeutschstudentInnen an einem privaten, linksliberalen Elitecollege vorführen. Um einen Eindruck von der Institution zu bekommen, habe ich mir in den Tagen zuvor Videos auf Youtube angeschaut. Die Uni hat einen eigenen Kanal, auf dem wöchentlich neue Filme online gestellt werden. StudentInnen berichten aus ihrem Alltag, zeigen, wie sie ihre Unterkünfte eingerichtet haben, und verleihen ihrer Hoffnung Ausdruck, dass dieses Studium ihr Leben prägen wird. Man identifiziert sich offenbar stark mit seinem College, wenn man hier studiert. Alle blicken optimistisch in die Zukunft, ein erfolgreicher Lebensweg ist vorgezeichnet.
Bei einer kurzen Kaffeepause vor dem Einchecken zeige ich Christiane die Videos am Handy. «Die wirken alle so wahnsinnig uninteressant», ruft sie sichtlich schockiert. «Wie so totale Streber.»
«Na ja, vielleicht interviewen sie nur die Streber. Sie werden ja jetzt nicht die abfilmen, die alles scheiße finden.»
«Hoffen wir mal.»
Am Check-in-Schalter geht ihr Handy wieder aus. Kurz droht alles zu eskalieren. «Ich schwöre, es war heute Morgen voll.»
«Wieso hast du’s nicht einfach ausgedruckt?», frage ich noch einmal ganz konstruktiv vorwurfsvoll.
«Das Ding war vor einer Stunde noch geladen.»
Am Ende steckt es ein Mitarbeiter wieder an, und wir finden auch die Dateien irgendwo in den Sofaritzen des Handys und können den Beweis erbringen, dass wir die Seuche nicht exportieren. Endlich können wir uns Richtung Gate bewegen. Jetzt kommen die Spritzen zur Thrombosevorbeugung. Ich habe das noch nie gemacht, aber Christiane hat noch eine übrig, die sie mir verschwörerisch zusteckt. Bei meinem Kettenrauchen vielleicht keine schlechte Idee, sagt sie. Das Rauchen könne ich mir überhaupt abgewöhnen. Sie würde jede Zigarette bereuen, die sie jemals geraucht hat.
«Aber du rauchst doch immer noch! Nach Auftritten!»
«Das ist ja was anderes», sagt sie. «Kuck, du musst jetzt einfach nur so eine Falte nehmen, hier am Bauch.» Sie zwickt durch den Pullover hindurch meine Schwarte. «Ah, siehste, is ja genug vorhanden bei dir, hahaha. Und dann drückst du’s einfach rein.»
Wir trennen uns, und im Klo injiziere ich mir mit Herzklopfen das Zeug, wie ein Junkie aus Angst vorm Entzug. Als alles drin ist, verdrehe ich die Augen und stöhne. Mein Blut verdünnt sich.
Die ersten Hürden haben wir also hinter uns, jetzt kann es nur noch einfacher werden. Die Euphorie kickt ein, ich strecke die Fäuste in die Luft und rufe wieder «USA, USA, USA!». Das ist ein Homer-Simpson-Zitat, Christiane erkennt es nicht. Sie denkt wahrscheinlich, das ist wieder was Österreichisches.
Ob diese Reise eine gute Entscheidung gewesen ist, weiß ich immer noch nicht. Ich schätze eben mittlerweile das Vertraute. Je stärker mein Schriftstellerinnendasein durch Touren und Lesungen geprägt ist, desto mehr sinkt im Privaten die Lust auf Ortswechsel. Ein warmes Nest, alte FreundInnen, regelmäßiges Krafttraining an der Langhantel, am Abend ein Nudeltopf und kuscheln, keine neuen Leute kennenlernen. Das sind mittlerweile die Eckpfeiler meines Lebens. «Ist der Freund erst auf dem Sofa, hilft kein Auto und kein Mofa», sagt Christiane dazu.
All das habe ich nun hinter mir gelassen für die wilden, unerforschten Weiten des Mittleren Westens, für Abenteuer und Risiko. Dabei bewerbe ich mich nie auf Aufenthaltsstipendien, wie sie für Künstlerinnen wie mich oft ausgeschrieben werden. Erstens, weil ich mit Ablehnung nicht umgehen kann. Zweitens klingt es in der Theorie gut: schreiben in einem Häuschen in der Toskana, kreativ werden in einem Mecklenburger Schloss, Stadtschreiberin von Wels sein, dichten im Ruhrpott. In der Praxis sind diese Wagnisse vor allem umständlich und einsam. Die neuen Eindrücke lenken einen sowieso vom Schreiben ab, oft wollen Mäzene und örtliche Kulturenthusiasten dann außerdem von der anwesenden Künstlerin mit snobistischen Gesprächen über die Bildungsferne unserer Zeit unterhalten werden wie von einer Art Hofnarr, dabei möchte man selbst eigentlich in die primitivste Kneipe und über arrogante Bildungsbürger herziehen und wie dümmlich sie den Wein beschnuppern. Ab Mitte dreißig hat man als Bohemienne auch nicht mehr das Rudel arbeitsscheuer Penner im Freundes- und Bekanntenkreis, das sich bereitwillig für ein paar Wochen miteinzeckt, egal wo, Hauptsache gratis. Die Gesellschaft hat sich auch bereits in die wüstesten Punks verzahnt, sie mit Terminen eingemauert, TherapeutInnen haben ihnen die Drogen ausgeredet. Vielleicht sollte man sich einfach jüngere Freunde suchen – auch eine Fähigkeit, die ich an Christiane bewundere. Aus einem Beisl voller Zwanzigjähriger ziehe ich mich mittlerweile respektvoll zurück, aus Angst, mich anzubiedern, eine Hängengebliebene zu sein. Christiane dagegen ist noch mit fünfzig mit der Zwanzigjährigen-Band «Ja, Panik» durch Deutschland getourt. Und von außen betrachtet ist das gar nicht merkwürdig. Das sollte man eigentlich genau so machen.
Im Flugzeug sitzen wir nicht nebeneinander. Wir ergeben uns den Entertainment-Optionen, die man am Bildschirm auswählen kann, in Europa noch nicht erschienene Filme, HBO-Serien. Ich bin noch nicht weit gereist in meinem Leben. Als mein Schwerpunkt Freizeit war, hatte ich kein Geld, und als es mit dem Geldverdienen anfing, hatte ich keine Freizeit. Das ist die gefinkelte Falle des Kapitalismus. Meine früheren Reiseziele lagen in Osteuropa, das war interessant, individualtouristisch und vor allem günstig. Wenn wir durch Albanien autostoppten und uns von Toastbrot ernährten, gaben wir weniger Geld aus als zu Hause. Und es waren alles Länder, in die man mit einem österreichischen Pass einfach so einreisen konnte. Das Visum für die Staaten beantragen zu müssen war für mich also eine neue Erfahrung. Wochenlang war ich mir daraufhin nicht sicher, ob das ganze Projekt nicht an meiner Bürokratieinkompetenz scheitern würde. Wenn ich ein Formular sehe, schlafe ich sofort ein, eine körperliche Reaktion, für die ich nichts kann. Und für die Einreise in die USA muss man online einen zwanzigseitigen Fragebogen ausfüllen, um überhaupt einen Termin am Konsulat zu bekommen. Hatte ich endlich und unter Aufbringung aller Kräfte zehn Seiten ausgefüllt, hängte sich die Webseite auf. Offenbar eine Zermürbungsmethode, denn nach einem halben Tag vorm Computer und nach dem vierten Ausfüllversuch ist man sich plötzlich nicht mehr sicher, ob man nicht doch ein Waffenschieber ist oder an einem Genozid beteiligt war.
In Wien bekommt man die endgültige Einreisegenehmigung für die USA nicht in der Botschaft, sondern in einem unauffälligen Hintergebäude eines großen Hotels, als würde man nicht in das mächtigste Land der westlichen Welt reisen, sondern in einen halblegalen Schurkenstaat. Als ich den schmucklosen Eingang in einem Zwischengeschoss endlich fand, stand dort eine Schlange bis in den Gang hinaus. Vor der Tür ist ein muskulöser GI stationiert. Stramm steht der Uniformmann vor der USA-Flagge. Hier beginnt schon die Fiktion, Anfangsszene eines Actionfilms, man erwartet den Alienangriff, die Zombies, den Russen. Wenn man sich falsch hinstellt oder den Aufzug blockiert, brüllt er einen im Befehlston zur Ordnung, und man antwortet: «SIR, YES, SIR!»
Aber irgendwie habe ich es doch hingekriegt, und nun sitze ich behördlich legitimiert im Flugzeug und schaue Serien. Nach einer Stunde schon kommt das erste Flugzeugessen, ein Highlight. Die dreieckigen Teller, die aussehen, als kämen sie aus Science-Fiction-Filmen der siebziger Jahre. Im Kopf gehe ich nun durch, wovor ich mich ab jetzt fürchten könnte. Auch nach Durchlaufen der Einreisebürokratie ergeben sich Möglichkeiten zum Scheitern.
Ich soll in einem College unterrichten, obwohl ich selbst nicht mal Abitur habe. Die Kunstuni, an der ich kurz gewesen bin, habe ich aus Prinzip nur betrunken betreten. Meine Annahme, man würde dort mit anarchistischen Geistern die Gesellschaft durchschütteln, wurde schnell durch die Kunstweltrealität enttäuscht, stattdessen überhebliche Richkids, die dabei konkurrierten, Dekorationsobjekte für gelangweilte Millionäre anzufertigen und ihr Bedürfnis nach Investitionsobjekten unterwürfig zu bedienen. Mein Ego war zu groß für die Erniedrigung, den Sammler zu umschwänzeln. Bevor ich bei Artist Dinners mit Adligen über Segelyachten rede, dachte ich mir damals, saufe ich mich lieber tot. Das war’s dann mit der Uni. Wie soll ich irgendwas glaubhaft unterrichten? Und kenne ich überhaupt die Codes amerikanischer Wokeness? Ich bin gerade mal woke genug für österreichische Linke. Darf ich fragen, aus welchen Ländern die StudentInnen kommen, oder geht es dann gleich zu einem psychologischen Beratungsgespräch bei der Antidiskriminierungsstelle? Muss ich nach Pronomen fragen? Oder ist es im Gegenteil anstößig, nach Pronomen zu fragen? Will ich mich überhaupt den vermuteten Verhaltenscodes intellektuell elitärer Milieus fügen oder nicht lieber die jungen Leute mit einer echten österreichischen Proletin konfrontieren? Möchte ich etwas bewegen? Und wenn ja, wohin? Möchte ich Diskussionen anregen oder abwürgen? In Wirklichkeit will ich schon eher eine ruhige Kugel schieben. War es eine gute Idee, die Antidepressiva vor so einer Reise abzusetzen? Die Psychiaterin hat es vorgeschlagen, ich sei mittlerweile langweilig genug, um als normal durchzugehen. Werde ich noch dicker werden?
Der Anflug auf Chicago beginnt. Draußen ist es dunkel. Nach der Landung treffen Christiane und ich uns beim Ausgang. Nun muss alles schnell gehen, damit wir den Umstieg in die andere Maschine schaffen. Aufgrund der Übermüdung fetzen mir alle Reize ungefiltert ins Köpfchen. Wahrscheinlich ein ADHS-Symptom. Irgendeine der tausend neuen Stimmen sagt, dass wir noch mal durch Sicherheitskontrollen müssen.
«Wie soll sich das denn ausgehen? Wo müssen wir hin?», sage ich weinerlich und verwundbar wie ein Baby. Christiane wird stärker durch meine Schwäche, da ergänzen wir uns gut. Entschlossen nimmt sie mich am Arm: «Jetzt beruhig dich mal, kuck mal, wir fragen jetzt einfach den netten Mann da.» Ein freundlicher Flughafenangestellter zeigt uns alle Wege. «Siehst du, ist doch alles kein Problem. Komm, jetzt bin ich deine Betreuerin.»
Eine Stunde später sitzen wir in einem Regionalflieger nach Iowa. So etwas habe ich noch nie gesehen. Ein kleines Flugzeug, klapprig wie ein alter Bus, der sich windschief durch die Wolken schiebt. Das Interieur wirkt wie aus den Achtzigern, die Gurte sind abgewetzt, die Sitze breit genug für vom landwirtschaftlichen Überfluss wohlgenährte Körper. Inlandsflüge sind hier seit Jahrzehnten selbstverständlich, die Leute hocken so entspannt da wie in der U-Bahn, die Atmosphäre ist heimelig wie auf einer durchgefurzten Couch. Christiane sitzt neben einem älteren Mann mit roter Knollennase und weißem Haar. Ein großväterlicher Professorentyp, der sie gleich fragt, woher sie kommt. «DSCHÖRMANI!», sagt sie fröhlich. Ich fühle mich nicht in der Lage, mit fremden Menschen zu sprechen. Small Talk ist wirklich nicht meine Stärke, im Umgang mit normalen Menschen beherrscht mich der Gedanke, vorspielen zu müssen, dass ich nicht gerade aus der Psychiatrie geflüchtet bin.
Christiane plaudert entspannt dahin, ihr liegt es eher, sie hat eben eine lockerere Art als ich. Der ältere Herr erklärt ihr gerade, dass unser Reiseziel mit seinem College für die Verhältnisse in Iowa «sophisticated» sei, ich vertiefe mich derweil in die Zeitschrift der Fluggesellschaft. Ein Zahninstitut in Texas wirbt für Porzellankronen, man sieht drei Damen mit Lockenstabfrisuren, die diese amerikanischen Zähne haben, mit denen man schon Mitte zwanzig so aussieht, als hätte man die Dritten drin. Auf der nächsten Seite ist ein attraktiver, älterer Mann im Arztkittel abgebildet. Einer der Top Doctors in Amerika, steht über seinem Kopf. Haartransplantationen sind sein Gebiet, aber auch Operationen an der Wirbelsäule, je nachdem. Als ich weiter umblättere, blickt mir ein noch besser aussehender Arzt entgegen. Er trägt Anzug und strahlt schmierig wie ein Autoverkäufer. Sein Gebiet ist die Neurochirurgie, er operiert in Michigan am offenen Gehirn; in den Händen hält er darum eins aus Plastik. Offenbar soll seine strahlende Erscheinung die KundInnen der Fluggesellschaft davon überzeugen, vielleicht doch einen Kredit für den Gehirntumor aufzunehmen.
Die nächsten Seiten sind weniger bemerkenswert, eine Urlaubsreportage aus der Toskana. Christiane beugt sich zu mir rüber, streckt den Hals umständlich zu meinem Heft und sagt demonstrativ interessiert: «Ach kuck, Italien, da war ich auch schon mal. Warst du da schon mal, Steffi?» Offenbar will sie doch aus dem Gespräch befreit werden. Im Vergleich mit den eigenen Defiziten wirken andere immer viel patenter und sicherer, aber soo kommunikativ ist sie dann doch nicht. «Nein, aber da soll es sehr schön sein», antworte ich und schaue sie ernst an. «Italien soll schön sein.»
«Mensch, war der anstrengend», sagt Christiane, als wir aus dem Flugzeug steigen. «So behäbig.»
«Ach so, ich dachte, du bist voll am Flirten.»
«Spinnst du?», ruft sie laut, «siehst du mich echt mit so jemandem? So einem weißhaarigen Opi? Der war ja mindestens siebzig!»
«Na und, du bist doch auch sechzig?»
«Ja, aber ich wirke viel jünger.»[4]
«Ich hätte mir das gut vorstellen können.»
«Igitt.»
Der Flughafen von Des Moines ist winzig und riecht nach Flohmarkt. An den Wänden hängen Bilder von Kriegsveteranen, die im Irak oder in Afghanistan gefallen sind, dekoriert mit Plastikblumen. Von der Hektik Chicagos ist hier nichts mehr zu spüren. Die Menschen bewegen sich langsam, weil sie Wurzeln haben, tief ins Leben hinein, sie tragen Baseballkappen und weite Pullover. Die Decken sind niedrig, die Farben trüb. Über die Realität legt sich ab jetzt ein beige-bräunlicher Schleier. Das hier ist der vergilbte Teil der USA.
Draußen vor dem Flughafen ist die Nacht angebrochen, aber da steht ein weiß leuchtender Wagen mit der Aufschrift GRINNELL COLLEGE. Er hat auf uns gewartet, und wir steigen benommen ein.
Plötzlich im Land der Geschichten, eingestiegen in den Fernseher, in alle Erinnerungen an TV-Momente meiner Kindheit, die so echt sind wie Erinnerungen an Selbsterlebtes. Man kennt jedes Detail, allem haftet Magie an. Ich dränge Christiane, vorne zu sitzen, weil ich mich nicht unterhalten will. Seit ich stundenlang auf Bühnen spreche, bin ich privat schüchtern, eine eigenartige Wechselwirkung. Christiane wehrt sich kurz und versucht, mich nach vorne zu bugsieren, aber ich schiebe sie einfach an die Beifahrertür, ich bin kräftiger vom Gewichteheben der letzten Monate. «Du plauderst doch so gerne.» Ich spüre, wie sie nachgibt und schließlich vor meiner Muskelmasse kapituliert.
Der Fahrer ist um die sechzig und heißt Bob. Nachdem wir uns ebenfalls vorgestellt haben, beginnt er zu erzählen: Für ein kleines Trinkgeld übernimmt er in seiner Freizeit derartige Fahrjobs für das College. So hat er Gelegenheit, interessante Leute zu treffen, sagt er. Letztens erst habe er einen Nobelpreisträger gefahren. Deutschland kenne er gut, ja, da war er mal. Mit der Army, ein Jahr, in Heidelberg. Das ist die Gegend, aus der Christiane ursprünglich kommt. Super, haben sie schon mal ein Thema. Gut, dass sie vorne sitzt. Das Thema Heidelberg ist allerdings nach wenigen Minuten erschöpft. Der Fahrer interessiert sich weniger für regionale Besonderheiten und mehr für Hummelfiguren. Christiane wird mir später erklären, dass es sich dabei um kitschige Kleinplastiken aus Porzellan handelt, von denen die Amerikaner besessen seien. Sehnsuchtsobjekte aus der alten Welt, ursprünglich hat sie eine künstlerisch begabte Franziskaner-Ordensschwester namens Berta Hummel erfunden. Nach ihren Zeichnungen spielender Kinder wurden die Figürchen gestaltet und bald in großen Stückzahlen in die USA importiert, Soldaten brachten sie als Mitbringsel für die Liebsten nach Hause. Pausbäckige kleine Kinder, die mit Spatzen oder Rehlein spielen, unschuldige Szenen einer friedvollen Welt. So reaktionär, wie einem das vorkommt; unter den Nazis waren die verträumten, pummeligen Figuren sofort als entartete Körper klassifiziert. Man sah in ihnen fette Weicheier, dem Ideal strammer, kruppstahlharter Knaben und Mädel widersprechend, die statt dem Exerzieren nichtsnutzig auf die Blumenwiese schielten. Die verträumte Kindlichkeit war dem Faschismus suspekt, die Amerikaner aber lieben sie. Bei großen Hummelfiguren-Tauschtreffen kommen in den USA Tausende Menschen zusammen und erfreuen sich an ihrem gemeinsamen Hobby. Auf deutsch-amerikanischen Volksfesten gibt es sogar regelmäßig Hummel Lookalike Contests. Die niedlichsten Kinder werden in selbstgenähte Trachten gesteckt und mit Weidenkörbchen vor gemalte deutsche Berglandschaften gestellt.
Für unseren Fahrer sind Deutsche daher in erster Linie mögliche Connections, um an den heißen Hummelstoff zu kommen, das vermittelt er deutlich. Bevor er weiter erörtern kann, ob Christiane nicht zufällig was dabeihätte, wechseln wir das Thema und befragen ihn zur Universität.
«Ja, da sind viele schlaue Köpfe. Junge, intelligente Menschen. Die lernen viel und arbeiten hart. Haben das ganze Leben vor sich.» Ganz unkritisch sieht er das aber nicht. «Ich bin ein Liberaler, deshalb arbeite ich gern fürs College, aber man muss auch sagen, diese jungen Leute denken, die ganze Welt dreht sich um sie.»
«Genau wie du», sagt Christiane nach hinten gerichtet.
Draußen zieht Iowa an uns vorbei, in der Dunkelheit erkennt man allerdings nicht viel. Rote Windräderlichter blinken am Horizont und scheinen auf und ab zu hüpfen. Die Fast-Food-Kettenrestaurants am Wegrand sind dagegen unbeleuchtet, die Straßen kaum befahren. Alles ist still, es ist, als flögen wir durch ein Vakuum.
«Braucht ihr noch was von der Tankstelle?», fragt Bob. Ich habe schon wieder ein bisschen Hunger. Wir halten, Christiane bleibt mit dem Fahrer im Auto.
Neue Welt. Meine ersten Schritte in der freien Wildbahn. Die Schiebetüren öffnen sich, und vor mir tut sich das Amerika auf, von dem ich immer geträumt habe. Eine psychedelisch grelle Farblandschaft, alle Simpsons-Folgen auf einmal. Ich erblicke zwanzig verschiedene Getränkespender, sogenannte «Fountains». Die kleinsten Becher fassen einen Liter, die größten vier, spektakulär. Ich bin die Protagonistin aller tragischen Indie-Movies über eine verlorene Kleinstadtjugend. Am Schalter arbeitet passenderweise ein Mädchen, das die Augen mit schwarzem Kajal untermalt hat, die Stirnfransen sind grün gefärbt, sie trägt ein Metal-T-Shirt und strahlt bedeutungsvolle Zukunftslosigkeit aus. Sie ist die Protagonistin, ich bin nur Zuschauerin. Ihre Grunge-Band wird die Welt erobern, drogentot mit 24. Ich lächle sie an, während ich immer noch im Eingang stehe und die Schiebetür immer wieder aufgeht. Kurz muss ich mich sammeln und wieder in Erinnerung rufen, dass das echte Menschen sind und dies ihr echter Alltag ist, dass sie niemand als Kulisse vor mir aufgebaut hat. Ich muss jetzt etwas zu essen holen oder zumindest so tun.
In der Mitte des Raumes sind nebeneinander drei Stände mit Wärmeplatten aufgebaut, auf denen sich Tausende kleine Würstchen unterschiedlicher Form und Struktur drehen. Pork Dog, Vegetable Eggroll, Ranchero Steak and Cheese, Monterey Jack Chicken, Cheesy Buffalo Ranch Chicken, Chicken Caesar, Cheddar Wurst Smoked Sausage.
Endlose Variationen von Hot Dogs scheinen sich hier seit Jahren im Eigenfett zu wälzen, Kruste um Kruste aufzubauen wie Panzer gegen Verderblichkeit. Ich schaue zu, schaue, wie sich alles dreht, und weiß nicht mehr, wie lange mich die Würste hypnotisiert haben, die anderen müssen sich schon Sorgen machen. Auf einem Schild steht: All I Care About is Hunting and Like 3 Other People. Das Grungemädchen schaut mich skeptisch an. Sammeln, normal bleiben. Ich entscheide mich für ein Turkey Sandwich, eingeschweißt, es kostet sieben Dollar. Eine letzte Runde drehe ich noch. Das Mädchen kassiert und verabschiedet mich freundlich.
Mit aufgerissenen Augen steige ich wieder ins Auto. «Christiane, das war so großartig da drinnen, das war so surreal, es ist so ein Wahnsinn.»
«Steffi ist verrückt geworden», sagt Christiane.
Ich gebe ihr die Hälfte des Sandwiches, und durch die Dunkelheit des Mittleren Westens rollen wir weiter wie Tumbleweed.
Das Gebäude, vor dem wir schließlich parken und das unsere Heimat für die kommenden Wochen sein wird, ist ein gelbes Holzhaus mit zwei Stockwerken und einer Garage. Die Assistenzprofessorin, die uns eingeladen hat, winkt uns schon vom Eingang zu. Sie sieht jung aus, hat einen Nasenring und strahlend weiße Zähne. In der Küche hat sie drei Flaschen Wein und vier Dosen Bier bereitgestellt. Wir stoßen kurz mit ihr an und fallen bald im nächstbesten Bett in einen langen, tiefen Schlaf.
Am nächsten Morgen sind wir beide erstaunlich ausgeschlafen und reißen ungläubig die Augen auf. Iowa. Wäre es nicht so kalt, würde ein Vöglein zwitschern. Stattdessen eisige Luft auf der Veranda. Die Fenster lassen sich im gesamten Haus nicht öffnen. Nachdem wir uns einigermaßen orientiert haben, beginnen für Christiane und mich die Verhandlungen über die Schlafzimmer. Aber zuerst gehen wir das Haus ab. Es hat eine Küche, wie man sie genau so aus zahlreichen TV-Serien kennt, mit einem Ausgang zum Garten, wodurch sich in Verwechslungskomödien unwahrscheinliche Situationen ergeben. Unten ist ein großer Keller, in dem soll man sich im Falle eines Tornados verstecken.
«Ich hoffe, wir erleben auch wirklich einen echten Tornado», sage ich. «Das wär so cool!»
«Du wünschst dir für Instagram eine Naturkatastrophe.»
«Ich könnte eine Story machen, wo du so herumgewirbelt wirst.»
«So lustig ist das, glaub ich, gar nicht.»
Wir forschen weiter. Ein Wohnzimmer, ein Essbereich. Im oberen Stockwerk sind zwei Schlafzimmer und ein Bad. Unten gibt es den Master Bedroom mit Dusche. Ich biete Christiane das untere Zimmer an, aus Respekt. «Dann musst du nicht immer die Treppen hochsteigen.» Christiane ist entrüstet und besteht nun auf dem oberen Zimmer. Altersgemäßen Komfort lehnt sie meistens ab, und über Gebrechen jammert sie nur, wenn man sie sehr gut kennt, während ich mit Mitte dreißig gar nicht aufhören kann, über jede kleinste vorzeitige Alterserscheinung ausführlich Bericht zu erstatten. Außerdem, argumentiert sie, hätte sie oben ihre Ruhe, wenn wir vielleicht doch mal eine Party machen, die länger geht.
Das Haus befindet sich direkt am Collegegelände, das wir noch nicht genauer erkundet haben. Es gehörte zuvor einem Professorenehepaar, das es in seinem Testament für Gäste wie uns vermacht hat, die das intellektuelle Leben der Uni beflügeln sollen. Über dem Eingangsbereich hängt ein Portrait der beiden. Man sieht zwei Menschen in ihren Siebzigern, die sich an den Händen halten. In den freien halten sie Bücher mit Lederrücken. Es könnte die Bibel sein oder vielleicht Lexikonbände. Er trägt einen weißen Bart, sie einen Kurzhaarschnitt, sie lächeln einander zugewandt an, tiefes Vertrauen im Blick. «Die sehen aus wie Amish People.»
Unter dem Foto ist ein kleiner Text, demzufolge sich zwischen 1950 und 1980 StudentInnen vor dem Kamin der beiden versammelt hätten, um gemeinsam Latein- und Altgriechisch-Lesezirkel abzuhalten. Das habe allen viel Freude bereitet.
«Du hast ja eine Waage mitgenommen!», tönt es ungläubig aus meinem neuen Badezimmer. Aus Bequemlichkeit ist Christiane doch bei mir gegangen.
«Ja, ich hab oft eine dabei, wenn ich unterwegs bin.»
«Das find ich jetzt aber krass, dass du wirklich eine Waage mitnimmst.»