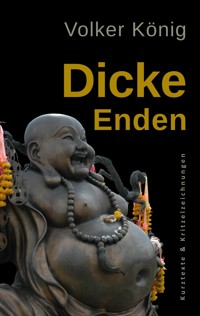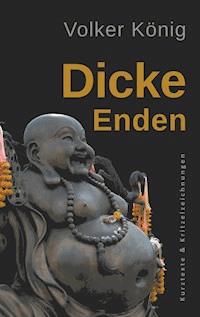
3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
"Einen Augenblick hatte die Welt ganz anders ausgesehen ... Tiefer, einfacher." Ein Adventskalender mit 358 Türchen, ein Prost! in die Weiten des Alls oder ein Pfirsich, der nach dem Sinn des Lebens sucht. Eine haarsträubende Sammlung aus Texten und Zeichnungen, der man gelassen entgegenblicken sollte.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 128
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Über den Autor:
Volker König wurde 1965 in Dortmund geboren und wuchs in Herdecke auf. Nach seinem Biologiestudium begann er zu schreiben. Bisher erschienen sind der Roman Tantenfieber, der Erzählband Dicke Enden, die Novelle Die Farbe des Kraken, die Erzählung VARN und der Roman In Zukunft Chillingham.
Er wunderte sich,
dass den Katzen gerade an der Stelle
zwei Löcher in den Pelz geschnitten wären,
wo sie die Augen hätten.
Georg Christoph Lichtenberg
Inhalt
358 Türchen
Kontakt
Messiaen
Das Wort
Vielleicht
Humpert
Filmriss
Kaugummi
Klang in der Leere
Mummenschanz
Rosy´s Helix
Ballade vom Pfirsich
Von der anderen Seite
Würgefeige
Fidschi
Im Blick des Auges
Gedenktag
Morgennot
Kirchgang
Tja
Triebtäter
Unterhalb
Einer reicht nicht
Mutabor
Vierteltöne
Blau
358 Türchen
Gleichmütig lächelnd stand Herr Piefke mit Zwiebelnetz und Senfglas in der Kassenschlange seines Supermarktes und ließ seinen Blick über emsige Kassiererinnen, nervöse Kunden und quengelnde Kinder schweifen, bis der an einem Haufen Adventskalendern haften blieb. Bald war Weihnachten! Die einst mit dem Öffnen der Türchen verbundene Aufregung durchflutete ihn mit einem Mal, und als sie etwas verebbte, erkannte er, dass er wohl nicht der Einzige zu sein schien, der mit diesem einfachen Gegenstand eine vorfreudige Stimmung verband. Gerade eben hatte wieder jemand einen Kalender mit kindlichem Lächeln an sich genommen. Wenn diese Vorfreude doch länger andauern würde, dachte Herr Piefke, als plötzlich in seinem Kopf eine geradezu ungeheuerliche Vorstellung entstand. Entschlossen griff er in den Haufen. Er brauchte ein Muster, denn er würde den ersten ganzjährigen Weihnachtskalender herstellen!
Zu Hause machte sich Herr Piefke sofort ans Werk. Der mitgebrachte Kalender inspirierte ihn zu zwei Varianten seiner Vision. Variante A sollte aus zwölf Steckmodulen über je einen Monat bestehen, die zusammen eine etwa 0,75 Quadratmeter große Weihnachtskalenderfläche ergaben. Hinter jeder der 358 Türchen, also vom 1. Januar bis zum 24. Dezember, sollte eine Schokoladenfigur warten, die saisonbedingt beispielsweise im Frühling ein Krokus oder im Sommer ein Sonnenschirm war. Die Variante B hingegen sollte vor allen Dingen Käufern mit kleinen Räumlichkeiten die Möglichkeit einer Installation dieses außergewöhnlichen Kalenders bieten. Dazu erdachte sich Piefke einen fünfzehn Zentimeter langen Wandhaken, an den die zwölf Steckmodule hintereinander gehängt werden konnten. Nach abgeschlossener Planung kratzte Piefke mit der Überzeugung, der Menschheit einen eigentlich unbezahlbaren Dienst zu erweisen, sein gesamtes Vermögen zusammen, leierte bei seiner Bank einen seine Erwartungen übertreffenden Kredit heraus und kaufte eine kleine Fabrik irgendwo in der Holsteinischen Schweiz.
Piefke hatte sich bereits im Vorfeld der Produktion zwar etwas von seiner Idee erhofft, aber als der Kalender nach einer angemessenen Werbestaffel schließlich an einem 1. Januar für gerade 9,95 Euro in den Läden erhältlich war, da sprengte die Resonanz seine kühnsten Erwartungen.
Menschen rotteten sich vor Supermärkten zusammen, manche übernachteten sogar vor den Türen, um als Erste einen Kalender zu erstehen. Kaum dass neue Kalender geliefert wurden, waren sie auch schon ausverkauft. Der Schwarzhandel blühte in diesen Zeiten des Engpasses. Eine Frau hatte die die astronomische Summe von 135 Euro gezahlt und war darauf sogar noch stolz. Selbst die schlimmsten Säufer kauften für einige Tage etwas weniger Schnaps, um das Geld für den Kalender zu sparen. Besonders Überzeugte waren der Meinung, dass auch die Toten dieser segensreichen Erfindung teilhaftig werden sollten, und so fand man die Variante B vereinzelt an Grabsteinen fest geschraubt.
Piefke selbst wurde in Talkshows herumgereicht, und auch die zynischsten Showmaster ließen es sich nicht nehmen, ihre Sympathie für Piefkes Projekt zu bekunden. Sicher gab es einige, die den Kalender mit Skepsis betrachteten, aber die hielten den Mund, denn zum einen wollten sie nicht ins Schussfeld der allgemeinen Meinung geraten, zum anderen mussten sie sich eingestehen, nur neidisch auf Piefkes Erfolg zu sein.
Bereits im März war die Fabrik der Nachfrage nicht mehr gewachsen, so dass vergrößert werden musste. Der kleine Ort in der Holsteinischen Schweiz entwickelte sich langsam zu einem Wallfahrtsort, worauf dort niemand vorbereitet gewesen war. Doch den findigen Bewohnern gelang es, den nahezu heiligen Glanz des Gegenstandes auf ganz gewöhnliche Dinge umzuleiten. Selbst die Steine des Zufahrtsweges zur Fabrik wurden fortgetragen, denn immerhin hatten die Lkws, bepackt mit Weihnachtskalendern, sie berührt. Eine Gruppe extremer Priester schlug Piefke schließlich als Anwärter für eine Heiligsprechung vor, aber so weit wollte man im Vatikan noch nicht gehen. Immerhin wäre das Unternehmen vordergründig rein kapitalistisch, wenn auch ein gewisser Bezug zu Glaubenssachen nicht abzustreiten sei. Aber ärgerlicherweise sei Piefke Protestant.
Man hätte meinen können, dass Piefke in seinem Büro im zwölften Stock seines neuen Verwaltungsgebäudes für immer ausgesorgt haben müsste. Aber eines Tages im Hochsommer, als er sich wieder vor der Panzerglasvitrine mit dem ersten gekauften Weihnachtskalender in seinem Ruhm aalte, sah er, wie sich die Pappe um den 15. Dezember herum erst ausbeulte und dann verfärbte. Ungläubig rieb er sich die Augen. Eine braune Masse quoll durch die Perforation der Papptürchen und wälzte sich langsam über die Weihnachtsmänner und rehgezogenen Schlitten. Dann breitete sie sich auf dem Samtkissen, auf dem der Kalender ruhte, aus. Piefke wurden die Knie weich. Die im Kalender enthaltene Schokolade hielt den Sommertemperaturen nicht stand.
Es hagelte zunächst nur Beschwerden, dann aber vor allem Rechnungen über verschmierte Wohnzimmerwände. War der Stein des Anstoßes erst nur die sich verflüssigende Schokolade gewesen, so wurden nun Kritiker mutig, die sich im Zuge der Euphorie nicht getraut hatten, ihre Meinung zu sagen. Reporter zogen durch das Land, um die Menschen nach ihrer Meinung zu befragen. Sehr viele wussten nun, warum der Piefke-Kalender nur 9,95 Euro gekostet hatte, denn sie sahen sich darin bestätigt, dass das, was nichts kostet, auch nichts taugt. Eine Gruppierung zur Rettung des Osterfestes wurde laut, denn der Piefke-Kalender hätte durch seine Konzeption das Weihnachtsfest so stark in den Vordergrund gerückt, dass andere Feste – speziell Ostern – völlig vernachlässigt worden seien. Wieder andere empfanden es plötzlich als langweilig, ein ganzes Jahr auf Weihnachten zu warten. Ganz spitzfindige meinten dagegen, dass von Ganzjährigkeit überhaupt nicht die Rede sein konnte, denn schließlich würden dafür exakt 7 – in Worten sieben – Tage fehlen, auch wenn es im Volksmund die Tage zwischen den Jahren gebe. Manche hatten sich auch über die Schokoladenfiguren hinter den Türen geärgert, und speziell eine alte Jungfer hatte die Darstellung eines Frosches mit der eines spärlich bekleideten Mannes verwechselt und geisterte seitdem verwirrt durch U-Bahn Schächte.
Die wahrscheinlich größte Katastrophe hatte der Ka-lender aber in Geheimdienstkreisen heraufbeschworen. Spezialisten hatten aus der vorgegebenen Anordnung der Schokoladenfiguren einen super geheimen Code entwickelt, der dort, wo der Kalender hing, zum Informationsaustausch der Agenten diente. Die sich auflösenden Figuren führten somit zu einem Informationsloch, das behelfsmäßig, und darum fehlerhaft, gestopft wurde und zu drastischen Missverständnissen führte. So war die Ermordung des Präsidenten einer Bananenrepublik schließlich nur auf ein derartiges Missverständnis zurückzuführen. Kommunistische Staaten empörten sich, kapitalistische Staaten versuch-ten zu vertuschen, bis die Zusammenhänge von einem renommierten Nachrichtenmagazin veröffentlicht wurden und die Situation entschärft werden konnte. Schließlich wäre ein Krieg durch einen schlecht gemachten Weihnachtskalender nicht zu rechtfertigen gewesen. Am Ende zogen die extremen Priester ihren Vorschlag zurück und wandelten ihn in einen Antrag auf Exkommunizierung Piefkes um, der aber aus denselben Gründen abgelehnt wurde wie der zuvor gestellte.
So kam es, dass Piefke sein gesamtes Vermögen für Wiedergutmachungen ausgeben musste. Zudem wurde sein Kalender verboten, und auch eine verbesserte Neuauflage wurde ihm nicht gestattet, weil man soziale, moralische und wirtschaftliche Unruhen befürchten musste. Piefke stand schließlich wieder genau dort, wo er angefangen hatte: in der Schlange vor der Kasse, mit einem Zwiebelnetz und einem Senfglas in der Hand, und stellte verbittert fest, dass die Grenze zwischen Heldentum und Schande wahrhaftig fließend sein kann.
Kontakt
„Sind Sie ein furchtsamer Mensch?“
Ich starre direkt in ein spitznasiges, schlecht rasiertes, tief zerfurchtes und groß grinsendes Gesicht unter einem seltsamen Hut, das mich mit seiner Frage aus meiner Lektüre herausgerissen hat.
„Nicht, dass ich wüsste“, stammele ich irritiert und zugleich in die Enge getrieben und blicke mich daher suchend um. Aber ich bin allein mit meinem Gegenüber an dieser verlassenen Bahnstation.
„Hervorragend“, sagt der Andere und tritt einen Schritt zurück. Er steckt in einem zusammengewürfelten, abgetragenen Anzug, überdeckt von einem langen, dunklen, mit einer derben Kordel am Hals zusammengehaltenen Umhang. Blitzsauberer Schuhe lugen unter dem Saum hervor.
„Dann werde ich Sie jetzt mit einer Sache vertraut machen. Dabei müssen Sie aufmerksam sein. Schauen Sie hin. Hören Sie zu. Auf keinen Fall dürfen Sie jedoch weiterlesen!“
„Wenn Sie das für richtig halten“, sage ich, sehr darauf bedacht, den anderen nicht zu reizen, weiß man doch, wohin leichtfertige Worte führen können.
Ich lasse die Lektüre also sinken, ja ich halte es sogar für angemessen, die Hände frei zu haben, und lege die Lektüre darum neben mich auf die Bank. Ich hoffe inständig, es lediglich mit einem jener harmlosen Verwirrten zu tun zu haben, wie sie mir in dieser Gegend des Öfteren begegnen.
„Ich bin sozusagen ein Entdeckungsreisender. Sie kennen doch Entdeckungsreisende, oder?“
Ich nicke vorsichtshalber. Zu meiner Erleichterung tritt der Mann noch einen Schritt zurück.
„Dann werde ich Sie jetzt mit meiner Vorübung vertraut machen. Sie werden sehen.“
Er breitet die Arme aus, so dass der Umhang den Bahnsteig dahinter vollständig verdeckt.
„Es ist eine Vorübung, die absolut nötig ist ... zum Aufwärmen sozusagen. Vor allem muss sie rechtzeitig ausgeführt werden. Sonst funktioniert es nicht.“
„Sonst funktioniert was nicht?“, frage ich.
„Es hat mit dem Reisen an sich zu tun. Dem Prozess als solchem. Ich muss mich sehr konzentrieren, und selbst dann gelingt es nicht immer. Jetzt, wo Sie mich schon einmal gesehen haben, spielen Sie auch eine gewisse Rolle dabei.“
„Wieso ich?“, frage ich verblüfft.
„Nun, jetzt lässt es sich nicht mehr rückgängig machen. Und darum müssen Sie genügend vorbereitet sein.“
„Ich? Wofür?“
„Es nennt sich Nebensprung und befähigt mich, eine kurze Distanz zu überbrücken, ohne dass mich irgendetwas daran hindern könnte.“
Jetzt bin ich vollständig davon überzeugt, es mit einem dieser Verwirrten zu tun zu haben.
Er beginnt langsam mit den Armen auf und ab zu wedeln, als wolle er sich einem großen Schmetterling gleich in die Luft erheben. Seine Bewegungen werden schneller und schneller, bis ich den Eindruck gewinne, seine Arme mit dem darüber hängenden Umhang hätten sich in so etwas wie riesige, rauschende Flügel verwandelt, denn der hinter ihm liegende Bahnsteig wird für mich wieder sichtbar. So schnell sind seine Bewegungen. Sein restlicher Körper mit dem Kopf darauf bleibt dagegen in absoluter Ruhe.
„Sehen Sie?“, lächelt er mir zu. „Ich habe das lange geübt.“
„Wie weit können Sie sich denn auf diese Weise bewegen?“, frage ich inzwischen belustigt, denn obwohl die Geschwindigkeit der Arme beeindruckt, so bewegt sich der Kerl um kein Maß in irgendeine Richtung.
„Nur ein paar Schritte. Sie werden sehen. Übrigens, fährt hier nicht der Schnellzug durch?“ Ich stutze.
„Ja, das tut er. In wenigen Minuten wird er kommen. Aber er wird nicht halten. Er ist kein Bummelzug.“
„Das ist gut“, sagt der Mann. „Würden Sie mir Bescheid geben, wenn er sich nähert?“
Ich blicke in die Richtung, aus welcher der Zug kommen wird, und auch, um mich zu vergewissern, ob vielleicht inzwischen irgendjemand den Bahnsteig betreten hat und ebenfalls Zeuge seiner Darbietung wird. Aber weder das eine noch das andere ist der Fall. Ich wende mich wieder dem seltsamen Mann zu.
„Gut, das wird reichen“, sagt er und stellt seine Armbewegungen so schlagartig ein, dass es mich ein wenig schwindelt.
„Aber Sie sind nach wie vor an derselben Stelle“, sage ich.
„Wie ich bereits erwähnte, handelt es sich dabei lediglich um eine Vorübung. Sie werden sehen.“
In diesem Moment beginnen die Gleise zu singen.
„Ich denke, der Zug kommt“, vermute ich. „Ja, da hinten zeigt er sich schon. Gleich wird er da sein.“
„Vielen Dank“, lächelt der Mann sehr breit. Zumindest wirkt es so, als lächele er jetzt breiter. Tatsächlich aber hat es einen kurzen Ruck durch seinen Körper gegeben, und er hat sich in zwei identische aufgeteilt, die um etwa eine Fingerbreite gegeneinander verschoben sind und sich dabei vollständig durchdringen. Diese beiden Männer werden transparent, springen zurück ineinander, springen wieder auseinander, schneller und schneller und sind schließlich so etwas wie ein oszillierendes, ein flimmerndes System. Als wäre ich noch nicht genug verblüfft, hebt dieses Gebilde, denn von einem Mann mag ich in dem Moment nicht mehr reden, eine Hand oder vielmehr zwei rechte Hände zum Gruß. Mit einem sanften Blitz etwa in der Art, wie er beim Ausschalten eines Fernsehgerätes beobachtet werden kann, verschwindet die Erscheinung in dem Augenblick, als der Zug am Bahnsteig entlang rast.
Ich erhasche den Anblick des Mannes, wie er hinter einem der vorübersausenden Fenster weiterhin zu mir herübergrüßen. Mir stellt sich die Frage, was jene Passagiere in dem Abteil wohl über sein plötzliches Erscheinen, seinen Nebensprung, denken möchten. Ich bin immerhin in geeigneter Weise vorbereitet worden, um mich nicht zu fürchten.
Messiaen
Warum habe ich mich um Himmels Willen nur darauf eingelassen?
Weil sie mir geschmeichelt haben? Weil ich zu gutmütig bin? Weil es eine Herausforderung ist? Sie haben kein Basssaxophon auftreiben können, das sie eigentlich gebraucht hätten. Aber ich hätte doch zu Hause eine Tuba. Die würde ich doch wie meine Posaune vorzüglich beherrschen, haben sie gesagt. Die Tuba sei jedoch in Es gestimmt, habe ich gesagt. Eher etwas für ein Ensemble, nicht für ein Blasorchester. Sie hätten keinen anderen, haben sie gesagt. Keinen anderen Dummen, füge ich jetzt für mich hinzu. Dabei liegt das Stück selbst eigentlich in einer günstigen Lage, bis auf diesen einen Ton. Den ersten Ton. Den allerersten Ton. In Forte Fortissimo!
Nein, nein, eine Tuba bläst man nicht wie eine Blockflöte. Der Ton wird mit den Lippen erzeugt. Er muss auch ohne Mundstück und Instrument klingen. Ich habe während der ersten Probe mit Sub-Kontra-Es angegeben. Naturton auf diesem Instrument! Kaum 20 Hertz! Über eine Oktave tiefer als für das Stück nötig und als es mit einem Basssaxophon überhaupt möglich wäre. Sub-Kontra-Es ist leicht, das spiele ich im Schlaf, das will das Instrument fast von allein spielen. In dieser Tiefe klinge meine kleine Tuba beinahe so schnarrend wie ein Basssaxophon, meinte der Maestro. Er will darum unbedingt Sub-Kontra-E haben. Das ist auch im Keller, auch ganz unten, aber eine Idee über der Leichtigkeit. Gerade eben kein Naturton. Eine Qual. Da muss man alle vier Ventile drücken, da muss man Luft geliehen bekommen, vor allem bei mehrfacher Taktlänge und Forte Fortissimo. Das nenne ich Ewigkeit! Die Lippen sind flaumweich und flattern vor den Zähnen im Kessel des Mundstücks herum. Sub-Kontra-E! Die Zunge verkriecht sich in den vibrierenden Hals, aber auch der Kopf vibriert, der Brustkorb, ja der ganze Körper bis in die kleine Zehe. Der Raum drumherum geht manchmal in Resonanz über. Selbst das Haus kann mitschwingen.
Speziell bei meinem Instrument muss man den Ansatz für diesen Ton ein wenig absacken lassen – vor dem Anblasen, nicht während! Er darf keinesfalls geschlenzt sein wie bei manchen Schlagersängern. Dieser Ton muss genau auf den Einsatz des Maestros hin sauber im Raum stehen. Man muss ihn eine halbe Sekunde früher anblasen, damit die Luftsäule genug Zeit hat, um sich einzuschwingen für Sub-Kontra-E und Forte Fortissimo. Es dauert bei diesem Stück Messiaens besagte Ewigkeit, bis das Orchester einsetzt und mich erlöst. Meine Lunge ist ausgequetscht und fühlt sich nur noch walnussgroß an. Mir ist dann schwindelig. Als Posaunist bin ich so was nicht gewohnt.