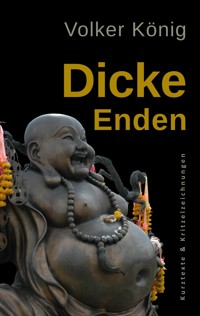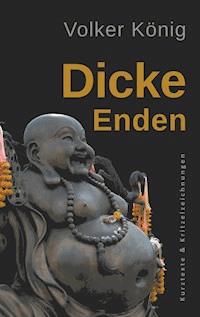4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: via tolino media
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
Eigentlich wollte Frigga Lendel ein paar arroganten Macho-Astronomen in England zeigen, wo der Hammer hängt. Aber sie musste ja ihr Spezial-Teleskop hinter einer Sicherheitstür deponieren! Den Schlüssel hatte der exzentrische Rentner Bause. Jetzt hat ihn die Polizei, denn Bause wurde brutal ermordet. Doch die Zeit zum Abflug drängt, die Polizei kommt nicht zu Potte, und die Suche nach einem Ersatzschlüssel ist verzwickt. Aber wer ist sie, um Ermittlungen anzustellen? Dafür muss es schon noch dicker kommen ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Impressum
Zitat
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
Volker König
Früh am Morden
Kriminalroman
Impressum
© Erstauflage April 2020
© 2020 Volker König
Kämmereihude 14, 45326 Essen
www.vkoenighome.de
Bildquelle: pixabay
ISBN der Printversion: 9 783751 906920
Qindie steht für qualitativ hochwertige Indie-Publikationen. Achten Sie also künftig auf das Qindie-Siegel! Für weitere Informationen, News und Veranstaltungen besuchen Sie unsere Website:https://qindie.de
Zitat
Wer weniger hat, als er begehrt,
muss wissen,
dass er mehr hat, als er wert ist.
Georg Christoph Lichtenberg
1.
In einer ruhigen Nebenstraße steht die Tür des Hauses Nummer neunzehn offen. Starker Wind in der Nacht hat Blätter und Papier in den Hausflur geweht. Eine zerfetzte Plastiktüte hat er bis zur niedrigen Stufe vor der Eingangstür der linken Wohnung getrieben. Es ist so kalt, wie es Ende März in Altenessen-Nord zu erwarten ist.
Oben im Haus fällt eine Tür ins Schloss. Ein Relais im Keller klackt und schaltet die Lampen an den überhohen Decken des Treppenhauses ein. Sie sind nur wenig heller als das Dämmerlicht durch die Fenster auf den Treppenabsätzen.
„Ich bin so froh, dass Sie mitkommen“, dringt eine Frauenstimme bis ins Erdgeschoss. Eine andere Frau antwortet Unverständliches. In ein paar Schritte mit spitzen, harten Absätzen mischt sich müdes Schlurfen. Dann knarren die ersten rotbraunen Holzstufen.
„Ich hätte ja Martin gefragt, aber der scheint nicht da zu sein“, sagt die eine Frau. „Und da dachte ich, dass vielleicht Viktoria ...“
„... schläft wie gesagt noch“, knurrt die andere Frau, niest unterdrückt und zieht dann die Nase hoch. „Was ist mit Polizei?“
„Um Himmels Willen! Am Ende ist alles ganz harmlos, und ich hole uns die Polizei ins Haus.“
Nach ein paar Stufen bleiben sie stehen.
„Ach, hier wohne ich übrigens. Direkt unter Viktoria.“
„Dann sind Sie Frau Rathenau?“
„Wie konnte ich das nur vergessen? Gesine Rathenau.“
„Lendel, Frigga Lendel, und ich habe ja auch noch nicht daran gedacht, mich vorzustellen“, sagt Frigga.
„Sie sind bei Viktoria zu Besuch, richtig?“
„Nur für ein paar Tage.“
„Und da bitte ich Sie in aller Frühe gleich um so etwas hier“, sagt Frau Rathenau.
„Ist schon in Ordnung. Die Nacht war ja auch schon schlecht“, sagt Frigga und denkt an Viktorias Sofa voller Hausstaubmilben.
„Es war ganz schön windig. Ich kann Ihnen nicht genug danken“, sagt Frau Rathenau.
Sie erreicht den ersten Treppenabsatz, nimmt die Brille ab und reibt sich nervös die Augen. Ihr heller Mantel steht offen, betont aber trotzdem ihre schlanke Figur. Das Licht aus Fenster und Lampe des Absatzes spiegelt sich in einer Uhr an einer Kette um ihren Hals.
„Was ist los?“, fragt Frigga, die hinter ihr aufgetaucht ist und erneut die Nase hochzieht. Sie steckt in einem zu großen, gelben Bademantel und trägt derbe Bergstiefel. Alles Licht fällt durch ihre weit abstehenden, flammend roten Haare.
„Ich weiß nicht“, sagt Frau Rathenau. „Ich habe halt so ein komisches Gefühl, dass da was nicht stimmt.“
„Wird schon nicht so schlimm sein“, sagt Frigga und steigt an Frau Rathenau vorbei die letzte Treppe zum Erdgeschoss hinunter.
„Ach, das hatte ich ganz vergessen“, sagt Frau Rathenau, die Frigga gefolgt ist. „Die Haustür ist auch offen. Sie muss die ganze Nacht offen gewesen sein, so kalt wie das hier ist.“
Sie zieht sich den Mantel enger um den Körper und will die Tür schon schließen, aber Frigga hält sie zurück.
„Wir sollten hier vorsichtshalber alles unverändert lassen“, sagt sie.
„Aber Sie haben doch gesagt, dass es wohl nicht so schlimm … oh, natürlich“, meint Frau Rathenau, „wenn Sie das für notwendig halten.“
Seltsam, denkt Frigga, jemand hat einen Keil unter die Tür geschoben, und auf der Straße weist nichts darauf hin, dass er im Moment für jemanden nützlich ist.
„Sehen Sie“, sagt Frau Rathenau und zeigt auf die linke Wohnungstür, „Herrn Bauses Wohnung steht halb offen. Ich habe schon gerufen, doch es kam keine Antwort. Aber Herr Bause ist ja auch schon ein alter Mann. Er hört nicht mehr so gut.“
Frigga wischt sich mit dem Ärmel die Nase. Verdammt, es ist ja Viktorias Mantel, und ich bin noch gar nicht geduscht, schießt es ihr durch den Kopf, denn sie riecht etwas streng. Dann drückt sie gegen die Tür, die lautlos ihre Endstellung erreicht. Frigga hört ein leises Ticken.
Nur das spärliche Licht des Treppenhauses fällt in den Flur der Wohnung. Frigga tastet nach einem Lichtschalter neben der Tür. Das Deckenlicht flammt auf. Vom sehr kleinen Flur gehen drei Türen ab. Die geradeaus steht offen und führt in ein fensterloses Badezimmer. Die rechte Tür hat eine Glasscheibe und verschließt die Küche.
„Hallo!“, ruft Frigga. Keine Antwort.
„Sehen Sie, es scheint niemand da zu sein“, flüstert Frau Rathenau hinter ihr.
„Vielleicht schläft er ja auch sehr tief“, sagt Frigga und wendet sich der Tür links zu. Die ist massiv und steht ebenfalls halb offen. Frigga muss sie ganz aufdrücken, denn nach einem kurzen Anstoß verhindert der Teppich, dass sie sich mehr als ein paar Zentimeter bewegt. Die Rollläden sind noch unten, und darum schaltet Frigga auch hier das Licht ein.
Ein Wohnzimmer mit in dunkler Eiche getäfelten Wänden. Rechts an der Wand eine hellbraune Chesterfield-Sitzgruppe. Über dem Sofa an der Wand eine Pendeluhr, die jetzt leiser als erwartet tickt. Sie steht auf 6:38 Uhr und zeigt damit eine halbe Stunde früher an als die Uhr in Viktorias Wohnzimmer. Mehrere kleine, alte und vermutlich teure Möbel sind im Raum verteilt, darunter ein Sekretär. Auf der Ablage über der Klappe fehlt kreisrund der dünne Staub. Daneben steht ein Bild. Es zeigt einen viel jüngeren Herrn Bause mit einem kleinen Mädchen auf dem Schoß. In der Mitte des Raumes liegen einige Zettel und Bauses umgestürzter Rollstuhl. Hinten im Raum ist eine weitere, vollständig geöffnete Tür. Sie führt in tiefe Dunkelheit.
Frigga durchquert das Wohnzimmer. Der dicke, russisch-grüne Teppich dämpft ihre Schritte. Von der offenen Tür führen braune Flecken wie von Katzenpfoten zurück in das Wohnzimmer. Sie werden von Fleck zu Fleck blasser, bis sie nicht mehr zu erkennen sind. Frigga bleibt stehen und dreht sich zu Frau Rathenau um. Die steht mit eingezogenem Kopf hinter ihr und starrt sie an.
Sie muss ziemlich kurzsichtig sein, denkt Frigga. Ihre Augen wirken so klein und ängstlich. Vielleicht ist sie Mitte fünfzig.
„Bis hierher können wir noch nichts Genaues sagen“, sagt Frigga. „Es ist noch fast alles vorstellbar. Schrödingers Katze ist noch beides, tot und lebendig. Wenn wir aber durch diese Tür gehen und das Licht einschalten, dann wird sich ein Zustand bewahrheiten. Egal welcher das sein wird, behalten Sie um Himmels Willen die Nerven.“
Frau Rathenau nickt.
„Ich kenne Herrn Schrödinger und seine Katze zwar nicht, aber du kannst mich Gesine nennen.“
„Frigga“, sagt Frigga. „Und los.“
Ein letztes Mal drückt sie einen Lichtschalter.
Auf dem Boden liegt Bauses Gehstock mit silber- glänzendem Knauf. Er ist blutbeschmiert. Herr Bause liegt auf dem Rücken im Bett mit dem Kopf unter dem Kissen. Sein linker Arm hängt aus dem Bett heraus. Ein tiefer Schnitt klafft im Unterarm, und an den Fingern kleben Blutstropfen. Der Teppich unterhalb der heraushängenden Hand ist mit Blut vollgesogen. Hier sind die Pfotenabdrücke am deutlichsten und bilden ein aufgeregtes Muster. Die hat was aufgeschreckt, denkt Frigga. Der Wecker auf dem Nachtschränkchen steht auf 7:12 Uhr. Um 7:00 Uhr hat er geklingelt. Er ist blutbeschmiert. Am Nachtschränkchen ist Blut, an den Wänden ist Blut, am Schrank ist Blut. Überall ist Blut. Gesine stößt einen spitzen Schrei aus und lehnt schwach am Türrahmen.
„Der Graf ist tot“, ächzt sie.
Verdammt, denkt Frigga, klapp jetzt bloß nicht zusammen. Ich sollte die Polizei rufen. Am besten auch einen Krankenwagen für Gesine.
Sie will sich gerade zum Gehen wenden, als sie etwas am Hals des Toten glitzern sieht. Sie tritt an das Bett. Eine dünne Kette verschwindet im blutgetränkten Halsausschnitt des Pyjamas. Frigga weiß genau, was am Ende dieser Kette hängt. Sie hat es sich gestern von Herrn Bause geliehen und ihm gestern auch wieder zurückgegeben. Sie sieht den alten Mann in seinem Dreiteileranzug und dem gezwirbelten Schnurrbart noch vor sich, wie er an der Wohnungstür, im Rollstuhl sitzend, den Schlüssel aus dem Hemd zieht. Sie möge sorgsam damit umgehen, denn er habe dafür unterschreiben müssen, hatte er ihr eingeschärft. Es ist der Schlüssel zum Dachgeschoss. Dort hat sie ihr Teleskop bis zu ihrer Weiterfahrt geparkt. Sie muss den Schlüssel jetzt nehmen, denn die Polizei wird hier alles auf den Kopf stellen, und dann ist er erst einmal weg. Ohne Schlüssel bleibt ihr Teleskop eingesperrt, und ohne Teleskop … Sie greift zu.
„Sie lassen auf der Stelle los, was Sie in der Hand haben, und treten sofort zurück“, hört sie eine gefährlich ruhige Stimme hinter sich.
Frigga lässt den Schlüssel los, der an seiner Kette zurück unter den Pyjamakragen rutscht, und dreht sich langsam um.
In der Tür steht ein riesiger Kerl in schwarzem Lederjackett und Jeanshose. Vielleicht fünfunddreißig, sechsunddreißig und damit so alt wie ich, tippt Frigga, gut trainiert, ein kleines Schuppenproblem, leicht zerknitterter Hemdkragen, wohnt wahrscheinlich allein.Die rechte Hand des Riesen ruht auf seiner Waffe an der Hüfte, die andere hält eine Metallplakette. Eine junge Frau mit blondem Pferdeschwanz kniet vor Gesine.
„Ganz ruhig“, sagt Frigga, „ich kann das erklären.“
„Da bin ich aber gespannt“, sagt der Kerl. „Aber zuvor treten Sie zurück.“
Frigga befolgt die Anweisung.
„Schon gut, schon gut.“
„Kriminaloberkommissar Thomas Scheibelhud, und das ist meine Kollegin Kommissarin Sigrid Mlaka.“
„Ich bin auch eine Kollegin, Oberkommissar Scheibelhud. Hauptkommissarin Frigga Lendel aus Bielefeld. Ich habe hier alles im Griff.“
Oberkommissar Scheibelhud lächelt verkniffen.
„Ja, ich habe gesehen, dass Sie gerade etwas angefasst haben.“
„Wollen Sie mich belehren? Wollen Sie mir sagen, wie ich meine Arbeit zu tun habe?“
Sie geht einen Schritt auf den Beamten zu in der Hoffnung, dass er zurückweicht. Doch der denkt wohl nicht daran.
„Wie Sie sehen, ist hier ein Kapitalverbrechen begangen worden, Oberkommissar Scheibelhud. Rufen Sie also ihre Leute her ... und achten Sie auf Ihre Kleidung. Wir wollen hier keine Kontaminationen!“
Sie zeigt auf eine Stelle an seiner Schulter, wo ein welkes Blättchen von einem der Straßenbäume klebt.
Scheibelhud nimmt das Blättchen und steckt es in seine Tasche.
„Danke, dass Sie mich darauf aufmerksam gemacht haben. Und nun treten Sie bitte wieder zurück. Sie können sich doch wohl ausweisen, oder?“
Frigga starrt ihn kalt an. Dann zeigt sie erst auf ihre Schuhe und dann auf den Bademantel.
„Wenn Sie meine Dienstmarke hier irgendwo finden, dann haben Sie schon jetzt einen Orden verdient.“
„Das habe ich so nicht gemeint“, sagt Scheibelhud und legt seine Hand wieder auf die Waffe. „Wenn Sie die Dienstmarke nicht bei sich tragen, dann gehen wir jetzt in Ihre Wohnung.“
„Wir gehen jetzt nirgendwo hin, verstanden?“, ruft Frigga.
Kommissarin Mlaka stellt sich in die Tür.
„Vorerst können oder wollen Sie sich also nicht ausweisen“, sagt Scheibelhud. „Ich nehme Sie daher vorläufig wegen des Verdachtes auf Täterschaft fest.“
Frigga hat nur einmal ungläubig geblinzelt, da hat ihr der Beamte bereits Handschellen angelegt. Seine Kollegin redet gedämpft in ihr Funkgerät.
„Ich werde mich bei Ihrem Vorgesetzten beschweren!“, schimpft Frigga.
„Dazu haben Sie jedes Recht der Welt.“
Er führt Frigga und Gesine durch das Wohnzimmer, als die Pendeluhr dreimal schlägt. Unmittelbar darauf klingelt das Telefon. Frigga schießt die Möglichkeit zu Gegenwehr und Flucht durch den Kopf, aber ihre Arme zucken nur einmal kurz gegen den Widerstand der Handschellen. Dann legt sich Scheibelhuds Hand schwer auf ihre Schulter, und sie bleibt stehen.
Der Anrufbeantworter springt an.
„Hallo, Herr Bause“, dringt eine schwache Frauenstimme aus dem Apparat. „Hier ist Marie Keller. Ich hoffe, dass Sie das hier bald abhören. Leider kann ich heute nicht vorbeikommen, weil ich krank im Bett liege. Habe wohl gestern was Falsches gegessen und die ganze Nacht auf der Toilette ... oh, mein Gott, es geht schon wieder los.“
Das Geräusch eines großen Dilemmas ist zu hören. Dann rauscht eine Klospülung.
„Aber machen Sie sich bitte keine Sorgen“, dringt kurz darauf die gequälte Stimme durch das Geräusch von nachlaufendem Wasser. „Ich sorge dafür, dass jemand nach Ihnen schaut. Wenn ich mich wieder besser fühle, dann melde ich mich. Bis dahin! Oh, nei...“
Bevor erneut ein Dilemma übertragen wird, hat Marie Keller das Gespräch abgebrochen. Kommissarin Mlaka notiert ihre Rufnummer.
Auf der Straße sieht Frigga die alte Frau von gegenüber in ihrem Fenster lehnen. Unter ihr auf dem Gehweg stehen zwei Anwohner und unterhalten sich leise mit ihr.
„Vorsicht beim Einsteigen“, hört sie Scheibelhud hinter sich sagen, und seine Hand schirmt ihren Kopf gegen den Türrahmen ab. Frigga zwängt sich mit den Händen im Rücken auf die Sitzbank. Der Bademantel lappt über den Einstiegsschweller, und Scheibelhud schiebt ihn in den Fußraum. Dann drückt er die Tür zu. Hier riecht es nach Waffenöl. Sie fahren los, als ein paar Polizeifahrzeuge eintreffen. Jetzt ist es Frigga doch etwas flau im Magen.
2.
Die Bude in Schonnebeckshöfe öffnet früh. Burkhard Gorontzki betritt den Verkaufsraum mit lediglich einer vagen Vorstellung von den Kleinigkeiten, die er für seine Bahnfahrt einkaufen will. Irgendwas zum Essen, irgendwas zum Trinken, irgendwas zum Lesen. Die Zeitung hat er schnell gewählt, eine in Teig verpackte Salami setzt sich gegen eine Tafel Schokolade durch. Jetzt steht Gorontzki vor dem Kühlschrank. Wasser, Saft, ein Milchgetränk oder vielleicht ein Bier? Das Wasser würde seinen Durst löschen oder zumindest die Kehle befeuchten. Der Saft schmeckt zwar besser, aber er wäre vielleicht doch zu süß. Das Milchgetränk schließt Gorontzki aus, denn bis er das Getränk nötig hat, wäre die Milch warm und noch schleimiger geworden. Dem kann er nichts abgewinnen. Bliebe noch das Bier.
Die Tür wird mit einem Klingeln aufgedrückt. Ein halbes Dutzend Schulkinder erobert den Verkaufsraum und formiert sich vor dem Tresen. Dort stehen mehrere Glasgefäße mit Süßigkeiten. Die Kinder plappern durcheinander, und die Budenbesitzerin kämpft sich durch die Bestellungen. Saure Gummischlangen, Lutschmuscheln, Schnuller, Liebesperlen. Tüte um Tüte füllt sich.
Das Bier würde seine Nerven beruhigen. Wenn Gorontzki es aber vor dem Test trinkt, dann müsste er auch noch eine Rolle Pfefferminzbonbons kaufen, damit er nicht durch eine Fahne auffiel. Das Wasser müsste er in jedem Falle zum Nachspülen haben. Wenn der Test gelaufen war, könnte er sich in Oberhausen ein weiteres Bier kaufen. Ob als Belohnung oder zur Tröstung, hinge vom Ergebnis des Tests ab. Grün ist die Hoffnung, denkt Gorontzki und fügt eine grüne Flasche Stauder sowie eine Flasche Wasser seiner Sammlung bei.
Er wendet sich dem Tresen zu. Der Süßigkeitenverkauf ist ins Stocken geraten, weil ein Junge zu wenig Geld dabei hat. Zum Beweis hält ihm die Budenbesitzerin die flache Hand mit den Münzen hin. Die anderen können ihm nichts leihen, weil sie ihres schon ausgegeben haben.
„Dann nehmen wir wieder etwas aus der Tüte heraus“, bietet die Budenbesitzerin an. „Auf was kannst du verzichten?“
Der Junge wirft einen scheelen Blick auf die prallen Tüten der anderen und kann auf gar nichts verzichten.
Burkhard Gorontzki schaut auf die Uhr. In sechs Minuten fährt der Zug nach Oberhausen ab.
„Du musst dich schon entscheiden“, sagt die Budenbesitzerin. „Entweder eine Lutschmuscheln oder dreimal den Zauberbären. Den Kleinkram fische ich nicht mehr raus.“
Der Junge ist hin- und hergerissen.
„Wie viel fehlt denn?“, fragt Gorontzki.
„Nur achtzehn Cent“, sagt der Junge.
Gorontzki zückt sein Portemonnaie und begleicht den Betrag. Die Bande zieht aus dem Laden, und Gorontzki bestellt am Tresen die Rolle Pfefferminzbonbons. Jetzt muss er sich aber beeilen. Wenn er zu spät kommt, dann ist der Job weg.
„Macht vier Euro achtunddreißig.“
Das sind acht Cent zu viel für Gorontzki. Er lässt die Bonbonrolle zurück und stopft alles andere in seine Aktentasche. Die hat er schon seit seiner Schulzeit. Sie lässt sich nicht mehr schließen, weil das Schloss defekt ist. Er eilt in Richtung Bahnhof Essen-Zollverein Nord. Als er unten an der Treppe zum Bahnsteig steht, fährt der Zug ein. Gorontzki ist schon jetzt außer Atem. Mit großen Sätzen stürzt er die Treppe hoch. Sein Mund ist staubtrocken. Nur noch zwei Sätze. Seine Beine haben kaum noch Kraft. Er taumelt. Sein schwingender Arm mit der Aktentasche gerät unter den Handlauf der Treppe, die Aktentasche dreht sich heraus, rutscht auf den obersten Treppenabsatz und öffnet sich. Auch die Türen des Zuges öffnen sich. Ein paar Fahrgäste steigen aus und weichen Burkhard Gorontzki aus, der zwischen ihren Füßen zusammenrafft, was er erreichen kann. Die Bierflasche ist über den Rand des Treppenabsatzes gerollt. Dahinter ist es abschüssig. Ein Wunder, dass sie nicht zerbrochen ist. Die Wurst ist auch dorthin gerutscht. Gorontzki kann beides nicht mehr sehen. Dafür sieht er aber, dass sich die Türen schließen. Es ist keine Zeit, nach seinem Besitz zu suchen. Er sprintet zum Zug, steckt seine Hand zwischen die fast geschlossenen Türen und drängt hinein. Schwer atmend steht er an eine Haltestange gelehnt. Es wird kein Beruhigungsbier geben. Hoffentlich reicht das Geld für das Belohnungsbier danach. Dass die Flasche bei seiner Rückkehr noch dort liegen wird, braucht er wohl nicht zu hoffen.
3.
Während der Fahrt behält Scheibelhud Frigga und Gesine im Auge. Mlaka steuert das Fahrzeug. Friggas Hände werden langsam kalt. Die Handschellen sitzen eng. Dreh nur nicht durch, denkt sie. Am Ende lässt sich alles irgendwie klären. Bring es mit Anstand hinter dich.
Sie blickt zu Gesine hinüber. Die ist weit davon entfernt, die Sache mit Anstand hinter sich zu bringen. Zusammengesunken hockt sie da. Sie ist auch etwas bleich, und plötzlich durchströmt ein beißender Geruch das Wageninnere.
„Nein, das ist jetzt nicht wahr!“, ruft Scheibelhud.
„Sie hätten sich die Frau vielleicht mal besser ansehen sollen, bevor Sie sie wie eine Verbrecherin in ihren Polizeiwagen zerren“, sagt Frigga. „Sie hat immerhin gerade eine Leiche gesehen. Das ist menschenunwürdig, was Sie hier mit uns machen.“
Gesine Rathenau laufen Tränen über die Wangen.
„Du meine Güte! Fahr schneller, Mlaka!“, ruft Scheibelhud und stellte die Sirene an.
Die Fahrt dauert nur noch sehr kurz, denn das Polizeirevier liegt am Mallinckrodtplatz und damit nur einen knappen Kilometer entfernt vom Tatort.
Die Polizeiinspektion 3 – Nord Polizeiwache Altenessen – ist ein mehrstöckiges, graues Gebäude, das auch ein Wohnhaus hätte sein können, wenn nicht über dem Eingang in großen Buchstaben POLIZEI stünde, und wenn nicht fast ein Dutzend Polizeifahrzeuge davor parkten.
Scheibelhud springt aus dem Wagen und reißt Gesines Tür auf. Ihr Rock wie die Sitzbezüge sind nass. Gesine wimmert, dass es ihr leid tue, und Frigga würde Scheibelhud am liebsten an die Kehle fahren. Mlaka geleitet sie beide ins Gebäude hinein. Dort wird Gesine auf die Toilette, Frigga dagegen in einen Raum mit einer Pritsche geführt. Auf der Pritsche stehen eine weiße und eine blaue Schale. Eine Polizistin schließt die Tür und stellt sich davor, eine andere weist auf die Pritsche.
„Bitte ziehen Sie alle Kleidungsstücke aus, und legen Sie sie in die weiße Schale. Die Schuhe bitte in die blaue.“
Frigga schluckt.
„Weshalb denn das?“
„Sie sind am Tatort vorläufig festgenommen worden, und die Kleidung wird zwecks Spurensicherung gebraucht. Sie wissen doch, wie das geht, Frau Hauptkommissarin.“
Die Beamtin an der Tür unterdrückt ihr Grinsen nur mühsam.
„Aber ich habe dann doch gar nichts mehr an!“, ruft Frigga. „Wie weit wollen Sie uns denn noch demütigen?“
„Jetzt machen Sie hier keinen Aufstand! So was wie bei Ihrer Freundin kann passieren. Da kann der Kollege überhaupt nichts für. Sie aber können sich vorübergehend hiermit behelfen. Und keine hektischen Bewegungen, wenn ich bitten darf!“, sagt sie scharf, weil Frigga mit ihrer Hand herumwedelt. Hier gibt es eine Fliege.
Die Polizistin reicht Frigga etwas, was wie eine weiße Plastikfolie aussieht.
„Das soll ich anziehen?“
Die Polizistin an der Tür nickt langsam, während die andere Frigga anstarrt.
„Das wird Sie noch teuer zu stehen kommen“, presst Frigga hervor und zieht sich aus. Die Fliege setzt sich auf ihren nackten Oberschenkel.
Die Folie lässt sich zu einem Plastikoverall mit Kapuze entfalteten. Er fühlt sich kühl auf der Haut an, wird aber sicher bald auf ihr kleben. Nur gut, dass das Ding blickdicht ist, denkt Frigga. Die Fliege krabbelt ihr über den nackten Fuß.
„Soll ich barfuß hier herumlaufen?“, fragt Frigga.
„Nehmen Sie diese Überzieher“, sagt die Polizistin und hält ihr zwei kleine, weiße Plastikfolien hin. Das Gummi am Einstieg ist verhältnismäßig stramm und wird Abdrücke auf der Haut hinterlassen.
„So, und damit die Dame keine schwarzen Fingerchen bekommt, haben wir hier unser AFIS“, sagt die Polizistin. „Drücken Sie ihre Fingerkuppen drauf!“
Sie hält ihr ein elektronische Gerät entgegen, auf das sich die Fliege setzt und erst flüchtet, als Frigga tut, was man von ihr verlangt.
„Dann haben wir es ja beinahe geschafft“, sagt die Polizistin und greift nach einem Plastikröhrchen. „Sie wissen, was das ist? Stichwort DNA-Probe?“
Sie wedelt mit dem Röhrchen.
„Ich weise Sie darauf hin, dass sie dazu nicht verpflichtet sind. Sollten Sie sich jedoch weigern, werden Sie per richterlicher Anordnung dazu gezwungen. Die Anordnung ist in ein paar Stunden erteilt. Solange bleiben Sie hier. Ich empfehle Ihnen, zu kooperieren.“
Die Polizistin an der Tür grinst nicht mehr, sondern sieht jetzt wirklich gefährlich aus. Die andere zieht ein Wattestäbchen aus dem Plastikröhrchen, und Frigga lässt sie damit in ihrem Mund herumwerkeln. Sie kann gerade so verhindern, dass ihr die Fliege nicht auch noch hineinfliegt.
Anschließend wird Frigga vermessen, gewogen und fotografiert.
„Folgen Sie mir.“
Man führt sie in ein Büro. Allein die Vorstellung, in diesem Anzug vernommen zu werden, bereitet ihr Unbehagen. Aber der Grund, weswegen sie sich wirklich flau fühlt, liegt woanders.
„Bitte, setzen Sie sich.“
In dem Büro wartet Scheibelhud. Er deutet auf einen Stuhl. Kommissarin Mlaka postiert sich an der Tür.
„Bitte, nennen Sie mir Ihren Namen, ihre Anschrift und Ihr Geburtsdatum.“
Er fragt auch nach ihrem Geburtsort, dem Familienstand und ihrer Staatsangehörigkeit und tippt alles in einen Rechner.
„Zu Ihrem Beruf haben Sie sich ja bereits geäußert. Bei nächster Gelegenheit werden wir das natürlich überprüfen“, sagt er. „Dann weise ich Sie hiermit auf Ihre Rechte hin.“
Er spult auch diesen Teil wie eine gut geölte Maschine ab, und Frigga überlegt, wie sie vorgehen soll. Die Aussage verweigern, einen Anwalt anfordern, eigene Beweisanträge zur eigenen Entlastung stellen oder sich ausschließlich schriftlich äußern? Nichts von allem wird ihr helfen. Man hat sie mit der Hand am Toten im Mordzimmer vorgefunden. Da sie der Tat aber nicht schuldig ist, macht ihr das keine Sorgen. Aber etwas anderes bohrt in ihr. Sie muss es jetzt zur Sprache bringen, ohne Anwalt und ohne viel Firlefanz.
„Ich möchte eine Aussage machen“, beginnt sie, als ein Mann, ehrfurchtgebietend grauhaarig und mit unverschämt vielen silbernen Sternen auf den Schulterklappen, den Raum betritt.
Frigga starrt ihn an.
„Onkel Horst?“, flüstert sie.
Im Großraumbüro nebenan klingelt ein Telefon.
„Polizeiinspektion 3, Kriminaloberkommissar Görtzig“, meldet sich der Beamte.
„Kemsich Moden, Teuber“, meldet sich eine Frau am anderen Ende, „ich wollte nur mal nachhören, ob sich schon eine Spur wegen der Puppe ergeben hat.“
„Der Puppe?“, fragte Görtzig.
„Unsere Schaufensterpuppe wurde doch vorgestern gestohlen“, erklärte Frau Teuber, und Görtzig schlägt die Hand an die Stirn.
„Es ist nur so, dass es sich dabei um ein altes Stück handelt, antik sozusagen, und es ist eine Leihgabe. Wir brauchen es daher unbedingt zurück. Haben Sie denn schon eine Spur?“
Görtzig verdreht die Augen.
„Wir sind mit allen Kräften auf der Suche und melden uns, sobald wir etwas ermittelt haben.“
„Wir wollen halt nur, dass ihr nichts passiert. Die Puppe ist unbezahlbar für diejenigen, die sich damit auskennen. Ein Sammlerstück. Eine Bonaveri von 1951! Wir mussten zweitausend Euro hinterlegen.“
„Ich kann Sie nur bitten, sich zu gedulden. Wir warten nur darauf, dass die Entfüh...“
Er hält inne, legt die Hand über das Mikrofon des Telefonhörers und schüttelt den Kopf, weil er sich über seine Gedankenlosigkeit wundert.
„Eine Entführung? Sie glauben, es ist eine Entführung?“, schallt es schrill aus der Ohrmuschel.
„Nein, so kann man es wohl nicht bezeichnen“, versucht Görtzig zu beruhigen. „Trotzdem tun wir alles in unserer Macht Stehende, um Ihnen das Stück zurückzubringen. Wir melden uns, sobald wir mehr sagen können.“
Kaum hat er aufgelegt, als das Telefon erneut klingelt. Die angezeigte Nummer kennt er, und sie ist wichtig. Er hebt ab und beginnt zu schwitzen.
„Sie kennen den Ersten Kriminalhauptkommissar Sobel?“, fragt Scheibelhud verblüfft.
„Ja, den kennt sie“, antwortet Sobel. „Hallo, Frigga!“
„Hallo, Onkel Horst. Ich wusste gar nicht, dass du in dieser Dienststelle bist“, sagt Frigga und wird rot.
„Letztes Jahr habe ich mich her versetzen lassen. Als Dienststellenleiter hatte ich da die Wahl.“
Er hockt sich auf einen Stuhl und blickt Frigga so streng an, dass ihr plötzlich der Plastikoverall am ganzen Körper klebt.
„Ich habe die Befragung am Rechner mitverfolgt. Als dein Name fiel, wurde ich natürlich hellhörig. Ganz besonders, als ich las, dass du jetzt Kriminalhauptkommissarin bist.“
„Nun, dazu wollte ich gerade etwas sagen, als du hereingekommen bist.“
„Das hört sich an, als wolltest du dem etwas hinzufügen, oder?“
Frigga nickt.
„Wir brauchen also nicht erst in Bielefeld zu fragen, ob die eine Kriminalhauptkommissarin deines Namens haben, nicht wahr?“
Frigga schüttelt den Kopf.
„Am Ende meinst du es damit auch nicht so ernst, wie es zunächst schien?“
Frigga schüttelt den Kopf noch heftiger.
„Denn so etwas könnte man leicht als Amtsanmaßung ahnden, und das ist eine Straftat. Was ist also dein wirklicher Beruf?“
„Ich fahre Taxi“, sagt Frigga. „Es tut mir leid, dass ich etwas anderes gesagt habe. Wahrscheinlich ist mir eine Sicherung durchgebrannt angesichts des Toten. Frau Rathenau hat mich zu Hilfe geholt, weil Herrn Bauses Tür offen stand. Sie hat sich nicht alleine hineingetraut, und ich wollte doch nur fühlen, ob er noch lebt.“
Sobel lehnt sich zurück.
„Wurde Frau Rathenau schon befragt?“
„Sie war vorher dran“, sagt Scheibelhud.
„Ist das die Frau, die sich ...“
Scheibelhud nickt verkniffen.
„Da reden wir später drüber. Deckt sich Friggas Aussage mit der von Frau Rathenaus?“, fragt Sobel. Scheibelhud schaut in seinen Rechner und nickt.
„Was meinen Sie, Scheibelhud, müssen wir die Amtsanmaßung weiterverfolgen?“
„Wir müssten eigentlich schon … allerdings haben wir keinen Hinweis darauf, dass Frau Lendel eine Handlung vorgenommen hat, die nur Kraft eines öffentlichen Amtes vorgenommen werden darf. Sie hat lediglich behauptet, Kriminalhauptkommissarin zu sein.“
„Und was hat Sie dazu veranlasst, ihr das nicht zu glauben?“, fragt Sobel.
„Wie Sie sehen, ist hier ein Kapitalverbrechen begangen worden“, zitiert Scheibelhud.
„Verstehe“, meint Sobel, „so reden wir heute nicht mehr. Ich denke, dann ist alles geklärt. Frigga kann erst einmal gehen, wir kennen ja ihren Aufenthaltsort. Oder haben Sie noch Fragen an sie.“
Scheibelhud schüttelt den Kopf. Sobel erhebt sich.
„Onkel Horst?“
Sobel wendet sich ihr zu.
„Was ist mit Herrn Bauses Schlüssel? Kann ich den bekommen?“
„Keine Ahnung. Das muss der Oberkommissar entscheiden.“
„Das ist nicht möglich“, sagt Scheibelhud. „Wir haben noch nichts ausgewertet. Aber ihren eigenen Schlüssel kann sie natürlich wiederhaben.“
Die Tür wird geöffnet, und Görtzig bedeutet Sobel, er möge herauskommen. Für einen kurzen Moment sitzen sich Scheibelhud und Frigga wortlos gegenüber.
„Wie lange sind Sie noch in Essen?“, fragt Scheibelhud schließlich.
„Bis Samstag.“
Scheibelhud schaut zum Wandkalender, auf dem Mittwoch mit einem Plastikrahmen markiert ist, und macht einen Vermerk.
„Wofür brauchen Sie eigentlich den Schlüssel?“, fragt er.
„Ich habe was für meine Reise auf dem Dachboden deponiert.“
Nur einmal noch treffen sich ihre Blicke, und Frigga weiß Scheibelhuds nicht einzuordnen.
Sobel kehrt zurück. Er wirkt angespannt.
„In Arnheim hat jemand um sich geschossen. Es gab Tote. Der Mann ist auf der Flucht, und die holländischen Kollegen bitten um Amtshilfe an der Grenze. Görtzig stellt die Teams zusammen. Die können jeden Mann brauchen, den sie kriegen können. Mlaka, Sie melden sich bei Görtzig. Scheibelhud, Sie machen das hier weiter.“
„Aber das ist für einen alleine ...“
„Der Erkennungsdienst ist doch schon vor Ort. Die Arbeit bleibt Ihnen also schon einmal erspart. Und außerdem wird es nicht für ewig sein. Wie lange kann schon so einer fliehen. Ansonsten stellen Sie meinetwegen Frigga als Informantin ein.“
„Was?“, ruft Scheibelhud. „Eine Zivilistin? Das kann nicht ihr Ernst sein.“
„Jetzt hören Sie mal zu.“
Sobel stützt sich auf den Schreibtisch.
„Ich hatte einmal einen sehr geschätzten Kollegen namens Robert. Leider hat er uns viel zu früh verlassen. Kriminalkommissar Lendel ist vor etwa fünfundzwanzig Jahren im Dienst zu Tode gekommen. Frigga ist seine Tochter.“
Ein Hauch von Verständnis huscht durch Scheibelhuds Widerwillen und zeichnet ein schiefes Lächeln in sein Gesicht.