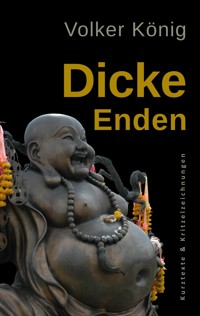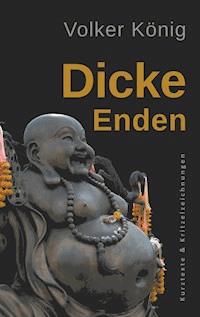Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: epubli
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Henry, der reichste Mensch der Welt, sitzt nach seinem Versuch, ein Kreuzfahrtschiff zur Umkehr zu bewegen, in einer Kajüte fest. Freiheit sei jedoch relativ, meint er unbeeindruckt und erzählt von seiner Begegnung mit dem seltsamen Bill. Den hatte er vorübergehend bei sich einziehen lassen. Nach und nach erschloss sich Henry nicht nur Bills Wesen, sondern er erhielt auch eine Ahnung über unser aller Schicksal.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 125
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Volker König
Pier Runners
Novelle
Inhaltsverzeichnis
Impressum
Zitat
Quant Eins
Mann mit Gepäck
Quant Zwei
Sauber und satt
Quant Drei
Ein kühner Plan
Quant Vier
Dichte
Quant Fünf
Plan B
Quant Sechs
Der Vogeleffekt
Quant Sieben
Achterbahn
Quant Acht
Ahnung und Gewissheit
Quant Neun
Unten durch
Quant Zehn
Ferngesteuert
Quant Elf
Impressum
Erstauflage November 2023
Texte: © Copyright by Volker König
Umschlaggestaltung: © Copyright by Volker König
Covervorlage: pixabay
Verlag:
Volker König
Kämmereihude 14
45326 Essen
www.vkoenighome.de
Druck: epubli – ein Service der neopubli GmbH, Berlin
Zitat
Wenn die Menschen nur über
das sprächen, was sie begreifen,
dann würde es sehr still
auf der Welt sein.
Albert Einstein
Quant Eins
Am Landgang habe ich mich diesmal nicht beteiligt. Empfehlungen anderer Reisenden halten ohnehin nicht das, was man dann tatsächlich vorfindet. Wie geheim ist ein Tipp aus einem Reiseführer? Die tropische Hitze hätte mir heute auch den Rest gegeben. Ich bin schließlich nicht mehr jung. Und so bin ich in meiner kleinen, schwankenden, aber klimatisierten Kabine der Especially now bestens aufgehoben.
Das Schiff ist zwar alt und abgeblättert, aber das stellt seine Seetüchtigkeit nicht in Frage, wie der Sturm vor ein paar Tagen bewiesen hat. Es wird also nicht untergehen. Der globale Krieg wäre schon eher ein Grund für seinen Untergang. Doch zum einen kreuzt die Especially now in halbwegs befriedeten Gewässern, zum anderen haben sich die Mächtigen dieser Welt einmal mehr auf eine zweimonatige Feuerpause geeinigt. Nur deshalb findet diese komplett KI-freie Kreuzfahrt für einige der Reichsten überhaupt statt. Es wird noch weitere Landgänge geben, und ich werde mich erst wieder an einem beteiligen, wenn sich die Gegend merklich verändert hat und ich eine nette oder coole Begleitung gefunden habe.
Am frühen Nachmittag aber will ich mir die Beine vertreten und begebe mich auf das Promenadendeck. Von hier aus kann ich den Hafen der Insel überblicken.
Nach und nach kehren die Landgänger zurück. Nach und nach gesellen sich weitere Passagiere zu mir an die Reling. Freundschaften habe ich noch keine geschlossen. Gelegentlich nicke ich Leuten zu, die ich an der Bar oder im Speisesaal gesehen habe. Niemand will sich aufdrängen. Jeder hat hier eine Stange Geld gezahlt und sucht sich seine Gesellschaft zum Zeitvertreib sorgfältig aus.
Ein paar Schritte von mir entfernt steht Henry mit einem lustigen Schirmchen im Drink. Er war mir gestern beim Shuffleboard weniger durch seine besonderen Fähigkeiten in dem Spiel – denn die hat er nicht – als durch seine geschwätzig schneidende Stimme aufgefallen. Möglicherweise fühlte er sich durch die Gesellschaft einiger Damen angetrieben oder sogar herausgefordert, besonders aber durch die einer bestimmten Dame, die über jeden seiner noch so schlechten Witze in helles Lachen ausbrach. Henry bemühte sich, sie beständig am Lachen zu halten und verzögerte das Spiel dermaßen, dass einige Teilnehmer die Segel strichen. Heute scheint sich seine Redseligkeit gelegt zu haben, es sind ja auch keine geeigneten Damen weit und breit. Auf seinem Hemd klebt unter dem aufgestickten Emblem seiner Firma noch immer das inzwischen zerknitterte Namensschild, das sich jeder für das Spiel angeheftet hatte. Nicht nur deshalb weiß ich, dass er Henry heißt. Er ist der Reichste von allen und darum jedem bekannt. In einem Interview verriet er kürzlich, dass ihn die Hunderte Milliarden über seine ersten 13,8 Milliarden hinaus nicht interessieren.
Ich deute auf das Schild, das er mit arrogantem Dankeslächeln entfernt, zwischen den Fingerkuppen zusammenknüllt und über Bord wirft. Gelangweilt schaut er ihm hinterher, wie es tief unten über die Pier rollt. Dort verschwinden die letzten Rückkehrer im Bauch des Schiffes.
Mich wundert immer wieder, wie ähnlich sie gekleidet sind. Nach ihrem Ausflug wirken alle auch gleichermaßen abgekämpft. Bestimmt haben sie sich stundenlang der Angebote in den engen Gassen erwehrt. Ihre Hoffnung auf Schonung durch gelegentlichen Kauf von Tinnef war natürlich unbegründet. Meist potenzieren die Händler dann ihre Anstrengungen. Umso mehr freundliche Energie braucht es, um sie loszuwerden. Mitleid habe ich nicht mit ihnen.
Gleich wird die Gangway eingezogen. Ein paar Arbeiter lösen bereits Vertäuungen, als mehrere weiß gekleidete Matrosen erscheinen. Sie blättern in Listen auf Klemmbrettern. Wegen Chipmangels werden Digitalversionen nicht mehr hergestellt. Man berät sich, man findet nur eine Lösung. Ich ahne, was das bedeutet. Jemand wird vermisst, hat es bisher nicht zurückgeschafft. So etwas kommt recht selten vor und würzt darum solche Reisen. Alle, die sich an der Reling versammelt haben, verfolgen jetzt nicht nur das Ablegen des Schiffes, sie wollen wissen, wie knapp und dramatisch die Sache werden wird. Es wird Pier Runners geben!
Ein Elektrofahrzeug, ähnlich einem Golfmobil, das genau dafür etwas abseits gewartet hat, startet jaulend. Einer der Offiziere schaut wieder und wieder auf seine Armbanduhr. Die Abfahrt steht unmittelbar bevor. In der Ferne biegt das Golfmobil in die Gassen der Hafenstadt ein. Noch zwei Mal blickt der Offizier auf seine Uhr, dann gibt er den anderen ein Zeichen und bellt in sein Funkgerät. Er zieht mit seinen Leuten ins Schiff, die Arbeiter ziehen die Gangway ein. Alle Leinen sind los. Die Leute auf den Decks rufen und johlen und kreischen. Die Geräuschkulisse schwillt weiter an, als sich das Schiff von der Pier entfernt. Noch würde ein großer Schritt genügen, um an Bord zu gelangen. Sekunden später muss es schon ein beherzter, gewaltiger Satz über das brodelnde Wasser zwischen Pier und Bordwand sein. Jetzt explodieren die Rufe. Man hat das Golfmobil entdeckt, wie es weit hinten an der Pier in der Kurve liegt. Die Innenräder heben vom Boden ab. Ohrenbetäubender Lärm. Alle haben ihre Handys gezückt. Das wollen sie nicht nur sehen, das müssen sie posten.
Das Golfmobil kommt auf Höhe des Schiffs zum Stehen. Eine Frau springt heraus und rennt auf das Schiff zu, das bereits unerreichbar weit vom Ufer entfernt treibt. Sie rennt sogar ein paar Schritte neben dem Schiff her, winkt albern und ruft, bis ihr die Aussichtslosigkeit bewusst wird. Ich kann ihr Gesicht von hier oben wegen ihres breitkrempigen Hutes nicht erkennen. Wir sind jetzt auch schon zu weit weg, aber ich sehe, wie schlagartig jegliche Spannung ihren Körper verlässt. Kopf und Schultern fallen nach vorne, die Knie geben nach, und sie sinkt zu Boden. Ihr Klagen geht im beruhigenden Blubbern der Schiffsdiesel unter. In den Gesichtern der Gaffer an Bord spiegelt sich eine Mischung aus Mitleid, Hoffnung und Schadenfreude. Der Fahrer des Golfmobils steht hilflos neben ihr. Er ist Angestellter des Hafens und hat sein Bestes für die Kreuzfahrtgesellschaft gegeben.
Etwas zerspringt. Henrys Glas liegt am Boden verstreut. Seine Hände sind in die Reling gekrallt. Dann löst er sich davon, schaut fahrig mit einem seltsamen Glitzern in den Augen umher, entscheidet sich für den Weg links von mir und eilt auf den nächsten Eingang ins Schiff zu.
Was dann geschehen sein muss, erfahre ich später beim Abendessen. Der Kapitän posaunt es lauthals an seinem Tisch heraus. Bis dahin habe ich nicht einmal bemerkt, dass Henry nicht am Essen teilnimmt. So aber kann ich kurz zusammenfassen, dass Henry, unmittelbar nachdem er mich verlassen hatte, hinauf zur Brücke gestürmt war, auf seinem Weg dorthin noch irgendeinen Gegenstand, der, wie der Kapitän konstatiert, zum Koppkloppen geeignet war, eingesammelt und dann die Brücke geentert hatte. Zwei oder drei der Offiziere dort hatte er tatsächlich den Kopp gekloppt, dann den Kapitän bedroht, er solle das Schiff zurückfahren, was der natürlich ablehnte, und erst nach einem kräftigen Handgemenge war er überwältigt worden. Jetzt ist er im Austausch für seine Luxussuite in einer Kabine eingesperrt. Als erste Strafmaßnahme sozusagen. Der stärkste Security-Mann halte davor Wache, protzt der Kapitän. Bei sexuellen Übergriffen und Diebstahl, den häufigsten Delikten sonst an Bord, sei eine solche Abschottung nicht unbedingt nötig, bei einem Angriff auf die Führung des Schiffes allerdings müsse man Kante zeigen. Die ehemaligen Herrschaften der jetzigen Knastkabine hätten Henrys freie Suite beziehen dürfen und seien überglücklich, feixt der Kapitän.
Ich hätte der Angelegenheit keine weitere Beachtung geschenkt, wenn ich bei der Rückkehr in meine Kabine nicht einen riesigen Wachmann auf dem Gang vorgefunden hätte. Er steht vor der Kabine neben der meinen und wirkt entschlossen. Er bestätigt, dass Henry hier festgesetzt sei. Man werde ihn im nächsten Hafen übergeben. Das werde voraussichtlich in zwei Tagen geschehen.
Ob es den beiden Offizieren, die Henry geschlagen habe, gut gehe, will ich wissen, und er versichert mir, dass sich angemessen um sie gekümmert werde. Mehr ist aus dem Mann nicht herauszubekommen.
Jetzt hätte der Fall für mich vollständig erledigt sein sollen, doch als ich mich auf meine Koje lege und mir die pikante Situation, neben einem eingesperrten Kriminellen zu nächtigen, durch den Kopf gehen lasse, höre ich ein Flüstern. Ich glaube nicht an Geister oder, um im Bild zu bleiben, an Klabautermänner und versuche daher, der Ursache des Flüsterns auf den Grund zu gehen.
Auf Schiffen gibt es die unterschiedlichsten Geräusche. Sie entstehen, weil sich das Schiff als Fremdkörper mit den Naturgewalten auseinandersetzen muss. Dabei wird es gebogen und verwunden, Spannungen aller Art entstehen und lösen sich wieder. Außerdem hatte sich die Kreuzfahrtindustrie nach der Pandemie und wegen der alsbald beginnenden Kriege nicht mehr erholen können. Dieses Schiff ist wahrscheinlich das letzte, das noch fährt. Es ist, wie schon angedeutet, alt und voller Mängel.
Die Quelle des Flüsterns finde ich schnell. Es kommt aus dem zusätzlichen Waschbecken, das ich als überraschendes Stück Komfort im Schlafbereich der Kabine habe. Nach nur kurzem Hinhören bin ich mir sicher, dass es Henry ist, der da flüstert. Seine Stimme ist zu markant. Offenbar hängt mein Waschbecken an einem seiner Fallrohre.
»Haben Sie keine Angst, aber geben Sie mir ein Zeichen, dass Sie mich verstehen«, wiederholt er so lange, bis ich antworte.
»Ich wusste doch, dass da jemand ist«, flüstert er aufgeregt. »Sie müssen mir helfen. Sie haben mich hier eingesperrt.«
Das habe ja wohl auch seinen Grund, flüstere ich zu meinem Erstaunen ebenfalls. Immerhin habe er Menschen verletzt. Das bedauere er zutiefst, und es hätte nicht dazu kommen müssen, wenn man seiner Forderung nachgekommen wäre. Ihn wundere allerdings, dass die Männer Schaden genommen hätten, denn er habe sie doch allenfalls gestreift.
Dazu könne ich nichts sagen und wisse nur, dass der Kapitän an Bord das Sagen habe. Es wäre schön, wenn er mich nicht weiter belästige. Andernfalls würde ich dafür sorgen, dass er in eine andere Kabine verlegt werde.
Das scheint ihn zu beeindrucken, denn eine Antwort bleibt aus. Ich lege mich wieder hin, aber meine Gedanken kreisen von nun an noch intensiver um den Gefangenen nebenan. Seit ein paar Jahren, seit ich in Rente bin, finde ich ohnehin nur schwer in den Schlaf. Oft reicht ein kleines Ereignis am Tag, um mich die ganze Nacht wach zu halten.
Nur wenige Minuten später meldet sich Henry wieder aus dem Waschbecken.
Er habe lediglich der am Pier zurückgelassenen Frau beistehen wollen, flüstert er. Im Übrigen glaube er, in der Frau seine ehemalige Mitbewohnerin Simone erkannt zu haben. Eigentlich sei er nur ihretwegen auf dieser Kreuzfahrt. Mehrere Jahre habe er nach ihr gesucht, dann einen Hinweis erhalten, sie aber bisher nicht treffen können. Als er sie dann dort draußen rennen sah, habe sein Verstand ausgesetzt und ihn in diese Lage gebracht.
Aber jedem an Bord werde eingeschärft, dass man von einem Landgang zeitig zurückkehren solle, wispere ich. Jeder wisse, dass das Schiff nicht warten werde. Es werde auch nicht halten oder gar umkehren, wenn jemand sich verspäte.
Und doch passiere so etwas wie heute immer wieder, flüstert Henry. Seiner Meinung nach betreffe es drei verschiedene Typen von Passagieren. Der erste Typ habe keinen Bezug zur Zeit und sei schon sein ganzes Leben unpünktlich, der zweite halte sich für unverwundbar und glaube, er stehe über dem Gesetz, und der dritte habe Pech gehabt.
Zu welchem Typ er die Frau denn rechne, will ich wissen. Zum dritten, antwortet er. Während so eines Ausfluges in eine fremde Welt könne allerhand Unvorhergesehenes passieren. Ein Unwohlsein bei der Hitze da draußen reiche schon aus, um das Schiff zu verpassen. Dieser Typ täte ihm leid, wohingegen die beiden anderen vor seinen Augen keine Gnade fänden. Im Grunde seien diese anderen Typen ausgemachte Egoisten, die glaubten, sie könnten sich Freiheiten nehmen, für sie würden Ausnahmen gemacht. Sie verdienten es, zurückgelassen zu werden. Denn die Freiheit ende streng genommen nicht erst dort, wo sie mit dem Gesetz in Konflikt gerät. Sie ende viel früher und auch allumfassender, als ich es mir vorstellen könne. Vor Jahren habe er eine seltsame Geschichte erlebt, die ihm dies verdeutlicht habe. Ob ich die Geschichte hören wolle? Ich könne doch sowieso nicht schlafen.
Was fällt denn dem ein, denke ich empört, stimme aber zu, denn einerseits hat er Recht, andererseits wäre es vielleicht sogar eine gute Möglichkeit, etwas Schlaf zu finden. Sollte er doch vor sich hin plaudern. Bestimmt merkt er nicht, wenn ich einnicke. Und wenn doch, was sollte er machen? Er weiß ja noch nicht einmal, wer ich bin. Am Ende täten wir uns gegenseitig einen Gefallen. Ich hatte schon immer eine Schwäche für solche Konstellationen.
Ich lege mich bequem hin, Henry scheint sich etwas zu sammeln, und dann erfüllt sein Flüstern die Stille.
Mann mit Gepäck
Simone zog vor fünfzehn Jahren an einem nebligen Mittwochmorgen aus. Vielleicht wundern Sie sich jetzt, dass ich etwas weiter aushole, aber das ist nötig, um Ihnen all meine Beweggründe begreiflich zu machen. Sollte ich aber zu weit abschweifen, zögern Sie nicht, mich zu unterbrechen. Ich werde dann prüfen, ob ich tatsächlich zu weit gegangen bin.
Simone zog also aus, und ich hatte den Gehweg so großzügig abgesperrt, dass ein Möbelwagen genügend Platz hatte. Ich schaue mir die Dinge gerne von oben an und so stand ich am Fenster, als der Möbelwagen in die Straße einbog. Je näher er kam, um so mehr verlor er seine Räumlichkeit, bis er direkt unter mir zu einem großen, schmutzgrauen Rechteck mit einem kleineren, schmutzgrauen Rechteck quer davor wurde. Die Servolenkung jaulte, ein dunkles, kleines Trapez drehte sich aus der mir zugewandten Schmalseite des kleineren schmutzgrauen Rechtecks, und ich wusste, dass ein anderes auf der gegenüberliegenden Seite dasselbe tat. Der Motor brummte abgründig, der Wagen setzte unerträglich langsam zurück. Eine Ecke des großen, schmutzgrauen Rechtecks stupste die Straßenlaterne am Haus an. Bimmelnd schwang sie hin und her. Der Wagen bremste scharf, und es wirkte anschließend, als denke er nach. Dann reckte sich eine Hand diesseits aus dem kleineren, schmutzgrauen Rechteck und verstellte den Spiegel. Die Bremsen entlüfteten, der Motor drehte etwas höher, eine dunkelgraue Dieselqualmwolke mischte sich in den Nebel, und der Wagen schob sich wieder ein Stück nach vorn. Noch ein kleines Einlenkmanöver, und er stand, für jeden auf der Straße sichtbar da, groß und grau und kantig. Dann nagelte der Motor noch ein wenig, schüttelte sich und den Wagen einmal durch und kam zur Ruhe. Aber gut!
Der Fahrer sprang routiniert auf die Straße, was ich von oben nur erahnen konnte. Sehen konnte ich von ihm nur seine